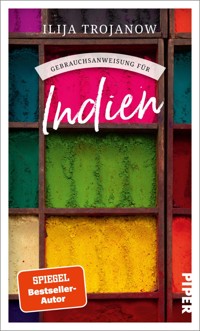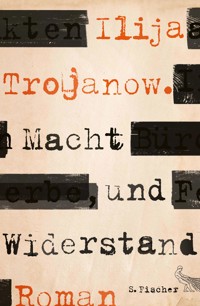12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der investigative Journalist Ilija wird innerhalb weniger Minuten von zwei Whistleblowern des amerikanischen und des russischen Geheimdienstes kontaktiert. Ein großer Coup? Eine Falle? Er lässt sich auf das Spiel ein, zusammen mit Boris, einem amerikanischen Kollegen, folgt er der doppelten Spur nach Hongkong, Wien, New York und Moskau. Die geleakten Dokumente eröffnen einen Abgrund von Korruption und Betrug, von üblen Verstrickungen krimineller Oligarchen und Mafiosi. Auch die Staatspräsidenten Russlands und Amerikas sind involviert. Was darf man glauben? Mit welcher Absicht werden Lügen verbreitet? Sind die beiden Reporter nur ein Spielball der Geheimdienste? Literarisch virtuos wie kein anderer spielt Ilija Trojanow in diesem Roman mit Fakten und Fiktionen und führt uns wie nebenbei vor Augen, wie sehr wir durch Fake News zu Komplizen der Macht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ilija Trojanow
Doppelte Spur
Roman
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Allen ehrlichen Whistleblowern
Alles in diesem Roman ist wahr oder wahrscheinlich
»Ich habe für den Geheimdienst gearbeitet.«
»Alle anständigen Menschen haben ihre Karriere im Geheimdienst begonnen. Auch ich.«
Gespräch zwischen Wladimir Putin und Henry Kissinger.
Aus: »First Person«, der Autobiographie von Wladimir Putin
»Wieder einmal ist schwarze Desinformation in ihren giftigen Farben im globalen Medienraum aufgeblüht.«
Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums
»Wer einem das Absurde schmackhaft machen kann, kann einem das Unrecht schmackhaft machen.«
Voltaire
Prolog
Ich werde ihn Boris nennen. Das ist nicht besonders einfallsreich, aber es geht um den Schutz eines Lebens, nicht um Originalität. Obwohl wir uns erst vor drei Wochen kennengelernt haben, verbringen wir jede wache Minute zusammen, Tag und halbe Nacht. In einem mit Schaumstoff ausgepolsterten Zimmer, das uns vor Überwachung schützt. Durch wen, wissen wir nicht. Es gibt Verdächtige genug. Dies ist ein sicherer Hafen, unser einziger. Was wir zu besprechen haben, tun wir innerhalb dieser vier Wände. Draußen bestellen wir Pizza und putzen uns die Zähne. Danach lesen wir weiter.
Dokumente. Wie ich dieses Wort hasse. Früher hätte man »Papiere« gesagt, »vertrauliche Papiere«, das klingt soigniert und trifft nicht mehr zu: Wir haben kein einziges Dokument ausgedruckt, wir lesen an mehreren Laptops. Dokument klingt wie ein archaischer Fluch, wie das Rattern der Tintenstrahldrucker von einst. Bedächtig, bedrohlich. Schwer zu sagen, was für Dokumente wir lesen (durchkämmen?). Amtliche Schriftstücke? Ja, sie enthalten Schrift, sie stammen meist von Ämtern (mehr Amt geht nicht). Und doch wirken sie unwirklich in ihrem Schattendasein als Dateien in Reih und Glied, ohne sichtbare Ordnung. Gemeinhin sind Dokumente »Urkunden, die zur Belehrung bzw. Erhellung dienen«. Gewiss, sie lehren uns eines Schlimmeren, und ja, sie erhellen unsere Gesichter (in diesem Raum des künstlichen Lichts), darüber hinaus droht zwischen allen Zeilen Verdunklungsgefahr. Dokumente dienen als Beweise, heißt es. Das mag stimmen, nur haben wir noch nicht herausgefunden, was sie beweisen. Zweifelsfrei beweisen.
Wer ununterbrochen liest, überliest ab einem gewissen Zeitpunkt das Wesentliche. Allein das Unbewusste nimmt noch wahr (ein unzuverlässiger Zeuge). Deswegen müssen wir relevante Textstellen markieren, highlighten, wie Boris sich ausdrückt. Er spricht highlight aus wie high life, er ist blass und hat so viel Zeit vor Computern verbracht wie ich auf staubigen Straßen, er hat ein anderes Verhältnis zu Dokumenten, ein fast erotisches. Wir lesen auf Englisch, wir lesen auf Russisch, wir unterhalten uns meist auf Englisch, es sei denn, Boris ruft etwas in seiner Muttersprache aus, dann erwidere ich auf Russisch. Mein Akzent amüsiert ihn. Wir ergänzen uns gut. Er kennt sich in Finanzen aus, präziser gesagt bei Korruption und Unterschlagung, bei Geldwäsche und Steueroasen, er ist ein Spezialist für die kreativen Seiten der Gier. Ich hingegen habe mich auf die zersetzende Wirkung von Macht fokussiert. Politik ist für mich strukturelle Gewalt, die es zu entlarven gilt. Boris sichtet bevorzugt Unterlagen, ich würde Gespräche vorziehen. Gemeinsam kreisen wir in unserer Raumkapsel seit Wochen um Fragen, die weltweit ein Erdbeben verursachen könnten: Wer kontrolliert wen? Wer manipuliert wen? Wer wird obsiegen in diesem meist unsichtbaren Krieg?
Wir machen Fortschritte.
Wir kommen. Nicht. Voran.
Von jedem erklommenen Hügel aus blicken wir auf höhere Gipfel, schroff und steil, und kein Pfad hinauf.
Als wir mit dieser Arbeit (Schinderei?) begannen, einigten wir uns darauf, den amerikanischen Präsidenten »Schiefer Turm« zu nennen und den russischen Präsidenten »Mikhail Iwanowitsch«. Diese Beinamen helfen uns, Distanz zu wahren, uns gegen die übergriffige mediale Präsenz der beiden zu wappnen. Egal, wie sie in diesem Bericht heißen, gemeint sind die zwei Männer, die uns täglich in den Nachrichten anstarren, mit den Augen toter Fische. Die sich vordergründig so wenig ähneln (wie sehr der erste Eindruck täuschen kann). Die dabei sind, die Welt zu verändern, zuungunsten der Menschheit. Was wir belegen wollen, nagelfest. Egal, wie lange es dauern mag.
Schiefer Turm und Mikhail Iwanowitsch haben Boris und mich – unabsichtlich, aber nicht zufällig – zusammengeführt. Vor drei Wochen. Aus heiserem (kein Tippfehler) Himmel.
An einem Flughafen …
Hongkong
Am 12. Oktober 2018 erhielt ich um 20.16 Uhr eine anonyme E-Mail. Die Signatur bestand aus einem Konsonanten, gefolgt von einem Ausrufezeichen, der Absender verbarg sich hinter einer langen Zahlenreihe. Die Nachricht lautete (auf Englisch):
»Die Wissenschaft sammelt schneller Wissen, als die Gesellschaft Weisheit. Wenn Sie etwas dagegen unternehmen wollen, antworten Sie, indem Sie Isa in die Betreffzeile schreiben.«
Ich befand mich am Frankfurter Flughafen, in einem Restaurant (»authentisch italienisch«) mit Ausblick auf Flieger hinter nasser Scheibe. Unschlüssig, wie ich diese Mail einschätzen sollte, widmete ich mich wieder der Zeitung. Der Tag war auf der Buchmesse verflogen, in Gesprächen von der Dauer einer Zigarette. Jeder hatte sich nach meinem nächsten Projekt erkundigt, nach einem neuen Scoop. Ich hatte ausweichend geantwortet.
Zehn Minuten später ging eine zweite Nachricht ein:
»Moral sollte Sie nicht davon abhalten, das Richtige zu tun. Wenn Sie zu diesem Zweck verlässliche Informationen erhalten wollen, antworten Sie, indem Sie Asi in die Betreffzeile schreiben.«
Der Absender bestand wiederum aus einer langen Zahlenreihe, seine Identität versteckte sich hinter einem einzigen Großbuchstaben, dieses Mal einem Vokal, gefolgt von einem Fragezeichen. Der Text war auf Russisch verfasst.
Im Sitzen denkt es sich schlecht, erst recht beim Essen. Ich zahlte so schnell wie möglich und ging zwischen Gate Z15 und Z25 möglichen Erklärungen für die beiden E-Mails nach. Ein Scherz? Eine ausgebuffte Verkaufsstrategie? Ein Betrugsversuch? Eine raffinierte Marketingaktion? Eine Falle? Oder aber, tatsächlich, die Kontaktaufnahme eines Whistleblowers? Es wäre nicht das erste Mal. Aber gleich deren zwei? Innerhalb weniger Minuten? Stammten beide Nachrichten von ein und demselben Whistleblower? (Die Formulierungen ähnelten sich doch sehr.) Wieso dann das Spiel mit den Sprachen? Wollte mich die unbekannte Person prüfen, auf eine mir unverständliche Weise? Mein Flug wurde aufgerufen. Auch nach mehrfacher Lektüre konnte ich den Nachrichten nichts außer weitere Fragen entlocken. Als die Aufforderung erfolgte, die Handys in den Flugmodus zu versetzen (oder auszuschalten, aber wer tut das noch?), tippte ich Isa und Asi in die jeweilige Betreffzeile und drückte auf »Senden«.
Eine unverbindliche Reaktion, dachte ich, was kann mir da schon Schlimmes passieren?
Wie sehr ich mich täuschen sollte.
Die WLAN-Verbindung auf Flügen funktioniert so wie mein alter Staubsauger: sporadisch. Erst nach der Landung am Chek Lap Kok in Hongkong konnte ich meine Mails abrufen. Übernächtigt – Langstreckenflüge in der Economy sind Entbehrungsübungen für Schlakse und ehemalige Volleyballspieler – blickte ich erst wieder in mein Postfach, als ich im Airport Express saß. Die Fahrt nach Central dauert 24 Minuten, kaum Zeit, den Inhalt zweier weiterer Mails – die eine angeblich von einem Mitarbeiter des Federal Bureau of Investigation, die andere vermeintlich von einem Agenten der Sluschba wneschnei raswedki – zu studieren. Beide enthielten als Anhang jeweils ein einziges Dokument. Das eine war als »secret« gekennzeichnet, das andere als »секретен«. Inmitten schweigender Passagiere, die sich selbst genügten, überflog ich den Inhalt. Bürokratische Sprache, pedantischer Inhalt. Aus dem Zusammenhang gerissen ergaben die Dokumente wenig Sinn; sie waren alles andere als sensationell. Die einzige Erkenntnis: Sie erschienen mir authentisch.
Zu Fuß, bepackt mit meinem leichten Carry-On-Rucksack, machte ich mich auf den Weg Richtung Wan Chai, quälte mich durch dichten Verkehr, setzte mich auf eine Bank zwischen zwei Fahrspuren, so als wartete ich auf die nächste (zweistöckige) Tram. Um mich herum Stau, in mir Unruhe. Die englischsprachige E-Mail versprach Belege über Machenschaften, die ich in meinen Artikeln schon wiederholt zur Sprache gebracht hatte, Machenschaften, die sich in einem Satz zusammenfassen lassen: Die Mafia ist nicht Teil des Staates, der Staat ist Teil der Mafia. Die russische E-Mail versprach mir Informationen über Verflechtungen zwischen der amerikanischen Regierung und ausländischen Interessen. Die Nachricht endete mit dem Satz: »Bislang haben Sie spekuliert; wir wollen Ihnen helfen, Klarheit zu finden.« Ein gewichtiges »wir«, ein gewaltiger Anspruch. Ein Geheimdienstler, der Klarheit verspricht, das war so absurd, meine Neugier war angestachelt. Wenn ich mit einem simplen »Я хочу« antwortete, würden mir die Dokumente auf sicherem Wege zugestellt werden.
Wie hätte ich darauf nicht eingehen sollen?
In meiner billigen Absteige (das Check Inn, eine bessere Jugendherberge, im internationalen Vergleich geradezu luxuriös) duschte ich ausgiebig, kalt. Schwitzte trotzdem weiter. Die englischsprachige E-Mail forderte mich auf, am Abend desselben Samstags um 18.30 Uhr das Pacific Place aufzusuchen und dort »nach Lust und Laune zu flanieren«. Eine irritierende Formulierung. Das Pacific Place sei ein Einkaufszentrum, erfuhr ich an der Rezeption, hochmodern, ultraschick, megateuer, unweit entfernt. Ich schlenderte durch die geschwungenen Etagen eines Glastempels, kaufte mir in der Food Hall ein Sesam-Eis in der Tüte, betrachtete Auslagen (und Gesichter, die mir über die Schulter blickten), gab vor, das Menüangebot eines Restaurants zu studieren, vor dessen Eingang eine junge Frau auf einem Stuhl saß wie auf einem Hochsitz. Ich stieg zum wiederholten Mal auf die Rolltreppe.
Hinter mir eine Frauenstimme: »Nicht umdrehen. Fahren Sie einen Stock weiter.« Das tat ich. Die Stimme, ruhig, ein Alt: »In Ihrer Jackentasche ist eine Speicherkarte. Kaufen Sie sich einen Laptop, verbinden Sie ihn auf keinen Fall mit dem Internet. Lesen Sie die Unterlagen. Sollten Sie zu einem weiteren Treffen bereit sein, trinken Sie morgen früh in Ihrem Hotel um acht Uhr einen Orangensaft.«
Ich drehte nach links ab, umrundete eine behelfsmäßige Wand, stieg auf die abwärts führende Rolltreppe, blickte mich um. Hinter mir eine chinesische Mutter und ihre wunderschöne Tochter, beide elegant gekleidet. Die Tochter strahlte einen wohldosierten Hauch Verruchtheit aus. Beide ignorierten meine unhöflichen Blicke.
Erst auf der New-World-First-Fähre, die über die Bucht nach Kowloon tuckert, griff ich in meine Jackentasche. Nichts! Ich eilte in die Toilette, um meine Taschen auszustülpen. Eine microSD-Karte fiel zu Boden, so klein, sie hätte unter meiner Zunge Platz gefunden. Auf dem Außendeck, die entschwindenden Finanztürme im beschlagenen Blick, fiel mir ein, wieso ich nach Hongkong gekommen war: um eine Reportage über Chinas Überwachungsmethoden zu recherchieren. Erst neulich waren Lampenmasten mit intelligentem, multifunktionalem Innenleben zur Kontrolle des öffentlichen Raums aufgestellt worden (ein Mitarbeiter von Amnesty International hatte mich darauf hingewiesen). Obwohl schon seit längerem mit dem Thema vertraut, war mein endgültiger Entschluss erst gefallen, als ich gelesen hatte, dass in chinesischen Staatsschulen ein lehrreiches Spiel eingeführt worden war:
»Wer findet den Spion«.
In einem Laden, kaum größer als ein Kabuff, kaufte ich einen vorinstallierten Huawei-Laptop sowie einen Adapter für die Karte, ohne Aufhebens, so wie man einen Kugelschreiber oder eine Schachtel Kondome erwirbt. Wo soll man in einer fremden Stadt geheime Dokumente lesen? Mir war nicht nach meiner Pension zumute (die Stimme auf der Rolltreppe hatte sich nicht nach meiner Hoteladresse erkundigt, fiel mir jetzt erst auf). Ein Museum erschien mir zu exponiert, ein Park zu unbequem. Ich streifte von Ampel zu Ampel, in meiner Hosentasche eine glühende Memory Card, in meinem Rucksack ein unschuldiger Laptop. In einer Nebengasse betrat ich kurzentschlossen ein Dim-Sum-Lokal, nahm am hintersten Tisch in der rechten Ecke Platz. Die Inneneinrichtung war unauffällig: wacklige Tische, eng nebeneinander, die Speisenden bildeten Reihen von Wand zu Wand, Ellenbogen an Ellenbogen. Es war still, für Hongkonger Verhältnisse geradezu unheimlich still. Ich schaltete den Computer ein und wandte mich dem Menü zu, Bleistift in der Hand: Kreuzchen, Kreuzchen und nochmals Kreuzchen. Ich gab meine Bestellung auf und schob den Stick in die USB-Schnittstelle. Umgehend wurde aufgetischt: mit Schnittlauch und Garnelen gefüllte Dim Sum, gebratene Reisröllchen, salzig-süße Schweinefleisch-Bällchen. Alle Dokumente waren als »top secret/noforn« eingestuft, nicht nur »streng geheim«, sondern auch vor den Augen von »foreign nationals« zu schützen. Vor Subjekten wie mir. Ich begann zu lesen, neben mir ein leises Schlürfen, beruhigend wie das Wischen eines Mopps über dreckigen Boden.
Trotz meiner langjährigen Tätigkeit als Journalist widerstrebt es mir, Texte zu lesen, die nicht für meine Augen bestimmt sind. Nicht aus moralischen Gründen. Angesichts der Datenrafferei der Großkonzerne und der Geheimniskrämerei des Staatsapparates fühle ich mich im Recht und trotzdem wie ein Eindringling. Ich empfinde keine Scham, wohl aber Widerwillen. Gruft reimt sich auf fehlende Luft. Wer sich in diese bürokratischen Labyrinthe hineinwagt, spürt, wie der Tod nach ihm greift.
Das Schlürfen am Nachbartisch war versiegt, ich vernahm eine entferntere Stimme, die sich in einen eigenen Witz hineinlachte.
Es dauerte Minuten, die Liste der Dateien herunterzuscrollen, inklusive gelegentlichen Stichproben. Einige der Dokumente waren alt, nachträglich eingescannt. Andere, neueren Datums, digital erstellt. Kein einziges war kommentiert. Ich bat um einen Jasmintee. Abhörprotokolle. Steuererklärungen. Interne Einschätzungen. Berichte von Informanten. Recherchen von Analysten. Anhörungen hinter verschlossenen Türen. Sogar Medienberichte. Ich öffnete Datei um Datei, nippte am Tee, überflog den Inhalt, bestellte einen Reispudding bei der drängenden Bedienung. Je mehr Dokumente ich aufrief, desto flüchtiger wurde meine Durchsicht. Informationen wie Heu und ich Buridans Esel inmitten einer lähmenden Qual der Wahl. Willkürlich öffnete ich eine weitere Datei, hielt inne, hüpfte von Stichwort zu Stichwort, kehrte zum Anfang des Textes zurück, las das Ganze aufmerksam durch, von Datum und Aktennummer bis zur Unterschrift, mit der in unserer merkwürdigen Zivilisation jede Aussage beglaubigt wird.
(Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich die Dokumente abdrucken sollte, samt aller bürokratischen Floskeln und Formalitäten. Ich habe mich dagegen entschieden. Irgendwann werden sie im Internet einzusehen sein, dann können jene, die meiner Darstellung misstrauen, sich einen eigenen Reim darauf machen. Niemand wird Zeit dafür haben.)
Hier eine erste Quintessenz …
Fünf Personen, darunter drei Führungskräfte des Taj Mahal Casinos in Atlantic City (CEO Steve Hyde, 43; President Mark Etess, 38; Executive VP Jonathan Benanav, 33) kamen am 10. Oktober 1989 ums Leben, als ihr Hubschrauber um 13.40 Uhr inmitten eines Pinienwalds in der Nähe von Forked River, N.J., abstürzte. Unmittelbar zuvor war zuerst der Hauptrotor abgebrochen, dann der Heckrotor. Um 13.32 hatte der Pilot zum letzten Mal Funkkontakt mit dem Kontrollturm auf der McGuire Air Force Base gehabt. Die fünf Männer hatten ihren geplanten Flug verpasst und kurzfristig eine andere Maschine gechartert, eine italienische Agusta anstatt der gebuchten Sikorsky.
Die Manager hatten an einer Pressekonferenz im Plaza Hotel in New York City teilgenommen, um den WM-Kampf im Weltergewicht zwischen Hector Camacho und Vinny Pazienza am 3. Februar 1990 in Atlantic City anzukündigen. Einen Clash der Großmäuler. El Macho Camacho, ausgestattet mit allen Finten und Haken, war auf dem Sprung zur Legende. Wenn er auftauchte, stahl sich der gute Geschmack aus dem Raum. Er erschien schmuckbehangen in einem langen, offenen Hemd mit silbernen Pailletten, auf seinen Schultern ein Zobelkragen, der aussah, als wäre das Tier gekämmt und geföhnt worden, bevor es abgebalgt wurde. Er redete ohne Punkt und mit Uppercut – »wenn Schweigen Gold ist, wieso sind die Taubstummen nicht alle reich?« –, er kaute seinem Gegner die Contenance ab, während Mr. Hyde und Mr. Etess entspannt dem Wortsparren freien Lauf ließen, sie waren extravagante Auftritte gewohnt, sie hatten schon die Kämpfe von Mike Tyson gegen Tyrell Biggs (»If I don’t kill him, it don’t count«), Larry »The Eastern Assassin« Holmes, Michael »Fear was knocking at my door« Spinks und Carl »The Truth« Williams angekündigt.
Nach dem Unfall war eine Untersuchung des FBI eingeleitet worden, weil ein Informant berichtet hatte, dass Steve Hyde, ein strenggläubiger Mormone, mit seinem Arbeitgeber heftig im Clinch gelegen und wiederholt auf strengere Vorkehrungen zur Einhaltung des Bank Secrecy Acts (BSA) gepocht habe. Vergeblich. Des Weiteren war ein anonymer Hinweis eingegangen, die Fotokopie einer Postkarte (als Scan vorhanden), auf der einen Seite das Foto eines Hubschraubers, auf der Rückseite in Schreibmaschinenschrift:
»Sikorsky. Russische Produktion. Stürzt nicht ab!«
Wegen Mordverdacht wurden Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet. Die technischen Details des Berichts waren für mich schwer verständlich. Das Ergebnis: Eine Sabotage könne zwar nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden, sei aber unwahrscheinlich. Alles deute auf einen Ermüdungsriss im Metall des Rotors hin.
Der Eigentümer des Taj Mahal Casinos hatte behauptet, er sei selbst beinahe mitgeflogen (»die Chancen standen fifty-fifty«). Der abschließende Bericht widersprach dieser Darstellung. Es war zu keiner Zeit beabsichtigt gewesen, dass er in dem abgestürzten Hubschrauber mitfliegen sollte, vielmehr habe er öffentlichkeitswirksamen Profit aus dem Unfall herausschlagen wollen. Laut Aussage eines Mitarbeiters wurde er »wenige Stunden nach der Tragödie per Telefon interviewt, worauf er die Leitung kurz auf stumm geschaltet hat, um den Anwesenden zuzuflüstern: ›Ihr werdet mich hassen, aber ich kann mir diese Chance nicht entgehen lassen‹, bevor er sich wieder an den Journalisten in der Leitung gewandt hat, mit den Worten: ›Wissen Sie, was, eigentlich sollte ich auch in dem verdammten Heli drin sein.‹«
Der Absender der Postkarte konnte nicht identifiziert, der Inhalt nicht zufriedenstellend erklärt werden.
In den folgenden Jahren habe sich das Taj Mahal zum Lieblingsort des russischen Mobs an der Ostküste entwickelt, aufgesucht von mafiösen Heerscharen in Ferraris und Rolls-Royces, High Rollern, die Comps für bis zu 100000 Dollar pro Person erhielten, Suiten und fine dining, Champagner, Zigarren und Unterhaltung jeglicher Art. Auch Hubschrauberflüge (die Firma: Executive Helicopter; der Inhaber: Joseph Weichselbaum). Meist in einem Sikorsky. Sie kamen »in den Genuss aller Privilegien«, während sie 100-Dollar-Scheine auf Zahl oder Farbe setzten, nicht immer aus Spielsucht, gelegentlich aus reiner Geldwäsche.
Das Finanzministerium beschuldigte das Taj Mahal Casino, in den 18 Monaten nach seiner Eröffnung 106 mal gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, u.a. indem es Tagesgewinne in Höhe von mehr als 10000 Dollar nicht vorschriftsmäßig der Behörde gemeldet habe. Noch 2015 verhängte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eine Strafe von 10 Mio. Dollar gegen das Casino wegen Verstößen gegen den Bank Secrecy Act.
Einige der Namen waren den Akten nicht zu entnehmen, sie waren geschwärzt (offenbar können selbst Leaks zensiert sein). Die schwarzen Balken wirkten auf mich wie eine Augenbinde.
Ich atmete tief durch. Das Neonlicht im Lokal erschien mir greller. Die Zusammenhänge ergäben nicht mehr als eine Fußnote der Kriminalitätsgeschichte, wäre der Arbeitgeber der fünf verunglückten Männer kein anderer gewesen als Schiefer Turm, inzwischen Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, einstiger Eigentümer des Taj Mahal Casinos, wo sich Boxer und Hubschrauber, die russische Mafia und das Glücksspiel ein Stelldichein gaben. In Atlantic City, wo auch ich, erst wenige Jahre her, inmitten klingelnder Verheißungen gesessen hatte, zwei Spielplätze entfernt von einer Frau, deren einarmiger Bandit sich mit einem schrillen Aufleuchten in einen Philanthropen verwandelte: Jackpot. Sie sprang auf, vollführte eine Pirouette, ein Cancan ertönte, andere Spieler strömten herbei, die Frau schrie, als spränge sie Bungee, ein Fotograf dokumentierte den ekstatischen Augenblick, zwei Mitarbeiter des Casinos zahlten 28000 Dollar aus. High Fives wurden hoch gehandelt. Allmählich verflog die Euphorie, die mit ihren exzessiven Glückwünschen Neid ausbrütenden Schaulustigen liefen auseinander, die Frau setzte sich an denselben Automaten und spielte weiter, neben ihr eine Freundin, die ebenso stumm und hektisch auf die Tasten drückte.
Nichts ist flüchtiger als gewonnenes Glück.
Die junge Kellnerin bedeutete mir, ich möge zahlen und verschwinden. Die sprichwörtliche asiatische Höflichkeit ist in Hongkong längst drainiert worden.
Die Nacht hindurch las ich in meinem Hotelzimmer Dokument um Dokument. Mein erster Verdacht bestätigte sich. Diese Unterlagen waren eine Fundgrube unverbundener Einzelheiten, eine Anhäufung disparater Details. Ich würde die verstreuten Punkte miteinander verbinden müssen, denn ohne plausible Erzählung hinterlassen Enthüllungen nackte Unverständlichkeit.
Mir schwante Sisyphus.
Gegen fünf Uhr am Morgen schlief ich unruhig ein, der Jetlag, die Stunden am Bildschirm, die innere Erregung gemischt zu einem Cocktail angespannter Erschöpfung.
Um acht Uhr trank ich demonstrativ an der Fensterfront des Hotelrestaurants ein großes Glas Orangensaft.
»Nennen Sie mich einfach DeepFBI.«
Das ungeschminkte Gesicht der kleinen drahtigen Frau entspannte sich zu einem Lächeln angesichts meiner Frage nach ihrem Namen (ich musste sie doch irgendwie ansprechen?).
Bar 109, Sonntagnachmittag. Wir teilten die enge Kaschemme mit Expats, alkoholisierten Männern und angetrunkenen Frauen. DeepFBI hatte diesen Treffort zu dieser Uhrzeit offensichtlich mit Bedacht ausgewählt.
»Überwiegend Kindermädchen, Hausangestellte. Aus den Philippinen, aus Indonesien. Sonntag ist ihr freier Tag. Den Rest der Woche sind sie im Dauerdienst. Am Sonntag schlagen sie über die Stränge.«
»Und die Männer?«
»Sexuelle Parasiten.«
Die Bar roch nach abgestandenem Bier und frischer Kotze. Mit einer Flasche Stella Artois in der Hand standen wir eng nebeneinander, die laute Musik pulsierte durch die allgegenwärtige Schäbigkeit. So mühsam wir uns verstanden, würde niemand unser Gespräch belauschen können.
»Wie sind Sie auf mich gekommen? Ausgerechnet auf mich?«
»Sie sind unabhängig.«
»Woher wollen Sie das wissen.«
»Wir haben so unsere Quellen.« Ein Lächeln huschte über ihre Augen.
»Klar. Sie wissen, dass mir die Einreise in die USA verweigert wurde.«
»Ein kleiner Fehler.«
»Technischer oder taktischer Art?«
»Ich gehe davon aus …«
Das Tremolo einer Synthesizer-Trompete. Einige der Frauen sprangen auf die Theke, tanzten ausgelassen. Jemand gab eine Runde Tequila aus. DeepFBI nahm einen Schluck aus der Flasche. Sie war weder burschikos, noch wirkte sie durchtrieben. Im Gegenteil. Sie strahlte etwas Fürsorgliches aus. Mein ertapptes Vorurteil. Ich leerte das Stamperl Tequila in einem Zug.
»Hier sollte man besser nicht nüchtern reinkommen,« sagte ich, als die Musik abschwoll.
»Auf keinen Fall nüchtern bleiben.«
»Unabhängig, sagten Sie. Was noch?«
»Sie mögen uns nicht.«
»Wer ist ›uns‹?«
»Die Geheimdienste. Im Westen wie im Osten, Sie sind konsequent in Ihrer Abneigung.«
»Ablehnung.«
»Ihre alte KGB-Akte ist recht ergiebig …«
»Tauschen Sie sich etwa untereinander aus?«
»Nicht doch. Sie selbst haben darüber geschrieben. Gelegentlich lesen wir auch, was frei verfügbar ist.«
Das hätte als gewitzter Smalltalk durchgehen können.
»Wieso benötigen Sie meine Hilfe?«
»Was für einen Nutzen haben Informationen, wenn man sie nicht verwenden kann? So viel wir auch wissen, wir können über dieses Wissen nicht frei verfügen. Es ist streng geheim und muss streng geheim bleiben, zum Schutz unserer Informanten und unserer Methoden. Das ist unsere Stärke – wir wissen so viel mehr als das, was wir nach außen geben, was nach außen dringt –, und zugleich unsere Schwäche: Wir müssen so einiges für uns behalten. Das bedauern wir gegenwärtig.«
»Wir?«
»Die unter uns, die bereit sind, die Notbremse zu ziehen.«
»Notbremse? Ist das nicht etwas melodramatisch?«
Sie wirkte konsterniert.
»Sie selbst malen in ihren Artikeln den Teufel an die Wand.«
»Ich möchte hören, wie Sie die Lage einschätzen.«
»Schlimmer noch.«
»Schlimmer als Notstand?«
»Kurz vor der Katastrophe.«
»Welcher?«
»Lassen Sie das Kopfgeplänkel. Glauben Sie, ich hätte mich zu diesem Schritt entschieden, wenn die Lage nicht brenzlig wäre?«
Der rotgesichtige Engländer neben mir mit der lauten Stimme eines Mannes, der auf einer Public School durch Erniedrigung zu einem höheren Wesen erzogen wurde, legte seine Pratze auf den Unterschenkel einer Philippinerin. Seiner Kleidung nach zu schließen, war er direkt von einem Rugby-Spiel an die Theke geeilt, sie hingegen schien sich für einen Opernbesuch herausgeputzt zu haben.
»Nachdem ich mir die Nacht um die Augen geschlagen habe, ist mir die Herausforderung halbwegs klar. Ich werde aus diesem Konvolut eine plausible Erzählung formen müssen. Ich weiß allerdings nicht, wie sie aussehen wird. Es ist nicht abzusehen, für welche Darstellung der Ereignisse ich mich entscheiden werde.«
»Das Risiko muss ich eingehen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Sie sind frei in Ihren Entscheidungen. Nur auf eines bestehe ich: Kein Kontakt vorab mit irgendwelchen Medien. Sie sichten das Material, Sie allein. Die Situation ist vertrackt. Die verschiedenen Gruppierungen bei uns belauern sich. Seilschaften haben sich in Feindschaften verwandelt. Der Schlag muss unvermittelt kommen. Nichts darf vorab durchsickern.«
»Wenn wir mit einer renommierten Zeitung zusammenarbeiten, könnten wir das Material über Wochen und Monate hinweg publizieren, das hätte größeren Einfluss auf die Öffentlichkeit.«
»Die Stärke eines Leaks ist seine Kompaktheit. Ein wuchtiger Schlag, in dem alles drinsteckt. Der Öffentlichkeit bleibt die Luft weg. Wer Enthüllungen dosiert, trägt dazu bei, dass sich die Leute an den Schmutz gewöhnen.«
»Sie halten nicht viel von der öffentlichen Debatte?«
»Vergessen Sie’s. Die kreist um Fragen der Legalität, als wären wir alle Juristen. Wer hat wann das Gesetz gebrochen? Wenn wir eine starre Linie zwischen Kriminalität und Rechtmäßigkeit ziehen, übersehen wir das Wesentliche.«
»Was ist mit der Justiz?«
»Gerichtsurteile sind Rezepte, die nach dem Kochen verfasst werden.«
»Glauben Sie ernsthaft, dass nur jemand wie ich das Wesentliche erzählen kann?«
»Werden Sie nicht kokett. Wir haben in der Vergangenheit schlichtweg die Bedeutung der Öffentlichkeit falsch eingeschätzt.«
»Soll heißen, es ist für Sie einfacher, einen Schuldspruch in der öffentlichen Meinung zu erreichen als eine Verurteilung vor Gericht.«
»Was ich sagen will: Ein Vorgehen muss nicht illegal sein, um die nationale Sicherheit zu bedrohen.«
»Ihre nationale Sicherheit interessiert mich einen Dreck.«
»Sie können unmöglich der Ansicht sein, dass es besser wäre, wenn die Macht nicht in staatlichen Institutionen, sondern bei der Mafia, der Oligarchie und den Finanziers liegt. Demokratie oder Kleptokratie, das ist die Wahl, vor der wir stehen.«
DeepFBI klang auf einmal wie Jean-Paul Marat, die Agentin als Revolutionärin, aufrecht neben der Theke, ihre Worte nicht aufgesogen vom aufrührerischen Volk, sondern zerfetzt von einer Stereoanlage. Mir war zum Lachen zumute, zugleich war ich zutiefst traurig. Mal wieder wurde mir vor Augen geführt, in was für lächerlichen Zeiten wir leben.
»Graduelle Differenzen«, hielt ich dagegen. »In den Worten von Augustinus: Jede Bande ist ein kleiner Staat und jeder Staat ist eine große Bande.«
»Der Heilige? Das hat er wirklich geschrieben?«
»Überprüfen Sie es. Was Sie sagen, überzeugt mich nicht. Sie könnten jederzeit eingreifen.«
»Ist nicht so einfach. Wem kann ich vertrauen? Die oberen Chargen stehen unter enormem politischen Druck, die ducken sich weg. Die besten Kollegen verlassen das FBI. Wir sind gelähmt. Ein Denkfehler ist mir in Ihren Texten aufgefallen. Sie glauben, der Staat sei allmächtig.«
»Ist er das nicht?«
Sie lachte, ein einnehmendes Lachen. »Ich muss los.«
»Eine Frage noch: Was ist mit der russischen Mail? Stammt die auch von Ihnen?«
»Russische Mail? Aus Russland? Auf Russisch?«
»Vermutlich beides.«
»Wovon reden Sie?«
»Sie haben sich nicht abgesprochen?«
»Mit wem?«
»Jemandem im SWR.«
»Nein.«
Sie lehnte sich vor, wie jemand, der auf einmal Gegenwind verspürt, ihr Blick auf jener abschüssigen Bahn von Verwunderung zu Befürchtung. Sie wollte mich ausfragen, entschied sich aber dagegen. Nachdem sie hundert Hongkong-Dollar auf die Tresen gelegt hatte, teilte sie mir mit, wie ich mit ihr in Kontakt treten könne: gar nicht. Sie werde bei mir »anklopfen«. Wieder diese höfliche Wortwahl. Das ganze Gespräch über hatte sie ihre Worte behutsam gewählt, als hinge alles von meiner Entscheidung ab, als hätte ich die freie Wahl.
»Sie sprechen übrigens tatsächlich exzellent Englisch. Niemand, der Ihre Akte nicht kennt, würde den Akzent zuordnen können. Gute Nacht!«
Es war 16.24 Uhr. Sonntagnachmittag. Mein letzter freier Sonntag für eine halbe Ewigkeit.
Wien
Es klingelte an der Haustür. »Paket für Sie. Sehr groß. Bitte nach unten kommen.« Ein DHLer. Einer, der klingelt. Manche seiner Kollegen werfen gleich den Lieferschein in den Briefkasten, weil der langsame Lift in den vierten Stock sie in ihrem Akkordzwang zu sehr aufhalten würde, worauf ich das Paket in einem Laden für afrikanische Mode abholen muss, wo zwei Schülerinnen über Hausaufgaben sitzen, umgeben von deckenkratzenden Paketen. In Schlappen stieg ich hinunter. Neben den Briefkästen lag ein brauner Quader von der Größe einer Waschmaschine. Nur mein Name auf dem Packpapier. Kein Aufkleber, kein Strichcode. Um einiges leichter, als seine Größe vermuten ließ. Das Paket passte gerade so in den Fahrstuhl. Es enthielt Unmengen an schwarzem SizzlePak sowie ein in goldenes Geschenkpapier eingewickeltes Päckchen. Einige der Papierfasern verhakten sich in meinem Pullover. Ein ovales Objekt unter einer Noppenfolie, mit Tesa zusammengeschnürt, eine Matrjoschka, eine Puppe aus ineinandergesteckten Puppen, üblicherweise Bäuerinnen mit gütig gerundetem Gesicht. Oder die sieben Führer des Landes seit der Revolution. Das Exemplar, das ich mir vor Jahren auf dem Ismailowski-Markt in Moskau hatte aufschwatzen lassen, begann mit Wladimir Iljitsch Lenin und schrumpfte zu Mikhail Iwanowitsch.
Die Matrjoschka im SizzlePak war weder Babuschka noch Breschnew. Die erste Puppe trug die Züge von Puschkin, dem entschlüpfte ein Gogol und diesem ein Gontscharow (lauter Schriftsteller, wie charmant). Es folgte ein Bulgakow, in dem ein Charms lauerte, der wiederum eine Figur mit zwei Gesichtern in sich barg, ein Januskopf, beide Seiten bartlos, mir unbekannt. Ich drehte die Puppe um. Auf der Unterseite stand: Ilf/Petrow, sowjetische Satiriker. Eigentlich hätte ich sie erkennen müssen, hatte ich doch erst vor kurzem ihr Tagebuch einer USA-Reise während der Weltwirtschaftskrise rezensiert und mit dem Bericht von John Steinbeck über seine Russlandreise einige Jahre später verglichen – humoristische Humanisten ohne Scheuklappen unterwegs im Land des vermeintlichen Feindes. Die letzte Figur war klein, der Abgebildete auf Anhieb nicht zu erkennen. Erst eine Inspektion mit der Lupe ermöglichte die Identifizierung, und auch nur, weil ich diesen Autor persönlich gekannt habe: Sinowjew. Alexander Sinowjew. Alexander Alexandrowitsch Sinowjew. Spätestens jetzt war die Illusion eines harmlosen Zufalls zerstört. Die Auswahl war bis zu diesem Moment eigenwillig genug gewesen. Aber mit dem so gut wie vergessenen Sinowjew zu enden, einem brillanten Logiker, der in wahnwitzigen Wortfällen (Fallstricke, Falltüren, Fallobst) die marxistisch-leninistische Ideologie in den miefigen Korridoren der sowjetischen Bürokratie als Wollmaus (nein, als Staubratte) entlarvt hatte – das war eine kaum verschlüsselte Nachricht an mich! Wer auch immer die russische Literatur so verschachtelt hatte, wusste über meine Vorlieben genau Bescheid. Woher? Waren diese Informationen öffentlich? Ich überlegte. Zur Neuübersetzung von Iwan Gontscharows Oblomow hatte ich ein Nachwort beigetragen, eine Auswahl der Minigeschichten von Daniil Charms an einem schlecht besuchten Abend in der Alten Schmiede in Wien vorgestellt, Der Meister und Margarita einmal (zu Weihnachten) als eines meiner Lieblingsbücher empfohlen.
Jemand hatte diese Flüchtigkeiten penibel zusammengetragen.
Wer?
Ich kippte das Paket um. Nur Füllmaterial, kein Umschlag, keine Nachricht. Ich untersuchte die Puppen, tastete die Aushöhlungen ab. Nichts bei Puschkin, Fehlanzeige bei Gogol und Gontscharow, Leere im Bauch von Bulgakow und Charms, kein Glück bei Ilf/Petrow. Es blieb nur noch der kleine Sinowjew (bei unserem ersten Treffen in Johanneskirchen bei München hatte er sich für sein schlechtes Deutsch entschuldigt, »wir sitzen vor dem Fernseher, so lernt man keine Sprache«). Er ließ sich nicht aufschrauben. Ich schüttelte ihn. Etwas klapperte in seinem Inneren. Ich würde ihn zerbrechen müssen. Ich zögerte – merkwürdig, wie eigenwillig unsere Pietäten ausfallen –, doch mir fiel sogleich ein, dass sich dieser hellsichtige Mann, der den Horror Bolschewiki wie kaum ein anderer beschrieben hat, nach seiner späten Heimkehr in einen russischen Patrioten und Apologeten Stalins verwandelt hatte. Die Schlussrunde kann das ganze Lebensrennen versauen. Ich sägte ihn auf. Vorsichtig. In der Puppe ein klitzekleiner USB-Stick.
Genauer gesagt: ein Secure USB (Zugriffsbeschränkung und Datenverschlüsselung nach AES 256). Ein Passwort wurde verlangt. Ich tippte meinen Namen ein. Falsch. Mir blieben fünf Versuche. Der Name Sinowjews. Неправильно. Drei weitere wohlüberlegte Vermutungen. Nein. Nein! Nein!! Die letzte Chance. Ich überlegte lange, bevor ich tippte:
Katastroika.
AES 256, öffne dich!
Meine Erwartungen an das russische Material waren bescheiden. Mikhail Iwanowitschs Methode der heimlich abgesicherten und demonstrativ ausgeübten Macht war bekannt. Seine Anordnungen hinterlassen keine Spuren. Niemand würde je ein entlarvendes Dokument finden, auf dem ein Mord, eine Bestechung, eine konkrete Geldwäsche vermerkt wären. Er entscheidet alles; er unterschreibt nichts. Das ist der Unterschied zum alten Regime – verherrlicht in frisch enthüllten Denkmälern –, das seine (Misse)Taten minutiös erfasste und archivierte. Das mir vorliegende Material war zur Gänze »сверхсекретен«, streng geheim. Es war ebenfalls bearbeitet worden: mehr schwarze Balken als bei den Amerikanern. Was ich nicht erwartet hatte: Einige der Dokumente führten ins letzte Jahrhundert, in die Epoche vor dem Zusammenbruch des Sowjetreichs. Als noch alles dokumentiert wurde (Amtshilfe für die Geschichtsschreibung). Ich begann zu lesen.
Als ob es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist …
Prag
Das älteste Dokument aus der Matrjoschka stammte aus dem September des Jahres 1977, verfasst von einem Major namens Nováček. Eine geheimdienstliche Aktennotiz der Art, wie ich sie nach jahrelanger Lektüre der Dossiers der Staatssicherheit verschiedener osteuropäischer Staaten zur Genüge kannte. Ich weiß sogar, wie sie realiter riecht. Während ich den Inhalt des Scans überflog, stellte ich mir den Major in seinem nüchternen Büro in dem schmucklosen Gebäude in der Bartolomějská vor, wie er an jedem seiner Diensttage damit beschäftigt war, für Ordnung zu sorgen. Mit Überzeugung. Es gibt Menschen, die an Gott glauben, an die Partei oder an sich selbst – der Major glaubte an die Ordnung der Abläufe. An die korrekte Ablage. An eine Präzision, die sich täglich wiederholen lässt. Improvisation ist was für Zigeuner, fand der Major, sollen die doch dudeln und fiedeln. Nicht angemessen für seriöse Berufe, für Ingenieure, Architekten oder Offiziere der Staatssicherheit. Wer die Ordnung missachtet, gefährdet die Gesellschaft. Hätte seine Ehefrau »Ordnung ist das halbe Leben« geseufzt, hätte er sie mit gespielter Strenge korrigiert: »Ordnung ist das ganze Leben.« Während der Major seine Berichte verfasste, seine Anweisungen hinzufügte, glitt sein Blick gelegentlich durch sein Büro (keine Familienfotos, keine Blumen, nur ein Aktenschrank und ein Kalender aus einem vergangenen Jahr mit farbschiefen Reproduktionen) zum Fenster hinaus. An diesem Septembertag schien die Sonne, auf unzuverlässige Weise. Er überlegte sich zwischen zwei Arbeitsabläufen, am Wochenende angeln zu gehen. Major Nováček schlug eine weitere Akte auf.