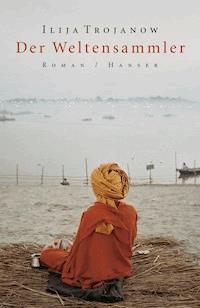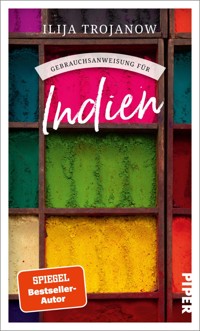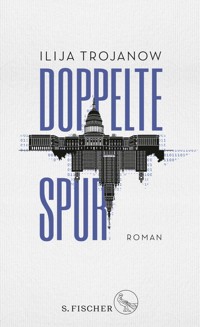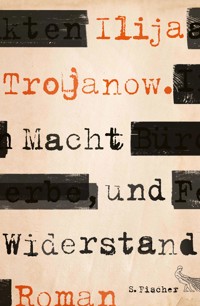12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Fuß oder mit dem Flugzeug, all inclusive oder solo - was suchen wir, wenn wir in andere Länder reisen? Wie viel Neues wollen wir entdecken, was hinter uns lassen, wie viel sind wir bereit zu ändern? Ilija Trojanow hat auf vier Kontinenten gelebt. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen schreibt er über Sinn und Ertrag des Vagabundierens, verbindet profundes Reflektieren mit Lustigem und Leichtem. In einzelnen Etappen geht es um Vorbereitungen und passendes Marschgepäck, um Reisen allein oder in Gesellschaft, um den richtigen Proviant und Durststrecken unterwegs. Um Kauderwelsch und Wegweiser, Zimmer mit Aussicht und Souvenirs. Gekonnt spannt Trojanow den Bogen bis zum Massentourismus und zum Reisen als Kunst, die es neu zu entdecken gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deVollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1. Auflage 2018ISBN 978-3-492-99188-9© Piper Verlag GmbH, München 2018Covergestaltung: Birgit KohlhaasCovermotiv: iStockDatenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenAlle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Mein schönstes Ferienerlebnis oder Wenn einer eine Reise tut
Intermezzo: Ein (Lieblings-)Ort
Eine kurze Geschichte des Reisens
Intermezzo: Ein (vergessener) Reisender
Unterwegs in zwölf Etappen
1. Stock und Hut
2. Wegweiser
3. Einsam oder gemeinsam?
Intermezzo: Eine (individuelle) Gruppenreise
4. Proviant
Intermezzo: Ein Essen (an drei Abenden)
5. Kauderwelsch
6. Gipfel
7. Gegenwind
8. Durststrecke
9. Fußläufig
Intermezzo: Ein (letztes) Foto
10. Augen auf
Intermezzo: Ein Autor (auf Reisen)
11. Pilgerschaft
12. Vor der eigenen Haustür oder In den eigenen vier Wänden
Intermezzo: Ein (sanfter) Fußabdruck
Von einem, der auszog, das Reisen zu lernen
Intermezzo: Ein (zauberhaftes) Buch
Lesetipps
Danksagung
Mein schönstes Ferienerlebnis oder Wenn einer eine Reise tut
Der wahre Reisende hat keinen festgelegten Weg,noch will er ans Ziel.
Lao-tse
Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mit Freunden zusammenkomme, erzählen wir uns am liebsten Geschichten von gemeinsamen Reisen. Egal, ob wir unter uns sind oder in größerer Runde. Es gibt Erlebnisse, die müssen immer wieder beschworen werden. Etwa jenes, wie wir damals durch Rabat schlenderten, am letzten Tag einer anstrengenden und nicht immer beglückenden Reise, wie wir uns überlegten, ins Kino zu gehen, wie wir an einer Ampel einen sympathisch wirkenden Einheimischen ansprachen, wie dieser uns zuvorkommend zu einem Programmkino führte, das leider keine interessanten Filme zeigte, wie wir an seiner Seite weiterschlenderten und uns immer mehr ins Gespräch vertieften, bis der Mann uns zu einer Bäckerei mitnahm, wo er nach dem Rechten schauen musste, denn an diesem Abend heiratete seine Schwester, und ein kritischer Bruderblick auf die bestellten Köstlichkeiten war nötig. Wie er uns kleine Leckereien kredenzte, wie wir weiter gemeinsam durch die Stadt streiften und er uns spontan zur Hochzeit einlud, und wie beglückt wir waren, nach einem Monat in Marokko zum ersten Mal privat eingeladen zu werden. Wie wir ihn sogleich fragten, was wir als Geschenk mitbringen sollten, wie er dieses Ansinnen von sich wies, wir aber darauf beharrten, bis er nachgab, scheinbar unwillig, und vorschlug, wir könnten eine der Champagnerflaschen übernehmen, die er noch besorgen müsse, und wir erfreut einwilligten, aber nur, wenn jeder von uns eine Flasche mitbringen dürfe, und wie er uns von den Schwierigkeiten berichtete, Alkohol zu kaufen, weswegen er geradezu konspirativ einen Franzosen in der Nähe aufsuchen müsse, und wenn wir wollten, könne einer von uns ja mitkommen, worauf die zwei Freunde mir ihr ganzes Geld übergaben und ich diesem sympathischen Mann folgte, bis wir einige Minuten später einen Hofeingang erreichten und er mich bat, draußen auf ihn zu warten. Ich drückte ihm unser Geld in die Hand, er ging hinein. An dieser Stelle legen wir beim Erzählen eine Kunstpause ein, nehmen einen Schluck oder grinsen uns an, bevor ich weitererzähle, wie ich vor dem Eingang wartete, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bis meine Sorgen überhandnahmen, wie ich hineinging und mich erkundigte, doch keiner der Anwohner wusste etwas von einem Franzosen, und wie mir, als ich in meiner wachsenden Verzweiflung nach einem Champagnerverkäufer fragte, misstrauische und teilweise aggressive Reaktionen entgegenschlugen. Wie ich mich aufmachte, die Freunde zu suchen (ich hatte beim Hinweg nicht auf den Weg geachtet und nun Schwierigkeiten, den Platz zu finden, wo sie auf mich warteten), und wie ich schließlich verwirrt und eher zufällig meine Freunde fand und ihnen mitteilen musste, dass wir einem Meister unter Trickbetrügern aufgesessen waren.
Erfahrungen auf Reisen sind nicht immer angenehm. Im Gegenteil: Beim Reisen ist das Hässliche, das Unangenehme, das Scheitern zugleich das Faszinierende, das Bewegende, das Unvergessliche. Die Erlebnisse auf Reisen werden zu intensiven Erinnerungen destilliert. Wer also sein Zuhause in der Erwartung eines sicheren und geplanten Ablaufs verlässt, wer genau das erlebt, was er oder sie erwartet hat, der war zwar unterwegs, aber nicht wirklich auf Reisen. Wer sich auch fern der Heimat, rasiert oder unrasiert, ein Schnitzel zum Abendessen wünscht, am liebsten im klimatisierten Reisebus durch die fremde Stadt kutschiert und diesen nur für ausgewählte touristische Highlights verlassen mag, bleibt am besten gleich zu Hause und schaut im Fernsehen »Länder – Menschen – Abenteuer«.
Vielleicht ist das größte Reisehindernis heutzutage unsere Ängstlichkeit. Wir leben in Westeuropa in einer historisch betrachtet selten lang andauernden Phase des Friedens, doch leider scheint dies zu wachsendem Sicherheitswahn und gesteigerter Hysterie zu führen. Nicht verwunderlich, dass Länder mit gutem »Sicherheitsimage« – die Schweiz, Kanada, Australien, Japan und die skandinavischen Staaten – derzeit auf dem Reisemarkt die höchsten Zuwächse erfahren. Viele sind dem Irrtum aufgesessen, das Leben habe ein Geländer, ein Sicherheitsseil und einen dritten Fallschirm. Das tut auch dem Reisen nicht gut.
Wir könnten uns ein Beispiel nehmen an dem Briten James Holman, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Blinder allein eine fünfjährige Weltreise unternahm. Holman empfand das Ungewisse als Lebenselixier. Er hat sich von der Mühsal des Reisens, von langen Phasen des Wartens und häufigen Gefahren kaum beeindrucken lassen. So, als beherzigte er das Diktum der taubblinden amerikanischen Schriftstellerin Helen Keller, die etwa hundert Jahre später schrieb: »Sicherheit beruht meist auf Aberglauben. Weder kommt sie in der Natur vor, noch ist sie jedem Menschenkind vergönnt. Die Vermeidung der Gefahr ist letztlich nicht sicherer, als sich ihr ohne Umschweife auszusetzen. Das Leben ist entweder ein waghalsiges Abenteuer oder vollkommen belanglos.«
Wir sind bereit, unsere Bürgerrechte einschränken zu lassen, damit wir vermeintlich vor einer statistisch verschwindend geringen Terrorgefahr geschützt werden. Wir fühlen uns unsicher, obwohl die Kriminalitätsraten beharrlich sinken. Weil wir in zivilisatorischen Blasen leben, schätzen wir Risiko falsch ein und lassen uns leicht einschüchtern. Außer auf vertrautem Terrain, etwa beim Autoverkehr. Da gehen wir erstaunliche Risiken ein. Wie viele Mitmenschen fahren auf der Autobahn lebensgefährlich dicht auf, hätten aber Bedenken, in eine motorisierte indische Rikscha zu steigen. Diese Widersprüche macht sich die Tourismusindustrie zunutze, indem sie uns ein kommodes, transportables Getto garantiert, eine Vollpanzerung gegen die Gefahren der Fremde: das luxuriöse Schiff, das internationalen Standards entsprechende Hotel, den Privatstrand, an dem sich keine aufdringlichen Einheimischen tummeln.
Die Tourismusindustrie muss das Produkt, das sie verkauft, erst erfinden. Das macht sie einerseits kreativ (siehe die Vielzahl an Spezial- und Nischenreisen, die in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gekommen sind), andererseits entzaubert sie dadurch das Reisen. Denn das im Katalog ausbuchstabierte Programm ist ein Menü garantierter Leistungen; das Salz der Reisen hingegen ist das Unerwartete, die Überraschung. Für viele Reisende bestehen die Höhepunkte einer Reise im Nachhinein betrachtet aus nebensächlichen Augenblicken, die einen persönlich berührten; nicht aus den abertausend Mal reproduzierten Abziehbildern, sondern aus einem ganz und gar individuellen Erlebnis: In einer winzigen Gasse, in die wir uns verirrten, war ein uriges Café, in dem einige alte Männer Domino spielten, und weil wir stehen blieben, wurden wir hineingewinkt und tranken den besten Thé à la Menthe unseres Lebens, mit gerösteten Pinienkernen natürlich, und wir schauten den Männern beim Spiel zu und unterhielten uns mit Händen und Füßen. Dies ist nur ein beliebiges Beispiel, ein jeder von uns wird es durch etwas Eigenes und Unvergessliches ersetzen können.
In diesem Buch möchte ich versuchen, dem existenziellen Zauber des Reisens nachzuspüren, ohne Schwärmerei oder esoterische Verklärung, sondern eher pragmatisch gesinnt. Mich haben auf der ganzen Welt immer wieder jene spirituellen Traditionen beeindruckt, die aus einer handfesten Praxis herrühren: Gehen, Schweigen, Teilen. Getragen von der Erkenntnis, dass tieferes Empfinden einfache Instrumente der Weltbegegnung voraussetzt.
Bevor wir die Möglichkeiten des Reisens auf zwölf Etappen abschreiten, möchte ich beteuern, dass ich kein antitouristischer Snob bin. Wir sind heute alle Touristen. Und jedem anständigen Touristen missfallen die anderen Touristen. Jeder von uns hat schon mal den Satz von sich gegeben (oder zumindest gehört): Dort ist es mir zu touristisch! Meist begleitet von einem tiefen Seufzer, der impliziert, man selbst habe die Reinheit der unberührten Beschau genossen und gewürdigt, aber inzwischen sei der Ort leider abgegriffen von den vielen gierigen Blicken. Solche Klagen sind alt: Bereits 1817 schrieb der englische Dichter Lord Byron, Rom sei »verseucht von Engländern, eine Menge glotzender Tölpel«. Und sie ergeben nur Sinn, wenn man sich der Illusion hingibt, selbst kein Tourist zu sein. Eine Werbung am Flughafen von Dhaka machte sich vor Jahren diese Paradoxie zunutze, indem sie folgende Einladung aussprach: »Besuchen Sie Bangladesch, bevor die Touristen es entdecken!«
Es kann durchaus beglückend sein, dass ein Ort touristisch erschlossen ist. Denn nur an einem solchen Ort finden wir jene vielfältigen Inszenierungen vor, die wir oft suchen – die romantische Stimmung, zu deren Krönung nur noch eine Kleinigkeit fehlt, ergo ein kühles Glas Wein oder ein kaltes Bier zum Sonnenuntergang, ergo Infrastruktur, Strom, Verkehrsanbindung. Der Sonnenuntergang in der Wildnis hingegen fühlt sich eher bedrohlich an, weil man kurz darauf einer ungewissen Dunkelheit ausgeliefert sein wird und Geräuschen, die das stadtgewohnte Ohr nicht zuzuordnen vermag. Ein vom Tourismus eroberter und ausgestatteter Ort kann die Erfüllung von Wünschen, die Befriedigung von Sehnsüchten bedeuten. Der Strand einige Dutzend Kilometer nördlich der sehr touristischen kenianischen Stadt Malindi ist traumhaft: weißer Sand, hohe Dünen, kein Mensch weit und breit. Pure, wunderschöne Idylle. Man springt ins Wasser, wälzt sich im Sand. Aber nach einer Stunde fällt einem auf, dass es keine Duschen gibt und keinen Schatten, dass nichts zum Trinken oder Essen angeboten wird. Und man sehnt sich nach einem Cappuccino zum Meerblick. Es wäre ehrlicher, sich in das eigene touristische Schicksal zu fügen und die Zumutung zu akzeptieren, dass sich die halbe Menschheit ins British Museum drängt und zwängt. Dies hat seinen guten Grund – die weltweit beeindruckendste Sammlung globaler Kulturgegenstände, über Jahrhunderte hinweg zusammengehamstert und -geraubt. Im nur leicht abseits der berüchtigten ausgetretenen Pfade liegenden Fan Museum in Greenwich sind Sie zwar allein und können sich viel auf diese charmante Entdeckung einbilden, aber Hand aufs Herz: Würden Sie tatsächlich für einen skurrilen Fächer aus dem 18. Jahrhundert auf die Schätze des British Museum verzichten?
Wenn die Zeit drängt und das Ziel es vorschreibt, muss man den inneren Touristen – der eng verwandt ist mit dem inneren Bildungsbürger – einfach gewähren lassen und akzeptieren, dass viele andere ebenfalls dieses Ziel ansteuern. Sie werden niemals ein einsames Stelldichein mit Dürers Nashorn erfahren, es sei denn, Sie brechen nachts ins Museum ein. Ein gewisses Maß an Tourismus ist unvermeidlich und in Ordnung, nur sollte man es nicht mit Reisen gleichsetzen.
Reisen ist viel mehr als nur Ortswechsel. Laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendeln 18,4 Millionen Bundesbürger wochentäglich zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, zwanzig, dreißig, fünfzig oder gar hundert Kilometer weit. Natürlich reisen sie nicht. Viele besuchen regelmäßig ihr Wochenendhäuschen oder ihre Ferienwohnung, aber wer würde dieses Hin und Her als Reisen bezeichnen? Nicht wenige fahren oder fliegen einmal im Jahr irgendwohin, stets an denselben Ort – Urlaub als »Einmal-im-Jahr-Pendeln«.
Und doch prangt »Reise« auf jedem Angebot. Weil die Industrie, die Bewegung organisiert, sich »Reisen« auf die Werbefahnen geschrieben hat: Reiseunternehmen, Reisebüros, Reiseagenturen – zum größten Teil führen sie eine Art Pendelersatzverkehr durch. Zum Reisen gehört eine gewisse Anstrengung, Überwindung, Unbequemlichkeit – das Shopping-Weekend in New York oder das Spa-Wochenende am Bodensee befriedigt körperliche oder geistige Sehnsüchte, viel mehr aber auch nicht.
Trotz aller Bedenken glaube ich weiterhin an die möglichen Segnungen des Reisens – an die geernteten Früchte der Erkenntnis, an die erfahrenen Berührungen. Edgar Allan Poe hat in seinem Tagebuch einmal die seiner Ansicht nach wichtigsten Elemente des Lebensglücks notiert: Liebe, Kreativität, kein Ehrgeiz und – an vorderster Stelle – Reisen. Das Fernweh, die Neugier auf das, was sich hinter der nächsten Ecke finden lässt, das Bedürfnis, über den eigenen Tellerrand zu lugen, ist dem Menschen eingeschrieben. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn beinahe jeder Erdenwinkel tausendfach im Internet abgebildet zu sein scheint und nirgends lexikonwürdige Entdeckungen winken. Mir selbst ist so etwas nur einmal »gelungen«, in den tansanischen Uluguru-Bergen, wo wir einen Affen vorbeihuschen sahen, den wir keiner der uns bekannten Arten zuordnen konnten; wir nahmen an, uns getäuscht zu haben, bis wir fünf Jahre später in der Fachzeitschrift Science lasen, Wissenschaftler hätten im Süden Tansanias den bis dato unbekannten Highland Mangabey (Lophocebus kipunji) identifiziert – kurz sonnte ich mich, für niemanden sonst sichtbar, in der Aura des Entdeckerruhms.
Trotz aller simulierten Realitäten, mit denen wir uns zunehmend umgeben, wollen wir weiterhin selbst sehen, riechen, anfassen, um danach stolz verkünden zu können: Ich war dort! Und nach der Heimkehr träumen wir von kommenden Reisen: »Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.« Ich bin überzeugt, dass wir auch im 21. Jahrhundert reisen können, auch wenn die Welt geschrumpft ist und alle weißen Flecken ausschraffiert sind. Nur müssen wir uns darum bemühen – Reisen ist eine Kulturtechnik, die erlernt und verfeinert werden kann. Dieses Buch erzählt in zwölf Etappen und einem persönlichen Resümee von der Quintessenz meiner Aufbrüche und Ausflüge, meiner Wirrungen und Verirrungen. Möglich ist vieles, denn beim Reisen gibt es eigentlich kein Scheitern. In den Worten von Kurt Tucholsky: »Umwege erweitern die Ortskenntnis.«
Intermezzo: Ein (Lieblings-)Ort
Wenn ich gestehe, dass für mich Bombay der aufregendste Ort auf Erden ist, blicken mich die Leute argwöhnisch an, als würde ich ihnen faulen Fisch andrehen wollen. Ich fühle den Drang, wie der Conférencier in dem Musical »Cabaret« flehentlich loszusingen: If you could see her through my eyes. Wieso gerade Bombay? Vielleicht wegen des makabren Tanzes von Erschaffung und Erschöpfung, der hier tagtäglich frenetisch aufgeführt wird. Vielleicht, weil Bombay die eigene Menschlichkeit herausfordert, ebenso wie alle Sinne, mit einer Wucht, die das Leben anderswo langweilig und lahm erscheinen lässt.
Im Schatten von Hochhäusern schlagen sich etwa zwanzig Millionen Menschen (niemand weiß das so genau) in einem verwirrend-faszinierenden Mischmasch der Kulturen und Religionen auf engstem Raum durchs Leben, die Hälfte davon in Elendsquartieren; zugleich wohnen hier mehr Millionäre als in ganz Deutschland. Jeder in Bombay giert nach etwas, und doch finden sich auch Nischen der Entrückung und Entsagung: etwa Gurus, die über sieben Jahre hinweg die heilige Schrift Bhagavad Gita ihren Schülern erklären, einen Vers pro Woche.
Schon in der Früh offenbart sich die Vielfalt der Stadt: Frauen in Saris und Turnschuhen sowie Männer in zu engen Tennishosen drehen auf der Pferderennbahn in Mahalakshmi ihre Runden. Obdachlose schütteln sich den harten Bürgersteig aus den Knochen, waschen sich am Straßenrand in Plastikeimern. In dem Park, in dem Mahatma Gandhi die Quit-India-Bewegung ausrief, treffen sich die Mitglieder eines Lachklubs und kichern, gackern, giggeln, wiehern eine halbe Stunde lauthals, ihre Glieder flattern in alle Richtungen, eine Zeit völliger Ausgelassenheit, bevor sie sich ihrem beruflichen Alltag unterordnen.
Wie kann man Zugang zu diesem Moloch finden? Die Antwort lautet: zu Fuß, auch wenn dies einiges an Durchhaltevermögen, Aufmerksamkeit und Bedacht erfordert. Vom muslimischen Viertel Mohammed Ali Road zum Chor Bazaar etwa, dem »Markt der Diebe«. Die Zeiten der Hehlerei sind längst vorbei, und wer hofft, in den übervollen Antiquitätenläden ein Schnäppchen zu machen, hat die Rechnung ohne das Internet gemacht, heute schlagen die Händler den Kunden ein Schnippchen. Die jüngste Generation an Antiquaren steht zwar in einer alten Familientradition, ist aber zugleich bestens informiert, was Emailleschilder oder Spielzeugautos weltweit kosten. Besonders sehenswert ist die Seitengasse, in der sich Autoteile fast bis zu den Dächern der dreistöckigen Gebäude hochstapeln. Man benötigt aber einige Geduld, denn im Chor Bazaar steht, wie in ganz Bombay, das Filigrane neben dem Verrosteten, das Liebenswerte neben dem Scheußlichen.
Bombay (administrativ korrekt, aber historisch falsch Mumbai genannt) kann anstrengend sein, aber trotz aller sozialen Gegensätze und Ungerechtigkeiten gehört die Stadt zu den sichersten der Welt. Selbst nachts kann man unbesorgt spazieren gehen. Eigentlich gibt es nur zwei Dinge, die man in Bombay niemals tun sollte: im Ozean schwimmen und den neuesten Bollywood-Film von einem Sitzplatz im Parterre aus anschauen. Wieso? Das müssen Sie schon selbst erleben.
Eine kurze Geschichte des Reisens
Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit.
Mark Twain
Wer hat’s erfunden? Wer war wohl der erste Mensch, der aus reiner Lust, allein aus Jux und Tollerei aufbrach? Der einfach nur wissen wollte, wie es hinter den Bergen, am anderen Ufer des Sees oder jenseits der Grenzen seiner Sippschaft aussah? Jäger und Sammler schwärmten aus, um Wild und Beeren zu ergattern, und brachten ihre Beute triumphal nach Hause, Pilger wallfahrten zu heiligen Stätten, um eine göttliche Pflicht zu erfüllen, Händler machten sich auf den Weg, ihre Güter dorthin zu transportieren, wo sie kostbarer waren. Soldaten wurden schon früh durch die halbe Welt getrieben – die einfachen Soldaten in der Armee von Alexander dem Großen waren wohl die weltgewandtesten Menschen ihrer Epoche, wenn sie die vielen Scharmützel und Schlachten überlebten.
Doch eines Tages kam ein Bewohner von Babylon, Damaskus, Athen oder Rom auf die Idee, er könnte sich doch einfach einmal so in der Welt umsehen, ohne Not und Zwang. Wir wissen nicht, wer er oder sie war. Eine Entdeckungsfahrt ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen, ohne den Ehrgeiz, etwas zu erobern oder zu ergattern. Wieso eigentlich? Was uns selbstverständlich erscheint, ist aus anderem Blickwinkel ein Mysterium. Sich ohne Not Gefahren auszusetzen, sich zu verausgaben, das muss einem erst einmal einfallen und dann auch noch einleuchten. Vor Jahren war ich mit einem simbabwischen Kollegen namens Chenjerai Hove in seinem Land unterwegs. In den wunderschönen Matopos-Bergen zog mich ein Gipfel magisch an, wir hatten Zeit, ich lud Chenjerai zu einer kleinen Besteigung ein. Er schüttelte amüsiert den Kopf. Ich ging allein los. Als ich nach einigen Stunden zurückkehrte, fand ich ihn in der Dorfkneipe vor, umgeben von einer Schar bierlauniger Männer. »Wieso steigst du rauf, wenn du wieder runtermusst?«, fragte Chenjerai. Alle lachten. Sie waren sich einig, dass es völlig sinnlos sei, ohne Grund auf einen Gipfel zu steigen. Wenn es galt, an einem heiligen Ort in diesem Gebirge eine Zeremonie zu begehen, dann ja, aber einfach so? Chenjerai zog mich noch Tage und Wochen später auf – wie verrückt ist der weiße Mann, der meint, mit seinen Füßen auch noch den letzten Winkel abgehen zu müssen. Auch nach einem knappen Jahrhundert Kolonialismus erschien ihm diese Form der Reiselust unverständlich.
Der Impuls zu reisen läutete eine kulturelle Zeitenwende ein, die sich irgendwann in der Antike vollzog. Noch heute können wir über die Via Appia gehen, rennen, hüpfen, fahren, an manchen Stellen sind gar noch die originalen Pflastersteine erhalten. Die alten Römer benötigten ein weit verzweigtes Straßennetz, um Waren und Waffen durch ihr riesiges, sich über drei Kontinente erstreckendes Reich transportieren zu können. Es dauerte nicht lange, bis sich Gelehrte und wohlhabende Feingeister zu Kaufleuten, Soldaten und Steuereintreibern gesellten. Die einen unternahmen Studienreisen, beobachteten Natur und fremde Menschen, die anderen hatten Erholung nötig. Bald blühte der Tourismus, Reiseführer und Souvenirhändler wurden einträgliche Berufe.