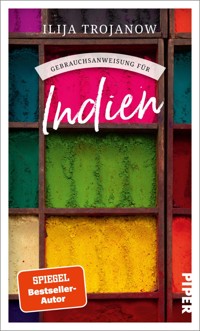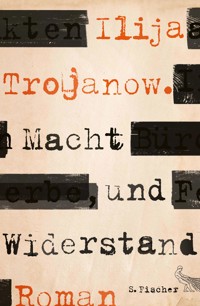9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ilija Trojanow, der Autor des ›Weltensammlers‹, nimmt uns in ›Meine Olympiade. Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen‹ mit in die Welten des Sports. Während der Olympischen Spiele 2012 fasst Ilija Trojanow einen ehrgeizigen Entschluss: Er will alle achtzig Olympia-Sommer-Einzeldisziplinen trainieren. Sein Ziel: halb so gut abzuschneiden wie der Goldmedaillengewinner von London. Gesagt, getan. Trojanow wirft Diskus, Speer und Hammer, spielt Badminton, misst sich im Zehnkampf, bezwingt im Kajak das Wildwasser, er lernt Ringen im Iran, boxt in einem legendären Gym in Brooklyn, absolviert das Judotraining in Japan und läuft im Hochland von Kenia. Ilija Trojanows Bericht einer Selbsterfahrung bietet einen einzigartigen, faszinierenden Einblick in die Welten und Milieus des Sports. Eine ebenso kluge wie humorvoll-selbstironische Reflexion über Grenzen, über die Beziehung von Geist und Körper und über das Älterwerden. Großartig geschrieben mit der leichten Hand eines Fechters und dem Punch eines Boxers Die olympischen Sommersportarten und ausgewählte Trainingsorte von Ilija Trojanow im Überblick: Badminton (Stuttgart) – Beach-Volleyball (Rio de Janeiro) – Bogenschießen (Wien) – Boxen (Brooklyn, NY) – Fechten (Wien) – Gewichtheben – Judo (Nagoya, Japan) – Kanurennsport (Donau) – Leichtathletik (Gehen, Kurz-, Langstrecken- und Hürdenlauf, Weit-, Hoch- und Stabhochsprung, Diskus-, Speer- und Hammerwerfen etc.: London, Wien, Kenia) – Radsport (London) – Reiten (Brandenburg) – Ringen (Iran) – Rudern (Bulgarien) – Schwimmen (Sri Lanka) – Segelsport (Sri Lanka) – Sportschießen (Wien) – Taekwondo (Hongkong) – Tennis – Tischtennis (Wien) – Trampolin (Stuttgart) – Triathlon (Südafrika) – Turmspringen (Berlin) – Turnen (Bulgarien u.a.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ilija Trojanow
Meine Olympiade
Ein Amateur, vier Jahre, 80 Disziplinen
Über dieses Buch
Ilija Trojanows Bericht über seinen olympischen Selbstversuch ist eine einzigartige Reise in achtzig Disziplinen um die Welt: Vom Bogenschießen über Rudern bis zum Wasserspringen. Von Rio de Janeiro über Teheran bis nach Stuttgart.
»Dieses Buch beschreibt die vier Jahre meines Lebens zwischen den Olympischen Sommerspielen in London und denen in Rio de Janeiro 2016. Vier Jahre, in denen ich oft in mich hineingehorcht und mich beobachtet habe. Vier Jahre, in denen ich intensiver gelebt habe als sonst. Vier Jahre, in denen ich viel über den Menschen erfahren habe, über seine Sinne und Sehnsüchte, seine Ambitionen und Illusionen.«
»Man verlässt dieses Buch als besserer Mensch.« Arno Widmann, Frankfurter Rundschau
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, D-60596 Frankfurt am Main, Hedderichstr. 114
Coverabbildung: Thomas Dorn
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402846-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Widmung
Ein Triathlon vorab
Vier Jahre Allympics
Im Wasser
Schwimmen (im Becken)
Freistil
Rückenschwimmen
Brustschwimmen
Schmetterling (früher Delfin)
Freiwasserschwimmen
Auf dem Wasser
Kanuslalom (Wildwasser)
Kanurennsport
Kajak
Kanadier
Rudern
Das Rennen
Segeln
Windsurfen
Kleiner Ball, großer Ball, Federball
Tischtennis
Tennis
Badminton
Leises Schießen, lautes Schießen, Tontaubenschießen
Bogenschießen
Wettkampf
Mit Gewehr und Pistole
Luftgewehr 10 Meter
Luftpistole 10 Meter
Kleinkalibergewehr: 50 Meter liegend
Kleinkalibergewehr: Dreistellungskampf 50 Meter
Freie Pistole 50 Meter
Schnellfeuerpistole 25 Meter
Wurfscheibenschießen
Trap / Doppeltrap
Skeet
Hauen und Stechen
Boxen in Brooklyn
Fechten in Wien
Ringen in Teheran
Judo in Tokio
Taekwondo in Zürich
Im Sattel
Radfahren
Auf der Bahn
Auf der Straße
Auf dem Mountainbike
Auf dem BMX
Reiten
Das Turnier
Springreiten
Vielseitigkeitsreiten
Der Moderne Fünfkampf
In die Knie
Gewichtheben
Luftsprünge
Turnen
Ringe
Reck
Boden
Barren
Pauschenpferd
Sprung
Trampolin
Wasserspringen
Leichtathletik
Der Zwanzigkampf
Werfen
Springen
Laufen
Der Zehnkampf
Marathon (Auf nach Athen!)
Mit Blick auf Rio
Nachspiel
Golf
Wer dreimal hintereinander gewinnt, ist ein schlechter Mensch.
Sprichwort der Lakota
Im antiken Olympia errichteten die Sieger Statuen zu Ehren ihrer Trainer. Da mir dies nicht erlaubt worden wäre, widme ich dieses Buch meinen vielen, wunderbar selbstlosen und engagierten Trainern.
Ein Triathlon vorab
Als ich vor Sonnenaufgang aufwachte, empfand ich keine Nervosität, bis ich in der Innenstadt von Kapstadt, keine Viertelstunde nach Abfahrt, bemerkte, dass ich mein Fahrrad zu Hause vergessen hatte. Ich musste zurück (ohne Fahrrad kein Triathlon) und ein weiteres Mal aufbrechen, nunmehr verspätet und spürbar nervös. Ich raste mit hundertfünfzig Stundenkilometern auf der schnurgeraden Landstraße nach Norden, Richtung Langebaan, der Tafelberg im Rückspiegel wie der Stempel auf einer Luftpostkarte. Es war inzwischen acht Uhr, es war schon heiß; der Start war für elf Uhr angesetzt.
Der erste Eindruck von den Mitstreitern war einschüchternd: eine Ansammlung junger, durchtrainierter Athleten mit negativem Körperfettanteil, starken Waden und mächtigen Oberschenkeln. Die Junioren bestritten gerade ihren Wettkampf. Der Ansager stellte einige der Zehn- bis Vierzehnjährigen vor – darunter ein Weltmeister in seiner Altersklasse –, die im professionellen Stil vom Rad sprangen, noch bevor sie die Umkleidezone erreicht hatten, und das Rad im Laufschritt zu ihrem Platz schoben. Die Bewegungsabläufe erfolgten beeindruckend flüssig. Unter den zahlreichen Angehörigen und Freunden herrschte eine ausgelassene Atmosphäre, wie auf einem Volksfest. Viele kannten sich, tauschten sich aus; eine eingeschworene Gemeinschaft, freundlich kameradschaftlich.
Nach der Anmeldung wärmte ich mich auf. Zwanzig Minuten radeln und eine Viertelstunde locker laufen. Danach zog ich meinen Neoprenanzug an und wunderte mich, dass er nicht so richtig sitzen wollte. Das Wasser hatte eine angenehme Temperatur; in der Nähe schwammen einige vergnügte Urlauber. Ihr samstägliches Planschen wirkte auf mich unseriös. Wir wurden in den Saal gerufen, zur Wettkampfbesprechung. Ein Mann tippte mir auf die Schulter: »Sag mal, wieso hast du den Neopren falsch rum an?« Eine Büchse Scham explodierte in mir, als mir klar wurde, was für eine lächerliche Gestalt ich abgab inmitten all dieser getunten Athleten. Was sollte ich antworten? Weil ich ein Trottel bin? Weil ich zu sehr damit beschäftigt war, Leute wie dich zu beobachten? Oder sollte ich sagen: Passt schon, mein Fahrrad hatte ich ja auch vergessen? Ich stammelte, dass es sich so bequemer anfühle. Der Mann warf mir einen exkommunizierenden Blick zu. Ich wartete, bis er mir den Rücken zugedreht hatte, und rannte in die Toilette. Das Zuziehen des Reißverschlusses am Rücken erwies sich als schwierig, dafür saß der Anzug jetzt viel besser. Ich hätte das Anziehen wirklich üben sollen.
Wir wurden an die Startrampe gebeten. Ich hatte mir keinerlei Gedanken gemacht, wo ich mich beim Schwimmstart positionieren sollte. Als das Horn ertönte und das Seil vor uns hinabfiel, musste ich innerhalb weniger Sekunden erfahren, wie töricht es war, aus der ersten Reihe heraus zu starten. Die Teilnehmer der Western Province Triathlon Championships schwammen nicht mit ruhigen, langen Zügen los, sie paddelten und wedelten wie Raubfische, die nach hingeworfenen Leckerbissen schnappen. Von hinten wurde ich nach unten gedrückt, zu beiden Seiten schwammen Haie über mich hinweg. Ich sank ein wenig, verschluckte mich beim Luftholen und stellte das Schwimmen ein. Als ich mich prustend wieder in Bewegung setzte, musste ich feststellen, dass der Pulk schon weit entfernt war. Obwohl wir in einer Lagune schwammen, war der Wellengang stark genug, um meinen Rhythmus durcheinanderzubringen und eine ruhige Atmung zu verhindern. Immer wieder musste ich aussetzen, um nach der nächsten Boje Ausschau zu halten. Einmal schwamm ich auf die falsche zu, bis ein Lebensretter in einem Kajak meine Richtung korrigierte. Ich stieg als Letzter aus dem Wasser, aber immerhin waren zwei andere Teilnehmer vor mir noch in Sichtweite.
Obwohl mir etwas schwindelig war, rannte ich so schnell ich konnte zur Transition Area hinauf, zu beiden Seiten des Weges Zuschauer, die vergnügte Zeugen meines Versuchs wurden, mich aus dem Neoprenanzug zu häuten (noch etwas, was ich nicht geübt hatte). Schlimmer noch: Der Ansager nahm sich meiner fürsorglich an. Mit einer fast unverständlichen Aussprache meines Namens beglückwünschte er mich zu meinem Schwimmresultat. Ich vermutete, er war entweder bestens gelaunt oder er wurde bestens dafür bezahlt, gute Laune zu verströmen. Als eine Böe mir die Startnummer entriss, die ich am Bauch befestigen sollte, die Schnur zu Boden fiel und ich dem Plastik hinterherhechelte, hörte ich ihn rufen: »Ja, lass dir nur Zeit, I-lai-dschah.« Und ich bildete mir ein, das Lachen der Zuschauer zu hören.
Schließlich gelang es mir, die Startnummer zu zähmen und mein Mountainbike aus der Zone zu schieben. Ich kämpfte mich die Anhöhe hinauf, die zur Hauptstraße führte, beflügelt von dem Wunsch, die Menschheit schnell hinter mir zu lassen. Die Streckenführung bestand aus drei Runden, die Hauptstraße entlang, an einem Kreisverkehr wieder zurück. Der Verkehr wurde umgeleitet. Kaum hatte ich meinen Rhythmus gefunden, wurde ich schon von einem Formel-1-Rad überrundet. Der Athlet lehnte sich tief gebeugt nach vorn und kurbelte seine Siebenmeilenpedale. Die Geschwindigkeit des Führenden war so hoch, dass ich kaum ein Zischen vernahm, bevor ich ihn vorbeiflitzen sah. Es ist immer erniedrigend, überrundet zu werden. Einziger Vorteil war, dass ich mir aufgrund der Geschwindigkeitsdifferenz zwischen uns keine Sorgen über unerlaubtes Fahren im Windschatten machen musste. Mein Mountainbike hatte dicke Reifen und ich begrenzten Ehrgeiz. Mühsam bewältigte ich den leichten, aber kontinuierlichen Anstieg von gut sechs Kilometer bei starkem Gegenwind. Ich beugte mich nach vorn, meine Augen hefteten sich auf den flimmernden gelben Streifen vor mir.
Meine Gedanken schrumpften mit jedem Kilometer. Bis sie von Panik erfasst wurden, weil der Griff nach meiner Wasserflasche in die Leere ging. Ich musste sie früh am Morgen, noch verschlafen, zu Hause liegengelassen haben. Vierzig Kilometer in dieser Hitze – auf der gesamten Strecke nicht einmal das Skelett eines Schattens –, ohne etwas zu trinken, das wäre herkulisch gewesen. Am Ende der ersten Runde erblickte ich eine Tankstelle. Ich bog ab, sprang vom Rad und stürzte in einen kleinen Laden hinein. Zwei dicke Buren standen an der Theke, in ihren Händen jeweils ein Sixpack einheimischen Biers. Sie starrten mich mit einem Gesichtsausdruck an, der nicht zu enträtseln war. Ich war mir nicht sicher, ob wir vom selben Planeten stammten. »Ein Getränk«, schrie ich, »ich habe kein Geld, aber ich brauche ein Getränk, ich zahle später.« Die Kassiererin blickte mich ausdruckslos an, eine endlos lange Zeit, bis sie sich schließlich zu einem bedächtigen Kopfnicken bequemte. Ich öffnete den Kühlschrank und nahm das erstbeste Getränk heraus. An der Tür stürzte ich einen Riesenschluck hinunter.
Auf der letzten Runde nahm der Gegenwind zu. Eine Frau zog an mir vorbei, die ich zuvor als Einzige überholt hatte. Ich schwang mich, um beim zweiten Umkleiden einen besseren Eindruck zu hinterlassen, schon fünfzig Meter vor dem Eingang zur Transition Area vom Rad und lief, für mein Empfinden, elegant in das Rondell hinein. Inzwischen waren meine Arme und Oberschenkel bedrohlich rot geworden. Also cremte ich mich ein, eine absurde Tätigkeit in dieser Zone blitzschneller Verwandlung, doch der Ansager war zu meiner Erleichterung damit beschäftigt, die Namen der Athleten bekanntzugeben, die das Ziel gerade erreicht hatten, samt ihrer astronomisch niedrigen Zeit. Derweil versuchte ich, in meine Laufschuhe zu schlüpfen. Meine Füße wollten partout nicht hineinpassen. Ich dachte, sie seien aufgrund der Anstrengung geschwollen, also zog ich die Fahrradschuhe wieder an.
Gelaufen wurde auf einem Rundkurs von zwei Kilometern, der fünfmal zu absolvieren war. Nach jeder Runde erhielt man von einer streng dreinblickenden Frau unter einem großen Sonnenschirm ein elastisches Band überreicht. Im Ziel würden die vier Bänder am Handgelenk beweisen, dass man die vorgeschriebenen zehn Kilometer hinter sich gebracht hat. Kaum war ich auf den Rundkurs eingebogen, wollte mir die Frau, in der Annahme, ich hätte schon eine Runde hinter mir, ein Band überstreifen. Es war einer jener Augenblicke im Leben, in denen man über sich hinauswächst. Obwohl es drückend heiß und ich ziemlich angeschlagen war (und mein Puls bei hundertsechzig), obwohl sich die Fahrradschuhe zum Laufen nur bedingt eigneten und die Vorstellung, nur acht anstelle von zehn Kilometern laufen zu müssen, mir zu diesem Zeitpunkt verlockender erschien als jede andere Sünde, widersetzte sich irgendetwas in mir der Versuchung, und ich lehnte das Geschenk ab.
»Ich bin stolz auf dich!«, rief die Frau mir hinterher.
Schwierigkeiten beim Laufen bereitete der Untergrund, mal Asphalt, mal Geröll, mal Steinplatte. Ich lief zum ersten Mal in meinem Leben auf einer so unebenen Strecke (auch das hätte ich üben sollen). Ich kam nicht in meinen Rhythmus hinein. Mein Puls beruhigte sich nicht. Die steilste der Steigungen konnte ich nur gehend bewältigen. Jeder Schritt war eine Überwindung. Ich verfluchte die schöne Umgebung um mich herum, die Hügel, das Meer, die Vögel, ich sehnte mich nach Ruhe und Einkehr. Was mich ermunterte, war die Kameradschaft der anderen Teilnehmer, die mir selbst beim Überrunden ein well done zuwarfen, sowie die großzügige Unterstützung durch die Zuschauer, die auch meine Bemühungen beklatschten, obwohl ich mit deutlichem Abstand der Letzte im Feld war.
Und dann gab es noch jenen rundlichen Mann, der am Ende des Anstiegs auf seiner Garage stand und eifrig meine zunehmend kraftlosen Anstrengungen kommentierte. Wir freundeten uns fast an. Mal beschwor er mich, nicht aufzugeben, mal triezte er mich, ob ich denn das Ziel im Gehen erreichen wolle, mal forderte er mich auf zu beweisen, wie hart ich sei, mal schalt er mich, dass ich beim Umdrehen an der Hafenmole eine kleine Abkürzung genommen hatte.
Auch die Frau, die Getränke austeilte, wartete bis zum Schluss auf mich, schüttete eisiges Wasser über meinen Kopf und lief einige Schritte neben mir her, während sie mich in höchsten Tönen lobte. Sie folgte mir bis ins Ziel, und wir wechselten später einige Worte. Sie erzählte, dass sie im Jahr zuvor ihren ersten Triathlon bewältigt habe und dabei Letzte geworden sei. »Aber weißt du«, sagte sie, »wenn es etwas im Leben gibt, bei dem man sich nicht schämen muss, Letzter zu sein, dann ist das ein Triathlon.«
Der Ansager bemühte sich erneut vergeblich, meinen Namen auszusprechen, ich lief den Hügel hinab ins Ziel, das Meer vor mir, die letzten Schritte auf einem Bein hüpfend, in einer Zeit, sagte der Ansager, von 3:45 (ich hatte mir eigentlich ausgerechnet, dass ich 3:30 schaffen müsste, aber wenn ich alle unfreiwilligen Pausen zusammenrechnete, war ich von diesem Ziel gar nicht so weit entfernt).
Danach trank ich einen Becher Cola. Die anderen Teilnehmer waren schon gegangen. Einsam schob ich mein Rad zum Auto zurück, ausgelaugt, durchdrungen von einem unvertrauten Stolz. Als ich den Schlüssel ins Zündschloss steckte, freute ich mich auf das Bad zu Hause, auf einen unendlichen Vorrat an kalten Getränken. Als ich den Schlüssel umdrehte, vernahm ich völlige Stille. Ich hatte die Scheinwerfer angelassen. Auch das Anschieben half nichts. Ich musste den AA rufen, das südafrikanische Äquivalent des ADAC. Da Langebaan etwas abseits liege, warnte mich die Frau am Telefon, müsse ich bis zu zwei Stunden warten. Ich stieg auf mein Fahrrad und rollte gemächlich zur Tankstelle, um meine Schulden zu begleichen und drei Liter Wasser zu kaufen. Ein Wachmann hatte Erbarmen mit mir, als er mich auf dem Asphalt im Schatten des Autos liegen sah, und kehrte mit einem älteren Herrn zurück, der seinen kleinen Honda neben meinem Jeep parkte, die Batterien austauschte, meinen Motor anwarf und die Batterien wieder zurücktauschte. Eine einfache Lösung, auf die ich nie gekommen wäre. Ich fuhr auf der Landstraße am tiefblauen Ozean entlang nach Hause. Im Radio lief ein Lied von Kate Bush. Auf einmal überschwemmte mich ein allumfassendes, grenzenloses Glücksgefühl, das mir Gänsehaut verursachte.
In der Euphorie ging mir auf, wieso es keine Rolle spielt, ob man Erster oder Letzter geworden ist – ein stärkeres Glücksgefühl als meines an diesem Nachmittag kann niemand empfinden, nicht einmal ein Olympiasieger.
Vier Jahre Allympics
»Worüber freust du dich?«, fragte Diogenes einen jungen Mann.
»Ich habe bei Olympia den Sieg davongetragen«, erwiderte dieser voller Stolz, »ich habe alle Mitstreiter besiegt!«
»Was für eine Ehre ist es«, versetzte Diogenes, »Schwächere zu besiegen?«
Im Sommer 2012 lümmelte ich wie Milliarden anderer Erdbewohner vor dem Fernseher und schaute mir Wettkämpfe in Sportarten an, von deren Existenz ich nichts wüsste, gäbe es nicht alle vier Jahre die Olympischen Spiele. Ich betrachtete wohlgeformte Menschen, die einander tänzelnd abschätzten, die auf dem Rücken eines herausgeputzten Pferdes eine bella figura abgaben, die hoch in die Luft schossen und einige Salti samt Drehungen vollzogen. Ich sah Verrenkungen unterschiedlichster Art, ich wurde Zeuge unvorstellbaren Durchhaltevermögens. Ich ließ nichts aus, keinen der Endkämpfe, kein Halbfinale, nicht einmal Vorläufe und Qualifikationsrennen, doch so sehr ich von dem Geschehen gepackt war, in mir nagte das Gefühl, das Wesentliche zu verpassen.
Je länger ich zusah, desto mehr wuchs meine Unzufriedenheit. Was ich zu sehen bekam, erschien am Bildschirm entweder zu einfach oder zu schwer. Die Bewegungen waren einerseits von selbstverständlicher Eleganz, andererseits von enormer Komplexität. Ich konnte nicht einschätzen, was die erzielten Leistungen bedeuteten, alle Zahlen (und an Zahlen herrschte kein Mangel) blieben abstrakt. Fragen an das Wie und Warum schossen mir durch den Kopf; sie wurden selten beantwortet. Im Gegenteil: Der perfekt ausgeführte Schlag, Stoß oder Wurf stand als Ausrufezeichen hinter einer mir unbekannten Geschichte. Die zirkusreife Virtuosität verschwieg die jahrelang vorangegangene Mühsal. Höchste Meisterschaft ist offensichtlich die dünne Spitze eines Eisbergs. Sport wird bei Olympia als glattes, makelloses Produkt präsentiert, hochgezüchtet, unnahbar, in staunender Passivität zu konsumieren.
Die Distanzierung vom Volk hat Tradition. Im antiken Griechenland waren die Wettkämpfer anfänglich einfache Pilger, die zu Ehren der Götter und im Vertrauen auf die legendäre Fruchtbarkeit des Ortes die Kultstätte Olympia aufgesucht hatten. Mit den Jahren und Jahrzehnten wurde die Pilgerstätte größer, die Wettkämpfe geregelter, bis nur noch Auserwählte antraten, die sich in ihrer Heimat jahrelang auf dieses Kräftemessen vorbereitet hatten. Die Athleten reisten einen Monat früher an, wurden in Elis, dem administrativen Zentrum nördlich der Sportstätten, geprüft und registriert, bevor sie sich sorgfältig auf die Wettkämpfe vorbereiteten, schon damals im heutigen Sinn Vollprofis.
In vielerlei Hinsicht wurde im antiken Olympia die Geschichte des Sports vorweggenommen. Die Ruinen erzählen von der Entwicklung vom Religiösen zum Säkularen. Zuerst errichtet Philipp II., dann Alexander der Große, einen imposanten Tempel zur eigenen Ehrung. Später platzieren die römischen Kaiser ihre Statuen an hervorgehobener Stelle. Repräsentation gewinnt an Bedeutung: Anlässlich des Besuchs von Nero wird eine Villa erbaut, luxuriöse Thermen runden das Lifestyle-Angebot ab. Der Kern der Tradition, die Ehrung von Zeus, die Verknüpfung von Pilgerschaft und Wettkampf, gerät in Vergessenheit. Die antiken Spiele enden mit dem Triumph des Christentums, bevor sie in der Neuzeit neuerdings als heidnischer Brauch wiederbelebt werden, bald schon in Diensten der Götter Masse und Mammon.
Im Laufe der Recherche hat meine Bewunderung für die individuellen Leistungen in dem Maße zugenommen wie meine Abneigung gegenüber dem Leistungssport. Nicht nur wegen der Dominanz von Kommerz, Betrug und Korruption, sondern auch, weil die Durchökonomisierung den Sport seiner Poesie beraubt. Gewiss, Betrüger gab es schon in der Antike. Allerdings standen vor dem Eingang zum Stadion Säulen, zanes genannt, auf denen die Sünder an den Pranger der unverbrüchlichen Erinnerung gestellt wurden. Jede neue Generation von Athleten schritt durch dieses Spalier abschreckender Beispiele. Wer damals erwischt wurde, erhielt eine ewige Sperre. Heute haben Dopingfälle höchstens einen Einfluss auf die spezifische Dichte unseres Zynismus.
Die Olympischen Spiele haben mich von früh an fasziniert. Als Flüchtlingskind streifte ich im Sommer 1972, angesteckt von der allgemeinen Begeisterung, durch München, um jeden öffentlich zugänglichen Wettkampf live zu erleben. Bernd Kannenberg kommt mit dynamischen Schritten näher, die Menschen klatschen, Fahrradfahrer rasen an mir vorbei, die Menschen jubeln, Bernd Kannenberg entfernt sich mit wackelnden Hüften, auf dem Weg zu seinem legendären Sieg. Es gelang mir sogar, mich in eines der Stadien hineinzuschmuggeln (dazu später mehr).
Die Faszination blieb. Noch Jahre später breitete ich gelegentlich in meinem Zimmer alle Spielsachen aus und veranstaltete meine eigenen Wettkämpfe, erfundene Disziplinen mit selbstbestimmten Regeln. Die Sportstätten bestanden aus Mikadostäbchen, Mensch-ärgere-dich-nicht-Brettern und Fischertechnik-Bauteilen, die Athleten wurden zwei Monopoly-Spielen (dem englischen und dem deutschen) entnommen. Die Hüte lieferten sich eines Tages ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Olympischen Spiele waren mir eine Kirmes, auf der in jedem Zelt eine andere aufregende, betörende Sensation aufgeführt wurde, Sport war für mich eher Theater als Wettkampf, eher Sprache als Statistik.
Vielleicht lag meine Begeisterung auch darin begründet, dass meine Eltern Leistungssportler waren, der Vater Hürdenläufer, die Mutter Volleyballspielerin. Oder darin, dass ich die ersten Schuljahre in einem britischen Internat namens Kenton College in Kenia verbrachte, wo wir jeden Nachmittag Sport trieben. Vielleicht verdanke ich mein Interesse einer frühen unreflektierten Ahnung, dass der Mensch im Sport seine vielfältigen Sehnsüchte ausleben, seinen individuellen Ehrgeiz wie auch seine soziale Kompetenz ausloten kann. Als lebenslanger Sportfan, als Aktiver (vor allem Tennis) sowie als Passiver (vor allem Leichtathletik), saß ich in jenem Sommer vor dem Fernseher und fragte mich: Was macht den Reiz dieser Sportarten aus? Was erzählen sie vom Menschen? Und: Wie würde ich mich anstellen, wenn ich sie betreiben würde?
Meine Fragen blieben natürlich unbeantwortet. Stattdessen folgte Siegerehrung auf Siegerehrung. Als die Fahne ein weiteres Mal gehisst und die Hymne abgespielt wurde, kam mir die eingangs erwähnte Anekdote über Diogenes in den Sinn. Bei diesen Krönungsritualen war trotz der Rührung der Gewinner von der »emphatischen Wahrheit der Geste in den großen Momenten des Lebens« (Baudelaire) wenig zu spüren. Schon während der Wettkämpfe galt die Aufmerksamkeit der Moderatoren einzig der Frage, wer wohl gewinnen würde. Sie erklärten kein einziges Mal, wieso willkürlich die drei Bestplatzierten geehrt werden, anstatt etwa die ersten fünf oder gleich alle Finalteilnehmer. Stets lag jemand »in Führung«, gelegentlich gab es eine »Aufholjagd« oder eine »Demonstration der Überlegenheit«, mal einen »klaren«, mal einen »überraschenden«, mal einen »sensationellen«, immer aber einen »Sieg« (weswegen es ein Leichtes ist, Sportübertragungen in einer fremden Sprache zu folgen, wenn man die Namen der Athleten kennt). Sport wurde auf einen einzigen Aspekt reduziert, der mir meist belanglos erschien, denn ich kannte keinen der antretenden Kanuten, Bogenschützen oder Gewichtheber, insofern war es mir egal, wer von ihnen gewann. Der Reichtum menschlicher Phantasie, die jede Sportart zu einem lebendigen Kunstwerk formt, wurde auf einen simplen binären Code reduziert: Daumen rauf oder Daumen runter. Die Choreographie der Abläufe, der soziopolitische Hintergrund der Regeln, die Physik der Bewegung und die Medizin der Anstrengung fanden kaum Erwähnung. Stattdessen pfiffen im aufdringlichen Hintergrund die Branding-Brigaden das olympische Marschlied: The sponsor takes it all.
Woher dieser Kult des Siegens? Diese Obsession der Zahl der Triumphe? Wieso macht es für den Sportler einen existentiellen Unterschied, ob er sechs oder sieben Mal Gold erringt? Wieso ist es von Bedeutung, dass irgendein Land im Fernen Osten elf anstelle von zuletzt neun Medaillen gewonnen hat? Die vielbeschworene Tragik des Leistungssportlers besteht nicht darin, dass er verliert, sondern darin, dass er fast gewinnt bzw. knapp verliert. Diese Dramatik des engen Ausgangs wird von den Moderatoren mit sich überschlagender Stimme und operettenhaftem Gehabe ausgeschlachtet. Wenn aber die Niederlage einem Wimpernschlag geschuldet ist, könnte man sie genauso gut als Nichtigkeit betrachten. Einer Hundertstelsekunde, einem Millimeter so viel Bedeutung beizumessen (zumal nach einem stundenlangen Wettkampf und jahrelangem Training) banalisiert die Schönheit der Tätigkeit, die bei den Olympischen Spielen angeblich gefeiert werden soll: des Sports.
»Dabei sein ist alles!« So wird die berühmteste Aussage des Neugründers der olympischen Bewegung, Pierre de Coubertin, salopp überliefert. Wortwörtlich sagte er 1908 in London: L’important dans ces Olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part. (Das Wichtigste an diesen Olympischen Spielen ist nicht das Siegen, sondern das Teilnehmen.) Und präzisierte im Anschluss: L’important dans la vie ce n’est point le triomphe mais le combat; l’essentiel ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. (Das Wichtige im Leben ist nicht der Triumph, sondern der Kampf. Das Wesentliche ist nicht, gesiegt, sondern gut gekämpft zu haben.)
Bekanntlich gelten Propheten nichts in der eigenen Religion. Auch wenn dieser Satz oft beschworen wird, angesichts der heutigen Realität klingt er hohl und verlogen. Nicht nur die Siege, auch die Platzierungen werden minutiös gewertet und bewertet, gemessen und bemessen, Finanzierungen und Investitionen daran geknüpft. Der Medaillenspiegel ist das olympische Testament. Das zweite, ebenso berühmte Credo – »citius, altius, fortius« (schneller, höher, stärker), formuliert von dem Dominikanerpater Henri Didon – folgt einer Wachstumslogik, die zu vielen Pervertierungen des Sports geführt hat, nicht nur zum Doping, sondern auch zu steigenden Anforderungen, die selbst Profis (fast) überfordern. Ist es wirklich heroisch, dass Athleten zehn Jahre ihres Lebens opfern, um zehn Sekunden schneller zu werden? Das »Höher hinaus« als geistige Übung, gemessen nicht in Minuten oder Metern, sondern in Erfahrung und Einsicht, ist hingegen in Vergessenheit geraten.
Ich weiß nicht, an welchem Tag während der Olympischen Spiele in London es geschah, aber mit einem Schlag (einem Ippon, einem Smash, einem Wurf) wurde mir bewusst, dass es für mich nur eine Reaktion auf diese Enttäuschung geben konnte: Ich musste die passive Rolle des Glotzers ablegen und den Sportler in mir wiederbeleben. Vom Voyeur zum Akteur! Also sprang ich vom Sofa auf und kramte aus der hintersten Ecke meines Schranks die alten Joggingsachen hervor. Das Trikot saß so eng, dass ich einer gestopften Leberwurst ähnelte. Souverän ignorierte ich mein Spiegelbild und trappelte das Treppenhaus hinunter. Nach einigen Kilometern war ich zwar außer Atem, aber zugleich euphorisch. In diesem verschwitzten Augenblick schoss mir ein vermessener Gedanke durch den Kopf: Ist der wahre Olympionike nicht derjenige, der sich allen Disziplinen aussetzt? Wieso täglich das gleiche Gericht essen? Wieso nur eine Sprache lernen? Wieso jeden Urlaub an denselben Ort fahren? Wieso sich beschränken bei so viel Auswahl? Ein kleiner Schritt im Kopf, unzählige Schritte (Sprünge, Züge) in der Realität. Allerdings konnte ich in dieser Stunde der unschuldigen Begeisterung nicht ahnen, was alles auf mich zukommen würde. Nur eines war mir von Anfang an klar: Der einzige Mensch, den es zu besiegen galt, war ich selbst.
Ich habe ein Leben lang Sport getrieben und ein Leben lang bedauert, nicht mehr Sport zu treiben. Ich war nie eine Sportskanone, aber auch nie ein Stubenhocker. Es gab Phasen, in denen mein Ehrgeiz erwachte, es gab lange Winter des Müßiggangs. Insofern war ich für dieses Experiment wie geschaffen. Was immer mir gelingen würde, könnte vielen anderen ebenso gelingen. Zunächst musste ich mir, nach einer längeren Lesereise mit alkoholisierten und nikotinisierten Abenden, eine gewisse Grundfitness aneignen. Das erste halbe Jahr verwendete ich darauf, mir eine solide Kondition anzutrainieren. Als neues Mitglied in einem schicken Fitnessklub nahm ich Stunden bei einem Personal Trainer. In diesem Zeitraum weihte ich so gut wie niemand in mein Projekt ein, um Reaktionen wie etwa »Du willst hundertfünfzig Kilometer Radfahren? Du? Der Wampenträger als Wasserträger!« zu vermeiden. Heimlich, still und leise kaufte ich mir neue Trikots und schnürte die Laufschuhe.
Nach einigen Monaten war ich ausreichend wiederhergestellt, um anderen von meinem Projekt erzählen zu können, ohne einen Lachanfall hervorzurufen. Die Reaktionen fielen trotzdem nicht immer ermutigend aus. Die meisten vermuteten ein Missverständnis und fragten erst einmal nach. Dann fragten sie noch einmal nach. Viele schüttelten ungläubig den Kopf und erklärten mich für verrückt. Sie waren zwar beeindruckt, aber eher wie von einem indischen Fakir, der einen langen Pilgerweg auf Händen und Knien zurücklegen will. Einzig ein Freund, der seine Freizeit seit Jahren damit verbringt, für Ironman-Triathlons zu trainieren, reagierte mit emphatischer und solidarischer Begeisterung. Von dick bis dünn wurde ich unterstützt von meiner Frau, die sich selbst Kriemhild nannte, kaum gebärdete ich mich wie Siegfried. In den langen Jahren des Trainings hatte sie reichlich Gelegenheit, ihre Augenbrauen zu einem skeptischen Bogen zu krümmen, wenn sie mich bei einer merkwürdigen, schief ausgeführten Übung ertappte. Kriemhild hüpft lieber, als dass sie läuft, planscht lieber, als dass sie schwimmt, schaukelt lieber, als dass sie turnt, zumal sie das Leben mit einem lädierten Knie meistern muss. Gemeinsames Training war also nur beim Schießen und Segeln angesagt, doch Ersteres interessierte sie nicht, bei Letzterem ging sie baden. Zwischendurch hüpften wir nebeneinander auf dem Trampolin.
Im ersten Überschwang wollte ich alle Disziplinen der Sommerspiele ausüben, bis mir bewusst wurde, dass ich auf die Mannschaftssportarten würde verzichten müssen. Es war schlichtweg nicht praktikabel, zehn bzw. fünf andere Sportler auf meinem Niveau zu finden, die bereit wären, kurz, aber intensiv mit mir zu trainieren. Aber es blieb ja Arbeit genug übrig: dreiundzwanzig Sportarten, achtzig Disziplinen. Als Nächstes musste ich dieses gewaltige Programm auf gut drei Jahre verteilen. Einige Entscheidungen ergaben sich von selbst: Der Zehnkampf würde einen krönenden Abschluss bilden. Ebenso der Marathon, in der Hoffnung, dass ich gegen Ende des langjährigen Trainings die nötige Fitness aufbringen würde. Da ich stets einige Sportarten parallel würde trainieren müssen, legte ich mir einen Plan zurecht, der konditionell anstrengende Tätigkeiten mit Disziplinen paarte, die eher technische und geistige Anforderungen stellten. Am Schießstand sparte ich die Energie, die ich für den langen Lauf danach brauchte; Segeln und Fahrradfahren ergänzten sich gut, ebenso Tischtennis und Schwimmen.
Um Effizienz bemüht, setzte ich Trainingseinheiten aus exzentrischen Duathlons und Triathlons zusammen. So nutzte ich das häufige Kentern bei meinen ersten Kajakstunden, um für eine Weile die richtige Wasserlage beim Schwimmen zu üben, während ich umgeben von Algen in einem Seitenkanal der Donau dahintrieb. Ich lockerte die Arme, zog die Schultern nach vorne, spannte den Bauch an und schlug leicht mit den Füßen aus, neben mir das Boot, das ich sofort umgedreht hatte. Nach dem Abtrocknen lief ich die acht Kilometer nach Hause. Auf dem Weg zu einer Trainingseinheit oder auf dem Rückweg vom Einkaufen setzte ich jeden meiner Schritte mit durchgedrücktem Knie, wie es das Sportgehen erfordert, ungeachtet der verwunderten Blicke, die ich erntete. Auf die Meinung der Nachbarschaft konnte ich bei einem so dichtgedrängten Programm keine Rücksicht nehmen.
In einer typischen Woche lief ich am Montag Intervalle, lernte am Dienstag die Riposte im Degenfechten, versuchte ich mich am Mittwoch an verschiedenen Schlagkombinationen unter der Ägide einer 78-jährigen Boxlegende. Oder ich trainierte Badminton, eilte aus der Stadt hinaus in die Berge, um am nächsten Morgen einen reißenden Fluss mit dem Kajak hinabzufahren, bevor ich mich am übernächsten Tag pünktlich an der Leichtathletikanlage im Prater zum Zehnkampftraining einfand. Wenn das Wetter für das Rudern unvorteilhaft war, ging ich segeln, und umgekehrt. Manchmal kam ich mir vor wie in der Karikatur The Seven-Second-Workout aus The New Yorker, auf der ein Mann mit Glatze und überlangen Schuhen mit einer Geschwindigkeit von zwanzig Meilen pro Stunde eine Steigung von fünfzig Grad hinaufrennt, während er fünfhundert Kilo stemmt.
Trainieren geht über Studieren, heißt es. Aber wer nicht studiert, der trainiert falsch. Soviel auch über das Trainieren nachgedacht und geschrieben wird, die Grundprinzipien sind denkbar einfach. Um seine körperliche Leistung zu verbessern, muss der Mensch regelmäßig und in Einheiten von gesteigerter Intensität und Dauer in einer Mischung aus Wiederholung und Abwechslung üben. Alles Weitere ist Feinarbeit. Das ist seit langem bekannt. Neu ist höchstens das Konzept des hochintensiven Intervalltrainings (auf Englisch HIIT, was eher wie eine seltene Krankheit klingt, die man sich im Regenwald von Borneo holen kann), ein professionelles Verfahren, das inzwischen bis zu den ambitionierten Hobbysportlern hinabgesickert ist. Kondition wird nicht allein durch ausdauerndes Training aufgebaut, sondern durch kurze, besonders fordernde Übungen, durch auf die Spitze getriebene Anstrengung. Kurze Sprints oder extrem schwere Gewichte, bei denen die Sportler alles geben müssen. Den Spruch no pain no gain schreibt diese Methode auf den Muskelkater. Weswegen jene Gurus, die bei geringem Zeitaufwand enorme Fortschritte vorhersagen, keineswegs das Blaue vom Himmel versprechen. Ob solche auf die Spitze getriebene Effizienz die Freude am Sport steigert, ist eine andere Frage.
Wie jeder Konvertit vertiefte ich mich in die heiligen Schriften. »Das große Laufbuch«, »Das große Fitnessbuch«, »Die Trainingsfibel«, »Alles, was Sie wissen müssen über Übungen, die ein jeder ohne weitere Hilfsmittel innerhalb von zwölf Minuten überall absolvieren kann«. »Ich lerne Fechten«, »Boxen basics«, »Badminton Training«. Jedes Mal kam ich mir wie ein Abc-Schütze vor. Ich informierte mich über alle technischen Hilfsmittel. Mein Bruder schenkte mir ein Gerät, das ein strenges Akronym trug (TRX) und von einem Soldaten der US-Navy-SEALs während eines Einsatzes in Asien entwickelt worden war, der sich vor lauter Sehnsucht nach dem heimischen Fitnessstudio mit einem Tau und den Strippen eines Fallschirms behalf. (So wie einst Joseph H. Pilates, Boxer und Zirkusartist in London, nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs von den Briten interniert, obwohl er Scotland-Yard-Beamten Selbstverteidigung beigebracht hatte, in der Not aus Einrichtungsgegenständen Sportgeräte gebastelt hatte.) Inzwischen sind die TRX-Seile wie auch die Pilates-Geräte modisch aufgepeppt und erfüllen hauptsächlich den Zweck, faulen Entschuldigungen den Garaus zu machen. Ebenso gewissenhaft studierte ich die Evangelien der richtigen Ernährung und entschied mich auf diesem sektiererischen Markt für eine strenge Low-Carb-Diät, schränkte somit meinen Konsum von Kohlenhydraten extrem ein, was allmählich zu einem Frühstück führte, über das sich alle Freunde lustig machten: Linsen, Sauerkraut, Ei und Hüttenkäse, indisch gewürzt.
Schon nach wenigen Wochen realisierte ich, dass mein Körper ein Buch war, in das ich bislang kaum hineingelesen hatte. Ein erstaunliches, sich selbst fortschreibendes Buch, das immer wieder neue Kapitel auftat. Nach jeder ersten Trainingseinheit einer neuen Sportart deklinierte mein Körper Muskeln, die nie zuvor zur Sprache gekommen waren. Die Erkenntnis, dass es über sechshundert verschiedene gibt, wurde mir subkutan vermittelt. Richtig trainieren, das begriff ich allmählich, bedeutet nichts anderes, als eine ehrliche Unterhaltung mit dem eigenen Körper zu führen.
Kriemhild achtete auf jede Veränderung an mir. Nach einem Jahr Training klatschte sie in die Hände und rief begeistert aus:
»Du hast ja einen Twopack.«
»Was soll das denn sein?«
»Ein Drittel eines Sixpacks.«
Ich fühlte mich gehörig geschmeichelt und sah mich vor meinem inneren Auge auf dem nächsten Cover von Men’s Health: »Twopack in sechs Monaten. Das neue Wundertraining.« Vom Ehrgeiz gepackt, eilte ich in die nächste Buchhandlung und kaufte mir das jüngst erschienene Werk »Sixpack in 66 Tagen«. Ich hatte die Wahl zwischen »Sixpack in 6 Wochen«, »Sixpack in 90 Tagen«, »Die Sixpack-Strategie« sowie einer Vielzahl anderer Sixpackiana. (»Ohne die Sixpack-Bücher«, vertraute mir die Buchhändlerin an, »hätte ich den Laden schon längst dichtmachen können.«) Alle diese Werke, unabhängig davon, ob sie eher gymnastisch fokussiert oder ernährungsphysiologisch-stoffwechseltechnisch versiert sind, erteilen in der Quintessenz ein und dieselben Ratschläge:
Weniger essen.
Richtiger essen.
Mehr trainieren.
Richtiger trainieren.
Das sind sie, die vier Geheimnisse des Sixpack-Mysteriums, meine Urformel des Waschbrettbauchs, die mich in den Ratgeberolymp katapultieren wird.
Die Zeit drängte, und es war nicht immer leicht, einem Trainer, der sein Leben einer bestimmten Sportart gewidmet hat, zu vermitteln, dass ich mich im Schnellverfahren, in einigen Wochen oder Monaten, vom blutigen Anfänger zu einem halbwegs akzeptablen Hobbysportler wandeln wollte, der im besten Fall in der Lage sein würde, an einem Wettkampf teilzunehmen und den letzten Platz zu gewinnen. Bei jeder Begegnung mit einem neuen Trainer erntete ich erst einmal Kopfschütteln ob der geringen Zeit, die ich zu investieren gedachte, um die Sportart kennenzulernen, von der ein jeder Trainer annahm, sie sei komplex und schwer zu erlernen. Selten sagte ein Trainer: Kein Problem, das kriegen wir im Handumdrehen hin. Manche überzeugten mich, dass mein Unterfangen in ihrer Sportart schlichtweg unsinnig und unmöglich sei (etwa im Reiten oder im Turnen), weswegen ich mich in solchen Fällen mit einem Anfängerkurs und ein wenig teilnehmender Beobachtung begnügen musste.
Um nicht ins Blaue hinein zu trainieren, hatte ich mir bei jenen Sportarten, die messbare Ergebnisse hervorbringen, das Ziel gesetzt, halb so gut wie der Olympiasieger von London 2012 zu sein. Das erwies sich in manchen Disziplinen als einfach (etwa beim Luftgewehrschießen), in anderen als unmöglich (etwa beim Wasserspringen), bestimmte aber oft erstaunlich genau die Grenze des für mich Erreichbaren. Bei anderen Sportarten, etwa den Ballsportarten, konnte ich nicht mehr anstreben, als das Alphabet der Schläge zu erlernen. Es kam mir entgegen, dass die meisten Trainer Wert auf eine solide Ausbildung der technischen Fertigkeiten legten. Auch wenn sie wussten, dass wir kein stabiles Haus würden bauen können, bestanden sie auf einem soliden Fundament. Allerdings fingen einige von ihnen während der gemeinsamen Trainingszeit Feuer, wandelten sich zu begeisterten Mittätern, die mich anspornten und antrieben.
In den meisten Sportarten erlebte ich einen Moment der Erkenntnis und Offenbarung, einen Durchbruch, einen Quantensprung (nur für mich natürlich: Mann, Mond und die Metaphorik der Schritte), einen Moment, in dem ich etwas Wesentliches über die jeweilige Disziplin begriff und soweit verinnerlichte, dass ich es umzusetzen vermochte. Das waren Glücksmomente. Einmal, in einer Juliwoche 2014, geschah dies in verschiedenen Disziplinen an aufeinanderfolgenden Tagen. Am Mittwoch gelang mir in einem Freibad, bei entgleitender Abendsonne, die entscheidende Hüftrotation, die müheloses Kraulen ermöglicht. Und am Donnerstag, auf einem Seitenarm der Donau, paddelte ich, auf einem kippligen Kajak sitzend, mehr als eine Stunde, engagiert und gelegentlich beschleunigend, ohne zu kentern (beim vorangegangenen Training war ich bei einem heftigen Wind, der die Wasseroberfläche aufraute, sechs Mal ins Wasser gefallen).
Solche Erfolgserlebnisse blieben bestehen, wurden weder relativiert noch zunichtegemacht durch die folgenden Rückschläge, denn ich betrieb die jeweilige Sportart nicht ausgiebig genug, um den unweigerlich einsetzenden Frust der gekrümmten Lernkurve – zunächst schneller Fortschritt, der allmählich abflaut, bis er sich sogar ins Gegenteil verkehren kann – zu erfahren. Im Gegenteil, ich war motiviert durch die rasanten Fortschritte, die mich nach wenigen Trainingsstunden in jede Sportart so hineinführten, dass ich meist ihrer Faszination erlag, ihren besonderen Reiz erkannte, ihre Schwierigkeiten ermessen konnte. Es ist erstaunlich, wie schnell man, als mittelmäßiges Talent in mittleren Jahren, eine völlig unbekannte Tätigkeit derart erlernen kann, dass sie einem Freude bereitet. So intensiv, dass ich bei jedem Neuanfang eine unerwartete Sehnsucht nach der aufgegebenen Sportart spürte, bevor eine neue Faszination die entstandene Leerstelle füllte.
Dieses Buch beschreibt die vier Jahre meines Lebens zwischen den Olympischen Sommerspielen in London und denen in Rio de Janeiro 2016. Vier Jahre, in denen ich fast jeden Tag sportelte oder, wenn ich aus Zwang oder freiem Willen eine Pause einlegte, über Sport nachdachte. Vier Jahre, in denen ich oft in mich hineingehorcht und mich beobachtet habe. Vier Jahre, in denen ich intensiver gelebt habe als sonst. Vier Jahre, in denen ich viel über den Menschen erfahren habe, über seine Sinne und Sehnsüchte, seine Ambitionen und Illusionen. Zweifellos, Sport ist Kampf. Doch Wettkampf, nicht Konflikt. Wichtiger als das Kräftemessen mit einem Kontrahenten ist die Überwindung aller Widerstände, des Wassers, der Luft, das Verschieben der Grenzen der eigenen Anatomie und des eigenen Geistes.
Ich habe einiges über mich selbst erfahren, was ich in diesem Buch gelegentlich anspreche, obwohl ich der modischen Sprache der Selbsterkenntnis misstraue. Entdecke dich selbst! Du kannst mehr, als du glaubst! Wachse über dich hinaus! In dir schlummert ein Tiger (oder irgendein anderes vom Aussterben bedrohtes Tier)! In unseren durchökonomisierten Zeiten wird Selbsterkenntnis zu einem Bestandteil der erstrebenswerten Flexibilität reduziert, die einem ermöglicht, konkurrenzfähig zu bleiben, vergleichbar dem regelmäßigen Dehnen der Muskeln. Ein Satz wie »You’re stronger than you think« (prangt auf einer meiner Trinkflaschen) ist grundsätzlich weder falsch noch richtig, als Werbespruch aber verdächtig glatt. Man stellt sich gleich einen Coach mit dem Aussehen von Tom Cruise beim Wochenendseminar mit Powerpoint-Präsentation vor: Gehe an deine Grenzen, und du wirst alle Hindernisse überwinden. Die Wahrheit ist, dass man oft schwächer ist, als man denkt, und dass man immer wieder scheitert an den Hürden, die einem das Schicksal oder der eigene Übermut in den Weg stellt.
Sport ist aber auch eine kulturelle Leitidee, übernimmt eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Die militärischen Ursprünge (Disziplin, Selbstüberwindung, Härte) wirken genauso nach wie die inhärenten sozialen Absichten (Kameradschaft, Solidarität, Gemeinsamkeit). Jene, die sich einer Sportart verschrieben haben, betrachten diese entweder als Kunst, als Wissenschaft oder als Religion. Wenn sie reden, ob in Zahlen oder Chiffren oder Schibboleths, offenbaren sie einen affirmativen Gestus oder einen emanzipatorischen Anspruch. Beides wirkt nebeneinander, manchmal sogar miteinander. Die althergebrachten Rituale, die in manch einer Sportart den Rahmen setzen, die Stimmung beeinflussen, werden von den einen streng eingehalten, von anderen spöttisch unterlaufen. Alle Sportler partizipieren an den kultischen Handlungen, manche als Hohepriester, andere als Ketzer.
Sport weckt Emotionen, provoziert Haltungen. Ich traf auf Apodiktiker und Rabulistiker, auf Häretiker und Fanatiker. Ich erlebte ideologische Grabenkämpfe zwischen Rationalisten und Esoterikern, zwischen Technomanen und Intuitiven. Einmal, beim Bogenschießen, wurde ich zu einem unschuldigen Pfand in einer Schlacht zwischen zwei Trainern mit unterschiedlichen Lehrmeinungen. Sport stiftet für viele der Menschen, die ihn intensiv betreiben, existentiellen Sinn. Sie werden von dieser Tätigkeit »davongetragen«, gemäß der etymologischen Herkunft des Wortes Sport aus dem lateinischen de(s)portare. Beim Training behalten sie die Zeit im Blick, weil sie meistens auf bestimmte Ziele hin trainieren. Danach, auf dem Sportplatz oder im Klubraum oder im Gasthaus, werden eigene und fremde Leistungen noch stundenlang besprochen. Bei Wettkämpfen wird ein erstaunlicher Ehrgeiz an den Tag gelegt. Wer sich einbildet, die älteren Semester würden mit abgeklärter Weisheit und ironischer Brechung in den Wettkampf trotten, wird eines Besseren belehrt. Gerade bei den Senioren begegnet man einer Ambition, die zunehmend lauter nach Verwirklichung schreit, weil sie zu lange nicht befriedigt wurde. Sport ist eine Arena der Leidenschaften. Für nicht wenige der Menschen, mit denen ich trainieren durfte, war der Sport ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, für manche von ihnen wichtiger als ihr Beruf, eine Tätigkeit, bei der sie eine Reise vom Ich zum Selbst vollzogen, oft zusammen mit anderen. Wer also – so wie ich – die Welt des Sports durchstreift, holt sich nicht nur einen Sonnenbrand und einen Twopack (beides vergänglich), sondern erfährt einiges über das Wesen des Menschen (von Dauer). Sport ist eine anthropologische Konstante. Auch wenn der Mensch nur einem Ball hinterherjagt.
Im Wasser
Geehrte Festgäste! Ich habe zugegebenermaßen einen Weltrekord, wenn Sie mich aber fragen würden, wie ich ihn erreicht habe, könnte ich Ihnen nicht befriedigend antworten. Eigentlich kann ich nämlich gar nicht schwimmen. Seit jeher wollte ich es lernen, aber es hat sich keine Gelegenheit dazu gefunden. Wie kam es nun aber, daß ich von meinem Vaterland zur Olympiade geschickt wurde? Das ist eben auch die Frage, die mich beschäftigt.
Franz Kafka, Der große Schwimmer
Schwimmen (im Becken)
Wasser ist unser fernster Verwandter. Unser Körper hat in etwa die Dichte von Wasser. Deswegen gehen wir nicht unter. Zumindest nicht sofort. Unser Körper besteht überwiegend aus Wasser, bei Neugeborenen etwa zu achtzig Prozent – der Wasseranteil nimmt im Laufe des Lebens ab, wir trocknen allmählich aus, bis zum logischen Endresultat: der Mumie. Wenn Sie jemanden kennenlernen, schwappt Ihnen knapp ein halber Hektoliter Wasser entgegen. Trotzdem ist der Mensch für längere Aufenthalte im Wasser nicht geschaffen. Wenn er schwimmt, begibt er sich in ein fremdes Element. Es ist eine gute Weile her, dass unsere Vorläufer an Land gekrochen sind.
Laufen ist die Beschleunigung einer gewohnten Bewegung, Schwimmen hingegen der Aufbruch in ein Reich der Träume, in dem die Normen des Alltags nicht gelten. Im Wasser können wir nur selten vergessen, dass wir zu Gast sind. Mühsam entwickeln wir ein Gefühl für das Element. Schwimmen ist die schwierigste aller Annäherungen.
Andererseits ist Schwimmen geradezu pathologisch gesund. Im Wasser, achthundermal dichter als Luft, erfolgt jede Bewegung gegen einen starken Widerstand. Der Kraftaufwand ist hoch, das Verletzungsrisiko gering. Wegen des Auftriebs (bei Frauen stärker als bei Männern) werden die Gelenke geschont. Zudem presst das Wasser die Blutgefäße unter der Haut zusammen, das Herz muss mehr arbeiten, um alle Muskeln mit Blut zu versorgen, die Folge: mehr Lungenvolumen, ein kräftigeres Herz.
Und doch gab es für mich gute Gründe, das Schwimmbad zu meiden: Der Chlorgeruch, der einen umschlingt wie ein Dunst aus der Unterwelt; und die Monotonie der einsamen Bahnen, die jegliche Abwechslung negierenden Kacheln am Beckengrund. So folgte ich dem Lockruf des Wassers nur, wenn dieses zum Horizont führte.
Freistil
Schwimmen lernte ich mit knapp fünfzig; die Kunst, nicht zu ertrinken, beherrsche ich seit dem siebten Lebensjahr. Als Kind konnte ich im Bruststil zum Riff hinausschwimmen, im Internat eine Meile im Schwimmbecken überstehen, in studentischen Sommern lange im Meer ausharren, aber das, wonach sich mein schwaches Schwimmerherz sehnte – ruhiges, kraftvolles, ausdauerndes Kraulen –, blieb mir versagt. Bis ich mich an einem windigen Frühlingstag aufmachte, »nach Art der Fische« schwimmen zu lernen – so lautete das Versprechen einer neuen Technik mit dem etwas blechernen Namen Total Immersion.
Adepten von TI (wie Total Immersion abgekürzt wird) sprechen von der Entdeckung dieses Schwimmstils wie von einem religiösen Erweckungserlebnis und von seinem Erfinder Terry Laughlin wie von einem Guru. Sie schwärmen von dem unvergleichlichen Gefühl, durch das Wasser zu gleiten, als würde man die Moleküle durchschneiden. Das klingt nach schlechter Poesie, aber aufregender Erfahrung. Julia, eine Ärztin, die sich mit Sommersprossen und blonden Haaren dieser Lehre verschrieben hat, verspricht mir zu Beginn das Blaue vom Wasser; sie wird ihr Versprechen (nicht ganz) halten.
Zunächst lässt sie mich einige Bahnen kraulen, filmt mich und zeigt mir anhand der Aufnahmen auf dem Tablet, was ich alles falsch mache (fast alles). Wir beginnen mit Grundsätzlichem: Wie liegt man richtig im Wasser? Mit entspannten Armen, die Schultern etwas nach vorn gestreckt, der Rumpf leicht angespannt. Die Beine sanft und ruhig flatternd. Auch der Kopf sollte entspannt sein, auf der Wasseroberfläche treiben, so als sei er abgeschnitten worden (Julia ist, wie schon erwähnt, Medizinerin). Die meisten Schwimmer halten den Kopf zu weit oben, was die Hüften sinken lässt, so dass eine gute Wasserlage nicht mehr möglich ist. Am ersten Tag lerne ich nicht mehr, als den Brustkorb ins Wasser zu drücken. Solange ich absinke, können wir nicht fortfahren.
Wer wie ein Stück Holz treibt, kann mit weniger Aufwand schwimmen. Wasser ist eine widersprüchliche Herausforderung. Je mehr unkontrollierte Kraft man einsetzt, desto mehr Widerstand entsteht. Wer schneller oder stärker mit den Armen zieht, verschwendet nur Energie, wie der kraftstrotzend-hilflose Versuch des athletisch gebauten Éric Moussambani aus Äquatorialguinea bei den Spielen in Sydney bewies, an dessen Ende der Olympionike fast ersoff. »Die schnellsten Schwimmer«, so eine Quintessenz der TI-Lehre, »benötigen am wenigsten Züge«.
Ein durchschnittlicher Schwimmer verwandelt nur drei Prozent seines Kraftaufwands in Vorwärtsbewegung, Michael Phelps immerhin neun Prozent, ein im Vergleich erstaunlich hoher Koeffizient, denn an Land sind Spitzenathleten im Durchschnitt »nur« zwanzig Prozent effizienter als Hobbysportler.
Beim Schwimmunterricht in der Schule konzentrierten wir uns auf Oberkörper und Beine, übten mit Flossen und Pull Buoys, um Armzug und Fußschlag zu verbessern. Jetzt wird mein Körper vertikal in zwei Hälften geteilt und Schwimmen als Serie von Gleitphasen vermittelt, unterbrochen von einer Rotation, weswegen der Körper meist seitlich im Wasser liegt, wie ein Boot mit leichter Krängung. Die Arme, angeführt von dem spitzen Ellenbogen, werden nach vorn gezogen – in Julias Worten »als sei der Unterarm amputiert worden« –, um diese Rotation zu erleichtern.