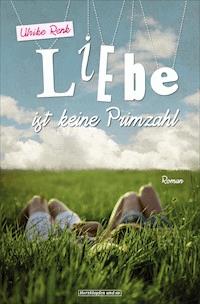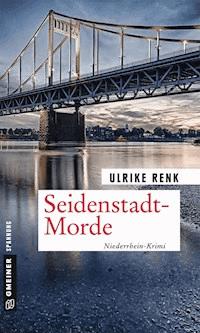10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eine junge Frau erobert die Welt der französischen Küche.
1889: Marthe wächst auf einem Hof in den Vogesen auf, ihre Großmutter bringt ihr bei Brot zu backen, ihre Mutter, eine hervorragende Köchin, wie man aus den einfachsten Zutaten wunderbare Gerichte zaubert. Als sie mit ihrer Mutter nach Paris zieht, taucht sie in eine neue Welt ein. Nicht nur lernt sie einen Mann kennen, der ihr aller Gegensätze zum Trotz den Hof macht, sie erkennt auch, dass ihr das Schreiben genauso viel Freude macht wie das Kochen. Doch wird es ihr gelingen, sich in der männerdominierten Welt der französischen Küche zu behaupten?
Bestsellerautorin Ulrike Renk erzählt das spannende Leben von Marthe Distel –Journalistin und Gründerin der renommiertesten Kochschule "Le Cordon Bleu".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Ähnliche
Über das Buch
Nach dem Tod ihres Vaters wächst Marthe bei ihrer Großmutter auf einem kleinen Hof in den Vogesen auf. Von Grand-mère lernte sie nicht nur die Kunst des Brotbackens, sondern auch all jene Gerichte, für die diese Region so berühmt ist. Dann erhält ihre Mutter Julie eine Anstellung als Köchin und holt Marthe zu sich nach Paris. Die Metropole brummt, die Weltausstellung steht kurz bevor, und Gustave Eiffel errichtet einen riesigen Turm auf dem Champs de Mars. Durch Florence, der Tochter der Familie, für die ihre Mutter arbeitet, lernt Marthe nicht nur das Leben der Pariser Oberschicht kennen, Florence ermutigt sie auch, ihre Leidenschaft, das Schreiben, weiterzuverfolgen. Und dann ist da noch Vincent, die beiden trennen Welten, und doch lässt er Marthes Herz höher schlagen …
Über Ulrike Renk
Ulrike Renk, Jahrgang 1967, studierte Literatur und Medienwissenschaften und lebt mit ihrer Familie in Krefeld. Familiengeschichten haben sie schon immer fasziniert, und so verwebt sie in ihren erfolgreichen Romanen Realität mit Fiktion.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ihre Australien-Saga, die Ostpreußen-Saga, die Seidenstadt-Saga, die große Berlin-Saga um die Dichterfamilie Dehmel und zahlreiche historische Romane vor.
Mehr zur Autorin unter www.ulrikerenk.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ulrike Renk
Mademoiselle Marthe und die Küche der Freiheit
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Amuse-Gueule — Gruß aus der Küche
Kapitel 1 — Remiremont, 1887
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Entrée — Vorspeise
Kapitel 5 — Paris, Herbst 1888
Kapitel 6
Kapitel 7 — Paris, Weihnachten 1888
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Warme Vorspeise — Potage
Kapitel 11 — Paris, Februar 1889
Kapitel 12
Kapitel 13 — Paris, Mai 1889
Kapitel 14 — Paris, Sommer 1889
Kapitel 15
Hauptgang — Plat principal
Kapitel 16 — Remiremont, Herbst 1889
Kapitel 17 — Remiremont, Frühjahr 1890
Kapitel 18 — Paris, Herbst 1894
Dessert — oder Entremets de fromage
Kapitel 19 — Paris, Frühsommer 1895
Kapitel 20 — Paris, Sommer 1900
Nachwort
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Claus – Oh Captain, my Captain
Amuse-Gueule
Gruß aus der Küche
Kapitel 1
Remiremont, 1887
Es hatte die ganze Nacht geregnet. Marthe zog die Schultern hoch, als sie auf den Hof trat. Sie ging an der Scheune vorbei zur Streuobstwiese. Auf dem Feld daneben standen die Kartoffelpflanzen gebeugt, ihre Köpfe hingen tief herab. Die Luft war würzig, es duftete nach der fruchtbaren, nun schweren Erde, und über dem Wald hing der Nebel.
Schon bald würde die Sonne den Nebel auflösen und die Luft erwärmen. Als sie auf dem kleinen Hügel hinter dem Haus stand, schaute sie zur Chaussee, doch dort war nichts zu sehen. Kein Reiter, keine Kutsche, noch nicht einmal ein Fuhrwerk. Aber es war noch früh, tröstete sie sich. Der Zug aus Paris würde erst gegen Mittag in Épinal ankommen. Bis zu dem kleinen Bauernhaus am Rande der kleinen Stadt Remiremont war es dann noch ein ganzes Stück – fast eine Tagesreise zu Fuß, mit einem Fuhrwerk immerhin noch zwei Stunden. Seit einer Woche stieg sie jeden Tag mindestens einmal auf den Hügel und schaute in Richtung Norden. Das kleine Gehöft ihrer Großeltern schmiegte sich in die Ausläufer der Vogesen, seit zwei Jahren, seit dem Tod ihres Vaters, lebten sie nun hier zusammen mit Grand-mère. Marthe strich sich die feuchten Haarsträhnen aus der Stirn, schaute noch einmal angestrengt die Chaussee entlang und kehrte dann um. Vor der Scheune hatte sie den Korb für die Eier abgestellt. Sie griff danach und öffnete die schmale Tür zum Hühnerstall. Jeden Morgen ging Grand-mère als Erstes zum Stall, molk die Kuh und ließ die Hühner auf den Hof. Die Kuh durfte anschließend auf die Weide hinter dem Kartoffelacker. Im Stall war es stickig, und es roch säuerlich nach Milch und Stroh. Schnell sammelte Marthe die noch warmen Eier aus den Nestern. Nebenan trat die Färse unruhig von einem Bein auf das andere, muhte unglücklich.
»Ist ja gut«, sagte Marthe in dem ruhigen Singsang, in dem auch Grand-mère immer mit den Tieren sprach. »Bald darfst du auch wieder auf die Weide.« Schnell füllte sie noch frisches Wasser für die Hühner nach, dann ging sie zurück zu dem Haus aus graugelbem Sandstein, das sich an den Hügel schmiegte, als würde es sich ducken.
Als Marthe eintrat, zog sie den Kopf ein. Natürlich war die Tür hoch genug, sie würde sich nicht stoßen, aber die Räume waren niedrig, und durch den Ruß eines Jahrhunderts wirkten sie noch gedrungener. Obwohl sie schon seit zwei Jahren hier wohnte, hatte sich Marthe immer noch nicht daran gewöhnt.
»Warst du wieder auf dem Hügel?« Grand-mère nahm ihr den Korb mit den Eiern ab. Ihre Hände, rissig und schrundig, so wie die Kruste des dunklen Brotes, das sie noch dampfend aus dem Ofen geholt hatte, legten die Eier sanft in die Mulden des Eierbretts, das immer mitten auf dem Küchentisch lag. »Deine Mutter wird schon zurückkommen«, brummte sie nun.
»Seit vier Wochen ist sie jetzt weg.« Marthe senkte den Kopf.
»Die Zukunft muss gut geplant werden. Wenn sie es jetzt gründlich macht, ist es besser für alle.« Grand-mère klang, wie immer, harsch. Das Leben war nicht gnädig mit ihr gewesen, und so wirkte sie oft unwirsch und brüsk, doch Marthe wusste, dass unter der kantigen Schale ein sanftes Herz pochte – so wie sich unter der harten Kruste des Brotes das wolkige und zarte Innere verbarg.
»Ich verstehe es trotzdem nicht.« Marthe wusste, wie bockig sie klang, und senkte beschämt den Kopf. Sie wollte ja geduldig sein, aber manchmal war es einfach zu schwer.
Grand-mère warf ihr einen kurzen Blick zu, wies dann auf das kleine Butterfass. Sie musste gar nichts weiter sagen. Marthe setzte sich auf den Hocker und begann, die Kurbel zu drehen. Am Anfang war es immer ganz leicht, aber dann nahm der Widerstand zu. Doch es war eine Tätigkeit, die Marthe mochte. Sie musste nicht aufmerksam sein, konnte ihren Gedanken nachhängen.
Auf dem Herd, dessen Feuer Grand-mère immer wieder mit kleinen Kohlestücken oder Ästen fütterte, stand, wie jeden Tag ein großer Topf, in dem Brühe vor sich hinköchelte. Das gleichmäßige Klack-Klack-Klack des Deckels hatte eine beruhigende, fast schon einschläfernde Wirkung. An den Fenstern lief das Kondenswasser herunter und ließ die Landschaft draußen wie in einem Nebel verschwinden. Nach und nach füllte der köstliche, satte Duft der Brühe die Küche und vermischte sich mit dem bitteren und beißenden Qualm des Holzfeuers.
»Pierre muss nach dem Kamin schauen«, murmelte Grand-mère. »Ich fürchte, er ist verstopft.« Sie öffnete eins der kleinen Fenster und wedelte den Rauch mit ihrer Schürze nach draußen. Dann überprüfte sie den Inhalt des Butterfasses. »Noch ein wenig, du musst schneller drehen«, ermahnte sie Marthe und trat zum Küchentisch. Sie griff nach dem großen, runden Brotlaib und presste ihn gegen ihren Bauch, schnitt mit dem Messer dicke Scheiben ab. Obwohl sie das immer so machte, staunte Marthe dennoch jedes Mal wieder. Sie selbst würde sich nicht trauen, das große Messer so schnell und kraftvoll in Richtung Körper zu ziehen.
Grand-mère legte zwei Brotscheiben auf ein Küchenbrett, nahm Marthe das kleine Butterfass ab und bestrich die Scheiben dick mit der frischen und süßen Butter.
»Es wird Zeit, dass die Färse belegt wird«, sagte sie mürrisch. »Bei der nächsten Brunft darf sie zu Pierres Bullen auf die Weide.«
»Warum hast du sie nicht schon dieses Mal dort hingelassen?«, fragte Marthe. »Sie dauert mich so, sie schreit ganz verzweifelt.«
»Tse«, machte Grand-mère. »Sie ist eine Kuh, und Tiere sind nicht verzweifelt, solange sie Wasser und Futter haben. Sie ist noch zu jung, um zu tragen. Auch nächsten Monat wird sie noch zu jung sein, aber die alte Kuh gibt immer weniger Milch. Ein Jahr muss sie schon noch durchhalten.«
»Warum noch ein Jahr?«, fragte Marthe.
Grand-mère schüttelte den Kopf. »Man merkt, dass du in der Stadt aufgewachsen bist. Jetzt lebst du schon so lange hier, aber vom Landleben verstehst du so viel wie eine Forelle im Teich.« Sie wandte sich ab, hob den klappernden Deckel des Topfes und rührte um.
Marthe wusste, dass es keinen Sinn machte, weiter zu fragen, Grand-mère würde nicht darauf eingehen.
Das Brot, das Grand-mère ihr hinschob, schmeckte herrlich würzig und zugleich süß. Marthe aß langsam, kaute gründlich. Bis zum Mittag würde es nichts weiter geben.
Der feine Regen hielt sich, ein Nebel, der über den Bergen hing, die Baumspitzen unter einer grauen, weichen Decke versteckte. Die Erde nahm die Feuchtigkeit dankbar auf, glänzte und duftete.
»Es ist zu feucht, um den Garten umzugraben«, brummte Grand-mère und legte ein Bund Möhren auf den Tisch. Sie war durch den Gemüsegarten gegangen so wie jeden Tag, hatte die Pflanzen geprüft, dort etwas aus der Erde gezogen und in ihren großen, breiten Korb gelegt, hier etwas abgezupft. Nun hängte sie ihr feuchtes Schultertuch über die Lehne und rückte den Stuhl vor den Ofen. Wieder einmal stopfte sie ein paar Zweige in die immer hungrige Ofenklappe. Mit kritischem Blick betrachtete sie die Holzvorräte. »Hol Holz«, sagte sie knapp, griff nach dem kleinen, scharfen Messer und begann, die Möhren zu putzen.
Marthe stand auf, nahm ihr Tuch vom Haken, schlang es sich um die Schultern und hob die Trage hoch, mit der sie Holz holten.
»Hier!« Das Wort reichte, damit sich Marthe umdrehte. Grand-mère schob die Schüssel mit Küchenabfällen in ihre Richtung. Marthe seufzte. Das waren die Reste, die das Schwein bekam. Die Hühner fraßen Gemüseschalen, welken Salat und Brotkrumen, das Schwein aber nahm den Rest. Sogar Knochen fraß es, zermahlte sie genüsslich und langsam. Früher hatte Marthe den Schweinerüssel niedlich gefunden, aber inzwischen wusste sie, dass hinter der niedlich grunzenden Schnauze scharfe Zähne waren. Entsprechend groß war ihr Respekt vor dem Tier. Das Schwein lebte in einem Verschlag hinter dem Stall. Dort durchwühlte es die Erde, wälzte sich voller Wonne im feuchten Dreck und suchte beständig nach Futter. Groß war der Auslauf nicht. Es sollte, so hatte Grand-mère ihr erklärt, sich nicht zu viel bewegen, sondern Speck ansetzen.
Im Haushalt der Distels wurde nichts verschwendet, was die Hühner nicht bekamen, fraß das Schwein. Im Herbst wurde das Schwein geschlachtet, und im Frühjahr zog ein neues Jungtier ein. Das Schlachtfest, das die Nachbarn gemeinsam feierten, hatte Marthe letzten Herbst das erste Mal erlebt, und es war ihr nachhaltig in Erinnerung geblieben. Dieses Jahr sprach sie kaum mit dem Tier, schmiss ihm nur das Futter hin und füllte das Wasser auf. Für einen Moment blieb sie am Gatter stehen, betrachtete den großen, gefleckten Körper des Schweins. Das Leben hier auf dem Hof war so anders als das in der Stadt, viel ursprünglicher. Sie vermisste die Stadt, Remiremont, vermisste den Trubel und die Fröhlichkeit. Alles dort schien leichter zu sein. Aber vielleicht täuschten sie ihre Erinnerungen auch nur, denn als sie noch in der Stadt wohnten, lebte ihr Vater noch. Die Erinnerung an ihren Vater kam plötzlich, und getroffen schloss sie die Augen. Seit seinem Tod hatte sich alles verändert.
»Marthe?«
Sie hörte die Ungeduld in der Stimme und straffte die Schultern. Niemand konnte etwas dafür, dass alles jetzt so anders war. Schon gar nicht Grand-mère, die ihre Schwiegertochter und die Enkelin seufzend bei sich aufgenommen hatte.
Warum, fragte sich Marthe, ist sie nicht dankbar und froh, dass wir bei ihr leben und sie nicht mehr allein ist? Schließlich nehmen wir ihr ja auch Arbeit ab. Dann aber senkte sie den Kopf. Aber natürlich, dachte sie beschämt, machen wir ihr auch Arbeit.
Schnell schaute sie noch einmal um das Haus herum zur Straße, doch sie war menschenleer.
Die Tage auf dem kleinen Gehöft verliefen gleichmäßig und eintönig – obwohl es immer etwas zu tun gab. Die Aufgaben richteten sich nach der Jahreszeit und dem Wetter, ein immer wiederkehrender Kreislauf, erkannte Marthe. Was gleich blieb, war die Versorgung der Tiere. Sie mussten gefüttert und getränkt, die Ställe gemistet, die Kuh gemolken und die Eier der Hühner eingesammelt werden. Jeden Montag buk ihre Großmutter Brot, aus einem Teig, den sie bereits am Sonntagabend angesetzt hatte. Vor einigen Wochen hatte sie angefangen, Marthe das Brotbacken beizubringen. Marthe liebte das lebendige Gefühl des säuerlichen Teiges unter ihren Händen. Sie knetete, walzte und faltete ihn, streichelte und klopfte, wie um ihn aufzumuntern. Dann wurde er in die Holzschüssel gelegt und mit einem sauberen Leinentuch abgedeckt, fast so, als würde man ein Kind zum Schlafen legen. Am nächsten Morgen, wenn Marthe das Tuch anhob, klopfte ihr Herz immer unruhig und besorgt. War das kleine Wunder wieder gelungen? War der Teig gewachsen, hatte sich entfaltet und war aufgegangen? Am Anfang misslang es ihr ein paarmal, und der Teig lag wie zusammengekrümmt auf dem Boden der Schüssel, hart und leblos. Erschrocken hatte sie Grand-mère angesehen, doch diese hatte nicht geschimpft, sondern nur geseufzt. Geduldig hatte sie den Teig neu angesetzt, mit Mehl, etwas Zucker und warmen Wasser gemischt, behutsam geknetet.
»Es muss Luft in den Teig, aber du kannst sie nicht hineinprügeln, du musst es mit Verstand und Hingabe machen. Der Teig lebt, du kannst ihn nicht zwingen, du musst ihn ermuntern zu wachsen und zu gedeihen.« Geduldig zeigte sie Marthe, wie sie den Teig kneten sollte. Und auch als es ein zweites Mal nicht gelang, wurde sie nicht unwirsch, sondern zeigte es ihr erneut.
Nach und nach bekam Marthe ein Gefühl für den Brotteig, wusste, wann er geschmeidig genug war und wie sie ihn am besten betten sollte. Es machte sie stolz, wenn sie den duftenden und mit Luftblasen durchzogenen Teig in den Ofen schob und später das herrlich krustige und dennoch lockere Brot auf den Tisch legen konnte.
Eine weitere Woche war vergangen, der Sommer war zurückgekehrt, und die Kartoffelpflanzen hatten sich wieder aufgerichtet. Auch die Färse durfte wieder auf die Weide und musste nicht mehr ihr einsames Leid im Stall klagen.
Marthe wurde immer unruhiger. Fünf Wochen war Maman nun schon in der großen Stadt. Langsam beschlich sie die Angst, ihre Mutter könne nie wieder zurück kommen.
»Was, wenn ihr etwas zugestoßen ist?«, fragte sie fast tonlos, während sie die Kurbel des Butterfasses drehte. »Paris ist so groß. Warst du schon mal dort?«
»Einmal«, sagte Grand-mère in dem Tonfall, der keine weiteren Fragen zuließ. »Was soll ihr denn zugestoßen sein?«
Marthe zuckte hilflos mit den Schultern. »Ich weiß nicht. Dort gibt es doch auch viele Clochards und … andere dunkle Gesellen. Papa hat immer davon erzählt. Er ist nie gerne nach Paris gereist.«
»Ihr ist nichts zugestoßen.«
»Aber was, wenn doch? Was, wenn sie einfach nicht mehr wiederkommt?« Marthe schluckte. Erst jetzt merkte sie, wie groß die Angst in ihrem Bauch geworden war.
»Mon Dieu, du machst dir aber auch immer Gedanken um ungelegte Eier.« Grand-mère schüttelte den Kopf und verzog den Mund. »Falls ihr etwas passiert wäre, wüssten wir schon Bescheid. Schlechte Nachrichten reisen schnell.«
»Aber wenn sie in die Seine gefallen ist? Oder jemand sie in einem Hinterhof versteckt hat?« Marthe stockte der Atem, ihre Gedanken überschlugen sich.
»Deine Phantasie ist so blühend wie die Kapuzinerkresse im Garten. Das mag an den Heftchen liegen, die du immerzu liest. Du solltest dich lieber nützlich machen. Geh zum Gemüsebeet, das Unkraut wächst schneller, als man gucken kann – aber man kann es nicht essen.«
Marthe zog die Küchenschürze aus und den Gartenkittel über. An der Scheune standen der Eimer, die Harke und die kleine Schaufel, mit der sie das Unkraut ausstechen konnte. Die Arbeit im Gemüsegarten war mühsam, langweilig, aber auch wichtig, das hatte Marthe inzwischen begriffen. Alles, was Grand-mère hier anbaute, ernährte sie. Jetzt, im Sommer, leerten sich die Regale der Vorratskammer. Und noch gab es nicht viel, was schon geerntet werden konnte. Zwar hatten sie im Erdkeller noch zwei Säcke mit schrumpeligen Kartoffeln, doch bis sie den Acker umgraben konnten, würde es noch dauern. Im letzten Jahr war es sogar noch schlimmer gewesen. Da hatte Grand-mère unwillig und grummelnd einige Ware auf dem Markt dazukaufen müssen, sie war nicht auf zwei weitere hungrige Mäuler eingestellt gewesen.
In diesem Jahr hatte sie den Gemüsegarten vergrößert und den Kartoffelacker auch. Zudem war das Frühjahr feucht, aber nicht zu nass gewesen, so dass die Beerensträucher und die Obstbäume voller Fruchtansätze hingen.
Die Erde war noch vom gestrigen Regen schwer, Marthe musste sich durchkämpfen. Sie war froh, als Grand-mère sie zum Abendessen ins Haus rief. Am gestrigen Sonntag hatte Grand-mère ein Kaninchen geschmort. Die Feinde des Gemüsegartens fing sie mit Fallen, und somit kamen sie oft auf den Tisch. Für Marthe zu oft.
»Ich esse sie lieber, als dass sie unser Gemüse und den Salat vertilgen«, sagte Grand-mère gerne. Marthe meinte sogar, eine gewisse Genugtuung in ihrem Gesicht zu erkennen, wenn sie wieder einmal einem Kaninchen das Fell über die Ohren zog.
Nachdem Marthe sich den Kittel ausgezogen und Hände und Gesicht gewaschen hatte, setzte sie sich an den schrundigen alten Tisch, der schon seit Generationen in der Familie war und sicherlich viele Geschichten hätte erzählen können.
Grand-mère stellte einen Teller mit dünnen und über dem Feuer gerösteten Brotscheiben auf den Tisch, dazu ein Schälchen. Marthe sah sie verblüfft an.
»Ein kleines Amuse-Gueule«, sagte Grand-mère, und ihr Mund verzog sich zu einem kaum erkennbaren Lächeln. »Eine Rillette vom Kaninchen.«
»Oh!«
»Ich dachte, du könntest etwas Aufmunterung gebrauchen«, murmelte sie, setzte sich Marthe gegenüber, faltete die Hände und senkte den Kopf zum stummen Gebet. Früher hatte Papa das Tischgebet gesprochen, und wenn er nicht da war, hatte Maman diese Rolle übernommen. Doch seit sie hier wohnten, hatte es kein laut gesprochenes Gebet mehr gegeben. Marthe fiel es normalerweise schwer, ihren Dank und ihre Bitte an Gott im Kopf zu formulieren, doch nun war dort dieser eine große Wunsch, um dessen Erfüllung sie wieder und wieder bat. »Lass Maman zurückkommen!«
»Amen«, sagte Grand-mère und reichte Marthe das Brot und die Rillette.
»Es ist köstlich«, sagte Marthe erstaunt. Normalerweise waren die Speisen im kleinen Bauernhaus bodenständig und einfach, doch die Rillette überraschte sie.
»Es ist ein Rezept, das ich von deiner Mutter habe«, sagte Grand-mère. »Sie ist eine gute Köchin.«
»Woher weißt du das?«, fragte Marthe fast trotzig. »Du lässt sie doch nie an den Herd.«
»Ich weiß es von früher, Kind«, sagte Grand-mère. »Und dies ist meine Küche, mein Herd. Julie würde sich nicht wohlfühlen, hier kochen zu müssen. Auch kocht sie ja ganz andere Gerichte, als ich es tue.«
»Das ist gar nicht wahr. Maman kochte fast so wie du. Nur gab es bei uns öfter eine Süßspeise als Dessert. Und außerdem hat sie natürlich auf dem Markt eingekauft. Unsere Vorratskammer war nicht so groß wie deine, und einen Erdkeller hatten wir in der Stadt erst recht nicht.«
»Und deshalb sind unsere Gerichte ja auch so unterschiedlich.«
Marthe merkte, dass für Grand-mère das Thema beendet war. Statt der sonst üblichen Schüssel Potage, der Gemüsesuppe, die tagtäglich auf dem Herd köchelte, gab es heute eine klare, aber sehr kräftige Brühe.
»Es war ein weiteres Kaninchen in der Falle. Ich habe eine Brühe aus den Knochen gekocht. Bei einem lohnt sich das nicht, da gebe ich die Knochen zum Potage.«
Verwundert sah Marthe ihre Großmutter an. So kochte sie sonst nur an Feiertagen oder wenn Besuch kam – was sehr selten war.
Nach der Suppe holte Grand-mère gebratene Kaninchenkeulen aus dem Ofen, die sie entbeint und mit Kräutern gefüllt hatte. Dazu gab es die ersten Möhren in Butter gegart und mit frischem Kerbel bestreut.
»Lass es dir schmecken«, forderte sie ihre Enkelin auf.
»Feiern wir irgendetwas?«, fragte Marthe unsicher.
»Wir feiern uns. Manchmal muss das sein, Kind. Ich merke, dass du deine Mutter vermisst. Und ich weiß, dass sich dein Leben in den letzten zwei Jahren sehr geändert hat. Es wird sich wohl noch mehr verändern. Und deshalb feiern wir das Hier und Jetzt. Und nun iss.«
»Aber …« Grand-mères Blick schnitt ihr das Wort ab.
Was meint sie wohl damit, fragte sich Marthe verwirrt. Weiß sie etwas, was ich nicht weiß? Gibt es schlechte Nachrichten von Maman? War ihr doch etwas zugestoßen? Marthe blickte zu ihrer Großmutter, versuchte, in dem unbewegten Gesicht zu lesen – doch es gelang ihr nicht. Sie beugte sich wieder über den Teller und aß etwas von der Kaninchenkeule. Verwundert schloss sie die Augen. Das Fleisch war herrlich zart, fast buttrig, die frischen Kräuter unterstrichen den Geschmack. Estragon konnte sie herausschmecken und auch etwas Kerbel. Die jungen Möhren, die Grand-mère nur abgebürstet hatte, waren süß und voller Geschmack. Sie hatten noch nicht die herbe Holzigkeit der Lagermöhren, die den Winter in der Kiste mit dem feuchten Sand verbrachten und inzwischen aufgebraucht waren.
Marthe nahm sich von dem Brot, das immer zum Essen gereicht wurde, um auch den letzten Rest des Fleischsaftes und der Soße aufzuwischen und zu genießen.
Zu guter Letzt stellte Grand-mère das Brett mit dem Käse auf den Tisch, schnitt noch ein paar weitere Scheiben frischen Brots vom Laib, dazu reichte sie eine Schale mit Butter, die sie mit Meersalz verrührt hatte. Frischkäse stellte sie selbst her, auch etwas selbst gemachter Schnittkäse ruhte immer in der Vorratskammer. Jeden Tag wischte Großmutter den Käse mit einem Lappen, den sie in Salzwasser tränkte, ab und wendete die Stücke. Von Pierre, dem Nachbar zur Linken, bekam Grand-mère Camembert und Ziegenkäse, denn er betrieb mit seiner Frau eine kleine Käserei.
»Brot und Käse«, sagte sie und schob das Brett über den Tisch zu Marthe.
»Grand-mère …«, sagte Marthe unsicher. »Warum …?«
»Essen ist mehr als nur Nahrung. Mahlzeiten sind auch Gefühle, vergiss das nie. Du weißt jetzt, besser als noch vor zwei Jahren, woher die Nahrung kommt. Sie kommt aus dem Garten, wächst in der Erde. Man muss alles hegen und pflegen, man muss sich kümmern. Essen ist mehr, als nur satt zu werden. Ich möchte, dass du das weißt und dich immer daran erinnerst.« Sie sah ihre Enkeltochter eindringlich an. »Versprichst du mir das?«
Marthe nickte.
Nach dem Essen räumten sie den Tisch ab und spülten das Geschirr. Grand-mère schickte Marthe nach draußen, um die Kühe von der Weide zu holen, die Hühner in den Stall zu bringen. Wieder stieg Marthe auf den Hügel, aber auch diesmal konnte sie kein Fuhrwerk entdecken.
An diesem Abend ging sie früh zu Bett. Grand-mère saß noch am Küchentisch und palte die ersten Erbsen, die sie heute aus dem Garten geholt hatte.
Marthe und ihre Mutter schliefen in dem kleinen Kämmerchen unter dem Dach. Es war dort so niedrig, dass sie kaum aufrecht stehen konnte. Ihre Großmutter hatte ihr Schlafzimmer unten, neben der Küche.
Das winzige Fensterchen öffnete Marthe weit – denn im Sommer war es hier unter dem Dach heiß und stickig. Im Winter dagegen zugig und kalt.
Draußen zwitscherten sich die Vögel ihre Gute-Nacht-Rufe zu.
Wir können froh sein, hier unterzukommen, hatte ihre Mutter ihr gesagt. Am Anfang, kurz nach Papas Tod, war Marthe einfach nur entsetzt und traurig gewesen. Sie hatte alles – die Beerdigung und den Umzug hierher – wie durch Watte wahrgenommen. Sie hatte nicht wahrhaben wollen, dass ihr Leben sich so grundsätzlich geändert hatte. Das kleine Bauernhaus kannte sie schon, denn oft hatte sie die Großmutter in den Ferien besucht. Damals hatte aber auch noch Tante Cecilie hier gewohnt, und Marthe hatte keine Pflichten oder Aufgaben gehabt. Sie hatte sich immer auf die Tage bei Grand-mère gefreut und die Zeiten hier genossen.
Es ist schön hier, dachte sie nun. Aber es ist anders. Vor allem jetzt in den Sommermonaten, in denen die Schule geschlossen war. Für mich, denkt sie seufzend, ist die Schule sowieso vorbei. In der Dorfschule wurden die Kinder nur bis zur achten Klasse unterrichtet. Einige Jungs gingen danach auf die weiterführende Schule in Épinal, ganz selten wurde auch ein Mädchen geschickt. Doch die weiterführende Schule war teuer, und außerdem war sie zu weit weg.
Das ist sicher auch ein Grund, warum Maman nach Paris gefahren ist. Hier im Umland von Remiremont haben wir keine Zukunft. Wir können ja nicht ewig auf diesem kleinen Hof leben, auch wenn die Selbstversorgung in diesem Jahr besser funktioniert. Maman ist in Paris, um eine Ausbildungsstelle für mich zu finden. Und vielleicht auch eine Arbeit für sich selbst. Papa hat uns eine kleine Rente hinterlassen, außerdem gehören Maman zwei Weinberge im Süden – doch die werfen nicht viel ab, und die Rente reicht auch nicht weit, das hat Maman mir ja erklärt. Immer wieder hat Maman versucht, mit mir über die Zukunft zu sprechen, doch ich habe einfach meine Ohren verschlossen, gestand sich Marthe nun beschämt ein.
Der Gedanke an die Zukunft machte ihr Angst. Wie würde sie aussehen? Wie sollte das werden? Bis vor zwei Jahren war unser Leben einigermaßen sicher und geregelt. Wir hatten eine schöne Wohnung in Remiremont, Papa war Kurier. Er war oft unterwegs, aber dafür wurde er auch recht gut bezahlt. Das Pferd wurde ihm gestellt und manchmal sogar eine Kutsche – je nachdem, was er befördern musste. Immer hatte er spannende Geschichten mit nach Hause gebracht.
Marthe stopfte sich das Kissen zurecht, das mit den Daunen der Gänse aus der Nachbarschaft gefüllt war, und schloss die Augen. Sie konnte ihren Vater vor sich sehen, wie er in seiner schmucken Uniform lachend am Tisch saß und von all den Dingen erzählte, die er erlebt hatte. Oft hatte Marthe ihm an den Lippen gehangen, hatte jedes seiner Worte in sich aufgenommen. Manchmal hatte sie versucht, seine Geschichten aufzuschreiben. Immer aber hatten sie ihre Phantasie beflügelt. In den letzten zwei Jahren hatte sie diese Gedanken, die Phantasien und Träume nicht mehr zugelassen. Sie hatte sie in ein Kästchen gepackt und weggeschlossen.
Ich werde mich an seine Worte erinnern, beschloss Marthe nun und nickte, verschränkte die Arme vor der Brust. Ich werde mir jede seiner Erzählungen ins Gedächtnis rufen und alles aufschreiben. Sie sollen weiterleben, in mir, vielleicht auch für andere. Ich werde schreiben.
Maman hatte sie oft gefragt, was sie denn würde machen wollen, wie Marthe sich ihre Zukunft vorstellte. Doch Marthe hatte keine Vorstellung von der Zukunft gehabt. Zu groß war die Angst, dass alle Pläne, die sie machte, zerplatzen würden wie eine Seifenblase – so wie ihr sicheres und schönes Leben in Remiremont von einem Tag auf den anderen geplatzt war. Nun aber fasste sie einen Plan, ein kleiner Gedanke erst, wie ein Samenkorn, das man in die feuchte Erde legte und das Zeit brauchte, um zu wachsen. Ich möchte etwas mit Worten machen. Ich möchte etwas mit Schrift machen – schreiben. Berichte schreiben vielleicht. Ja, das möchte ich. Aber … gab es dafür einen Weg? Maman war nach Paris gefahren, um für sie beide eine Zukunft zu finden. Was für eine Zukunft hatte ein fast sechzehnjähriges Mädchen in Frankreich denn, wenn sie nicht zur höheren Schicht oder gar zum Adel gehörte? Maman würde eine Stellung für sie suchen. Eine Anstellung als Hausmädchen, als Zimmermädchen oder gar als Wäschefrau. Als Frau hatte man doch gar keine anderen Möglichkeiten, wenn man nicht in eine entsprechende Familie hineingeboren worden war. Marthe biss sich auf die Lippe. Nein, nein, so würde es nicht enden. Sie würde einen Weg finden.
Ja, Marthe Marie Josephine, das wirst du tun, versprach sie sich selbst. Du wirst deinen Weg finden und gehen. Du wirst es für Papa machen – denn das würde er von dir erwarten.
Das erste Mal seit Wochen schlief sie mit einem Lächeln auf den Lippen ein.
Kapitel 2
Als Marthe am nächsten Tag den Tisch für das Abendessen deckte, hörte sie Hufgetrappel und das Knirschen von Rädern auf der steinigen Zufahrt zum Hof. Sie hob den Kopf, hielt den Atem an. War das nur Pierre, der Nachbar, der irgendetwas brachte? Manchmal kam er vorbei. Sie schaute unsicher zu Grand-mère, die auch den Kopf gehoben hatte und sich nun die Hände am Küchentuch abwischte.
»Er… erwartest du jemanden?«, fragte Marthe und schluckte, ihre Stimme klang brüchig.
»Nein.« Grand-mère ging zur Tür, öffnete sie und schaute in den Hof. Marthe wollte ihr folgen, traute sich aber nicht. Immer, wenn Händler kamen, schickte Grand-mère sie weg.
Unsicher stellte Marthe die Teller aus Steingut auf den Tisch, legte das Besteck daneben. Ihrer Großmutter war es wichtig, dass auch Stoffservietten neben den Tellern lagen und jeder ein Glas hatte. Auch ein Krug mit frischem Wasser aus dem Brunnen war Pflicht, genauso wie einer mit dem Hauswein, den sie aus dem Fass im Keller abfüllten.
Marthe prüfte den Tisch, alles war so, wie Grand-mère es wünschte. Nun ging sie zögerlich in Richtung Tür, wo die Großmutter immer noch abwartend stand.
Die Kutsche fuhr in den Hof, hielt an. Auf dem Kutschbock saß ein Mann, der die Hand zum Gruß hob, dann öffnete sich die Tür, und Marthe konnte eine Frauengestalt erspähen, die ausstieg. Sie streckte sich.
»Maman!«, rief Marthe, drängte sich an der Großmutter vorbei und eilte in den Hof. »Maman!«
Die beiden umarmten sich herzlich, drückten sich fest.
Endlich, dachte Marthe, endlich. Endlich ist Maman wieder da. Sie fühlte sich an wie immer, vielleicht ein wenig knochiger und steifer, aber sie roch ganz anders, ganz unvertraut. Julie rückte ein Stück von ihrer Tochter ab, musterte sie.
»Es ist schön, wieder bei dir zu sein«, sagte sie leise.
Der Mann auf dem Kutschbock räusperte sich, und Julie drehte sich schnell zu ihm um, nahm eine Münze aus ihrer Tasche und reichte sie ihm. Dann holte sie das kleine Köfferchen aus der Kutsche und ging zum Haus.
Grand-mère stand immer noch in der Tür, sie hatte weder etwas gesagt noch sich gerührt. Jetzt nickte sie ihrer Schwiegertochter zu und trat zur Seite, ließ sie ins Haus.
»Mach dich in Ruhe frisch«, sagte sie nun. »Wir werden mit dem Essen warten.«
»Ist gut«, sagte Julie.
In der Waschküche war auch die Zinkwanne, und dort gab es einen Pumpschlegel, der Brunnenwasser führte. Einmal in der Woche wurde im großen Waschkessel Wasser für die Wanne erhitzt, und alle badeten nacheinander. Im Winter gab es jeden Abend einen Krug mit warmem Waschwasser, im Sommer wuschen sie sich kalt.
Grand-mère zögerte einen Moment, doch dann ging sie mit festem Schritt in die Waschküche und setzte Wasser auf. »Nach so einer langen Reise willst du vielleicht ein schnelles Bad nehmen und dir den Reisestaub abwaschen.«
»Danke«, sagte Julie verblüfft. »Das wäre wirklich schön.«
»Bring den Koffer deiner Mutter nach oben«, wies Grand-mère Marthe an. Sie selbst ging zum Herd, zog den Topf mit der Suppe vom Feuer. Dann nahm sie Speck aus dem Vorratsschrank und würfelte ein paar Zwiebeln.
Marthe hatte den Koffer nach oben gebracht und stand nun unsicher in der Küche. »Kann ich helfen?«
»Geh in den Garten und hole etwas Salat. Nein – lass mich das tun. Du kannst die Zwiebeln würfeln. Aber schneide wirklich feine Würfel.«
»Ich kann auch in den Garten gehen …«
»Pfff«, machte Grand-mère nur und eilte an ihr vorbei nach draußen.
Sie traut mir gar nichts zu, dachte Marthe und spürte die Wut in ihrem Bauch. Warum nicht? Ich gebe mir doch so viel Mühe, höre immer auf das, was sie sagt. Ja, ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen, und nein, ich weiß oft nicht, warum man dies tut und jenes nicht, aber sie könnte es mir doch erklären.
Missmutig krempelte sie die Ärmel ihres Kleides hoch und nahm das Messer. Bei Maman und Grand-mère sah es immer so leicht aus. Sie nahmen das Gemüse – Zwiebeln, Karotten oder was auch immer zu schneiden war –, legten es auf das große Brett, nahmen das Messer und schnitten mit schnellen Bewegungen, fast fließend sah es aus. Das würde sie sicher auch hinbekommen. Doch das Messer, das Grand-mère immer benutzte, war lang und scharf. Es wurde regelmäßig gewetzt und eingeölt. Eigentlich durfte niemand außer ihr das Messer benutzen. Maman hatte ihre eigenen Messer, die sie in einer besonderen Tasche verstaut hatte. Die Tasche lag normalerweise oben unter ihrem Bett und sie hütete sie wie einen Schatz. Hatte sie die Tasche mit nach Paris genommen?, fragte sich Marthe nun und nahm das große und schwere Messer in die rechte Hand, die Zwiebel hielt sie mit der linken. Mit einem forschen Schnitt halbierte sie die Zwiebel, so wie sie es bei Grand-mère beobachtet hatte. Dann legte sie die Hälften auf das Brett. Grand-mère schnitt die Zwiebel immer mit dem Messer von oben ein – in dünne Streifen. Aber sie machte es so, dass die Streifen nicht auseinander fielen. Dann schnitt sie zweimal waagerecht und schließlich senkrecht, und somit entstanden die Würfel. Das ist nicht schwer, dachte Marthe.
Sie setzte das Messer an, wollte schnell und zügig schneiden, aber die Schneide rutschte von der glitschigen, frischen Zwiebelhaut ab.
Ich mache es langsam, sagte sich Marthe. Lieber langsam und sorgfältig als schnell und grob. Grand-mère soll keinen Grund haben, mich zu schimpfen. Wieder nahm sie das Messer, setzte erneut an und schnitt beherzt zu. Anders als bei Grand-mère blieben die Streifen nicht in Form, sondern fielen auseinander. Dünn waren sie auch nicht. Marthe biss sich auf die Lippe und runzelte verzweifelt die Stirn.
»Was machst du da?«, fragte Julie, die aus der Waschküche kam, frisch duftend und noch mit feuchtem Haar. Sie lächelte ihre Tochter an.
»Ich soll die Zwiebeln würfeln. Fein würfeln. Aber … es gelingt mir nicht.« Marthe wischte sich mit der Rückseite ihrer Hand über die Augen. Es waren ganz sicher die Zwiebeln, die sie zum Weinen brachten.
»Schau, du hast die Zwiebel falsch geteilt. Siehst du das hier?« Julie nahm eine neue Zwiebel, schälte mit einer schnellen und sicheren Bewegung die äußere Schale ab. »Hier ist die Wurzel, und auf der anderen Seite wächst der Stiel. Du muss sie durch beides hinweg teilen und nicht in der dicken Mitte.«
»Ach?«
»Ja.« Julie lächelte. »Und dann legst du die Hälfte so hin und schneidest von der Mitte bis zur Wurzel – aber nicht ganz. Ein ganz kleines Stück lässt du stehen. So hält es zusammen, siehst du?« Sie zeigte es langsam und sorgfältig. »Und jetzt du.«
Marthe nahm die andere Hälfte des Gemüses, versuchte, genauso zu schneiden, wie es ihr ihre Mutter gezeigt hatte. Es gelang ihr fast.
»Das hast du schon ganz gut gemacht. Für das erste Mal war es sogar sehr gut.« Julie nahm das Messer. »Und jetzt schneidest du waagerecht hindurch – einmal, das reicht schon. Siehst du – so geht das.«
Wieder folgte Marthe dem Beispiel ihrer Mutter.
»Du darfst auch jetzt nicht bis ganz zum Ende schneiden. So hält das Wurzelstück alles noch zusammen.«
»Ich verstehe«, murmelte Marthe.
»Und nun kannst du die Würfel schneiden – von oben, so fein und so dünn wie möglich. Schau, es ist eigentlich ganz einfach.«
»Wenn du es machst, sieht es so leicht aus.« Marthe biss sich wieder auf die Lippe und versuchte, sich zu konzentrieren. Ihre Würfelchen waren gröber als die der Mutter, aber es sah schon ganz anders aus als beim ersten missglückten Versuch.
»Das ist die Übung«, sagte Julie. »Ich werde hochgehen und meine Haare richten. Kommst du nun allein zurecht?«
»Ja, ich glaube schon.« Marthe schob die Zunge zwischen ihre Zähne, nahm die nächste Zwiebel und zog die Haut ab. Dann schnitt sie sie so, wie es Maman ihr gezeigt hatte. Sie machte es langsam und sorgfältig. Wieder wurden ihre Würfel nicht so fein wie die von Maman oder Grand-mère, aber weitaus besser als das, was sie am Anfang zustande gebracht hatte.
Als sie die vierte Zwiebel geschnitten hatte, kam Grand-mère zurück in die Küche. In ihrem Korb lagen Salatblätter, eine kleine rote Bete und Kräuter. Kritisch betrachtete sie die Zwiebelwürfel auf dem Brett, kniff kurz die Augen zusammen. »Du lernst schnell. Die Letzten sind gar nicht so schlecht.«
So viel Lob hatte Marthe selten von Grand-mère bekommen, und das Blut stieg in ihre Wangen. »Danke.«
»Sie sind aber weit entfernt von perfekt. Und glaub bloß nicht, dass ich nicht sehe, dass deine Mutter es dir gezeigt hat.«
Marthe hielt die Luft an. Würde nun ein Tadel kommen? Aber Grand-mère nickte nur. »Die Reste, deine erste Zwiebel und all die Wurzelstücke kannst du in den großen Suppentopf tun.«
»Nicht in die Schale für die Hühner oder das Schwein?«, fragte Marthe.
»Natürlich nicht. Das sind frische Zwiebeln.« Grand-mère wusch die Salatblätter an der Pumpe in der Waschküche, kehrte dann zurück an den Küchentisch.
»Ich dachte, die Tiere bekommen alle Abfälle«, sagte Marthe.
»Aber die Zwiebelreste sind keine Abfälle. Das ist doch gutes Gemüse.«
»Die Schalen bekommen sie aber?«
»Nein, natürlich nicht. Auch die kommen in die Suppe. Sie geben Geschmack und Farbe.«
»Aber … aber manchmal gibst du doch die Schalen in das Tierfutter.« Marthe rieb sich über das Kinn.
»In das Tierfutter kommen alle alten und harten Schalen, alles, was schon runzelig und vielleicht auch schon ein wenig schimmelig ist«, sagte Julie, die nun die Treppe herunterkam. »Diese Zwiebeln sind frisch, höchstens drei Wochen alt. Frische Schalen und Reste – von Zwiebeln, Karotten und anderem Gemüse – sollte man auskochen. Manchmal haben sie mehr Geschmack als die Frucht selbst.«
Grand-mère nickte kaum sichtlich.
»Im Winter haben wir aber …«
»Im Winter brauchen die Hühner zusätzliches Futter – sie finden draußen kaum etwas. Und wenn es schneit, können sie gar nicht nach draußen. Deshalb füttern wir im Winter mehr zu«, erklärte Julie.
»Was glaubst du denn, warum wir im Winter kein Schwein haben? Wir könnten es gar nicht über die kalten Monate bringen«, brummte Grand-mère. Sie schob den Laib Brot zu Julie, das Messer hinterher. Dann ging sie zum Herd, auf dem schon eine Eisenpfanne stand, und ließ Speck aus, gab die Zwiebelwürfel hinzu. Der würzige Duft erfüllte die niedrige Küche, schien alles einzuhüllen. Grand-mère stellte eine zweite Pfanne auf, ließ etwas von dem flüssigen Fett hinein, nahm die Brotscheiben, die Julie inzwischen abgeschnitten hatte, und briet sie in dem Fett aus. »Du hast den Tisch noch nicht fertig gedeckt«, ermahnte sie dann Marthe.
Eilig deckte Marthe den Tisch, während die beiden Frauen – Mutter und Großmutter – stillschweigend, aber Hand in Hand das Essen zubereiteten. Es war wie ein Tanz, stellte Marthe fest. Wie ein gut einstudierter Tanz. Niemand brauchte eine Anweisung, ein Blick, ein Heben des Kinns, eine Handbewegung schien ihnen als Kommunikation zu reichen. Das war schon immer so gewesen, wurde Marthe nun klar, sie hatte es nur noch nie so deutlich wahrgenommen wie heute.
Der Duft in der Küche wurde intensiver, nahm Körper an. Die Aromen schienen Fangen miteinander zu spielen, vermischten sich, stoben wieder auseinander. Die Schärfe der frischen Zwiebeln vermischte sich mit der Schärfe des Knoblauchs und dem Hauch des Piment d’Espelette, den Grand-mère über die Pfanne stäubte. Sie nahm die angerösteten Brotscheiben aus der Pfanne, legte kleine Stücke des Ziegenkäses hinein, den sie vom Nachbarn bezog. Dann beträufelte sie den Käse mit etwas Honig und ein paar getrockneten Lavendelblüten, mahlte Pfeffer darüber und schwenkte die Pfanne sacht. Julie hatte die frische, noch zarte Bete geschält und in feine Scheiben geschnitten, richtete sie kreisförmig auf einem Teller an und gab etwas Olivenöl darüber, salzte mit dem Sel gris vom Atlantik, das in einem großen, irdenen Topf aufbewahrt wurde. Es schmeckte anders, würziger und jodiger als das Steinsalz, das in den Bergen gewonnen wurde und das Grand-mère nur zum Kochen, aber nicht zum Würzen nahm.
Ihre Großmutter schüttelte die jungen Salatblätter trocken und legte sie zu den Betescheiben.
»Warum durfte ich keinen Salat holen?«, fragte Marthe.
»Welchen Salat hättest du denn genommen?«, fragte Grand-mère zurück.
»Nun … den, den du auch da hast.«
»Wirklich?« Grand-mère zog die Augenbrauen hoch.
»Es ist doch nur Salat. Den hätte ich doch auch aus der Erde ziehen können.« Marthe runzelte die Stirn. Warum traute ihr Großmutter nichts zu? Schließlich war dies schon der zweite Sommer hier, und sie war ja nicht dumm.
»Ich habe aber nichts aus der Erde gezogen, Kind. Ich habe einzelne Blätter gepflückt – vorsichtig habe ich sie abgeknipst, um die Pflanze nicht zu verletzen. Wenn man sie rauszieht, dann … kann sie ja nicht mehr wachsen. Wenn man aber nur hier und da ein äußeres Blatt nimmt, bleibt die Pflanze am Leben und wächst weiter.«
»Aber im letzten Jahr haben wir doch die Salatköpfe mit den Wurzeln aus der Erde gezogen.«
»Ja, das war, kurz bevor sie geschossen sind, bevor sie geblüht haben. Blühender Salat wird bitter, den kann man nur noch kochen, aber nicht mehr roh essen, das schmeckt nicht.«
»Das wusste ich nicht«, sagte Marthe verblüfft.
»Du bist ja auch ein Stadtmädchen«, murmelte Grand-mère, und es klang nicht freundlich.
Marthe zog verletzt die Schultern hoch.
Ihre Großmutter beachtete sie jedoch nicht, sie rührte im großen Topf, schmeckte ab. Dann nickte sie Julie zu.
»Händewaschen«, sagte Julie.
»Ich habe mir doch vorhin schon die Hände gewaschen.«
»Dann machst du es jetzt noch einmal. Vor dem Essen waschen wir uns die Hände.«
Marthe ging grummelnd in die Waschküche, schwenkte die Pumpe und wusch sich die Hände. Sie sah Grand-mère über den Hof zu dem kleinen Erdkeller gehen, der in den Hügel eingegraben war. Was mochte sie jetzt noch aus dem holen, fragte sie sich verwundert. Dort wurden im Winter Eisschollen eingelagert, die dick mit Stroh gepolstert wurde, damit sie den Sommer überstanden und sie immer frisches Eis hatten. Dort wurden auch die Milch und andere Sachen aufbewahrt, die kühl stehen mussten. Grand-mère kam mit einer Schüssel zurück, aber Marthe konnte nicht erkennen, was darin war. Schnell ging sie zurück in die Wohnküche. Sie wollte sich neben den Herd stellen und ihrer Grußmutter zusehen, aber Maman wies Marthe mit einem Blick an, am Tisch Platz zu nehmen.
Julie stellte den Teller mit den gerösteten Brotscheiben und die Schüssel mit dem Salat auf den Tisch. Dazu kam ein Schüsselchen mit gesalzener Butter und ein weiteres mit der süßen Butter vom Morgen.
Grand-mère stellte die Pfanne, die sie kurz ausgewischt hatte, wieder auf und gab etwas Speck hinein. Es zischte, und der würzige Duft füllte die Küche. Sie zog die Pfanne ein wenig vom Feuer, stellte sie an den Rand des gusseisernen Ofens, so dass sie nur noch mäßige Hitze abbekam, und legte das hinein, das sie aus dem Erdkeller geholt hatte. Marthe wusste immer noch nicht, was es war, doch dann erkannte sie den Geruch von Fleisch. Es war doch gar nicht Sonntag – was gab es dann zu feiern?
Nun wusch sich Großmutter schnell die Hände, nahm den Krug mit dem Landwein und schenkte ihnen allen ein Glas ein, bevor sie sich an den Tisch setzte.
»Auf deine Rückkehr, Julie«, sagte sie und hob ihr Glas.
Marthe und Julie hoben ebenfalls ihre Gläser, und Marthe wurde es ganz warm und wohlig. Endlich war Maman wieder da. Sie trank einen kleinen Schluck, der Wein füllte angenehm ihren Magen.
Julie gab jedem eine Scheibe Brot und etwas Salat mit dem Ziegenkäse auf den Teller.
»Bon appétit.«
Sie aßen schweigend. Danach holte Grand-mère die Suppe – sie hatte etwas Brühe aus dem großen Suppentopf abgeseiht und geklärt. Nun gab sie ein paar frische Kräuter hinzu und servierte die warme Vorspeise.
»Köstlich«, sagte Julie.
Grand-mère brummte nur. Schließlich trug sie den Hauptgang auf.
»Jean-Paul hat Lammböckchen geschlachtet, und ich habe ihm etwas von dem Fleisch abgekauft«, erklärte sie. Zu dem kurz gebratenen Lamm gab es Rübchen, die Grand-mère aus dem großen Suppentopf fischte, und eine köstliche, aromatische Soße.
»Wo hast du die Soße her?«, fragte Marthe verblüfft.
»Das ist eine ganz normale Soße«, sagte Grand-mère. »Wo soll ich sie schon herhaben? Ich habe sie gekocht.«
»Grand-mère hat sie aus der Brühe gezogen. Hast du das nicht gesehen?«, erklärte Julie nun. »Sie hat doch Brühe abgeseiht. Dann hat sie fein gewürfelten Speck und Zwiebeln angebraten, mit Rotwein abgelöscht und mit der sehr reduzierten Brühe aufgefüllt. Dazu kommt zum Schluss der Bratensaft und das Ganze wird mit etwas Mehl abgebunden.«
»Einfach so? Nebenbei?«
»Manchmal«, grummelte Grand-mère, »glaube ich, dass du deiner Tochter gar nichts beigebracht hast. Und hier hat sie auch nicht viel dazugelernt.« Sie nahm eine weitere Brotscheibe und wischte den letzten Rest Soße vom Teller. »Wie man eine Soße zieht, weiß man doch. In deinem Alter, Marthe, konnten deine Mutter und ich schon ganze Menüs selbstständig zubereiten und servieren. «
Marthe biss sich verärgert auf die Lippen. »Du lässt mich oder Maman ja kaum in die Nähe vom Herd. Und du erklärst auch kaum etwas. Wie soll ich denn dann etwas lernen?«
»Ja, Grand-mère«, sagte Julie. »Aber die Zeiten waren anders. Bist du länger als vier Jahre zur Schule gegangen? Nein, und ich auch nicht. Du und ich, wir sind auf Höfen aufgewachsen, Marthe aber in der Stadt, und sie ist zur Schule gegangen. Das ist ein ganz anderes Leben.«
»Hmm.« brummte Grand-mère. »Räum den Tisch ab, Marthe«, sagte sie dann. »Und spül das Geschirr. Deine Mutter und ich müssen reden.«
»Marthe sollte dabei sein«, sagte Julie. Ihre Stimme war leiser geworden, und es schien Marthe so, als sei sie in sich zusammen gesunken.
Grand-mère runzelte die Stirn, nickte dann aber kaum merklich. Schnell räumten sie gemeinsam den Tisch ab, stapelten das Geschirr in der Spüle in der Waschküche. Grand-mère ließ ein wenig Wasser darüber laufen. Dann stellte sie das Käsebrett auf den Tisch, schenkte sich und Julie noch etwas Wein ein, Marthe musste mit Wasser vorliebnehmen.
»Warst du bei Alphonse?«, fragte sie dann.
Julie nickte. »Er hat mir einen Brief an dich mitgegeben. Ihm, Claire und den Kindern geht es gut. Das Geschäft läuft.« Julie nippte nachdenklich an ihrem Glas.
»Und?« Grand-mères Stimme klang nicht freundlich.
Marthe saß angespannt auf ihrem Platz. Würde sie nun erfahren, was die Zukunft bringen würde?
»Es ist alles nicht so einfach. Alphonse könnte mir eine Arbeit vermitteln, aber bei ihnen wohnen kann ich nicht. Wohnraum in Paris ist sowieso sehr knapp und teuer.«
»Wohnen? Du willst doch nicht wirklich nach Paris ziehen?«, fragte Marthe nun erschrocken.
»Still, Kind«, brummte die Großmutter. »Alphonse ist Josephs Cousin, mein Neffe. Er und seine Familie werden doch wohl für dich und Marthe etwas zusammenrücken können. Wir sind doch Familie. Und welche Arbeit hätte er für dich?«
»Die Wohnung ist schon sehr eng, Grand-mère«, sagte Julie und runzelte die Stirn, räusperte sich. »Ich könnte Zimmermädchen in einer Pension werden. Dort müsste ich die Zimmer putzen und die Betten machen. Wie die Wohnungen sind auch Arbeitsstellen nicht so einfach zu bekommen.«
»Zimmermädchen? Du?« Grand-mère schnalzte mit der Zunge. »Warum so eine Stellung? Warum kannst du nicht in der Küche arbeiten? Du bist Köchin.«
»In den Restaurants und Hotels gibt es keine Köchinnen, es gibt sogar kaum Küchenmädchen. Das ist dort eine Männerdomäne.«
Grand-mère verzog das Gesicht. »So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Du hast doch lange auf dem großen Weingut der Familie d’Harcourt als Köchin gearbeitet – bis zu deiner Eheschließung mit meinem Sohn. Warum solltest du jetzt nicht mehr als Köchin arbeiten können?«
»Die Zeiten haben sich geändert«, sagte Julie seufzend. »Und in Paris gibt es keine Weingüter.«
»Aber es wird genügend Familien geben, die eine gute Köchin suchen.« Grand-mère verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich habe mich erkundigt.« Julies Stimme war ganz dünn geworden. »Fast alle Haushalte suchen Köche – keine Köchin.«
»Ach so. Du hast dich also erkundigt? Hast du dich auch beworben? Es reicht doch, wenn du ihnen etwas servierst. Jeder Gourmet wird dich mit Kusshand aufnehmen.«
Julie senkte den Kopf. »Ich weiß nicht … ich glaube, eine Frau hat dort in der Stadt keinen Platz in großen Haushalten – außer als untergeordnete Kraft.«
Grand-mère richtete sich auf und funkelte ihre Schwiegertochter wütend an. »Nun sag mir, warum du nach Paris gehen willst? Warum?«
»Wegen Marthe, das weißt du doch.«
»Genau. Mon Dieu, ich hätte doch ein wenig mehr Rückgrat von dir erwartet. Du solltest doch mehr für dich einstehen. Mein Sohn hätte ganz sicher kein Mäuschen geehelicht.«
Julie schwieg. Dann sah sie Grand-mère an. »Darüber werde ich nachdenken.«
»Aber warum willst du denn überhaupt nach Paris ziehen?«, fragte Marthe ganz aufgebracht. »Wir können doch auch hier bleiben. Was habe ich damit zu tun?«
»Alles«, sagte Grand-mère. »Du sollst nicht so werden, wie deine Mutter es gerade ist – ängstlich und unsicher. Du sollst eine bessere Chance im Leben haben.«
»Ich bin nicht ängstlich«, sagte Marthe trotzig. »Und ich muss nicht nach Paris gehen. Was soll ich denn dort überhaupt?«
»Zur Schule gehen«, sagte Julie nun. »Du sollst zur Schule gehen und auch studieren, wenn du es möchtest. Hier auf dem Land bekommst du nicht die richtige Ausbildung. Deshalb will ich mit dir nach Paris.«
»Studieren?« Marthe sah ihre Mutter mit großen Augen an. »Ja, was soll ich denn studieren?«
»Das, was du möchtest. Das, was deinem Leben einen Sinn gibt.«
»Aber … aber was, wenn ich heirate? Hat nicht Papa deinem Leben einen Sinn gegeben, Maman? Hättest du weiter zur Schule gehen wollen?«
»O ja, mein Kind, das hätte ich. Nur damals war es nicht möglich. Und ja, Papa hat meinem Leben einen Sinn gegeben – so wie du auch. Und deine Geschwister, wenn sie denn überlebt hätten.« Julie schluckte. »Aber sie sind gestorben – genau wie dein Vater. Und nun stehe ich da und habe nichts – keine Arbeit, keine Ausbildung, kaum Einkommen.«
»Du bekommst ja etwas Geld«, sagte Grand-mère. »Und ich habe auch ein wenig zurückgelegt. Das sollte für den Anfang für euch reichen. Und dann suchst du dir eine Stellung als Köchin. Denn das ist, was du kannst, sehr gut sogar.« Sie setzte eine strenge Miene auf.
Julie sah sie verblüfft an. »Sagst du das, weil du es so meinst, oder willst du mich loswerden?«
»Es gäbe sehr viel einfachere und bessere Methoden, um dich aus dem Haus zu treiben«, entgegnete Grand-mère sachlich. »Das ist nicht meine Intention. Ich möchte, dass ihr – du und Marthe – eine bessere Zukunft habt. Schau mich doch an – ich werde hier bis zu meinem Tod leben. Ich werde die Kühe melken, das Schwein füttern. Im Herbst werde ich Würste aus dem Schwein drehen und Schinken in den Rauch hängen. Im Winter hocke ich mich vor dem Kamin und lausche den Stürmen, die über die Vogesen ziehen. Das ist kein schlechtes Leben, so haben wir seit Jahrhunderten gelebt. Aber heute gibt es andere Möglichkeiten. Möglichkeiten für Frauen – die gab es früher nicht.« Sie schnaufte, trank einen großen Schluck Wein, schenkte sich nach. Der Krug war leer. Grand-mère hielt ihn Marthe hin. Sie stand auf, eilte in den Keller und füllte einen weiteren Krug ab.
»Bring den Pastis mit«, rief Julie ihr hinterher.
Der Pastis wurde nur selten hervorgeholt, aber Marthe wusste genau, wo die Steingutflaschen standen. Dennoch zögerte sie, bevor sie eine der Flaschen in die Hand nahm und mit nach oben trug.
Grand-mère war hart, manchmal sogar fast gehässig, aber sie war im Grunde nie böse. Doch es gab etwas zwischen Grand-mère und Maman, wie einen unausgesprochenen Streit, den Marthe nicht wirklich fassen, nicht wirklich verstehen konnte. Glut, die in der fast schon ausgekühlten Asche schwelte, aus der aber immer mal wieder kleine Flammen, angefacht durch etwas Luft und heiße Worte, nach oben schlugen. Wollte Grand-mère, dass sie weggingen? Waren sie ihr lästig? Das Gefühl fraß sich in ihre Gedanken, wie eine Zecke, die sie sich unvorsichtig eingefangen hatte. Sie bohrte sich in die Haut und sog sich voll, sog an den Gefühlen.
Schnell eilte sie wieder nach oben, sie wollte auf keinen Fall etwas von dem Gespräch verpassen. Aber womöglich hatte es nun schon den entscheidenden Wortwechsel gegeben, und Marthe würde nie erfahren, warum die beiden manchmal so spinnefeind miteinander waren.
Sie stellte die Flasche und den Krug auf den Tisch, ging in die Küche und holte zwei von den niedrigen und breiten Gläser aus dem dicken Glas, aus denen Grand-mère ihren Pastis trank.
Großmutter nickte anerkennend, schenkte sich und Julie ein.
»Liberté, Égalité, Fraternité – so heißt es doch. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und was ist mit uns? Mit uns Schwestern? Wir bleiben außen vor.« Grand-mère schnaufte, trank den Pastis, schenkte sich erneut ein. »In der Ersten Republik sah das noch anders aus, in der Zweiten unter Bonaparte wurden uns wieder Rechte genommen – Pflichten nie, Pflichten durften wir behalten. Und jetzt?«, sagte sie und sah Julie an. »Wie sieht es in der Dritten Republik aus?«
»Frauen haben ein Recht auf Bildung«, sagte Julie leise. »Sie dürfen zur Schule, in Frankreich dürfen Frauen auch studieren.«
»Ja, das dürfen sie. Aber dürfen sie wählen? Nein, das dürfen sie nicht. Haben sie Mitsprache in der Politik, in der Gesellschaft?« Grand-mère schüttelte den Kopf. »Und deshalb müssen Frauen sich bilden. Aus Fraternité muss Humanité werden.« Sie sah Marthe an. »Du, du musst dich dafür einsetzen. Du musst dich stark machen dafür, dass Frauen sich wirklich bilden können und die gleichen Rechte wie die Männer erhalten. Schau dir deine Mutter an.«
Marthe blickte verwundert zu Julie.
Grand-mère lachte leise und bitter auf. »Deine Mutter hat gelernt, sie hat die harte Lehre vom Küchenmädchen zur Köchin vollzogen. In einer großen Küche, auf einem großen Gut. Und sie kann so gut kochen wie jeder einzelne Koch in diesem Land. Aber sie traut sich nicht, sich um eine Stelle zu bewerben, weil sie eine Frau ist.«
»Natürlich traue ich mich«, sagte Julie nun und trank ihren Pastis aus, stellte das Glas hart auf den Tisch. »Doch, das traue ich mich. Nur … meine Chancen sind gering.«
»Du traust dich? Wirklich? Beweise es mir.« Grand-mère stand auf, sie schwankte leicht. »Zeig es mir. Dann glaube ich dir.« Sie drehte sich um, sah Julie an, schwieg für einen Moment. »Nein, ich will dich nicht rausschmeißen. Ich habe erst gehadert damit, euch hier aufzunehmen – aber wo solltet ihr hin? Und jetzt? Jetzt schmerzt mich der Gedanke, dass ihr gehen werdet. Aber ihr müsst, um Marthes willen müsst ihr gehen.« Sie holte tief Luft, ging dann mit kleinen, langsamen Schritten zu ihrer Kammer und schloss die Tür hinter sich.
Julie blieb noch einen Moment nachdenklich sitzen, dann stand sie auf und räumte das restliche Geschirr ab, schürte den Herd.
»Ich will nicht nach Paris«, sagte Marthe und merkte, wie zugeschnürt sich ihr Magen anfühlte. »Ich will hierbleiben. Gerade habe ich mich eingelebt.«
Julie drehte sich um, musterte sie nachdenklich. »Wir können jederzeit hierher zurückkommen. Das wird auch immer unser Zuhause bleiben. Aber Grand-mère hat recht – welche Zukunft hast du hier? Keine.«
»Ich … ich könnte in Remiremont eine Ausbildung machen.«
»Als?«
Marthe zuckte mit den Schultern. »Das ist doch egal.« Tränen stiegen ihr in die Augen. »Ich will bloß nicht weg. Ich will hierbleiben.«
Julie trat zu ihr und nahm sie in die Arm, drückte sie an sich. »Mon Cœur, meine Süße, gräm dich nicht. Sch, sch«, sagte sie. »Du willst nicht hierbleiben, aber das weißt du noch nicht«, flüsterte sie. »Mir macht es auch Angst, in die große Stadt zu gehen. Ich verstehe dich.«
»Wenn es dir auch Angst macht, dann lassen wir es einfach«, flehte Marthe. »Wir können ja nach Épinal gehen, dort kann ich auch zur Schule, und es wird andere Möglichkeiten für uns geben.«
Julie schüttelte den Kopf. »Das könnten wir vielleicht machen – aber … aber Grand-mère hat schon recht. Wir müssen jetzt in die große Stadt gehen, uns dort dem Leben anpassen, sonst wird es uns immer und immer fremd bleiben. Je später wir diesen Schritt tun, je älter wir sind, um so schwerer wird es uns fallen. Paris ist wie ein … ein Lebewesen. Es wächst und verändert sich – stetig. Und wir müssen versuchen, uns anzupassen und mitzuhalten.«
»Ich will das nicht«, flüsterte Marthe.
Julie drückte sie noch enger an sich. »Ich weiß. Jetzt spülen wir erst einmal das Geschirr.«
Sie wuschen die Teller und Schüsseln ab, schrubbten die Töpfe. Julie räumte die Lebensmittel in den Keller, wo es kühl war. Dann füllte sie den Wasserkessel wieder auf und legte etwas Holzkohle nach, so dass der Ofen über Nacht nicht ausgehen würde. Marthe nahm die Laterne und ging zum Stall. Einer von ihnen musste abends noch einmal alles kontrollieren und sicherstellen, dass keins der Hühner im Hof geblieben war, alle Tiere genügend Wasser hatten und die Türen verschlossen waren. In den Wäldern lauerte nicht nur der Fuchs, um nachts Beute zu machen. Marthe war ganz aufgewühlt, und viele Gedanken, die sie nicht einordnen konnte, schossen ihr durch den Kopf. Wirklich glücklich war sie auf dem Hof nie gewesen, aber einigermaßen zufrieden. Der Gedanken, von hier weg und in die große Stadt zu ziehen, verstörte sie. Es war mehr als nur die Angst vor dem Ungewissen.
Vielleicht, dachte sie und klammerte sich an das kleine Fünkchen Hoffnung, überlegt es sich Maman noch. Sie möchte ja auch nicht wirklich in die große Stadt. Vielleicht können wir in Remiremont oder in Épinal eine Zukunft finden. Ja, das wäre sicher der bessere Weg.
Sie rüttelte vorsichtig an der Stalltür, um sicherzugehen, dass die Tür wirklich zu war. Dann ging sie zurück zum Haus. Aus der Stube fiel eine warme Lichtpfütze in den Hof, es sah so anheimelnd aus. Bisher war es nur ein niedriges, altes Haus für sie gewesen, doch nun schien ihr der kleine Hof, der sich am Hügel duckte, wie eine sichere Höhle und Zuflucht zu sein.
Julie wischte den Tisch ab, als Marthe hineinkam. »Geh schon hoch und mache dich bettfertig«, sagte sie. »Ich lösche noch die Lichter.«
Als Marthe im Bett lag und durch das kleine Fenster nach draußen zum Sternenhimmel schaute, spürte sie, wie erschöpft sie war. Es fühlte sich an, als hätte sie den ganzen Tag auf dem Acker gearbeitet und Kartoffeln aus dem lehmigen Boden gezogen. Doch es waren die Worte, die Gespräche gewesen und keine körperlichen Tätigkeiten, die sie so ermüdet hatten. Sie schloss die Augen, aber fand keine Ruhe.
Leise öffnete Julie die Tür, schlüpfte in ihr Bett, das auf der anderen Seite der Kammer stand und drehte die Lampe aus.
»Maman?«, flüsterte Marthe in die Dunkelheit.
»Ich dachte du schläfst schon, mon Cœur.«
»Ich glaube, ich kann nicht schlafen.« Marthe holte Luft. »Wolltest du immer Köchin werden?«
»Oh.« Julie klang überrascht. »Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Es hat sich einfach so ergeben. Ich hatte keine Wahl damals und war froh, dass ich als Küchenmädchen genommen wurde.«
»Wie alt warst du?«
»Ich war elf oder gerade zwölf«, antwortete Julie nachdenklich. »Meine ältere Schwester hatte den Hof schon verlassen, weil … nun, die Ernten waren schlecht gewesen, und der Hof warf nicht mehr genug für uns alle ab. Mein Bruder konnte besser bei der Feldarbeit helfen als ich, also war mir bewusst, dass ich gehen musste.«
»War das nicht schrecklich für dich?« Marthes Stimme zitterte. »Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wegzugehen … ohne dich. Und du warst ja noch viel jünger, als ich es bin.«
Julie zögerte. »Es ist ja schon eine Weile her – ich kann mich daran gar nicht mehr so genau erinnern. Aber nein – wirklich schrecklich fand ich es nicht. Ich wusste, dass es sein musste. Es war nicht ungewöhnlich damals und wie gesagt – meine Schwester war ja auch schon vom Hof gegangen.«
»Aber – hast du deine Eltern nicht vermisst? Hattest du nicht ganz furchtbares Heimweh?« Marthe erinnerte sich an die ersten Monate, nachdem sie hierher gezogen waren. Sie hatte ganz starkes Heimweh nach ihrer Wohnung in Remiremont gehabt, nach ihrem alten Zuhause.
»Das hatte ich bestimmt. Aber ich kann mich auch daran nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich in der ersten Zeit immer sehr müde und erschöpft war. Zwar musste ich auch zu Hause auf dem Hof meiner Eltern immer mithelfen, aber die Arbeit in der großen Küche auf dem Gut war doch um einiges anstrengender.«
»Hmm.« Marthe schaute durch das dunkle Zimmer zum Bett der Mutter. Sie konnte sie nur schemenhaft erkennen. »Was war so anstrengend?«