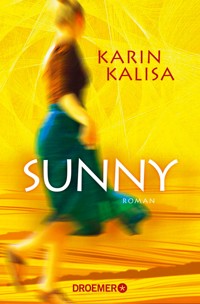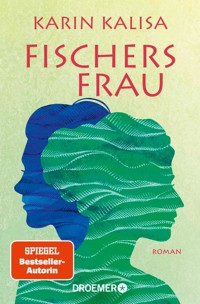15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Poetisch und pointiert: Mit diesen Kurzgeschichten für Erwachsene schenkt uns Bestseller-Autorin Karin Kalisa 18 gute Gründe, die Nacht zu mögen. Was hat die Nachtwache im alten Babylon mit dem Dornröschenschlaf einer jungen Frau in Japan zu tun? Das und vieles mehr verrät Karin Kalisa in 18 Streifzügen durch die andere Seite des Tages – von Jule Vernes »Reise zum Mond« über den nachtaktiven japanischen Lurch bis zu den internationalen Nachtzugverbindungen. Unterhaltsam, klug und auf unausgetretenen Pfaden durchschreiten wir das Firmament polaren Lichtspiels, schauen mit Plutarch durchs Fernrohr – und horchen dabei auf die Resonanzen des Nächtlichen in uns selbst. Am Ende wissen wir: Ja, es gibt 18 gute Gründe, die Nacht zu mögen, obwohl sie manchmal dunkler ist als nötig; und zuweilen auch länger. Aber dafür gibt es ja dieses Buch. Karin Kalisas Magst du die Nacht ist die Suche nach Antworten auf eine Frage, die sich allen stellt, die nicht jede Nacht durschlafen. Entstanden sind 18 vielschichtige Kurzgeschichten aus nächtlicher Welten mit überraschenden Perspektiven und erstaunlichen Verknüpfungen. Wer sich für pointierte Kurzgeschichten und Erzählungen begeistert, wird Magst du die Nacht lieben. »Wie Karin Kalisa sanft und doch realistisch von den großen Chancen erzählt, die in unserer Gesellschaft als Schätze vorhanden sind, ganz ohne Kitsch und Süße, das ist ihre große Kunst. Ein starkes, Hoffnung stiftendes Buch.« Neue Bücher (NDR) über Karin Kalisas Roman »Bergsalz«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karin Kalisa
Magst du die Nacht?
18 Geschichten von der anderen Seite des Tages
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
18 gute Gründe, die Nacht zu mögen
Was hat die Nachtwache im alten Babylon mit dem Dornröschenschlaf einer jungen Frau in Japan zu tun? Dies und vieles mehr verrät Karin Kalisa in 18 Streifzügen durch die andere Seite des Tages – und erzählt dabei vom nachtaktiven japanischen Lurch ebenso wie von den internationalen Nachtzugverbindungen …
Mit diesen fein komponierten Texten schenkt uns Bestseller-Autorin Karin Kalisa 18 gute Gründe, die Nacht zu mögen, obwohl sie manchmal dunkler ist als nötig; und zuweilen auch länger. Aber dafür gibt es ja dieses Buch.
Inhaltsübersicht
Widmung
Magst du …? – Fragen haben [...]
Ja, ich mag die [...]
1 Der Mann im Mond
2 Graf Keyserlingk kann nicht schlafen
3 Polarlicht
4 Nachts sind alle Katzen grau
5 Tagesrest
6 Nachtmahl
7 Unter Tage
8 Night Fever
9 Tagundnachtgleiche
10 Starry Starry Night
11 Nachtzug
12 Im Dunkeln tappen
13 Scheherazade
14 Politisches Nachtgebet
15 Nachtaktiv – Glühwürmchen und mehr
16 Nachtwache
17 Paten der Nacht
18 Sterntaler. Mit Hegel und Heine, mit Marx und Büchner
Für J., der mir diese Frage stellte.
Magst du …? – Fragen haben ein beachtliches Spektrum. Von simplen Fragen à la »Magst du Spinat?« (Jazz, Fisch, Wand-Tattoos, Curry-Ketchup), die sich mit »ja«, »nein«, »geht so« oder »geht gar nicht« beantworten lassen, über mittelkomplexe Fragen wie: »Magst du klassische Musik?« (kaltes Wasser, den Wechsel der Jahreszeiten, Familienfeste, Fernreisen), bis hin zu den an Existenzielles rührenden: »Magst du den Wind?« (die Berge, die Wüste, den Himmel), zu denen auch diese gehört: »Magst du die Nacht?« Darüber ließe sich lange nachdenken und differenziert sprechen. Und wenn man nun schnell antworten muss? Weil die Frage von einem kleinen Kind gestellt wird, an dessen Bett man soeben etwas vorgelesen hat? Das hellwach daliegt und noch sehr damit zu tun hat, sich in diese Welt hineinzufinden: »Mama, magst du die Nacht?«
Was habe ich damals geantwortet? Womöglich so etwas wie: »Oh, weißt du, ich denke schon. Sicher ist sie manchmal fürchterlich finster und hin und wieder auch mal viel zu lang, aber sie hat den Mond und die Sterne, und das ist immerhin ziemlich schön, oder?«
Etwas in der Art wird es wohl gewesen sein, weil diese Frage ja offensichtlich auf eine Antwort aus war, die sicherstellen würde, dass mit der Nacht prinzipiell alles in Ordnung ist – obwohl sie eine gewisse Vorliebe dafür hat, aus Ecken, Kästen und Fensternischen die Schatten unheimlicher Wesen hervortreten zu lassen.
Ob die Antwort damals die Nacht ins richtige Licht gerückt hat? Jedenfalls hat mich die Frage nie mehr ganz losgelassen, und über Jahre hinweg – ungefähr die Zeitspanne, in der ein Kind von der Schulreife zur Wahlberechtigung heranwächst – gab es Gelegenheiten, mit Nächtlichem, wo es sich zeigte, in Zwiesprache zu gehen. Ohne Vorauswahl kam es auf mich zu: in Märchen und Montanwissenschaft, in kontrapunktischen Etüden und funkigen Popsongs, in Gedichten und Gebeten, in Mitternachtsmahlzeiten und Nachtzügen, in Himmelsmechanik und Tiefseeforschung. Es sind achtzehn Versuche daraus geworden, diesen Spuren zu folgen und auszuleuchten, wohin sie wohl führen.
Ja, ich mag die Nacht. Und jetzt kann ich auch sagen, warum.
Ja, ich mag die Nacht. Und jetzt kann ich auch sagen, warum.
Auch die Nacht zeigt mir ihr Gesicht
Es ist mir gleich
Wie es zu mir spricht
Ich liebe jede Stunde
Karat, Jede Stunde
1 Der Mann im Mond
»Aber bei der Mondgöttin selbst, haltetihr es für möglich, dass es Schatten von Schluchten und Abgründen gibt, die von dort bis zu unserem Auge gelangen?«
Plutarch, Das Mondgesicht
Natürlich hat er ein Gesicht. Warum auch nicht? Nur weil Plutarch vor zweitausend Jahren Augen, Mund und Nase als Meere und Gebirge beschrieben hat – sehr schön hat er die beschrieben – und nur weil dies nach und nach von der astronomischen Forschung bestätigt wurde? Als ob all dies ausreichen würde, nicht mehr zu sehen, dass da ein Gesicht ist: der Mann im Mond – der übrigens in den meisten Kulturen eine Frau ist. Dafür ist dort die Sonne männlich. Aber das nur nebenbei. Es ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Gesicht freundlich ist. Denn bei Nacht ist man auf eine gewisse Freundlichkeit angewiesen. Wie sollte jemand auch nur ein Auge zubekommen, wenn es bedrohlich aus dem Himmel herunterfunkeln würde? Nein, ein grundgütiger Mond muss es sein. Sonst würde die Sache mit dem Tag-Nacht-Rhythmus komplett aus dem Ruder laufen.
La-le-lu – Nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babies schlafen … ein sanfter Dreiklang und drei gleich anlautende Silben, die es nahezu zum Urtyp des Wiegenliedes machen, eines Lullabys eben, das sich in schöner Schlichtheit hervorragend zur Dauerschleife einer Spieluhr eignet, obwohl nicht wenige Eltern und Anverwandte lieber auf gehobene Klänge an der Wiege setzen: Brahms’ Guten Abend, gute Nacht, Mozarts Kleine Nachtmusik, Haydns Serenade. Und nicht auf eine einfache Melodie aus dem Geiste des Schlagerliedchens der Nachkriegszeit. Denn um nichts anderes handelt es sich hier. Komponiert von einem gewissen Heino Gaze in Berlin, der sich tags als Jurist und nachts als Barpianist verdingt hat und mit dem Mond vermutlich sehr auf Du und Du war. Doch nicht er selbst wurde berühmt damit, sondern Heinz Rühmann als Teddy Lemke, ein ehemals viel gefragter Clown, der es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, mit dieser Melodie sein Kind in den Schlaf zu singen. Das tragischerweise gar nicht sein eigenes Kind war. Und er folgerichtig nicht sein leiblicher Vater. Gleichwohl haben sich die beiden von Herzen lieb, und auch der Titel des UFA-Streifens von 1955 störte sich nicht an den zivilrechtlichen Gegebenheiten, denn der lautete: Wenn der Vater mit dem Sohne … Weil esnatürlich nicht so ist, dass Vatergefühle und Sohngefühle sich an die gleiche DNA binden. Wo kämen wir da hin, wenn es so wäre. – Die leibliche Mutter jedenfalls, die aus dem Nichts auftaucht und ihr Kind zurückhaben will, ist unter pädagogischen Gesichtspunkten eine Katastrophe und so schmonzettig inszeniert, dass einem die Haare zu Berge stehen. Jedenfalls wird die wundersame und wunderbare Zweisamkeit von Vater und Sohn von Amerika aus und nach Amerika hin zertrennt. Herzzerreißend. Und trotzdem gilt, und das spricht sehr für Teddy Lemke, eisern eines: Am Abend muss die Welt in Ordnung sein. Weil die Kinder einen Anspruch darauf haben. Egal ob leiblich oder nicht leiblich, wer gerade da ist, hat dafür zu sorgen. Hat zärtlich in den Schlaf zu singen oder zu fiedeln. Punkt. Es reicht eben nicht, dass man den Kleinen zu essen gibt und darauf achtet, dass sie sich die Zähne putzen, dass man ihnen das Bett frisch bezieht und gut durchlüftet. Besser dies alles zu vernachlässigen, als zu vergessen, die Welt in Ordnung zu bringen – so gut es eben geht.
Da dieser berechtigte Anspruch erstaunlicherweise nicht in die UN-Kinderrechts-Konvention eingegangen ist, sollte schleunigst ein Antrag daraufhin gestellt werden. Unter Artikel 3 »Wohl des Kindes« oder Artikel 18 »Verantwortung für das Kindeswohl« könnte ein solcher Passus stehen – oder warum nicht auch unter Artikel 27: »Angemessene Lebensbedingungen«. Hauptsache, er kommt unter. Obwohl auch in diesem wohlmeinenden Text insgesamt zu häufig die Worte Behörde, Regelung und Vertragsstaaten vorkommen und insgesamt zu wenig die Wörter: Vertrauen, Glück und Freude. Natürlich ist es ein juristischer Text. Die sind an sich nicht freudvoll. Allerdings könnte er dann in seiner spröden Sprache wenigstens rechtsverbindlich sein. Wo ihn doch alle Länder der UN, letztlich sogar Süd-Sudan und Somalia, allerdings nicht die USA, unterschrieben haben und er 1989 erstmals in Kraft trat. Nicht rechtsverbindlich sein und sprachlich ohne Durchgriff bleiben, dieses doppelte Zuwenig ist eigentlich ein deutliches Zuviel an Negativität im Gutgemeinten. Vermutlich geht man davon aus, dass Rechtsverbindlichkeit von Kinderrechten die Welt aus den Angeln heben würde. Und was hätten die Kinder von einer aus den Angeln gehobenen Welt? Wahrscheinlich schafft man es auch deshalb hierzulande nicht, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Da können wir noch lange warten.
Abgesehen von der Frage nach der Rechtsverbindlichkeit bleibt daran festzuhalten, dass, wenn die Welt nicht in Ordnung ist, und meistens ist sie das nicht, die Erwachsenen jedenfalls gehalten sind, hart daran zu arbeiten, dass sie es wieder sein wird. Darauf müssen Kinder vertrauen können, wenn sie sich dem Schlaf und der Nacht überlassen. Womöglich ist dies der tiefste Sinn der Wiegenlieder, dass, indem die Erwachsenen den Kindern dieses Vertrauen geben, sie sich selbst daran erinnern: »Nicht vergessen! Welt in Ordnung bringen.« Wenn es die Wiegenlieder nicht gäbe, dann würde dieser Auftrag, vielleicht der wichtigste, einem wahrscheinlich öfter mal durchrutschen. Und alle möglichen Gespenster würden sich vor das Gesicht des Mannes im Mond schieben.
Deshalb mag ich die Nacht, weil sie das klarstellt.
La-le-lu, vor dem Bettchen stehn zwei Schuh …
Rein textlich ist das Lalelu-Liedchen natürlich ziemlich aus der Zeit gefallen. Nach Astrid Lindgren und Janosch, nach Pippi Langstrumpf und dem Tiger-Bär-Gespann – wo würden da noch zwei Schühchen ordentlich vorm Bett stehen? Alles so niedlich; dabei nicht ohne wilhelminische Obertöne. Eine kleine Revision täte da gut. Dem Schweizer Liedermacher Linard Bardill verdanken wir ein zeitgemäßes Gutenachtlied, in dem die Kinder aufgefordert werden, sich nicht nur beim Schlafen zusehen und beschützen zu lassen, sondern gern auch einmal zurückzuschauen: »Luege, was der Mond so macht.« Weil Vertrauen haben und Selbstbewusstsein entwickeln nicht in einem Gegensatz-, sondern einem Komplementärverhältnis zueinander stehen. Mit anderen Worten: Auch wenn die Schühchen quer im Zimmer verteilt sind, sollten die beiden Eckpfeiler einer glücklichen Kindheit fest eingepflockt sein: beschützt sein und neugierig sein dürfen.
Auffällig und bemerkenswert in diesem Setting ist noch etwas anderes: Der Mond hat offenbar eine ausgesprochen Berlinische Neigung. So eine speziell urbane Note. Nicht nur Heino Gaze hat sein Lied aus der »Berliner Luft« gegriffen, sondern noch ein Weiterer hat dem Mond eine Berlinische Prägung gegeben. Und auch der hatte auffälligerweise zwei Berufe: Leutnant der preußischen Landwehr einerseits, Literat und Mime andererseits. Gerdt Bernhard von Bassewitz-Hohenluckow, schauspielernder Offizier aus mecklenburgischem Uradel, ausgewandert nach Berlin, hat hier Peterchens Mondfahrt verfasst; man schrieb das Jahr 1912. In diesem, nennen wir es: Bravourstück, hat er einiges verbraten: nicht nur seine Vorliebe für Militärmusik – es rumst und scheppert im Kanonengetöse, dass einem ganz schwummrig wird –, sondern auch das volkstümliche Märchen vom Mann im Mond, in dem ein Holzfäller, der selbst im Angesicht eines himmlischen Besuchs den Sonntag nicht heiligt, sondern mit der Axt im Wald zugange ist und dann auch noch lästerlich spricht: Sonntag oder Mondtag, das sei ihm so was von egal. Folglich wird er auf den Mond verbannt. Das hat er nun davon. In Peterchens Mondfahrt wurde versehentlich das sechste Beinchen eines Maikäfers, Sumsemann sein Name, mit dorthin expediert.
Anneli und Peter (genau – die Anneli ist nämlich auch dabei und durchaus nicht weniger involviert in das Geschehen als das Peterchen), zwei Kinder, die noch nie einem Tier etwas zuleide getan haben, könnten dieses von Generation zu Generation vererbte Verhängnis eines fehlenden Maikäferbeinchens rückgängig machen. Aber es braucht Mut: So enorm einladend ist die Mondlandschaft nicht, kann man sich denken, wenn raue Gesellen wie dieser Holzfäller dort beherbergt werden. Auch der große Bär ist wahrlich kein Kuscheltier – allerdings lässt er sich besänftigen, und zwar mit Äpfeln, die Anneli (!) geistesgegenwärtig als Reiseproviant eingepackt hat. Dafür kann man dann auf der Milchstraße herrlich Schlitten fahren, und die Nachtfee lädt auf die Sternenwiese zum Kaffeeklatsch. Schon nähern sich die drei Eisgeschwister: Neben Hagelhans und Frau Holle, ist es der Eismax, der das schöne Idiom kräftig auffährt: Artig melde er sich bei der »jnädigsten Nachtfee« zur Stelle, »jereist mit jletscherhafter Schnelle – zwar für mich unjewöhnliche Zeit; aber doch eisbärenmäßig jefreut!«.
Wer möchte es ihm verübeln, dass er um »etwas jekühlte Temperatur!« bittet:
»Und die Sonne, das jreuliche Weib,/Mir nicht so nahe uff’n Leib./
Kann die Person durchaus nich’ vertragen,/Krieje Triefaugen und weichen Kragen«.
Det is’ Balin – auf dem Mond! (Wer sich jetzt vorstellt, Katharina Thalbach könnte sich als berlinernder Eismaxe gut machen, muss nicht enttäuscht werden. Diese Einspielung liegt bereits vor.) Vielleicht war dies von Bassewitz’ glücklichste Flucht aus der preußischen Wirklichkeit: die literarische, geradewegs auf den Mond.
Muss man da noch Frau Luna erwähnen? Ungern. Nicht, weil Frau Luna uns jene gassenhauerische Musical-Melodien ins Ohr gesetzt hat: »Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft …«, sondern weil ihr Schöpfer, der Komponist Paul Lincke, geboren 1866 in Berlin–Kreuzberg, ein konservativer Knochen war und sich mit den aufkommenden Nationalsozialisten verbandelt hat. Interessanterweise aber fanden die Nazis gerade die frivol aufbereitete Mond-Thematik nicht so passend. Dennoch wurde Paul Lincke ein Profiteur des Nazi-Regimes, und dennoch ist irritierenderweise eine Kreuzberger Straße nach ihm benannt worden, sogar eine besonders schöne. Frau Luna, diese Berlin-Operette, war natürlich lange vor den Nazis, nämlich bereits 1899 uraufgeführt worden und längst in die lokale Seele eingesickert.
Der Mond und Berlin – eine feststehende Verbindung? Nun, letztlich scheint das Mond-Fieber doch pariserisch inspiriert gewesen zu sein, denn von dort aus nahmen die berühmten Mondrevuen ihren Ausgang, die die Lust am Nächtlichen und Romantischen und Zukunftsmäßig-Technischen so spielerisch und verrückt unter einen Hut brachten, dass die ganze Sache nur auf einen zurückgehen konnte: Jules Verne. Für Realphantastik dieser Spielart zuständig wie kein anderer, hatte er den Stein ins Rollen gebracht. Bereits 1865 hatte er Von der Erde zum Mond geschrieben, und fünf Jahre später folgte die Reise um den Mond. Die ingenieurshafte Greifbarkeit des Mondes in diesen Romanen brachte die Leute aus dem Häuschen, obwohl die Columbiade, gestartet übrigens ganz in der Nähe von Cape Canaveral, statt auf dem Mond zu landen, in dessen Umlaufbahn gerät, zum Glück elliptisch und nicht hyperbolisch, sodass sie nicht übers Ziel hinausschießt, sondern die Kurve zurück zur Erde bekommt und im Pazifik landet. Erstaunlich prophetisch. – Das befand auch Kepler von sich selbst, als er in seinem Kommentar zu Plutarchs Mondgesicht sich hoch erfreut darüber zeigte, dass spätere Beobachtungen lunarer Täler bestätigten, was er selbst Jahre zuvor ersonnen hatte: Eine »Vorwegnahme der Wahrheit, die Mut zeigt und eine männliche Miene.« Apropos Mann im Mond …
Zum Nach- und Weiterlesen:
Plutarch: Das Mondgesicht. De facie in Orbe Lunae, Zürich 1968, S. 51. ☾ ☾ ☾ Johannes Kepler: Der Traum, oder: Mond Astronomie: Somnium sive astronomia lunaris. Mit einem Leitfaden für Mondreisende von Beatrix Langner, Berlin 2012, S. 91. ☾ ☾ ☾ Herwig Görgemanns: Untersuchungen zu Plutarchs Dialog »De facie in orbelunae« (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften Band 33). Heidelberg 1970. ☾ ☾ ☾ Lexikon des Internationalen Films: Eintrag: Wenn der Vater mit dem Sohne (1955) https://www.filmdienst.de/film/details/7774/wenn-der-vater-mit-dem-sohne-1955 (abgerufen 20.10.2021). ☾ ☾ ☾ Klaus Bartels: Vom Mondgesicht zur Mondkarte, in: Cartographica Helvetica 5/1992 https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=chl-001:1992:5::119 ☾ ☾ ☾Konvention über die Rechte des Kindes (20. November 1989) Abrufbar unter: https://www.unicef.de/informieren/materialien/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes/17528 (Stand 20.10.2021). ☾ ☾ ☾ Gerdt von Bassewitz: Peterchens Mondfahrt, München 1912. Als Audio-CD: Katharina Thalbach liest: Peterchens Mondfahrt (2013). ☾ ☾ ☾ Ludwig Bechstein: Das Märchen vom Mann im Mond, in: Ludwig Bechstein: Deutsches Märchenbuch (1845) darin Kap. 33; neu aufgelegt Hildesheim 2003. ☾ ☾ ☾ Eintrag »Frau Luna«. Forschungsinstitut für Musiktheater, Hg.: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters: Oper, Operette, Musical, Ballett. Band 3, München 1989, S. 507ff. ☾ ☾ ☾ Linard Bardill: Luege, was der Mond so macht.21 Kinderlieder. Audio CD. 1997. ☾ ☾ ☾ Jules Verne: De la Terre à la Lune (1865), dt.: Von der Erde zum Mond, 1873; Neuauflage Köln 2014. ☾ ☾ ☾ Jules Verne: Autour de la Lune (1870), dt.: Reise um den Mond, 1873; Neuauflage Frankfurt 2001. ☾ ☾ ☾
2Graf Keyserlingk kann nicht schlafen
Man schreibt das Jahr 1741. Es tobt der Österreichische Erbfolgekrieg: Hat doch tatsächlich eine junge Frau, Maria Theresia, die Tochter Karls VI., in Wien den Thron bestiegen und den militant geäußerten Unwillen etlicher europäischer Fürsten hervorgerufen, die allesamt und darüber hinaus jeder für sich, meinten, sie würden die Geschäfte wesentlich besser führen – und es stände ihnen zu. Und dann will dieses junge Ding auch noch ihr Schlesien behalten. Also zieht man am besten gleich doppelt in den Krieg: zum einen gegen Maria Theresia und zum anderen um Schlesien. Im März verbünden sich Großbritannien, Sachsen, Russland, die Niederlande mit Österreich gegen die Preußen, die jedoch bereits im April in der Schlacht zu Mollwitz die Österreicher besiegen. Schon im darauffolgenden Monat wird eine neue bemerkenswerte Koalition geschmiedet: Bayern, Spanien, Preußen und Frankreich zusammen gegen Österreich. Unterdessen wird Maria Theresia auch noch Königin von Ungarn. Großbritannien schaut sich das Ganze aus sicherer Entfernung an und zieht Neutralität vor. Dafür stellt Kursachsen sich auf die österreichische Seite. Unbeeindruckt davon schließen Preußen und Österreich – heimlich – einen Waffenstillstand, für den Niederschlesien an Preußen verschachert wird. Dennoch fällt Friedrich der Zweite wenig später in Böhmen ein: Die Österreicher hätten sich an die geheime Abmachung nicht gehalten. Außerdem erklärt Schweden Russland den Krieg; ausgerechnet Russland, wo sich inzwischen auch eine Palastrevolution abzeichnet, im Zuge derer ein einjähriges Kind, Zar Iwan der Sechste, nebst seiner Mutter (oder umgekehrt) gestürzt werden wird – um nur die wichtigsten Ereignisse festzuhalten …
Wahrlich, selbst für einen Diplomaten gibt es geringere Gründe, nicht schlafen zu können. Graf Hermann Carl von Keyserlingk jedenfalls, Gesandter des russischen Hofes in Dresden, liegt wach. Der deutsch-baltische Adelsspross in seinen Vierzigern ist ein erfahrener und hochgebildeter Unterhändler. Einige Zeit war er sogar Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften. Aber was kann ein Gesandter tun, wenn eine gerade Dreiundzwanzigjährige in schnellem Takt Thronfolgerinnen und Thronfolger gebiert, während sie gleichzeitig mit größter Zähigkeit ihr habsburgisches Erbkönigreich verteidigt? Wenn anderswo Säuglinge vom Thron gestürzt werden können, weil die heimischen Truppen gerade in Schweden beschäftigt sind? Wenn Frankreich wild entschlossen ist, Österreich zu schwächen, indem es die deutschen Fürsten unterstützt, und Russland Österreich nicht zu Hilfe eilen kann, weil Schweden gerade nichts Besseres zu tun hat, als Russland den Krieg zu erklären? Und seine eigene baltische Heimat immer nur ein Spielball der Mächte. Was kann ein russischer Diplomat am kursächsischen Hof da überhaupt noch bewirken – und wie? Zumal, wenn er nicht gut schläft.
Ob er ihm nicht etwas komponieren könne – etwas, das, trefflich vorgetragen zu nächtlicher Stunde, sein Gemüt beruhigen könne. Ein Stück mit schöner Grundharmonie, sanft, dabei nicht ohne eine gewisse maßvolle Heiterkeit, fragt er Johann Sebastian Bach, mit dem er freundschaftliche Kontakte pflegt.
Da hat er natürlich den Richtigen gefragt. Einen Spezialisten für Gegenläufigkeiten im Zeichen von Harmonie und Wohltemperiertheit, einen Kontrapunktiker, wie man sich keinen Besseren wünschen könnte. Vielleicht hat genau dies die tiefe freundschaftliche Verbundenheit des barocken Tonsetzers und des politischen Unterhändlers begründet: das Anliegen, Mehrstimmigkeit zu organisieren. Allerdings fragt man sich doch, warum es am Dresdner Hof der Protektion eines Diplomaten in russischen Diensten bedurft hatte, damit Johann Sebastian Bach zum »Königlich Polnischen und Kurfürstlich Sächsischen Hofcompositeur« ernannt wurde. Aber ja, Bach gehört zu denen, deren Rang erst posthum erkannt und gewürdigt wurde.
Jedenfalls kann Johann Sebastian Bach das Anliegen seines schlaflosen Freundes und Förderers verstehen – und liefern: Eine Clavier Ubung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Veränderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen. Haupttonart G-Dur. Auch einen begnadeten Cembalisten für die Aufgabe, dieses Wiegenlied zu intonieren, musste man nicht lange suchen. Sowohl Johann Sebastian Bach als auch Graf Keyserlingk schätzen den gerade erst vierzehnjährigen Johann Gottlieb Goldberg, der dem Grafen vom Nachbarzimmer aus das Bach’sche Werk zu Gehör bringen soll.
Aus heutiger Sicht fragt man sich, ob solche Nachtschichten dem jungen Cembalisten in seiner eigenen Entwicklung nicht unzuträglich gewesen sind. Gerade Heranwachsende brauchen ihren Schlaf. Immerhin trägt diese wunderbare Musik seinen Namen, sodass man auf diese Weise auch seiner – er verstarb früh an Tuberkulose – gedenken kann.
Was macht die Goldberg-Variationen so besonders? Eine Aria leitet dreißig Variationen ein, dieselbe Aria beschließt diesen Reigen, weshalb eine schlaffördernde Endlosschlaufe sich geradezu anbietet: War es nun die Aria, die beschließt, oder die Aria, die eröffnet? Egal, Hauptsache, es hört nicht auf. Dieses beruhigende Doppelgesicht eines implementierten Da capo. Die Variationen dazwischen werden getragen und sonor zusammengehalten von der tiefsten Stimme. Im Schutz der Basslinie dürfen sich die anderen Stimmen munter austoben, mal im Kanon, mal im Quodlibet. In Letzterem, es ist die Variation 30, hat Bach zwei Gassenhauer seiner Zeit verhackstückt. Verhackstückt heißt in diesem Fall: mit größter Sorgfalt und geradezu mathematischer Präzision in die Reihe der vorangehenden Variationen eingearbeitet.
Keine Fuge, keine Sinfonie, kein Oratorium. Einfach nur eine Klavierübung hat Johann Sebastian Bach seinem Freund und Förderer zugeeignet. Und doch firmiert dieses Stück als eines der wunderbarsten und zugleich schwierigsten Stücke der Klavier-Literatur, an dem sich die Besten und Allerbesten der Szene probiert haben und auch weiterhin probieren werden. Darunter einer, der kongenial, wie man versucht ist zu sagen, unter chronischer Schlaflosigkeit litt. Das muss irgendwie gepasst haben.
Glenn Gould war dreiundzwanzig Jahre alt, als er 1955 das Stück bei Columbia Records zum ersten Mal einspielte. Er starb 1982, wenige Monate, nachdem er die Goldberg-Variationen zum zweiten Mal aufgenommen hatte. So umfassen die Goldberg-Variationen seine Karriere vom Debüt bis zur letzten Aufnahme wie die Aria und ihr Da capo die dreißig Variationen, die zwischen ihnen liegen.
Das ist natürlich ein Stoff, aus dem Legenden geradezu von selbst entstehen. Man kann gar nichts dagegen machen. Und sollte es vielleicht auch gar nicht erst versuchen. Legendär ist ja an sich nichts Verwerfliches. Und wenn man diese Einspielungen hört, ist schon jede für sich legendär. Allerdings auch ihr Verhältnis zueinander: Die zweite Einspielung ist doppelt so langsam wie die erste. Natürlich ist die langsamere Fassung zur inneren Beruhigung etwas besser geeignet. Jedenfalls hat sich da jemand richtig Zeit genommen. Nicht wissend, aber vielleicht ahnend, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb – ganz im Geiste des Kontrapunkts.
Die Zeit, die zwischen diesen beiden Einspielungen lag, war eine, in der Glenn Gould als Exzentriker berühmt wurde: Schrullen, Attitüden, Idiosynkrasien. Es gibt viele Vokabeln für das Verhalten eines Menschen, der sich vielleicht einfach keine Zwänge mehr von der Art antat, die Konventionen nur bedient.
Er sang und brummte mit (das hatte er von seiner Mutter, Florence Gould), hockte sehr tief auf einem Stuhl (das hatte er von seinem ersten Lehrer Alberto Guerrero). Manche sagen, er habe die Beine des Stuhles eigenhändig abgesägt, andere behaupten, er habe einen kurzbeinigen Stuhl eigens anfertigen lassen. Wahrscheinlich stimmt beides. Es wird nicht nur ein Stuhl im Spiel gewesen sein.
Allerdings beschließt er schon bald, nicht mehr öffentlich zu spielen. Er zieht sich zurück. Immer hat er gefroren in dieser Welt. Und das Schlafen verlernt. Nachts hat er Radio gehört und telefoniert. Eines Tages – oder eines Nachts – kam ihm die Idee, Stimmen zusammenzusetzen zu einer Vokalfuge on air. So hat er dem Radio etwas zurückgegeben, etwas Wunderbares, Einzigartiges: das Dokumentarhörspiel The Idea of North.
Und das kam so:
Obwohl er eigentlich nicht mehr reist, steigt er 1965 in einen Zug von Toronto nach Winnipeg. Von Winnipeg aus weiter an die Südwestküste der Hudson-Bay, bis es dann nur noch mit einem Auto weitergeht, dorthin, wo er, endlich, seine Blicke über die vereisten Seen nördlich des Polarkreises schweifen lassen kann. Davon hatte er geträumt.
Der Zufall will es, dass er im Speisewagen einen Landvermesser trifft, mit dem er über den Norden ins Gespräch kommt. Kaum zu glauben: ein Mann, der die Kälte flieht und berühmt, geradezu berüchtigt dafür ist, mehrere Mäntel und Mützen übereinander zu tragen, ein Mann, der sein Alleinsein allenfalls durch Telefongespräche unterbrechen mag, reist Richtung Polarkreis und spricht mit einem ihm bis dato unbekannten Menschen Face-to-Face über acht Stunden hinweg. Hier entsteht die Idee, ein Radiostück über den Norden zu machen.
Zurück in Toronto, beginnt Glenn Gould damit, das Projekt zu realisieren. Er interviewt fünf Menschen, die mit dem Norden durch Herkunft und/oder Berufstätigkeit verbunden sind. Nach Ende der Aufnahmen setzt er sich ins Auto, hört die von ihm so hoch geschätzte Petula Clark, aber fährt gerade nicht Downtown, sondern wieder in die Einsamkeit des Nordens. In einem Motel schreibt er das Skript zur Sendung The Idea of North. Abermals zurück in Toronto, beginnt die Arbeit im Tonstudio. Aber sie will nicht gelingen. Diese vertrackte Linearität: erst spricht der, dann die, dann der, dann wieder die … bringt ihn zur Verzweiflung. Wo ihm doch eine integrierte Einheit vorschwebt, »in der die Textur, das Gewebe der Wörter selbst, die Personen differenzieren und traumartige Verbindungen innerhalb des Stücks schaffen würden«. Die Lösung liegt in Rasierklinge und Leim – und im Prinzip des Kontrapunktes. Gemeinsam mit dem Cutter Lorne Tulk schneidet er die Bänder und klebt sie auf neue, hoch bedachte Weise zusammen, bis aus den Einzelinterviews eine – ja, was eigentlich? – harmonische Simultanität, eine Art Triosonate entsteht. Nicht nur eine auf- und abebbende Polyphonie, sondern eine, in der die verschiedenen Stimmen in ihrem Gegeneinander zu einem Zusammenklingen gebracht werden, ohne dass ihre je eigene Linie je aufgegeben wird. Das war kurz vor dem Sendetermin am Abend des 28. Dezember 1967 beim Kanadischen Rundfunk, und mit den Ansprüchen eines Glenn Gould eine kaum zu bewältigende Arbeit. Am Heiligabend war man noch mitten in der Arbeit, ein Ende kaum abzusehen. Es wird durchgearbeitet. Gould hält seine Mitarbeiter mit kleinen Späßchen und seinem unbedingten Willen wach und bei Laune. Und sie schaffen es. Glenn Gould, der einsame Radiohörende, hat für eine knappe Stunde (58’55) die linearen Stimmen aus dem Äther in Kontrapunktisches Radio verwandelt. Es lässt jenes Stimmengewebe vernehmbar werden, das uns in Resonanz mit einer Welt bringt, die uns trägt; auch und gerade nachts.
Offenbar kann man alles Mögliche machen, wenn man nachts nicht schlafen kann: Einer tröstlichen Musik lauschen, sich selbst etwas komponieren oder sich etwas komponieren lassen. Nur daliegen und Probleme noch größer werden lassen – ob es sich nun um eine russisch-preußische Krise, um Ängste verschiedenster Art (die Auswahl ist groß) oder um chronische Einsamkeit handelt – das ist keine gute Idee.
Die Welt ändert sich. Das Einschlafproblem bleibt. Einschlafen 2.0 ist Einschlafen mit Wikipedia. Ein Podcast, der auf der ebenso schlichten wie genialen Idee beruht, die Menschen an der schieren Unerschöpflichkeit des Wissens der Welt zu ermüden, auf sachlich interessierte Weise in den Schlaf zu gleiten zu lassen, sei es mit Details zur Erfindung der Wäscheklammer, sei es zu: Maggi, Satelliten, Schrödingers Katze, die Seidenstraße, Blätterteig, Bermudadreieck, Capoeira, Punk, Baumhaus, Ufos, Pommes, Mount Everest, Klettverschluss …
Träumt was Schönes.
Zum Nach- und Weiterlesen:
Putzger. Historischer Weltatlas, Berlin 2021. ☾ ☾ ☾ Ulrich Siegele: Johann Sebastian Bach komponiert Zeit. Tempo und Dauer in seiner Musik. Band 1: Grundlegung und Goldberg-Variationen. Hamburg 2014. ☾ ☾ ☾Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Kassel 1974, S. 91–93 [1802]. ☾ ☾ ☾ Diether de la Motte: Kontrapunkt, Kassel 2010. ☾ ☾ ☾ Otto Friedrich: Glenn Gould. Eine Biografie, Reinbek b. Hamburg 1994, S. 225. ☾ ☾ ☾ Jonathan Cott: Telefongespräche mit Glenn Gould, Frankfurt/M. 1995. ☾ ☾ ☾ Anyssa Neumann: Ideas of the North. Glenn Gould and the Aesthetic of the Sublime, in: Voice Xchange, Vol. 5 No. 1, Chicago 2011. ☾ ☾ ☾ Anthony Cushing: Examing the New Counterpoint in Glenn Gould’s Contrapuntal Radio (18.10.2010). ☾ ☾ ☾ J. D.Connor: Trans-Canada Express: Glenn Gould, Petula Clark, and the Possibilities of Pop, nonsite.org Issue 8.☾ ☾ ☾ John Jessop, zus. mit Glenn Gould: Radio as Music. Filmversion 1975. ☾ ☾ ☾ Glenn Gould: The Idea of North. (Erstes Dokumentarhörspiel aus der von Gould verfassten und produzierten Solitude Triology), Canadian Broadcasting Corporation (CBC), am 28.12.1967. ☾ ☾ ☾ Glenn Gould: The Search for Petula Clark:CBC, 11.12.1967. ☾ ☾ ☾ Tim Page: The Glenn Gould Reader, New York 1984. ☾ ☾ ☾ Und zum Einschlafen: Einschlafen mit Wikipedia: https://einschlafen.podigee.io ☾ ☾ ☾
3Polarlicht
Im Herbst des Jahres 2003, genauer gesagt Ende Oktober bis Mitte November, geschah eine Art Wunder: Der Himmel zeigte sich nach Sonnenuntergang mit grünen, roten und violetten Lichtern unterhalb des Polarkreises wie sonst nur oberhalb des Polarkreises. In Deutschland, dort, wo nicht gerade dichte Bewölkung die Sicht verstellte, schwärmten die Hobbyastronomen und Fotografen aus, fingen in euphorischer Stimmung das Unglaubliche in die Speicherchips ihrer Kameras ein und verfassten dazu enthusiastische Begleittexte. Erstens, wie das Ganze mutmaßlich zustande gekommen war: Der Sonne hatte es beliebt, mehr Wind als sonst zu machen. Zweitens, wie sie selbst es geschafft haben, den Lichtern auf die Spur zu kommen: durch gute Ortskenntnis, langen Atem und eine erfahrungsgesättigte Ausrüstung im Kofferraum.
Die Hobbyastronomen sind eine von mir sehr geschätzte Spezies. Ich kann es gut nachvollziehen, dass manche von ihnen sich lieber Sternenfreunde nennen, denn tatsächlich klingt der Zusatz »Hobby«, oder auch »Amateur«, sobald er vor einer Berufsbezeichnung steht, sehr nach Halbwissen. Das ist schade, denn tatsächlich sind es oft gerade diese Menschen, die nicht nur ungewöhnliche Himmelsphänomene noch vor den Spezialisten ausmachen, wie erst kürzlich wieder, als finnische Sternenfreunde die »grünen Dünen« entdeckten – Polarlichter in sehr niedriger Höhe, die sich in Wellen fortbewegen – und sie ihren Fund zur weiteren Erforschung und treuen Händen der Weltraumphysikerin Minna Palmroth von der Universität Helsinki übergaben, sondern auch, weil sie in schöner, oft witziger Sprache informative und verständliche Texte liefern, die Menschen wie mir die Chance eröffnen, etwas zu verstehen, was zu verstehen sie ansonsten kaum hoffen dürften. (Herzlicher Gruß an dieser Stelle an André, Christian und Sven von der Volkssternwarte Recklinghausen, die die Polarlichter im Herbst 2003 so wunderbar dokumentiert haben!)
Was ich dank der Sternenfreunde verstanden habe, ist, dass Polarlichter gewissermaßen die Beziehungskiste zwischen Erde und Sonne sind, die sich auf spektakuläre Weise, also so, dass alle etwas davon haben, an den Polen austrägt. Heftige Eruptionen auf der Oberfläche der Sonne haben nicht minder heftige Winde zur Folge, die elektronisch geladene Partikel auf das die Erde umgebende Magnetfeld prallen lassen, es zusammenstauchen und sich dann zügig zu den magnetischen Polen aufmachen. Sobald sie in die Erdatmosphäre eindringen, treffen sie auf Sauerstoff und Stickstoff und – es wird Licht. Atomarer Sauerstoff leuchtet grün oder rot, Stickstoff violett. Polarlichter sind ein Kollisionsgeschehen. Je mehr Wind, desto heftiger wird das Magnetfeld der Erde angegangen, und desto besser stehen die Chancen, dass auch in Mitteleuropa, wie im Herbst 2003, die Lichter in Erscheinung treten. In Erscheinung treten trifft es ganz gut. Sie werden erwartet, sie werden erhofft und sind doch unvorwegnehmbar. Gut erforschte Wunder, die wieder und wieder geschehen; allerdings eben vornehmlich in den Polarregionen: Aurora borealis im Norden, Aurora australis