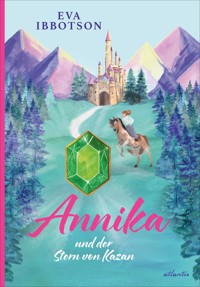8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Maias Abenteuer am Amazonas England 1910: Die elternlose Maia erfährt, dass sie zu ihren einzigen Verwandten nach Brasilien geschickt wird. Gemeinsam mit der Gouvernante Miss Minton tritt Maia die Reise über den Ozean an. Sie ist voller Vorfreude auf das unbekannte Land und ihre gleichaltrigen Zwillingscousinen. Doch das Mädchen wird bitter enttäuscht: Die Familie ist grässlich und nimmt Maia nur wegen ihres Vermögens auf. Doch dank Miss Minton und dem Waisenjungen Finn beginnt für Maia ein Leben voller Abenteuer und dramtischer Verwicklungen an den Ufern des Amazonas ….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eva Ibbotson
MaiaoderAls Miss Minton ihr Korsettin den Amazonas warf
Aus dem Englischen von Sabine Ludwig
Für Martha
1. Kapitel
Die Schule, die Miss Banks und ihre Schwester Emily gegründet hatten, war eine der besten in London. Die Schwestern waren der festen Überzeugung, dass Mädchen genauso gründlich und sorgfältig unterrichtet werden müssten wie Jungen. An einem ruhigen Platz mit Platanen und gut erzogenen Tauben hatten sie drei Häuser erworben und ein Messingschild angebracht, auf dem MAYFAIR-AKADEMIE FÜR JUNGE DAMEN stand.
Die Schule wurde ein großer Erfolg. Denn die Schwestern legten nicht nur Wert auf Fleiß, sie achteten auch auf gute Manieren, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft und die Schülerinnen wurden sowohl in Algebra als auch in Handarbeiten unterrichtet.
In die Schule wurden auch Mädchen aufgenommen, deren Eltern im Ausland lebten und die nicht wussten, wo sie ihre Ferien verbringen sollten.
Im Herbst des Jahres 1910, fast dreißig Jahre nach ihrer Gründung, hatte die Schule eine lange Warteliste und die Mädchen, die sie besuchten, waren sich ihres Glückes wohl bewusst.
Doch es gab natürlich auch durch und durch langweilige Stunden.
In dem großen Klassenraum, der auf die Straße ging, unterrichtete Miss Carlisle Geografie. Sie war eine gute Lehrerin, aber selbst dem besten Lehrer fällt es nicht leicht, die Flüsse Südenglands ungewöhnlich und aufregend darzustellen.
»Also, kann mir jemand sagen, wo genau die Themse entspringt?«, fragte Miss Carlisle. Sie ließ ihren Blick über die Tischreihen schweifen, über die plumpe Hermione und die ängstlich dreinblickende Daisy hinweg, und blieb bei einem Mädchen in der ersten Reihe hängen. »Hör auf an deinem Zopf herumzukauen«, wollte sie gerade sagen, unterließ es aber. Denn das Mädchen hatte einen Grund, auf dem lockigen Ende ihres schweren Zopfes herumzukauen.
Maia hatte gesehen, wie der Wagen vor der Schule hielt, und sie hatte gesehen, wie der alte Mr Murray in seinem Mantel mit dem Samtkragen das Haus betrat. Mr Murray war Maias Vormund und heute sollte er – das wussten alle – Nachrichten über ihre weitere Zukunft bringen.
Maia erhob die Augen zu Miss Carlisle und bemühte sich um Aufmerksamkeit. In dem Raum voller blonder und hellbrauner Köpfe stach ihr dreieckiges blasses Gesicht mit den großen dunklen Augen und dem dicken schwarzen Zopf hervor. Ihre freiliegenden Ohren ließen sie sehr verletzlich aussehen. »Die Themse entspringt in den Cotswold Hills«, begann sie mit leiser, aber klarer Stimme. »In einem kleinen Dorf.« Nur was für ein Dorf? Sie hatte keine Ahnung.
Die Tür ging auf, zwanzig Köpfe fuhren herum.
»Maia Fielding möchte bitte in das Büro von Miss Banks kommen«, sagte das Dienstmädchen.
Maia erhob sich. Angst ist der Keim alles Bösen, beschwor sie sich, aber sie hatte Angst. Angst vor der Zukunft … Angst vor dem Unbekannten. Angst, wie wohl jeder sie hat, der ganz allein ist auf der Welt.
Miss Banks saß hinter ihrem Schreibtisch, daneben stand ihre Schwester Emily. Mr Murray saß in einem Ledersessel am Tisch und blätterte in Papieren. Mr Murray war nicht nur Maias Vormund, er war auch Anwalt und sich dessen nur zu gut bewusst. Alles musste sorgfältig und langsam geschehen und alles musste aufgeschrieben werden.
Maia sah die Versammelten an. Die Gesichter waren freundlich, aber das konnte alles und nichts bedeuten. Maia bückte sich, um Miss Banks’ Spaniel zu streicheln, es tröstete sie, seinen runden warmen Kopf zu spüren.
»Nun, Maia, wir haben gute Nachrichten für dich«, sagte Miss Banks. Auf viele wirkte die Sechzigjährige mit dem imposanten Busen, der gut den Bug eines Segelschiffs hätte schmücken können, einschüchternd. Sie lächelte die vor ihr stehende Maia an. Ein kluges Mädchen und tapfer obendrein. Es war nicht leicht für sie gewesen, den Verlust der Eltern, die vor zwei Jahren bei einem Zugunglück in Ägypten ums Leben gekommen waren, zu verarbeiten. Alle im Haus wussten, dass Maia jede Nacht unter ihrem Kopfkissen geweint hatte, um die anderen nicht zu stören. Wenn sich das Schicksal nun als freundlich erweisen sollte, dann verdiente es keine mehr als sie.
»Wir haben deine Verwandten gefunden«, fuhr Miss Banks fort.
»Und wollen sie …«, begann Maia, aber sie konnte den Satz nicht beenden.
Mr Murray ergriff das Wort: »Sie wollen dir ein Zuhause bieten.«
Maia holte tief Luft. Ein Zuhause. In den letzten zwei Jahren hatte sie sämtliche Ferien in der Schule verbracht. Alle waren freundlich zu ihr gewesen, aber es war nun mal kein Zuhause.
»Und nicht nur das«, sagte Miss Emily, »es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Carters Zwillingstöchter in deinem Alter haben.« Sie strahlte über das ganze Gesicht, als hätte sie die Geburt der Zwillinge eigens für Maia arrangiert.
Mr Murray klopfte auf die dicke Akte auf seinen Knien. »Wie du weißt, haben wir lange nach Verwandten deines verstorbenen Vaters gesucht. Wir wussten, dass es einen Cousin zweiten Grades gibt, einen Mr Clifford Carter, aber alle Versuche, ihn ausfindig zu machen, schlugen fehl, bis vor zwei Monaten, als wir erfuhren, dass er vor sechs Jahren ausgewandert ist. Er hat mit seiner Familie England verlassen.«
»Und wo lebt er jetzt?«, fragte Maia.
Einen Moment lang herrschte Schweigen. Es schien, als seien die guten Nachrichten nun beendet, und Mr Murray setzte ein feierliches Gesicht auf und räusperte sich. »Er lebt – die Carters leben – am Amazonas.«
»In Südamerika. In Brasilien«, mischte sich Miss Banks ein.
Maia hob ihren Kopf. »Am Amazonas?«, sagte sie. »Sie meinen im Regenwald?«
»Nicht direkt. Mr Carter ist Kautschukpflanzer. Er hat ein Haus am Fluss, nicht weit von der Hauptstadt Manaus. Es ist ein völlig zivilisiertes Anwesen. Natürlich habe ich den britischen Konsul dort gebeten es sich einmal anzusehen. Er kennt die Familie, es sind respektable Leute.«
Mr Murray machte eine Pause. »Du möchtest sicher, dass ich den Carters regelmäßig eine Summe für deinen Lebensunterhalt und das Schulgeld anweise. Du weißt ja, dass dein Vater dafür gesorgt hat, dass du diesbezüglich wohl versorgt bist.«
»Ja, natürlich möchte ich das. Ich möchte meinen Teil beitragen.« Aber Maia dachte nicht an ihr Geld. Sie dachte an den Amazonas. An Wasserarme voller Blutegel, an finstere Wälder voller feindlicher Indianer mit Blasrohren und an zahllose Insekten, die sich einem ins Fleisch bohrten.
Wie sollte sie da leben? Und um sich selbst Mut zu machen, fragte sie: »Wie heißen sie?«
»Wer?« Der alte Mann war in Gedanken immer noch bei der Vereinbarung, die er mit Mr Carter getroffen hatte. Hatte er ihm zu viel Geld für Maias Unterhalt angeboten?
»Die Zwillinge. Wie sind die Namen der Zwillinge?«
»Beatrice und Gwendolyn«, sagte Emily. »Sie haben dir einen Brief geschrieben.«
Und sie reichte Maia ein einzelnes Blatt Papier.
Liebe Maia, hatten die Mädchen geschrieben. Wir hoffen, dass du kommst und bei uns lebst.Wir stellen uns das nett vor.
Maia sah sie beim Lesen vor sich: blond gelockt und hübsch, all das, was sie so gern sein wollte, aber nicht war. Wenn die beiden im Regenwald leben konnten, dann konnte sie das auch!
»Wann werde ich fahren?«, fragte sie.
»Ende nächsten Monats. Es trifft sich sehr glücklich, dass die Carters eine neue Gouvernante engagiert haben, die mit dir reisen wird.«
Eine Gouvernante … im Dschungel … wie seltsam das alles klang. Aber der Brief der Mädchen hatte Maia Mut gemacht. Sie freuten sich darauf, sie bei sich zu haben. Sie wollten sie. Bestimmt würde alles gut.
»Hoffen wir nur, dass es wirklich das Beste ist«, sagte Miss Banks, als Maia den Raum verlassen hatte.
Alle hatten nun ernste Mienen. Es war keine leichte Entscheidung, Maia so weit fort zu einer unbekannten Familie zu schicken – schließlich musste ja auch an Maias musikalische Begabung gedacht werden. Sie spielte gut Klavier, aber interessanter noch war ihre Stimme. Ihre Mutter war Sängerin gewesen und Maias Stimme war lieblich und rein. Und obwohl sie nicht vorhatte das Singen zum Beruf zu machen, war ihre Fähigkeit, neue Lieder zu lernen außergewöhnlich.
Aber was bedeutete das alles im Vergleich zu einem liebevollen Zuhause? Die Carters schienen wirklich sehr erfreut darüber zu sein, Maia aufnehmen zu können, und Maia war ein sehr anziehendes Kind.
»Der britische Konsul hat versprochen mich auf dem Laufenden zu halten«, sagte Mr Murray – und die Besprechung war beendet.
Inzwischen hatte Maias Rückkehr in die Klasse den Nebenflüssen der Themse ein Ende bereitet.
»Morgen werden wir eine Stunde über den Amazonas und die Flüsse Südamerikas abhalten«, sagte Miss Carlisle. »Ich möchte, dass ihr alle mindestens eine interessante Tatsache darüber herausfindet.«
Sie lächelte Maia an. »Ich bin sicher, du erzählst uns, womit und wie lange du reisen wirst, damit wir deine Abenteuer in Gedanken begleiten können.«
Kein Zweifel, Maia war eine Heldin. Aber keine, die von allen beneidet wurde, eher eine, die kurz davor stand, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Als sich ihre Freundinnen mit lauter »Ohs« und »Ahs« und besorgten Ausrufen um sie drängten, wünschte Maia nichts sehnlicher als so schnell wie möglich wegzulaufen und sich zu verstecken.
Aber sie tat es nicht. Sie bat um die Erlaubnis, nach dem Abendessen in die Bibliothek gehen zu dürfen.
Die Schulbibliothek war sehr gut bestückt. In dieser Nacht saß Maia ganz allein auf der Mahagonitrittleiter und las und las und las.
Sie las von den breitblättrigen Bäumen des Regenwaldes, durch die nur selten ein Sonnenstrahl fiel. Sie las von den Reisenden, die das Labyrinth von Flüssen erforscht und Tausende von unbekannten Pflanzen und Tieren entdeckt hatten. Sie las von Vögeln mit schillerndem Gefieder, die zwischen den ausladenden Zweigen herumschwirrten – Aras und Kolibris und Papageien –, und von Schmetterlingen, so groß wie Untertassen, von süß duftenden Orchideen, die wie Vorhänge von den Bäumen herabhingen.
Und sie las von der Weisheit der Indianer, die Krankheiten und Wunden auf eine Art und Weise heilen konnten, die in Europa keiner verstand.
Diejenigen, die das Amazonasgebiet für eine grüne Hölle halten, las sie in einem alten Buch mit zerfleddertem Rücken, bringen nur ihre eigenen Ängste und Vorurteile mit in dieses wunderbare Land. Ob ein Ort Hölle oder Himmel ist, liegt bei einem selbst. Und diejenigen, die mit Mut und Offenheit hierher kommen, finden sich vielleicht in einem Paradies wieder.
Maia sah von dem Buch auf. Ich kann es, schwor sie sich. Ich kann es zum Himmel werden lassen und das werde ich auch.
Es war längst Bettzeit, als die Hausmutter Maia immer noch zusammengekauert auf der Leiter vorfand, aber sie schalt sie nicht, denn es war ein seltsamer Ausdruck im Gesicht des Mädchens, als ob es sich bereits in einem fernen Land befände.
Am nächsten Tag kamen alle Schülerinnen gut vorbereitet in die Geografiestunde.
»Du beginnst, Hermione«, sagte Miss Carlisle. »Was hast du über den Amazonas herausgefunden?«
Hermione sah ängstlich zu Maia hinüber. »Es gibt riesige Krokodile in den Flüssen, die dir mit einem Haps den Kopf abbeißen können. Nur dass man sie nicht Krokodile nennt, sondern Alligatoren, weil sie eine dickere Schnauze haben, aber sie sind genauso grausam.«
»Und wenn man seine Hand ins Wasser steckt, dann kommen diese Piranhas, die dir Stück für Stück das Fleisch von den Knochen reißen. Sie sehen wie ganz gewöhnliche Fische aus, aber ihre Zähne sind teuflisch«, sagte Melanie.
Daisy wartete mit einer Mücke auf, deren Stich Gelbfieber übertrug. »Du wirst gelb wie eine Zitrone und dann stirbst du«, sagte sie.
»Und es ist so heiß, dass einem das Wasser wie in Eimern vom Körper läuft, so schwitzt man.«
»Es heißt nicht schwitzen, meine Liebe, sondern transpirieren«, korrigierte Miss Carlisle.
Anna beschrieb die Indianer mit ihrer Furcht erregenden Bemalung, die einen mit vergifteten Pfeilen beschossen, von denen man erst gelähmt und dann wahnsinnig wurde. Von Rose kamen Jaguare, lautlos wie ein Schatten, die sich auf jeden stürzten, der es wagte, den Urwald zu betreten.
Nun hob Miss Carlisle die Hand und sah Maia besorgt an. Das Mädchen war blass und still und die Lehrerin bereute sehr der Klasse diese Hausaufgabe gegeben zu haben. »Und du, Maia, was hast du herausgefunden?«
Maia erhob sich. Sie hatte sich Notizen gemacht, aber sie sah nicht aufs Papier, und als sie zu sprechen begann, hielt sie den Kopf hoch erhoben, denn der Abend in der Bibliothek hatte alles verändert.
»Der Amazonas ist der mächtigste Fluss der Welt. Der Nil ist zwar etwas länger, aber der Amazonas führt das meiste Wasser. Man nennt ihn deswegen auch Flussmeer und überall in Brasilien gibt es Flüsse, die in ihn münden. Manche von ihnen sind schwarz und manche braun und die, die aus dem Süden kommen, sind blau; das hängt davon ab, was unter dem Wasser ist.
Ich werde auf einem Schiff der Booth Line fahren; den Atlantik zu überqueren dauert vier Wochen. Und wenn ich in Brasilien angekommen bin, muss ich noch tausend Meilen auf dem Fluss reisen, zwischen Bäumen hindurch, deren Zweige ins Wasser hängen; es gibt scharlachrote Vögel und Sandbänke und eine Art großer Meerschweinchen, die man Capa… Capybaras nennt und die man zähmen kann.
Nach weiteren zwei Wochen auf dem Schiff erreiche ich die Stadt Manaus, dort ist es wunderschön. Es gibt ein Theater mit einem grüngoldenen Dach und Geschäfte und Hotels, gerade so wie hier. Die Gummipflanzer sind nämlich sehr reich geworden und konnten eine solche Stadt mitten im Urwald errichten. Dort werde ich dann von Mr und Mrs Carter und von Beatrice und Gwendolyn erwartet und …«
Sie brach ab und grinste ihre Klassenkameradinnen an. »Und danach weiß ich nicht weiter, aber es wird alles gut werden.«
Dennoch musste Maia all ihren Mut zusammennehmen, als sie einen Monat später in der großen Halle stand, um sich zu verabschieden.
Der große Koffer war verschnürt, ihr Cape lag in der kleinen Reisetasche, die sie mit in die Kabine nehmen durfte. Ihre Freundinnen umringten sie.
Hermione weinte und Dora, die jüngste Schülerin, klammerte sich an ihrem Rock fest. »Geh nicht, Maia!«, schluchzte sie. »Ich will nicht, dass du gehst. Wer erzählt mir denn jetzt Geschichten?«
»Wir werden dich vermissen!«, kreischte Melanie.
»Tritt bloß nicht auf eine Boa Constrictor!«
»Schreib uns, o bitte schreib uns ganz viele Briefe!«
In letzter Minute wurden Geschenke in ihre Reisetasche gestopft, ein etwas merkwürdig geformtes Nadelkissen von Anna und ein Paar Haarschleifen.
Auch die Lehrer hatten sich versammelt, um bei Maias Abreise dabei zu sein.
Die Küchenmädchen waren von unten hochgekommen. »Es wird alles gut, Miss«, sagten sie. »Sie werden eine zauberhafte Zeit verleben.« Aber sie sahen Maia voll Mitleid an. Piranhas und Alligatoren lagen in der Luft – und das Hausmädchen, das die Nacht bei Maia verbracht hatte, als diese vom Tod ihrer Eltern erfuhr, wischte sich die Augen mit einem Schürzenzipfel.
Nun kam die Direktorin die Treppe herunter, gefolgt von Miss Emily. Alle machten ihr Platz, als sie auf Maia zuschritt. Aber die Abschiedsrede, die Miss Banks vorbereitet hatte, wurde nie gehalten. Stattdessen machte sie einen Schritt nach vorn und legte die Arme um Maia, die zum letzten Mal an ihrem ausladenden Busen versank. »Lebe wohl, mein Kind«, sagte sie. »Gott schütze dich.«
Und dann kam der Pförtner und verkündete, dass die Droschke vorgefahren sei.
Die Mädchen folgten Maia hinaus auf die Straße, aber als sie die schwarz gekleidete Frau sahen, die mit den Händen auf ihren Regenschirm gestützt steif auf dem Rücksitz saß, zögerten sie. Das war Miss Minton, die Gouvernante, die sich während der Reise um Maia kümmern sollte!
»Sieht sie nicht finster aus?«, flüsterte Melanie.
»Die Ärmste«, murmelte Hermione.
Und in der Tat, die große, hagere Frau erinnerte eher an eine Harke oder einen Nussknacker als an ein menschliches Wesen.
Der Wagenschlag öffnete sich. Eine Hand in einem schwarzen Handschuh, knochig und kalt wie ein Skelett, streckte sich Maia entgegen. Maia ergriff sie und gefolgt von den Schreien und Rufen ihrer Kameradinnen stieg sie ein und fuhr ab.
Maia heftete ihre Augen auf die Straße. Nun, da sie ihre Freundinnen wirklich verließ, konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Sie schaffte es gerade noch, sie hinunterzuschlucken, als sie ein schnappendes Geräusch vernahm und sich umdrehte.
Miss Minton hatte die Metallschließe ihrer großen schwarzen Handtasche geöffnet und reichte ihr ein sauberes Taschentuch mit einem eingestickten großen A. »Ich für meinen Teil«, sagte die Gouvernante mit tiefer, schroffer Stimme, »würde daran denken, wie glücklich ich bin.«
»Weil ich an den Amazonas reisen darf, meinen Sie?«
»Weil du so viele Freundinnen hast, die traurig über dein Weggehen sind.«
»Haben Sie denn keine Freunde, die Sie vermissen werden?«
Miss Mintons dünne Lippen zuckten für einen Moment. »Der Wellensittich meiner Schwester wird mich vielleicht vermissen. Falls er begriffen hat, dass ich nicht wiederkomme, was höchst unwahrscheinlich ist.«
Maia drehte sich zu ihr um. Miss Minton war sicher eine höchst außergewöhnliche Erscheinung. Ihre Augen hinter den dicken, dunkel eingefassten Brillengläsern waren von einem undefinierbaren Braungrau. Ihr Mund war schmal, die Nase dünn und spitz und die schwarze Filzkappe war mithilfe einer Furcht einflößenden Hutnadel in Form eines Wikingerspeers an ihrem dünnen Dutt festgesteckt.
»Es ist eine Nachbildung des Speers von Erik dem Hammer«, sagte Miss Minton, die Maias Blick gefolgt war. »Mit so einer Hutnadel kann man jemanden töten.«
Beide schwiegen wieder, bis die Droschke plötzlich ins Schlingern geriet und Miss Mintons Regenschirm scheppernd zu Boden fiel. Es war so ziemlich der hässlichste Schirm, den Maia je gesehen hatte, mit einer Stahlspitze und einem langen Stock, der in einem hölzernen Griff endete, der wie der Schnabel eines Raubvogels geformt war.
Miss Minton besah sich sorgfältig einen alten Riss im Griff, der mit Leim geklebt worden war.
»War er Ihnen zerbrochen?«, fragte Maia höflich.
»Jawohl.« Miss Minton betrachtete den riesigen Schirm durch ihre dicken Brillengläser. »Ich zerbrach ihn auf dem Rücken eines Knaben namens Henry Hartington.«
Maia zuckte zurück.
»Wie …«, begann sie, aber ihr Mund wurde trocken.
»Ich warf ihn zu Boden, hielt ihn mit den Knien fest und bearbeitete ihn mit meinem Schirm«, sagte Miss Minton. »Sehr kräftig und sehr lange.« Sie lehnte sich in ihrem Sitz zurück und sah fast glücklich aus.
Maia schluckte. »Was hatte er denn gemacht?«
»Er hat versucht einen Spanielwelpen durch den Maschendrahtzaun am Tennisplatz seines Vaters zu stopfen.«
»Oh! War er schlimm verletzt? Ich meine, der kleine Hund?«
»Ja.«
»Was ist mit ihm geschehen?«
»Ein Bein war ausgerenkt und ein Auge zerkratzt. Dem Gärtner ist es gelungen, das Bein wieder zu richten, aber für das Auge konnten wir nichts mehr tun.«
»Ist Henry von seiner Mutter bestraft worden?«
»Überhaupt nicht. Beileibe nicht! Stattdessen wurde ich entlassen, ohne Referenzen.«
Miss Minton wandte sich ab. An das darauf folgende Jahr, in dem sie keine Anstellung gefunden hatte und bei ihrer verheirateten Schwester hatte leben müssen, wollte sie lieber nicht denken und schon gar nicht darüber sprechen.
Die Droschke hielt an. Sie hatten den Bahnhof Euston erreicht.
Miss Minton winkte mit ihrem Schirm einen Gepäckträger herbei und Maias Koffer und ihre Reisetasche wurden auf einen Gepäckwagen geladen. Dann erschien ein verbeulter Schrankkoffer aus Blech, auf dessen Seite A. MINTON aufgemalt war.
»Für den braucht man zwei Männer«, sagte die Gouvernante.
»Ich nicht, ich bin stark«, sagte der Gepäckträger beleidigt. Aber als er den Koffer hochheben wollte, taumelte er. »Himmel, Madam, was ist denn da drin?«, fragte er.
Miss Minton sah ihn von oben herab an und würdigte ihn keiner Antwort. Dann führte sie Maia auf den Bahnsteig, wo der Zug wartete, der sie nach Liverpool bringen sollte und zur RMS Cardinal in Richtung Brasilien.
Der Zug dampfte schon aus dem Bahnhof, als Maia fragte: »Sind das Bücher in Ihrem Koffer?«
»Es sind Bücher«, gab Miss Minton zu.
Und Maia sagte: »Gut.«
2. Kapitel
Die Cardinal war ein schönes Schiff, ein schneeweißer Ozeandampfer mit schlanken, hellblauen Schornsteinen. Sie hatte zwei Salons, einen Speisesaal und ein weiträumiges Deck, auf dem die Passagiere in der Sonne liegen, Rindsbouillon trinken oder sich Deckspielen hingeben konnten.
»Ist das nicht zauberhaft?«, rief Maia und sah sich schon mit windzerzaustem Haar an der Reling stehen, während sie den Tümmlern beim Spielen zusah und weiße Möwen ihren Kopf umkreisten.
Aber der Beginn der Reise sah ganz anders aus, denn nachdem die Cardinal Lissabon verlassen hatte, geriet sie in einen Sturm. Riesige grüne Wellen türmten sich wie Berge auf, das Schiff rollte, rüttelte und stampfte.
Kaum einer besuchte den Speisesaal und die Decktüren wurden geschlossen, damit die, die noch auf den Beinen waren, nicht über Bord gespült wurden.
Maia und Miss Minton teilten sich eine Kabine mit zwei portugiesischen Damen, die die meiste Zeit jammernd in ihrer Koje lagen; sie waren seekrank, beteten unablässig zur Jungfrau Maria und wünschten weiter nichts als zu sterben.
Maia fand, dass das etwas zu weit ging, aber wer seekrank ist, wünscht sich wirklich manchmal, das Schiff möge einfach untergehen und ihn von seinen Qualen erlösen.
Maia war nicht seekrank, ebenso wenig wie Miss Minton. Sie verspürten zwar keinen großen Hunger, aber es gelang ihnen, den Speisesaal zu erreichen, indem sie sich an allem festhielten, was auf dem Weg lag. Dort nahmen sie dann etwas Suppe zu sich, die die Stewards in Teller gossen, die wegen des Sturms mit speziellen Halterungen auf dem Tisch befestigt waren.
Wenn alle seekrank sind, nur man selbst nicht, fühlt man sich unweigerlich überlegen und Maia war ziemlich stolz auf sich. Jedenfalls so lange, bis Miss Minton, die sich mit ihren langen, schwarzen Armen ans Salongeländer klammerte, sagte, dass dies ein günstiger Moment wäre, um mit dem Portugiesischunterricht anzufangen. »Wir werden ganz ungestört sein.«
Maia hielt das für keine gute Idee. »Vielleicht bringen es mir die Zwillinge bei. Sie müssen es doch können, wenn sie schon so lange dort leben.«
»Du willst doch nicht etwa in einem Land ankommen und dich dort nicht verständlich machen können? Alle sprechen Portugiesisch in Brasilien. Sogar die Indianer mischen es mit ihren eigenen Sprachen.«
Aber der Unterricht verlief unbefriedigend. Miss Minton besaß zwar ein Buch über die Familie von Senhor und Senhora Olvidares und ihre Kinder Pedro und Sylvina, die all das taten, was man in einem Lehrbuch so tut, zum Beispiel sein Gepäck verlieren oder eine Fliege in der Suppe finden, aber auf die Seite zu starren, während das Schiff seine Auf- und Abbewegungen vollführte, erzeugte nichts als Übelkeit. Es ist keine gute Idee zu lesen, wenn man gleichzeitig herumgeworfen wird!
Am zweiten stürmischen Tag auf See machte sich Maia auf den Weg zu dem größeren der beiden Salons, in dem die Passagiere bei ruhigem Wetter ihre Drinks einnahmen und Partys feierten. Miss Minton kümmerte sich derweil um die seekranken portugiesischen Damen. Maia zog es vor, nicht dabei zu sein.
Es war ein riesiger Saal mit roten Plüschsofas, die fest am Boden verschraubt waren. Große goldgerahmte Spiegel bedeckten die Wände; auf den ersten Blick schien der Saal leer zu sein.
Aber dann entdeckte Maia einen Jungen in ihrem Alter, der in einen Spiegel am anderen Ende des Raumes blickte. Er hatte lange blonde Locken und war recht altmodisch gekleidet: Kniehosen aus Samt und ein gegürtetes Jackett, dessen Ärmel zu kurz waren. Als er sich umdrehte, bemerkte sie seinen traurigen, ängstlichen Gesichtsausdruck.
»Bist du seekrank?«, fragte sie ihn.
»Nein, aber ich bekomme einen Pickel«, sagte er und zeigte auf sein Kinn. Seine Stimme zitterte und zu ihrem Erstaunen sah Maia, dass sich seine großen blauen Augen mit Tränen füllten.
»Es sind keine Windpocken«, sagte Maia bestimmt. »Wir hatten Windpocken in der Schule und die sahen anders aus.«
»Ich weiß, dass es nicht die Windpocken sind. Es ist ein Pickel. Weil ich größer werde. Auf meiner Stirn wächst auch einer.«
Er hob seine blonden Locken, um Maia den Übeltäter zu zeigen, aber in diesem Moment schlingerte das Schiff heftig und Maia musste warten, bis sie wieder auf einer Höhe mit dem Jungen stand, um die kleine rote Pustel über seinem rechten Auge zu sehen.
»Und neulich ist meine Stimme plötzlich abgesackt, eine ganze Oktave tiefer. Wenn das auf der Bühne passiert, bin ich geliefert!«
»Jetzt verstehe ich! Du bist mit diesen Schauspielern hier, nicht wahr? Den Pilgrim Players «, sagte Maia. Sie erinnerte sich, dass in Lissabon eine Gruppe seltsam gekleideter Gestalten zugestiegen war, die mit hohen Stimmen sprachen und wild gestikulierten. »Unter der Schminke sieht man die Pickel bestimmt nicht.«
»Meine Stimme kann ich nicht mit Schminke verdecken. Wenn sie mir mitten im Kleinen Lord bricht, werfen sie mich raus.«
»Das werden sie nicht tun«, sagte Maia. »Du bist ein Kind. Kinder wirft man nicht so einfach raus.«
»Ach nein?«, sagte der Junge. Er betrachtete Maia, ihre saubere, teure Kleidung, ihr sorgfältig geflochtenes Haar. »Du hast doch keine Ahnung, was …«
Wieder schlingerte das Schiff, die beiden Kinder wurden gegeneinander geschleudert und stolperten auf ein am Boden befestigtes Sofa zu.
Der Name des Jungen war Clovis King.
»Das ist nicht mein richtiger Name. Eigentlich heiße ich Jimmy Bates, aber sie haben ihn geändert, als sie mich adoptiert haben.«
»Sie? Wer hat dich adoptiert?«
»Die Goodleys. Mr und Mrs Goodley. Sie sind die Leiter der Theatergruppe und spielen fast alle Hauptrollen. Dann ist da noch Mrs Goodleys Tochter Nancy – die ist schrecklich – und Mrs Goodleys Schwester und Mr Goodleys Neffe. Er ist der Inspizient und verkauft die Karten. Die alte Mrs Goodley näht die Kostüme, aber sie sieht nicht mehr gut. Sie haben mich gefunden, als sie unterwegs nachYork waren. Ich habe gerade mit meinen Freunden auf der Dorfwiese Kricket gespielt und sie sagten, sie bringen mir die Schauspielerei bei und dass ich die jugendlichen Hauptrollen spielen soll, du weißt schon, die Kinder und Pagen und so was. Weil ich eine gute Stimme habe, singen kann und gut aussehe.«
»Hatten deine Eltern nichts dagegen?«
»Ich habe keine Eltern, ich lebte bei meiner Pflegemutter. Sie hat geweint und geweint, als ich weggegangen bin, aber die Goodleys haben gemeint, das sei eine gute Chance für mich, ich könnte viel Geld verdienen und würde reich und berühmt zurückkommen. Aber ich verdiene überhaupt kein Geld, weil keiner von uns seine Gage kriegt, wir haben ständig Schulden und ziehen nur von einem grässlichen Ort zum nächsten.«
»Aber macht das nicht Spaß, das Spielen und Reisen?«
»Überhaupt nicht. Wir steigen in schäbigen Hotels ab, voller Wanzen und mit einem Essen, von dem mir schlecht wird. Meine Pflegemutter war früher Köchin bei reichen Leuten, sie machte Würstchen im Schlafrock und Siruppudding mit Vanillesauce und ich hatte jeden Tag eine frische Weste an«, sagte Clovis und wieder stiegen ihm Tränen in die Augen. »Seit vier Jahren sind wir nicht mehr in England gewesen, und wenn sie mich rauswerfen, komme ich nie mehr zurück, weil ich kein Geld habe.«
Maia versuchte ihr Bestes, ihn zu trösten, aber als sie später mit Miss Minton allein war, fragte sie: »Können die das? Können die ihn rauswerfen?«
»Das ist eher unwahrscheinlich«, sagte die Gouvernante. »Es hängt davon ab, ob sie ihn legal adoptiert haben oder nicht.«
Als das Meer sich beruhigt hatte und die Passagiere wieder an Deck kamen, waren sich Miss Minton und Maia jedoch nicht mehr so sicher. Die Goodleys waren nicht direkt böse, aber sie benahmen sich, als seien sie die einzigen Menschen auf der Welt.
Mr Goodley war groß mit rotem Gesicht, weißem Haar und einer lauten, bellenden Stimme. Mrs Goodleys Haare waren grellrot gefärbt und sie trug mehrere Boas und Stolen und Schals um den Hals, mit denen sie überall hängen blieb. Nancy Goodley war neunzehn, benahm sich affektiert und geziert und jeder musste nach ihrer Pfeife tanzen. Außer den Goodleys gab es noch die Santorinis, ein italienisches Ehepaar, das für Musik und Tanz zuständig war, sowie einen sehr alten Mann, dessen falsche Zähne so grellweiß leuchteten, dass man blinzeln musste, wenn man ihn lächeln sah.
»Wenn er Bösewichte spielt, trägt er ein anderes Gebiss, das ist gelb mit schwarzen Löchern drin und absolut scheußlich«, flüsterte Clovis.
Das Erste, was Mr Goodley tat, wenn er sämtliche Schauspieler um sich versammelt hatte, war, dass er die anderen Passagiere, die gerne lesen wollten oder Ringe werfen, vom Deck verscheuchte. »Wir müssen für mindestens zwei Stunden völlig ungestört sein«, sagte er.
Dann fingen sie mit Körperübungen für Schauspieler an. Mr Goodley hatte sie erfunden und war sehr stolz darauf. Er hatte sogar ein Buch darüber geschrieben, aber niemand wollte es drucken.
Zuerst streckte jeder den Brustkorb heraus und ließ aus den Tiefen der Lunge die Luft mit einem »Aaah« entweichen. Dann beugten sie sich alle vor und schüttelten die Schultern, wobei einer von Mrs Goodleys Schals herunterfiel. Danach streckten sie die Arme in Richtung Meer aus und riefen »Glücklich nach rechts!«, während sie ihre Gesichter zu einer fröhlichen Grimasse verzogen. Dann streckten sie ihre Arme in die andere Richtung aus und riefen »Glücklich nach links!«.
Wenn sie »Glücklich nach rechts« und »Glücklich nach links« beendet hatten, kam »Unglücklich nach rechts« und »Unglücklich nach links«. Dabei waren ihre Gesichter nicht länger fröhlich, sondern nahmen einen todtraurigen Ausdruck an.
Clovis musste mit den anderen mitmachen, aber wann immer er konnte, kam er zu Maia und Miss Minton herüber und stellte ihnen Fragen über England.
»Spielt man immer noch diese Wettspiele mit Kastanien«, wollte er wissen, »und macht man am Guy-Fawkes-Tag noch eine Strohpuppe und verbrennt sie? Und was ist mit Schneemännern? Hat es viel Schnee gegeben?«
»Ja, letzten Winter hat es viel geschneit«, sagte Maia. »Wir laufen immer raus, wenn die ersten Flocken fallen, und versuchen sie mit der Zunge aufzufangen. Der erste Schnee schmeckt wie nichts anderes auf der Welt.«
Clovis pflichtete ihr bei, aber der Geschmack von Dingen erinnerte ihn daran, was er am meisten vermisste: das englische Essen. »Hattet ihr Grießbrei zum Nachtisch? So welchen mit saftigen Rosinen drin? Und Marmeladenrolle und Pflaumenpudding?«
Maia sagte, ja, all das hätte es in ihrer Schule gegeben, aber insgeheim musste sie Clovis bedauern. Wie konnte er nur solches Heimweh nach diesen schrecklichen, schweren Puddings haben, die sie hoffte nie wieder essen zu müssen?
Wenn die Truppe ihre Übungen beendet hatte, begann sie damit, einige Szenen aus ihren Stücken zu proben. Eine davon war die Schlafwandelszene aus Macbeth. Mrs Goodley war Lady Macbeth, wer sonst? Maia stellte sich vor, wie sie mit einem irren Seitenblick über die Bühne schwanken und »Weg, du verdammter Fleck« murmeln würde, und war daher sehr enttäuscht, als Miss Minton, die gelesen hatte, ihr Buch zuschlug und sich anschickte nach unten zu gehen.
»Mögen Sie Shakespeare nicht?«, fragte Maia.
Miss Minton warf ihr einen Blick zu. »Für mich kommt Shakespeare gleich nach Gott«, sagte sie. »Und genau deswegen ziehe ich jetzt meine Kabine vor.«
Clovis hatte nicht viel zu tun in Macbeth – Mr Goodley hatte die meisten Szenen mit Kindern gestrichen –, aber am nächsten Tag probten sie den Kleinen Lord. Maia hatte das Buch gelesen. Es war etwas rührselig, aber dennoch eine gute Geschichte, und sie fand, dass Clovis seine Sache ausgezeichnet machte. Natürlich war er der Held, der kleine amerikanische Junge, der plötzlich feststellen muss, dass er der Erbe eines großen Schlosses in England ist, das seinem knurrigen alten Großvater, dem Earl, gehört.
Der Junge hieß Cedric und nannte seine Mutter Liebste. Zusammen reisten sie nach England, rührten das Herz des alten Earls, taten den Pächtern nur Gutes und wurden von jedermann geliebt.
»Ich finde, du warst sehr gut«, sagte Maia hinterher. »Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, seine Mutter Liebste zu nennen.«
»Sicher nicht. Vor allem nicht, wenn es sich dabei um Nancy Goodley handelt, die dich kneift, sobald sie dich nur sieht.«
»Und deine Stimme hat noch nicht mal gezittert.«
Clovis sah wieder besorgt aus. »Das war auch gut so. Dieser verdammte Lord Fauntleroy soll sieben Jahre alt sein.«
Er erzählte Maia, dass sie für zwei Wochen in Belém bleiben würden, der ersten Hafenstadt am Amazonas, um dann weiter nach Manaus zu reisen.
»Es gibt da ein richtig gutes Theater. Normalerweise bekommen wir ja kein Engagement in so einem großen Haus, aber die Ballettkompanie, die gebucht war, hat abgesagt. Wir werden jeden Vormittag eine Vorstellung vom Kleinen Lord geben. Wenn alles gut läuft, können wir vielleicht unsere Schulden bezahlen, aber wenn nicht …«
»Natürlich wird es gut laufen. Und ich bin so froh, dass du in Manaus spielen wirst, weil ich dich da nämlich sehen kann.«
Maia fand es wirklich traurig, dass sich ein Junge wegen eines Pickels Sorgen machen musste anstatt die Reise zum Amazonas zu genießen. Sie fuhren nun in warmem Wasser. Die Sonne schien Tag für Tag und das Meer war strahlend blau.
Aber Clovis hasste die Hitze. Wenn er nicht gerade Maia hinterherlief, um sie nach Yorkshire-Pudding und Apple Crumble auszufragen, lag er unter einem Ventilator, schlug nach den Fliegen und seufzte. »Ich muss einfach zurück nach England«, sagte er und wollte, dass Maia und Miss Minton ihm vom Schlittenfahren und Eislaufen auf zugefrorenen Teichen erzählten und von den noch warmen Muffins, die es danach zu essen gab.
»Meine Pflegemutter machte die besten Muffins der Welt«, sagte er.
Maia empfand ganz anders. Als sie noch klein war, hatten die Eltern sie mitgenommen, wenn sie in Griechenland und Ägypten in alten Ruinen herumbuddelten. Sie erinnerte sich gern an die Wärme, die dort selbst bei Nacht geherrscht hatte, und an die Freiheiten des Lagerlebens. Und je näher sie ihrem Reiseziel kam, desto sicherer war sie, dass das, was sie auf der Bibliotheksleiter gefühlt hatte, wahr und dieses neue Land für sie bestimmt war.
»Ich werde bei Zwillingen leben«, berichtete sie Clovis. »Glaubst du nicht auch, dass Zwillinge etwas Besonderes sind? So wie Romulus und Remus, obwohl die natürlich von Wölfen aufgezogen wurden.«
»Wenn sie nett sind, ist’s gut«, sagte Clovis. »Aber wenn sie scheußlich sind, hast du eine doppelte Portion Scheußlichkeit.«
»Sie sind bestimmt nicht scheußlich«, sagte Maia.
Als sie nach fast vier Wochen auf See eines Morgens an Deck kamen, roch es nicht wie sonst nach einem Gemisch aus Teer, Maschinenöl und Salz. In der Luft war etwas Warmes, Reiches, Modriges; es roch nicht nur nach Land, es roch nach Dschungel – und innerhalb weniger Stunden sahen sie tatsächlich eine dunkle Linie von Bäumen, an die die Brandung schäumte. Dann fuhren sie in die Flussmündung ein und warfen Anker vor Belém.
Hier verließen die Pilgrim Players das Schiff, mit ebenso viel Gerufe und Armgeschwenke, wie sie es betreten hatten. Maia und Clovis umarmten einander. Maia war sehr traurig über die Trennung. Sie gab ihm ihre Adresse bei den Carters, damit er sie dort besuchen konnte, sobald er in Manaus angekommen war.
»Das Haus heißt Tapherini. Das bedeutet Haus des Friedens, sagt Miss Minton, also ist es bestimmt sehr schön dort«, erzählte Maia. »Die Zwillinge werden sehr aufgeregt sein, wenn sie einen richtigen Schauspieler sehen.«
»Und du kommst bestimmt und siehst mich auf der Bühne?«
»Ich verspreche es«, sagte Maia. »Ich verspreche es ganz fest.«
Clovis umarmte nicht nur Maia, sondern auch Miss Minton. Es beeindruckte Maia, dass er bei seiner Angst vor so vielem anscheinend keine Angst vor ihrer finsteren Erscheinung hatte.
Die Reise auf dem Amazonas würde Maia nie vergessen. An manchen Stellen war der Fluss so breit, dass sie zwischen weit entfernten Baumlinien segelten, und Maia verstand, warum man ihn Flussmeer nannte. Ab und zu kamen sie an Sandbänken vorbei und Maia sah die ersten der Lebewesen, von denen sie gelesen hatte: einmal einen Wurf Capybaras, der hinter der Mutter hertapste (sie waren nahe genug, dass sie ihre lustigen Schnauzen und das sandige Fell erkennen konnte). Ein anderes Mal passierten sie einen Baum, dessen Wurzeln vom Sog des Flusses abgerissen worden waren, seine unbelaubten Zweige waren voller roter und blauer Papageien, die kreischend aufflogen, als sich das Schiff näherte. Und einmal sah Maia einen grauen Baumstamm am Ufer liegen, der plötzlich zum Leben erwachte.
»Oh, schauen Sie«, sagte sie. »Ein Krok… ich meine, ein Alligator. Mein erster!«
Ein Mann, der neben ihr stand, nickte und meinte, er sei froh, dass sie wüsste, dass es in diesem Teil der Erde keine Krokodile gäbe. »Du glaubst gar nicht, wie viele Leute das nie begreifen.«
Sie fuhren an Gummipflanzungen vorbei und an Indianerdörfern, deren Häuser auf Pfählen errichtet waren, damit sie bei Hochwasser nicht überspült wurden. Die Indianerkinder liefen auf den Landungssteg und winkten und riefen und Maia winkte zurück, bis sie außer Sicht waren.
Manchmal fuhr das Schiff so dicht am Ufer entlang, dass sie die alten Häuser von Kautschukpflanzern oder Kaffeehändlern sehen konnten, auf deren Veranden die Familien beim Tee saßen. Hunde aalten sich im Schatten, Hängekörbe waren mit scharlachroten Blumen gefüllt.
»Wird es bei den Carters auch so aussehen?«, hörte Maia nicht auf zu fragen. »Sie haben bestimmt eine Veranda, nicht wahr? Vielleicht könnten wir dort den Unterricht abhalten und auf den Fluss schauen.«
Sie wurde immer aufgeregter. Die Farben, die freundlich winkenden Indianer, die Vögel, all das begeisterte sie. Die Hitze machte ihr nichts aus.
Im Zentrum ihrer Gedanken waren jedoch die Zwillinge. Wie auf einem Bild sah sie die beiden vor sich in weißen Kleidern mit farbigen Schärpen, wie sie sie lachend und freundlich willkommen hießen. Sie malte sich aus, wie sie zu Bett gingen, sich gegenseitig die Haare bürsteten, in einer Hängematte lagen mit einem Korb voll junger Kätzchen im Schoß oder wie sie Blumen pflückten.
»Sie haben bestimmt einen großen Garten, der zum Fluss hinunterreicht, glauben Sie nicht?«, fragte sie Miss Minton. »Und vielleicht ein Boot mit einem gestreiften Sonnensegel. Ich mag Angeln eigentlich nicht besonders wegen der Haken, aber wenn sie es mir zeigen … bestimmt können sie gut von ihrem Land leben.«
Da der Brief der Zwillinge an sie nur zwei Sätze enthielt, konnte Maia deren Leben frei fantasieren, und das tat sie ohne Ende.
»Ich frage mich, ob sie wohl viele zahme Tiere haben? Ich denke schon, glauben Sie nicht? Nasenbären werden sehr zahm, aber vielleicht haben sie auch einen Affen als Haustier? Einen kleinen Kapuzineraffen, der ihnen auf der Schulter sitzt. Oder einen Papagei?«, fragte sie Miss Minton, die aber nur antwortete, sie solle abwarten, und ihr eine weitere Übung in portugiesischer Grammatik auftrug.
Aber was Miss Minton auch sagte, es spielte keine Rolle. In Maias Kopf paddelten die Zwillinge in ihrem Boot zwischen riesigen Seerosen herum, zogen furchtlos durch den Regenwald und spielten abends zweihändig Klavier; klangvoll drangen die Töne in die samtschwarze Nacht.
»Sie werden auch bestimmt von allem den Namen wissen, nicht? Von diesen orangefarbenen Lilien zum Beispiel, keiner scheint zu wissen, wie sie heißen«, sagte Maia.
»Der Name wird in einem Buch stehen«, entgegnete Miss Minton knapp, aber sie hätte sich den Atem sparen können, denn Maia wanderte weiter und weiter in das Leben von Gwendolyn und Beatrice hinein.
»Sie kürzen ihre Namen bestimmt ab, glauben Sie nicht auch? Vielleicht Gwen? Und Beattie?«
Maia fiel auf, dass Miss Minton ziemlich viel über die Tiere wusste, die ihnen auf der Flussfahrt begegneten, und als die Gouvernante sie auf Süßwasserdelfine aufmerksam machte, die vor dem Schiff herschwammen, fasste sie sich ein Herz und fragte sie, was sie bewogen hatte nach Brasilien zu gehen.
Miss Minton blickte über die Reling. Zuerst antwortete sie nicht und Maia errötete, weil sie glaubte unhöflich gewesen zu sein.
Dann sagte die Gouvernante: »Ich kannte mal jemanden, der hierher gezogen ist. Er hat mir vor einiger Zeit geschrieben. Und da habe ich es mit eigenen Augen sehen wollen.«
»Oh!«, machte Maia erfreut. Vielleicht hatte Miss Minton einen Freund hier und würde nicht einsam sein.
»Lebt er immer noch hier, Ihr Freund?«
Diesmal dauerte das Schweigen noch länger.
»Nein«, sagte Miss Minton. »Er ist gestorben.«
Nachdem sie eine Weile flussaufwärts gefahren waren, hielt das Schiff in Santarém, einer großen Hafenstadt, in der gerade Markttag war.
Die Passagiere durften an Land gehen und Maia hörte das vertraute Schnappen und sah, dass Miss Minton ihre große schwarze Handtasche geöffnet hatte.
»Mr Murray hat mir Reisegeld für dich mitgegeben. Gibt es irgendetwas, das du kaufen möchtest?«
Maias Augen glänzten. »Geschenke für die Zwillinge. Und vielleicht für Mr und Mrs Carter. Ich hätte das schon in England tun sollen, aber es ging alles so schnell. Hab ich denn genug?«
»Ja«, sagte Miss Minton trocken und gab Maia ein Geldbündel. Sie wäre froh gewesen, in drei Monaten so viel zu verdienen, wie Mr Murray Maia mitgegeben hatte, aber sie musste zugeben, dass Maia keinen verwöhnten Eindruck machte.
Der Markt war beeindruckend. Es gab Wassermelonen, größer als Babys, grüne Bananen und gelbe und solche, die fast orange waren. Nüsse lagen in großen Haufen aufgetürmt, Ananas und Pfefferschoten. Es gab frischen Fisch und getrockneten. Es gab Tiere, die an der Leine zerrten, und feine Spitzenarbeiten und Silberschmuck und geflochtene Körbe und Ledertaschen. Verkauft wurden all diese Sachen unter Lachen und Schwatzen von wunderschönen schwarzen Frauen, gehüllt in kräftig bunte Tücher. Es gab Indianer in europäischer Kleidung und Indianer mit bemalter Brust und Federschmuck und schlanke Brasilianerinnen mit goldbrauner Haut.
Aber Geschenke für die Zwillinge zu kaufen erwies sich als alles andere als einfach, denn Maia war ganz sicher, dass die Zwillinge sich nichts so sehr wünschten wie flauschige Hühner- und Entenküken, vielleicht auch eine weiße Maus. »Etwas Lebendiges ist immer das beste Geschenk«, sagte sie.
Aber Miss Minton blieb fest. »Du kannst ihnen keine Tiere kaufen, wenn du nicht weißt, was für Haustiere sie bereits haben. Du willst doch nicht, dass dein Geschenk gleich am ersten Tag aufgefressen wird.«
Also erstand Maia zwei Spitzenkragen für die Zwillinge und einen bestickten Schal für Mrs Carter und für Mr Carter eine lederne Brieftasche mit dem Bild eines Jaguars darauf.
Dann verschwand Maia und Miss Minton begann sich gerade zu sorgen, als sie zurückkam, einen blauen Sonnenschirm mit Fransen und einem geschnitzten Griff in der Hand.
»Weil sie doch Ihren auf Henry Hartington zerbrochen haben«, sagte Maia, »und der ist auch besser für die Sonne.«
»Und du, Maia? Was hast du für dich gekauft?«
Alles, was Maia sich wünschte, war ein Mischlingswelpe, der in einem Korb saß und sich flöhte. Aber wieder blieb Miss Minton fest. »Sie haben möglicherweise schon einen Hund, der das Haus bewacht«, sagte sie. »Mehrere, nehme ich an.«
Und damit musste Maia sich zufrieden geben.
Sie brauchten noch einige Tage, um den braunen, mit Blättern bedeckten Fluss hinaufzufahren. Wenige Stunden bevor sie im Hafen von Manaus anlegen sollten, wurden die Passagiere an Deck gerufen, um ein berühmtes Naturschauspiel zu bewundern.
Sie waren an der Stelle angekommen, die man »Hochzeit der Wasser« nennt, dort, wo die braunen Fluten des Amazonas auf das schwarze Wasser des Rio Negro treffen. Man konnte deutlich sehen, wie die Flüsse sich vermählten.
Als sie dann den Rio Negro hinauffuhren, sah Maia die grüngoldene Kuppel des Theaters von Manaus, sie sah Kirchtürme und das gelbe Zollgebäude.
Sie hatten Manaus erreicht. Sie waren angekommen.
3. Kapitel
Maia war ganz sicher gewesen, dass die Zwillinge am Hafen sein würden, um sie zu empfangen, doch es war weder von ihnen etwas zu sehen noch von ihren Eltern.
Die Passagiere hatten alle das Schiff verlassen, ihr Gepäck hatte den Zoll passiert, das geschäftige Treiben auf dem Kai hatte sich aufgelöst und noch immer kam keiner.
»Glauben Sie, dass man uns vergessen hat?«, fragte Maia und versuchte nicht allzu enttäuscht zu klingen. Plötzlich fühlte sie sich sehr verloren und so fern von all ihren Freunden.
»Dummes Zeug!«, schnaubte Miss Minton, aber ihre Nase sah noch spitzer aus als gewöhnlich, während sie suchend den Kopf hin- und herwandte.
Sie hatten über eine Stunde gewartet, als ein Mann in einem hellen, zerknautschten Anzug und einem Panamahut auf sie zukam. »Rafael Lima, Mr Carters Vertreter in Manaus«, sagte er. Der Mann hatte ein trauriges Gesicht mit gelblichem Teint und einem herabhängenden Schnauzbart. Und als er ihnen seine Hand zur Begrüßung gab, war diese feucht und schlaff. »Mr Carter hat das Boot für Sie geschickt. Er konnte nicht selbst kommen.«
Sie folgten ihm zu einem schwimmenden Kai, an dem ganz unterschiedliche Schiffe festgemacht hatten: ausgehöhlte Kanus, schnittige Segelboote sowie schmucke Barkassen in glänzenden Farben mit fröhlich gestreiften Markisen.
Das Boot der Carters hingegen war in einem dunklen Grün gestrichen, wie Spinat, auch die Markise war dunkelgrün, und an der Seite war kein Name aufgemalt, es stand nur CARTER da, um zu zeigen, wem es gehörte.
Als sie das Boot erreichten, erhob sich ein Indianer, der auf einem verladefertigen Ballen Kautschuk gesessen hatte, und warf seine Zigarette fort.
»Das ist Furo, der Bootsmann der Carters. Er wird Sie hinbringen.« Und nach einem weiteren schlaffen Händedruck war Lima gegangen.
Furo war anders als die lächelnden und winkenden Indianer, an denen sie vorbeigekommen waren, anders als die Matrosen an Bord, mit denen Maia gescherzt hatte.
Er zeigte ihnen die Kabine und zuckte die Schultern, als sie sagten, sie wollten lieber draußen an Deck bleiben. Dann startete er den Motor, zündete sich noch eine Zigarette an und starrte missmutig auf den dunklen Fluss.
Eine Stunde lang fuhren sie nun schon den Rio Negro hoch und hatten alle Zeichen der Stadt hinter sich gelassen.
Ohne sich dessen gewahr zu sein war Maia enger an Miss Minton gerückt. Er war so seltsam anders, dieser Teil des Flusses: geradlinig und still, ohne Sandbänke oder Inseln, nirgendwo waren Tiere zu sehen. Die Indianer, die auf den Kautschukplantagen arbeiteten und aufschauten, als das Boot vorbeikam, wandten sich ab …
Dann wies Furo auf das rechte Ufer und sie sahen ein niedriges Holzhaus mit einer umlaufenden Veranda, das in dem gleichen Dunkelgrün gestrichen war wie das Boot.
Unten auf dem Landungssteg warteten vier Personen darauf, sie zu begrüßen: eine Frau mit einem Sonnenschirm, ein Mann mit Sonnenhut auf dem Kopf – und zwei Mädchen!
»Die Zwillinge!«, rief Maia und strahlte über das ganze Gesicht. »O sehen Sie doch, da sind sie!«
Mit einem Schlag erwachten ihre Lebensgeister. Da waren sie und alles würde gut.
Miss Minton ergriff ihre Sachen, das Boot wurde festgemacht, und ohne Furos Hilfe abzuwarten sprang Maia auf den Steg. Dann erinnerte sie sich an ihr gutes Benehmen und ging zuerst auf Mrs Carter zu und machte einen Knicks.