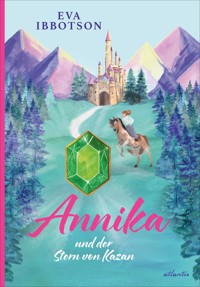6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Tierschutz mal anders Auf einer vergessenen Insel mitten im Atlantik leben drei schrullige alte Tanten, die sich um diese und um viele andere Tiere kümmern, die vor den Umweltsünden der Menschen geflüchtet sind. Allerdings brauchen Etta, Coral und Myrtle dringend Hilfe bei der Betreuung ihrer zahlreichen Schützlinge. Kurzerhand fahren sie nach London und kidnappen drei Großstadtkinder: Minette, Fabio und Lambert. Doch Lambert, der verwöhnte Millionärssohn, entpuppt sich als totaler Missgriff. Er bringt die Insel in allerhöchste Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Eva Ibbotson
Das Geheimnis derverborgenen Insel
Aus dem Englischenvon Sabine Ludwig
Für meinen Ehemann, der sichtatsächlich um ungewöhnlicheKreaturen kümmerte
1. Kapitel
Kindesentführung ist sicher nicht sehr nett, aber manchmal unumgänglich.
Tante Etta, Tante Coral und Tante Myrtle waren keine geborenen Kidnapper. Zum einen waren sie nicht mehr jung und Kindesentführung ist harte Arbeit, zum anderen waren sie trotz ihres etwas seltsamen Aussehens sehr warmherzige Wesen. Sie sorgten für ihren alten Vater, aber vor allem kümmerten sie sich um die Tiere der Insel, von denen einige höchst ungewöhnlich waren. Viele dieser Kreaturen waren von weit her über den Ozean auf die Insel gekommen, um sich helfen zu lassen. Aber in letzter Zeit hatten die Tanten gemerkt, dass sie selbst dringend Hilfe brauchten. Doch nicht die Hilfe von Erwachsenen, die in ihren Gewohnheiten festgefahren waren, die Hilfe musste von Kindern kommen, die jung waren und lernfähig.
An einem kalten, stürmischen Apriltag versammelten sich die drei Tanten um den Küchentisch und beschlossen endlich etwas zu unternehmen. Sie mussten ein paar Kinder finden und auf die Insel bringen; Kidnapping schien hierfür die vernünftigste Lösung zu sein.
»Auf diese Weise können wir die auswählen, die geeignet sind«, sagte Tante Etta. Sie war die Älteste der drei, eine große knochige Frau mit einem Bärtchen auf der Oberlippe, die jeden Morgen vor dem Frühstück fünfzig Liegestütze machte.
Die anderen beiden sahen aus dem Fenster auf den weichen grünen Rasen, das Meer mit seinen weißen Schaumkämmen und seufzten bei dem Gedanken daran, was ihnen bevorstand. All die Schlafpülverchen, präparierten Hamburger, die Taschen und Säcke und Cellokästen, die sie brauchen würden, um die Kinder hierher zu schaffen …
»Meint ihr, dass sie schreien und zappeln werden?«, fragte Tante Myrtle, die Jüngste. Sie litt unter Migräne und war sehr lärmempfindlich.
»Natürlich nicht. Sie werden doch bewusstlos sein«, sagte Tante Etta. »Total hinüber. Ich mag das genauso wenig wie du«, fuhr sie fort, »aber ihr habt doch letzte Woche die Sendung im Fernsehen gesehen.«
Die beiden anderen nickten. Als sie vor langer Zeit auf die Insel gekommen waren, hatte es hier keinen Strom gegeben, aber als ihr Vater hundert wurde und sein kleiner Zeh blau anlief, weil seine Füße nicht mehr richtig durchblutet waren, hatten sie einen Generator bestellt, damit ihr Vater eine elektrische Heizdecke benutzen konnte. Und warum dann nicht auch einen Wasserkocher und einen Fernseher, dachten sie dann.
Aber das mit dem Fernsehen war ein großer Fehler gewesen, und zwar wegen der Tiersendungen. Tierfilme gehen immer schlecht aus. Zuerst sieht man den drolligen Wombat, wie er mit seinen Jungen herumtollt, und dann – fünf Minuten vor Schluss – wird einem mitgeteilt, dass es in ganz Australien nur noch zwölf fortpflanzungsfähige Paare gibt. Oder es gibt Bilder vom Harlekinfrosch aus Costa Rica, der fröhlich quakend auf einem Lilienblatt hockt, und in der nächsten Minute erfährt man, dass er keine Überlebenschance hat, weil die Sümpfe alle austrocknen. Die Tanten konnten keine Sendung über den Regenwald mehr sehen ohne zu heulen. Vor einer Woche hatte es eine besonders schlimme Reportage gegeben, in der schlechte Menschen dabei gezeigt wurden, wie sie die Bäume verbrannten und abschlugen, und man sah Affen und Jaguare in Todesangst davonjagen.
»Und was ist, wenn wir aussterben?«, hatte Tante Coral gefragt und sich die Nase geputzt. »Nicht nur die Wombats und Harlekinfrösche und Jaguare, sondern wir!«
Die anderen hatten sofort verstanden. Wenn ein ganzer Regenwald einfach so verschwinden konnte – warum dann nicht auch drei ältere Damen? Und wenn sie nicht mehr da waren, was wurde dann aus ihrer Arbeit und wer würde sich um die Lebewesen kümmern, die auf der Suche nach Trost und Hilfe zu ihnen auf die Insel kamen?
Es gab noch etwas, was die Tanten beunruhigte. Seit geraumer Zeit wollten die Tiere die Insel nicht wieder verlassen. Auch lange nachdem sie geheilt waren, blieben sie einfach da, so als ahnten sie irgendetwas. Für die Tanten bedeutete das mehr und mehr Arbeit. Es gab keinen Zweifel: Hilfe musste herbeigeschafft werden, und zwar schnell. Also beschlossen sie zu tun, was zu tun war.
»Wie finden wir die richtigen Kinder?«, fragte Myrtle und sah sehnsüchtig hinaus zu der Landzunge, wo die Seehunde lagen. Einer der Seehunde mit Namen Herbert war ihr ganz spezieller Freund und sie wäre viel lieber draußen bei ihm gewesen und hätte für ihn auf dem Cello gespielt oder gesungen.
»Wir werden Tanten«, sagte Etta bestimmt und rückte die Brille auf ihrer langen Nase zurecht.
Die anderen beiden sahen sie erstaunt an. »Aber wir sind bereits Tanten«, sagten sie. »Wie können wir da welche werden?«
Das stimmte. Vor vielen Jahren waren sie, damals noch fünf Schwestern, mit ihrem Vater auf die Insel gekommen. Sie hatten ein verfallenes Haus vorgefunden und verlassene Strände, auf denen nur die Strandläufer und Meerlerchen ihre Spuren hinterlassen hatten. Nonnengänse gab es, die auf dem Weg von Grönland hier eine Pause einlegten, und die Seehunde, die völlig furchtlos aus dem Meer stiegen, um am Strand ihre Jungen zu bekommen.
Die fünf Schwestern hatten das Haus instand gesetzt und einen Garten angelegt. Eines Tages dann hatten sie einen ölverklebten Seevogel gefunden, der auf einem Felsen angespült worden war.
Es stellte sich heraus, dass es gar kein Seevogel war. Ölverschmutzt, das ja, aber eben kein Vogel, sondern etwas völlig Anderes … Und da begriffen sie, dass eine höhere Macht sie auf diese Insel geführt hatte. Sie hatten ihre Lebensaufgabe gefunden.
Betty allerdings, eine der fünf Schwestern, hatte sich aus der Insel nichts gemacht. Sie hasste den Wind und den Regen, die Fischschuppen im Tee und die Eiderenten, die sich in ihren Pantoffeln ein Nest bauten. Sie hatte die Insel verlassen und einen Steuerinspektor aus dem Örtchen Newcastle upon Tyne geheiratet. Nun lebte sie in einem Einfamilienhaus mit drei Sorten Raumspray im Klo und Deo für die Achselhöhlen und keiner einzigen Fischschuppe weit und breit.
Und sie hatte zwei Kinder. Sie nannte den Jungen Bubi und das Mädchen Kleinchen (obwohl sie natürlich richtige Namen hatten). Aber so schrecklich die beiden auch waren, sie waren Kinder, und aus diesem Grund waren Bettys Schwestern Tanten geworden, da alles, was man dazu tun muss, darin besteht, Neffen oder Nichten zu haben.
Und deswegen sahen Coral und Myrtle auch so überrascht aus und sagten: »Aber wir sind Tanten.«
»Nicht diese Art von Tanten«, sagte Etta ungeduldig. »Ich meine die Art Tanten, die in einem Büro oder einer Agentur sitzen und sich Tätige Tanten oder Kindertanten bei Tag und Nacht oder Tantenhilfe e.V. nennen. Tanten, die von Eltern dafür bezahlt werden, dass sie deren Kinder zur Schule oder zum Zahnarzt bringen oder am Bett der Kinder sitzen, wenn sie krank sind.«
»Warum machen die Eltern denn das nicht selbst?«, fragte Myrtle.
»Weil sie zu viel zu tun haben. Früher hatten die Leute richtige Tanten und Großmütter und Kusinen für solche Sachen, aber heute sind die Familien zu klein und die richtigen Tanten gehen auf Partys und haben Männerbekanntschaften!«, schnaubte Etta.
Coral nickte. Sie war die künstlerisch Veranlagte von den dreien; eine ziemlich große, beleibte Person, die selbst beim Hühnerfüttern eine Federboa und auffallenden Schmuck trug und nachts im Mondlicht Tango tanzte. »Das ist eine gute Idee«, sagte sie. »So kann man sich die Kinder aussuchen. Schließlich wollen wir nicht bei solchen wie Bubi und Kleinchen landen.«
»Das stimmt; aber Kinder, die von ihren Eltern wirklich geliebt werden, wollen wir auch nicht«, sagte Myrtle und warf ihr langes graues Haar zurück.
»Auf keinen Fall«, sagte Etta. »Schließlich wollen wir keinen Aufstand anzetteln.«
»Aber nette Kinder werden doch sicher von ihren Eltern geliebt«, warf Myrtle ein. »Und wenn sie nicht nett sind, dann wollen wir sie auch nicht.«
Etta rümpfte die Nase. »Du wirst dich wundern, meine Liebe, wie viele Kinder es auf der Welt gibt, deren Eltern nicht wissen, wie glücklich sie sein müssten.«
Die drei Schwestern überlegten noch eine ganze Weile hin und her, aber keiner fiel etwas Besseres als Kidnapping ein, jedenfalls nicht, wenn die Lage der Insel weiterhin geheim bleiben sollte. Und das war das Wichtigste.
Es gab noch eine weitere Tante, die fünfte der Schwestern, die bei der Ausführung von Ettas Plan hätte nützlich sein können (nicht die mit den drei verschiedenen Raumsprays, die war wirklich zu nichts nütze): Tante Dorothy, die Etta im Alter am nächsten stand und genau der Typ war, den man bei einer Kindesentführung hätte brauchen können. Aber Dorothy saß in Hongkong im Gefängnis. Sie war nach China gefahren, um einen Restaurantbesitzer davon abzuhalten, Schuppentier-Steaks zu servieren. Schuppentiere sind wunderschöne Tiere und außerdem vom Aussterben bedroht und sollten keinesfalls gegessen werden. Dorothy war sehr verärgert gewesen und hatte dem Restaurantbesitzer mit dessen Wok eins übergezogen, woraufhin man sie ins Gefängnis steckte. In einem Monat sollte sie entlassen werden. Also mussten die Schwestern die heikle Aufgabe erst einmal zu dritt erledigen, wobei noch nicht klar war, ob Myrtle überhaupt mitmachen sollte. Myrtle war nicht sehr weltgewandt und außerdem würde sie die Trennung von Herbert nur schwer ertragen.
»Bist du sicher, dass du nicht lieber hier bleiben willst?«, fragte Coral.
Aber Myrtle hatte beschlossen tapfer zu sein und ihren Teil beizutragen.
»Wir dürfen nur Daddy nichts sagen«, meinte Etta. »Schließlich ist Entführung ein Verbrechen und er könnte sich Sorgen machen.«
Captain Harper lag im zweiten Stock in einem riesigen Bett, mit einem Teleskop, das aufs Meer gerichtet war. Die drei hatten es längst aufgegeben, ihm irgendetwas zu erzählen. Zum einen war er stocktaub, so dass es ziemlich lange dauerte, bis er etwas begriff, zum anderen nutzte er jede Gelegenheit, Geschichten aus der Zeit zu erzählen, als er noch ein kleiner Junge war. Es waren gute Geschichten, aber jede der Tanten hatte sie mindestens dreihundert Mal gehört. Also vermieden sie es, sich länger als nötig bei ihrem Vater aufzuhalten.
Wichtig war nur, dass ihr Koch Artie genau wusste, was in ihrer Abwesenheit zu tun war. Artie war ein entflohener Sträfling, der in einem Ruderboot an ihrem Ufer angeschwemmt worden war. Er behauptete, als junger Mann einen Mord begangen zu haben; aber er konnte nichts töten, was Arme, Beine oder Augen hatte, noch nicht einmal eine Krabbe. Dafür konnte er köstliches Porridge zubereiten. Als das geklärt war, suchten die drei alles zusammen, was sie brauchten: Chloroform und Schlafpulver sowie Betäubungspfeile, die sie ansonsten benutzten, um verletzte Tiere für die Behandlung ruhig zu stellen.
Für den Transport der Kinder war ebenfalls gesorgt: Tante Etta hatte eine große Segeltuchtasche, Tante Coral einen Schrankkoffer aus Aluminium mit Luftlöchern darin und Tante Myrtle ihren Cellokasten. Nun mussten sie nur auf einen günstigen Wind warten, um mit ihrem Schiff Peggoty zur nächsten Insel zu segeln; von dort würden sie den Dampfer nehmen.
Es war eine lange und schwierige Reise. Vor vielen Jahren hatte das Militär auf der Insel eine Versuchsstation für Funksignale einrichten wollen. Damit ihre genaue Lage geheim blieb, wurden die Seekarten verändert und kein Schiff durfte an die Insel heranfahren. Letztlich hatte man die Insel nicht gebraucht, aber sie war nach wie vor ein vergessener Ort und die Tanten wollten, dass das so blieb.
»Eigentlich werden das gar keine richtigen Entführungen, weil wir ja von den Eltern kein Lösegeld verlangen«, sagte Etta.
»Mehr so eine Art Kinderklau«, stimmte Coral zu.
Aber egal, um was es sich nun handelte, es würde auf jeden Fall gefährlich sein und alles andere als nett, und während sie ihrer Insel zum Abschied zuwinkten, schlugen ihre Herzen sehr schnell.
2. Kapitel
Bis zu ihrem zehnten Lebensjahr hatte Minette die Fahrt zwischen London und Edinburgh bereits 47-mal gemacht. Das bedeutete 47 abgepackte Sandwiches vom Bahnhofskiosk, 47-mal im Zug aufs Klo gehen und 47-mal Bauchweh, denn der Wechsel von einem Elternteil zum anderen drehte ihr regelmäßig den Magen um.
Minettes Vater lebte in Edinburgh, in einem großen grauen Haus. Er war Grammatikprofessor. Minettes Mutter lebte in einer Wohnung in London und war Schauspielerin, besser gesagt, sie wäre gern eine gewesen, wenn jemand sie denn engagiert hätte. Minettes Eltern hatten sich getrennt, als Minette drei Jahre alt war, und sie hassten einander von ganzem Herzen.
»Sag diesem Mistkerl von einem Vater, dass er schon wieder seine Alimente nicht pünktlich gezahlt hat!« Dergleichen waren die Botschaften, die Minettes Mutter gewöhnlich ihrer Tochter auf den Weg gab, wenn sie sie zum Bahnhof King’s Cross brachte, um sie in den Zug nach Edinburgh zu setzen. Und mit den Worten »Na, unterhält deine Mutter noch diese Absteige für betrunkene Schauspieler?« würde ihr Vater sie vom Zug abholen.
Minette richtete ihren Eltern derlei Gemeinheiten niemals aus. Sie dachte sich stattdessen höfliche und freundliche Botschaften aus, aber weder ihre Mutter noch ihr Vater nahmen sie ihr ab.
Auf ihrer Reise, die anfangs noch fünf Stunden dauerte, hielt sie aus dem Zugfenster stets nach netten Häusern Ausschau, in denen sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater eines Tages zusammenleben würde, wie eine ganz normale Familie. Mit einer Katze, einem Kanarienvogel und einem Hund. Es war nicht der Umstand, dass ihre Eltern getrennt waren, der Minette so schmerzte. Sie kannte viele Kinder mit getrennten Eltern. Nein, es schmerzte sie, dass sie einander so hassten.
Normalerweise wurde Minette auf diesen Reisen von einer Tante begleitet. Die Tante stammte aus einer Vermittlung, die sich Karitative Tantenhilfe nannte, und es war entscheidend für den Verlauf der Reise, wie diese Tante war. Denn wenn sie die ganze Zeit quatschte oder irgendwelche dämlichen Spiele spielen wollte, dann hatte Minette keine Gelegenheit, sich Häuser für sich und ihre Eltern auszusuchen oder sich wundervolle Szenen auszumalen, wie die, in der sie nach einem Unfall ins Krankenhaus kam und die an ihr Bett geeilten Eltern sich über ihrem blutenden Körper tief in die Augen sahen, um festzustellen, dass sie sich noch immer liebten.
Und dann, gerade als sie ihre 48. Reise antreten sollte, stellte Minette fest, dass es ihr inzwischen völlig gleichgültig war, was für eine Tante man schicken würde. Sie hatte jegliche Hoffnung aufgegeben. Ihre Eltern würden einander ewig hassen und sie würde den Rest ihres Lebens damit verbringen, von London nach Edinburgh und wieder zurückzufahren, und niemals genau wissen, wo nun ihr eigentliches Zuhause war und wohin sie überhaupt gehörte.
Aber als ob eine höhere Macht sie erhört hätte, wurde an diesem Tag eine ganz und gar außergewöhnliche Tante geschickt. Sie unterschied sich so sehr von den bisherigen Tanten, mit denen sie gereist war, dass Minette und ihre Mutter erstaunt stehen blieben, als sie zum Zeitungskiosk auf Bahnsteig eins kamen, wo sie wartete.
»Sie sind …?«, begann Mrs Danby.
Die Frau nickte. Sie war sehr groß, mit einem kleinen Bärtchen auf der Oberlippe, und trug eine riesige Tasche, die ein wenig nach Fisch roch.
»Ich bin Ihre Tante«, sagte sie mit tiefer Stimme und tippte auf ihren Kragen, an dem ein Schild befestigt war. Kreative Tantenhilfe stand darauf und darüber die Worte: Ich heiße Etta.
Wenn Minettes Mutter es nicht so eilig gehabt hätte, mit ihrem neuen Freund ins Kino zu gehen, hätte sie vielleicht ein paar Fragen gestellt. Schließlich ist eine kreative Tante nicht unbedingt dasselbe wie eine karitative Tante, aber wie dem auch war, Minettes Mutter gab ihr das Geld für die Fahrkarten und Minettes Essen, nahm für einen kurzen Moment die Zigarette aus dem Mund, um Minette einen Kuss zu geben, und weg war sie.
Und bald saßen sich Minette und die Tante in einem dieser altmodischen Zugabteile ohne Korridor gegenüber, während der Zug durch die Londoner Vororte fuhr.
Tante Etta und ihre beiden Schwestern hatten eine harte Woche in London hinter sich. Sie hatten eine Pension gefunden, die voll war mit Leuten ihresgleichen. Tantenähnliche Personen, die in die Stadt gekommen waren, um ihre Möpse auf Rassehundeshows zu präsentieren oder um Treffen abzuhalten, in denen es um die Einrichtung von Altersheimen für altersschwache Esel ging. Trotzdem verabscheuten die drei Schwestern den Lärm und den Verkehr und die dreckige Luft in der Stadt. Außerdem war es gar nicht einfach, eine Agentur zu finden, die sie einstellen wollte.
Und als Etta schließlich engagiert und zur Arbeit geschickt worden war, da stellten sich die ihr zugewiesenen Kinder als einfach unmöglich heraus. Sie nahm einen kleinen Jungen mit auf eine Flussfahrt, der sich die ganze Zeit mit Eis und Popcorn und Chips voll stopfte und das Einwickelpapier ins Wasser warf. Sie musste mit einem Mädchen zum Zahnarzt gehen und zusehen, wie es den Zahnarzt in die Hand biss, und sie musste einem greinenden Balg namens Tarquin Sterndale-Fish Gesellschaft leisten, der Masern hatte.
Zu dem Zeitpunkt, als Etta auf dem Bahnhof King’s Cross Minette treffen sollte, war sie fast schon überzeugt davon, dass diese Entführungsidee ausgemachter Blödsinn war. Die Welt schien voller Bubis und Kleinchens zu sein und es wäre sicher besser, ausgerottet zu werden wie der Regenwald, als solche schrecklichen Kinder mit auf die Insel zu bringen.
Ettas erster Eindruck von Minette war nicht gerade viel versprechend. Das Mädchen sah irgendwie bedrückt und verhärmt aus, sie war klein für ihr Alter und sehr dünn und wirkte, als wäre sie schon müde auf die Welt gekommen. Ein verweichlichtes und schwaches Kind würde aber bei der schweren Arbeit auf der Insel zu nichts nütze sein. Außerdem war Minette reichlich albern angezogen, mit einem T-Shirt, auf dem stand Drück mich und ich quieke, und in ihrem langen Haar steckten jede Menge Spangen und Schleifchen. Über ihrer Schulter baumelte eine rosa Plastikhandtasche in Form eines Herzens.
Minette ihrerseits war genauso wenig von Tante Etta angetan wie diese von ihr. Eine ganze Weile saßen die beiden schweigend da. Von Zeit zu Zeit tropfte aus der Segeltuchtasche in der Gepäckablage ein wenig Wasser auf Tante Ettas grauen Dutt, aber sie schien es nicht zu bemerken.
»Läuft da was aus?«, fragte Minette.
Die Tante sah hoch und schüttelte den Kopf. »Dieses Segeltuch wird niemals richtig trocken. Ich benutze die Tasche, um Seehunde darin zu transportieren. Natürlich nur die Jungen, ein ausgewachsener Seehund würde da niemals reinpassen.«
Das schien Minette zu interessieren, ihr Gesicht verlor den gedrückten und besorgten Ausdruck. »Sind Sie Tierärztin?«
»Nicht ganz, aber es kommt der Sache schon ziemlich nahe.«
Dann schwiegen sie wieder. Minette wollte nicht neugierig sein und sah aus dem Fenster. Gerade kamen sie an dem ersten von den Traumhäusern vorbei, in dem Minette mit ihren Eltern leben wollte. Es war ein altes Bahnwärterhäuschen mit einem kleinen Giebel und Blumenkästen vor den Fenstern. Und als ob die Tante Minettes Gedanken erraten hätte, sagte sie: »Es muss hübsch sein, dort zu wohnen. Bestimmt fahren nachts Geisterzüge vorbei, mit interessanten Gespenstern darin, das bringt Stimmung in die Sache.«
Minette starrte sie an. »Glauben Sie etwa an …?«
»Aber sicher«, sagte die Tante lebhaft. »Ganz bestimmt. Ich glaube an fast alles. Du nicht?«
»Mein Vater sagt, dass man nichts glauben darf, was man nicht sieht oder beweisen kann«, erwiderte Minette.
»Ach ja?«
Als sie ungefähr eine Stunde gefahren waren, öffnete Minette ihren Koffer und wurde sehr geschäftig. Sie hatte pinkfarbene Socken getragen mit Mickymäusen drauf, die zog sie nun aus und stattdessen schlichte weiße an. Dann wechselte sie ihr T-Shirt mit der Aufschrift Drück mich und ich quieke gegen ein marineblaues mit langen Ärmeln und nichts Geschriebenem drauf. Und schließlich stopfte sie das herzige Täschchen in ihren Koffer und nahm stattdessen eine praktische Lederhandtasche heraus.
Schweigend sah die Tante zu, wie sich Minette von einem aufgebrezelten Modepüppchen in ein vernünftig, wenn auch etwas altmodisch gekleidetes Schulmädchen verwandelte.
Aber Minette war noch nicht fertig. Sie nahm Bürste und Kamm, stellte einen Spiegel auf ihre Knie und fing an ihr Haar in zwei lange, feste Zöpfe zu flechten.
»Ich zieh mich immer an dieser Stelle um«, erklärte Minette. »Hier gibt es nämlich nichts Interessantes draußen zu sehen. Mein Vater kann Anziehsachen mit Schrift drauf nicht ausstehen. Lustige Socken auch nicht. Er meint, das sei ordinär. Und er hasst unordentliche Haare.«
»Und auf der Rückfahrt ziehst du dich wieder um, löst deine Haare und steckst all das Tüdelzeug wieder rein?«
»Ja, meine Mutter mag es offen.«
»Und du? Wie magst du es denn?«
Minette seufzte. »Ich hätte am liebsten kurze Haare.«
»Kein Problem, ich hab eine Schere dabei. Warum schneiden wir sie nicht einfach ab?« Tante Etta öffnete ihre geräumige Handtasche und nahm eine Schere heraus.
»Nein! Das darf ich nicht! Dann wären ja beide wütend auf mich.«
Tante Etta zuckte mit den Schultern und stopfte die Schere zurück in ihre Tasche. »Langes Haar kann ja vielleicht auch ganz praktisch sein.«
»Wie das?«
»Na ja, um Sachen zu polieren … Muschelschalen und so. Und wenn man ins Wasser fällt, kann man daran herausgezogen werden.«
Sie kamen nun an dem zweiten von Minettes Traumhäusern vorbei. Ein niedriges weißes Haus am Flussufer, mit einer Trauerweide und einem Garten, der bis ans Wasser reichte. Aber dieses Mal sah Minette nicht wie sonst ihre Eltern auf dem Rasen zusammen Tee trinken. Sie hörte ihren Vater sagen »Diese Weide muss weg, sie nimmt das ganze Licht!« und ihre Mutter antworten »Wenn du diesen Baum fällst, bring ich dich ins Irrenhaus!«.
Und plötzlich, ohne erkennbaren Grund, erzählte Minette dieser fremden Frau alles über die endlosen Reisen von der kleinen Wohnung ihrer Mutter, in der es nach Gesichtspuder und Curry aus dem Schnellrestaurant von unten roch, wo im Bad die Strumpfhosen zum Trocknen hingen, hin zu dem kalten, ordentlichen, ernsten Haus, in dem die alte Standuhr tickte. Und sie erzählte von den albernen Träumen, die sie hatte, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, und der Aussichtslosigkeit derselben.
»Glauben Sie, es gibt einen dritten Ort? Nicht das Haus meines Vaters und nicht die Wohnung meiner Mutter, sondern irgendwo anders, am Meer vielleicht? Und werde ich diesen Ort eines Tages finden?« Danach fuhr sie erschrocken zurück, denn die grimmige Tante sah sie seltsam forschend an.
Aber dann nickte Tante Etta nur. »Natürlich«, sagte sie. »Natürlich gibt es diesen dritten Ort. Den gibt es für jeden. Aber man sollte ihn nicht mit Menschen aus seinem alten Leben füllen. Wenn du diesen dritten Ort finden willst, dann musst du es allein tun.«
»Aber ich bin noch ein Kind. Ich kann nicht fortgehen und irgendwo allein leben.«
»Wahrscheinlich nicht. Nicht ganz, trotzdem kannst du einen Neubeginn machen, wenn du den Mut dazu besitzt.«
»Ich bin nicht mutig«, sagte Minette bestimmt. »Ich bin feige.« Das war eines der wenigen Dinge, in denen ihre Eltern sich einig waren. »Ich habe Angst vor der Dunkelheit und davor, vom Dreimeterbrett zu springen, und davor, dass andere mich auslachen.«
Der Zug hielt in York und die Tante kaufte Sandwiches von einem Imbisswagen. »Ich schlage vor, du gehst dir jetzt die Hände waschen und dich etwas frisch machen«, sagte sie. »Es ist Zeit, Mittag zu essen. Welches der Sandwiches möchtest du? Ei mit Kresse oder Käse und Tomaten?«
»Das mit Käse und Tomaten, bitte.«
Wenn Minette hätte sehen können, was geschah, kaum dass sie das Abteil verlassen hatte, wäre sie sicher entsetzt gewesen. Aus der Tasche ihrer langen marineblauen Unterhose zog die Tante ein kleines Döschen mit bräunlichem Puder, den sie sorgfältig über dem Käse und den Tomaten verteilte. Dann zog sie den Reißverschluss der Segeltuchtasche auf und setzte sich mit äußerst zufriedenem Lächeln wieder auf ihren Platz. »Meine Erste«, murmelte sie, »meine Allererste. Oh, das ist wirklich aufregend!« Und dann: »Ich frage mich, wie es Coral wohl anstellt.«
Für Coral war es sehr viel schwieriger, wie eine professionelle Tante auszusehen. Sie war die dickste von den dreien, hatte in jungen Jahren eine Kunstschule besucht und liebte exzentrische Kleidung. Heute hatte sie sich alle Mühe gegeben, halbwegs normal auszusehen. Sie trug nur zwei Halsketten und ein Paar baumelnder Ohrgehänge, so dass sie sich so tantenhaft wie nur irgend möglich vorkam, als sie die Glocke an dem großen Haus in Mayfair läutete.
Sie sollte einen gewissen Hubert-Henry Mountjoy vom Haus seiner Großeltern in London zurück zu seinem Internat in Berkshire bringen, eine Aufgabe, zu der sie wenig Lust verspürte.
Die ersten Kinder, die sie zu betreuen gehabt hatte, waren ebenso schlimm gewesen wie die von Etta: Ein ekelhaftes, schwabbeliges Gör hatte versucht, sie ans Schienbein zu treten, und ein kleiner Junge hatte im Park auf einem Käfer herumgetrampelt. Dieser Hubert-Henry Mountjoy würde keinen Deut besser sein, bestimmt so ein eingebildeter kleiner Aristokratenlümmel. Wenn sie ihn dabei erwischte, wie er Käfer tottrat, würde sie ihn verprügeln, mit dem Tantenjob aufhören und nach Hause fahren, das hatte Tante Coral sich fest vorgenommen.
Als sie von einem hochnäsigen Dienstmädchen in die Eingangshalle geführt wurde, fühlte sie sich so elend wie nie zuvor. Das Haus war riesig, düster und kalt. In einer Ecke stand ein großer Messinggong, und Bilder von längst gestorbenen Mountjoys mit Schnauzbärten hingen an den Wänden. Schweren Herzens sah sie der ersten Begegnung mit Hubert-Henry entgegen.
Die Tür zum Salon öffnete sich. Heraus kam ein schmächtiger Junge in Schuluniform, vorwärts geschoben von einem großen, weißhaarigen Mann, der genauso aussah wie die Männer auf den Porträts, nur dass er nicht tot war. Erstaunt öffnete Coral ein wenig den Mund.
Hubert-Henry war ein schmaler und grazil gebauter Junge mit lackschwarzem Haar, olivfarbenem Teint und riesigen dunklen Augen. Etwas in seinen anmutigen Bewegungen und in dem wachsamen Ausdruck seiner Augen erinnerte sie an Bilder von Kindern in Südamerika, die inmitten von Orchideen und breitblättrigen Bäumen des tropischen Urwaldes lebten.
»Das ist Hubert-Henry!«, trompetete der Alte mit dem Schnauzbart. »Wie Sie sehen, ist er nicht als englischer Gentleman geboren, aber wir tun alles, damit aus ihm einer wird, nicht wahr, Hubert?«
Als er dem schweigsamen kleinen Jungen dabei einen Stoß in die Rippen versetzte, sah Coral einen derartigen Hass im Gesicht des Jungen, dass sie einen Schritt zurück machte und mit ihrem Hintern an den großen Gong stieß. Woraufhin Hubert-Henry seinen Kopf zurückwarf und laut loslachte.
Eine halbe Stunde später saßen sie nebeneinander in einem großen schwarzen Auto auf dem Weg zu Huberts Schule. Das Auto war eine geschlossene Limousine, wie man sie bei Hochzeiten und Beerdigungen mieten kann, mit einer Trennscheibe zwischen Fahrer und Gästen. Die Fahrt nach Berkshire dauerte nur drei Stunden, aber der Chauffeur hatte sich geweigert Hubert-Henry allein dorthin zu bringen. Also hatte man Tante Coral engagiert, um ihn nach Greymarsh Towers zu begleiten und der Anstaltsleiterin zu übergeben. Beim letzten Mal, als man ihn ins Internat zurückbringen wollte, hatte der kleine Junge anscheinend versucht aus dem Zug zu springen und wegzulaufen.
»Und du heißt wirklich Hubert-Henry?«, fragte Tante Coral, als sie London hinter sich gelassen hatten.
»Nein.«
»Wie heißt du dann?«
»Fabio.«
Er sprach mit einem leichten Akzent. Spanisch? Portugiesisch? Coral hoffte, er würde weitersprechen, aber er saß stumm und missmutig neben ihr.
Schließlich kam doch etwas: »Ich hab gesagt, dass ich die nächste Tante, die sie mir aufhalsen, schlagen werde. Richtig doll schlagen.«
»Oh, das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun«, erwiderte Coral. »Ich habe einen Tritt wie ein Esel. Das kommt von den Haaren, musst du wissen.«
»Was für Haaren?«
»Die Haare auf meinen Beinen. Wir haben alle behaarte Beine, meine Schwestern und ich. Haare geben Kraft, das steht schon in der Bibel. Denk nur an Samson.«
Aber das war nur so dahingesagt. Coral war telepathisch veranlagt, wie künstlerische Menschen so oft. Das hieß, dass sie manchmal Dinge wusste ohne zu wissen, woher sie sie wusste, und deshalb öffnete sie nun ihren Korb, zog einen Malblock heraus und ein Stück Zeichenkohle und begann zu zeichnen.
Fabio drehte immer noch missmutig seinen Kopf weg. Als Coral fertig war, legte sie die Zeichnung neben sich auf den Sitz. Bald darauf hörte sie, wie der Junge nach Luft schnappte. Er hatte das Blatt genommen und schien es mit den Augen zu verschlingen. Coral sah, dass ihm eine Träne die Wange herunterlief.
»Sah so dein Zuhause aus?«, fragte sie sanft.
Fabio nickte. »Der Baum stimmt. Ein Papayabaum, und der Affe auch … ein Kapuzineräffchen, das ich gezähmt habe. Aber da standen drei Hütten zusammen, es gab nicht nur eine. Wir wohnten in der, die dem Fluss am nächsten war. Die Hühner gehörten uns, aber die Ziege gehörte meinem Onkel in dem mittleren Haus. Das Schwein haben Sie gut getroffen, nur sein Bauch war noch dicker, er schleifte auf dem Boden.«
»Warum bist du von dort fortgegangen, Fabio?«, fragte Coral.
Das heimwehkranke Kind starrte immer noch auf die Zeichnung, auf der ein Fluss zu sehen war, ein großer Baum voller Früchte und ein Fischerboot am Ufer. »Ich weiß nicht genau«, sagte er. Aber dann erzählte er, was er wusste, und den Rest konnte sie sich denken.
Henry Mountjoy, sein Vater, war ein reicher Engländer gewesen mit einem großen Haus auf dem Land. Aber er war ein Spieler. Er hatte große Schulden gemacht und schließlich England verlassen, um in Südamerika Gold zu suchen. Natürlich fand er keins. Er wurde krank und Fabios Mutter, eine Tänzerin aus einem Nachtclub, las ihn halb tot in Rio auf und pflegte ihn gesund. Dann heirateten sie. Aber seine Gesundheit war ruiniert und er konnte nicht mehr arbeiten. Bald nach Fabios Geburt kehrte er nach England zurück.
Zuerst lebte Fabio mit seiner Mutter in Rio, und als diese dann mit einem anderen Mann zusammenzog, brachte man ihn flussaufwärts in den Wald zu seinen Großeltern. Viele Menschen gab es in den drei Hütten und wenig Geld, aber Fabio war glücklich. Sein Großvater war ein Indio und wusste einfach alles, Fabios Großmutter hatte als Köchin für einen portugiesischen Plantagenbesitzer gearbeitet und konnte die wundervollsten Geschichten erzählen.
Nach über einem Jahr kam Fabios Mutter in Begleitung eines Engländers, der sich die ganze Zeit den Schweiß von der Stirn wischte und beim Anblick des Schweins die Nase rümpfte. Es stellte sich heraus, dass Fabios Vater gestorben war und auf dem Totenbett seine Eltern, die alten Mountjoys, gebeten hatte Fabio nach England zu holen und zu einem englischen Gentleman zu erziehen.
Das war der Anfang eines Alptraums. Fabios Mutter bestand darauf, dass er ging. Henry Mountjoy hatte so viel von seinem großartigen Haus in England erzählt, dass sie ihren Sohn nicht um sein Erbe bringen wollte. Aber das großartige Haus war längst verkauft, um Henrys Schulden zu bezahlen, und für seine alten Eltern reichte ein Blick auf den kleinen wilden Jungen, um zu schaudern.
Da die Großeltern zu alt waren, um Fabio in einen englischen Gentleman zu verwandeln, sollte das in einem Internat besorgt werden. Nur waren Internate heutzutage nicht mehr streng genug, fanden zumindest die alten Mountjoys. Sie hatten zwei ausprobiert, die Fabio unverändert verlassen hatte, außer dass er besser Englisch sprach. Aber Greymarsh Towers war anders. Der Direktor dort verfuhr nach dem Motto: »Gelobt sei, was hart macht!« Und die Jungs dort waren regelrecht gemein.
»Sie nennen mich Affe oder Bohnenfresser und versuchen mich zu fesseln. Aber diesmal bringe ich sie um. Ich bringe sie alle um und den Direktor dazu, und wenn sie mich ins Gefängnis stecken, macht mir das gar nichts!«
Doch bevor Fabio dazu kam, den Direktor zu ermorden, musste er sich erst einmal übergeben.
Er übergab sich hinter Slough und auf der anderen Seite von Maldenhead, dann in den Eingang eines Hauses mit dem schönen Namen Im Lorbeerhag in Reading, und je näher sie Greymarsh Towers kamen, desto schlechter ging es Fabio.
Als Coral Greymarsh Towers erblickte, dachte sie, dass ihr ebenfalls übel würde, müsste sie hierhin zurückkehren. Es war ein riesiger Kasten mit vergitterten Fenstern, dessen schmutzige Steinmauern kalt und abweisend aussahen.
Es war höchste Zeit zu handeln. Der Chauffeur sollte sie an der Schule absetzen; Coral hätte mit dem Zug zurückfahren sollen.
»Würdest du bitte hier warten, Fabio«, sagte sie zu dem Jungen. »Behalten Sie ihn im Auge, Mr Fowler. Passen Sie auf, dass er nicht wegläuft.«
Der Junge, der gerade angefangen hatte ihr ein wenig zu vertrauen, sank in seinem Sitz zusammen und Coral marschierte zum Eingangstor. Allein der Geruch von Greymarsh hätte genügt sie für immer von dort fern zu halten. Es roch nach Desinfektionsmittel, zerkochtem Kohl und Abort. Was die Hausdame betraf, die jetzt aus ihrem Büro kam, so hätte die ein prima Kamel abgegeben: Die Nase war genau richtig, ebenso die höhnisch hochgezogene Oberlippe und die trüben, misstrauischen Augen. Nur dass Kamele nichts für ihren Gesichtsausdruck können. Menschen schon.
»Ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht in Bezug auf Hubert-Henry Mountjoy überbringen«, sagte Coral. »Ein schwerer Anfall von Burry-Burry-Fieber hat ihn erwischt. Er kann im Moment nicht zur Schule kommen.«
Die Leiterin verzog ihren Mund. »So etwas bleibt bei ausländischen Kindern natürlich nicht aus. Bestimmt hat er das aus dem Dschungel mitgebracht.«
Da Tante Coral das Burry-Burry-Fieber gerade erfunden hatte, nickte sie nur und sagte, sie würde dem Internat unverzüglich mitteilen, wenn es dem Jungen besser ginge.
Dann ging sie zum Auto zurück und sagte: »Es tut mir Leid, aber in der Schule ist eine Meningitis-Epidemie ausgebrochen. Alle sind in Quarantäne und Hubert darf die Schule nicht betreten.«
Der in den Polstern zusammengekauerte Junge setzte sich auf und lächelte. Sein Lächeln war sehr nett und Coral wusste, was zu tun war.