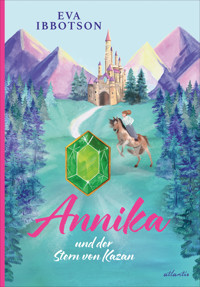18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Obwohl sie bislang noch jeden Heiratsantrag abgelehnt hat, wird sie von allen Frau Susanna genannt. Weil der Mann, den sie liebt, schon verheiratet ist, lebt sie allein im glanzvollen Wien der Jahrhundertwende. Am malerischen Madensky-Platz führt sie einen erfolgreichen Modesalon. Die Ideen für ihre wundervollen Kleider fliegen Susanna zu, sobald sie die Augen schließt. Die Menschen am Platz kennt sie wie ihre Westentasche: den alten Antiquitätenhändler Haller, der sich ärgert, wenn ihm jemand ein Buch abkaufen will, das er noch nicht zu Ende gelesen hat, Herrn Starsky, Professor für Reptilienkrankheiten, der gerade die Effekte von Spinat auf das Schildkrötenwachstum erforscht, den Schnauzer Rip, der seinem Frauchen jeden Morgen pünktlich um sieben die Zeitung bringt. Begleitet wird das Leben auf dem Platz vom unermüdlichen Klavierspiel des geheimnis vollen Fremden, der in die Mansarde gegenüber eingezogen ist. Doch obwohl Susanna hier ein Zuhause und eine Familie gefunden hat, lastet auf ihrem sonnigen Gemüt eine große Sehnsucht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eva Ibbotson
Der Modesalon des Glücks
Roman
Aus dem Englischen von Liselotte Julius und Lena Riebl
Kampa
31. März 1911
Madensky-Platz, Wien
Heute Morgen wachte ich besonders gut gelaunt auf.
In meiner Phantasie sah ich ein Kleid vor mir – beinahe fertig, beinahe greifbar: cremefarbene Seide, der Rock dicht mit Volants aus cremefarbener Klöppelspitze besetzt, das Oberteil in Biesen genäht, aber sonst schmucklos bis auf eine einzelne Rose. Als ich zu Bett gegangen war, war ich mir noch unschlüssig gewesen, welche Farbe diese haben sollte, aber beim Aufwachen wusste ich, sie musste ebenfalls cremefarben sein: eine Rose im selben Farbton, ein wenig verblüht, fast welk …
»Frau Susanna, Ihnen fliegen die Kleider zu wie Schubert seine Musikstücke«, sagte eine Kundin mal zu mir, und ich Dummkopf freute mich so über das Kompliment, dass ich für die Änderungen an ihrem Cape einen viel zu geringen Betrag in Rechnung stellte.
Doch die Vorstellung von diesem Kleid war nicht das Einzige, was mich heute früh froh stimmte. Noch ehe ich die Fensterläden öffnete, wusste ich, dass sich der scharfe Ostwind gelegt hatte und der Frühling endlich gekommen war.
Beim Aufstehen warf ich einen Blick in den Spiegel über der Kommode; auch in dem grellen Morgenlicht konnte ich mich noch immer sehen lassen. Ich bin sechsunddreißig, aber ich hätte sie tragen können, die cremefarbene Robe mit den Glockenärmeln und der Seidenrose.
»Faszinierend, wie aus deinen eigenwilligen Zügen perfekte Schönheit entsteht«, sagte einmal jemand zu mir. »Zu großer Mund, zu breite Stirn, Wangenknochen wie ein böhmischer Bauer … Aber die Augen – und das Haar … Wunderschön!«
In Wahrheit hat das nicht irgendwer gesagt, sondern Feldmarschall Gernot von Lindenberg, und der ist nicht »irgendjemand«.
Eine Sekunde lang sah ich im Spiegel, was er gesehen hatte, dieser ungestüme, alternde Mann, als er mein Gesicht mit seinen Händen umschlossen hatte. Dann blinzelte ich und fand mich wieder einer ganz gewöhnlichen Frau gegenüber – blondes Haar, blaue Augen, nicht mehr ganz jung.
Ich wohne auf einem kleinen Platz in der Innenstadt, direkt über meinem Laden. Die Glocken des Stephansdoms läuten die Uhrzeit für mich, und bis zur Oper sind es zu Fuß nur zwölf Minuten (in Wien misst man jede Strecke in Bezug auf die Oper!), aber dennoch lebt es sich hier so ruhig wie auf dem Land. Mein Schlafzimmer und das Bad, das ich (zur Belustigung der Handwerker) unbedingt einbauen wollte, gehen zum Hinterhof hinaus, das Wohnzimmer und die Küche – sowie natürlich der Modesalon – nach vorn auf den Madensky-Platz.
Ich hatte recht gehabt, was den Frühling anging. Während ich darauf wartete, dass das Wasser für meinen Kaffee kochte, lehnte ich mich, noch immer im Kimono, aus dem Fenster. Das Wasser im Brunnen glitzerte, der von Tauben belagerte Messingkopf des Oberst Madensky glänzte in der Sonne. Die Luft war warm, und aus den Geschäften und Hauseingängen stiegen verführerische Gerüche zu mir herauf, die im Winter nur zu erahnen sind: frisches Brot … Vanille … Sattelseife.
Als ich den Platz vor acht Jahren zum ersten Mal sah, wusste ich sofort, dass ich dort wohnen und meinen Laden haben wollte. Hier gibt es einfach alles: einen Brunnen, ein Denkmal, ein Café – sogar unsere eigene kleine Kirche. In der Mitte des Brunnens steht zwar keine steinerne Heldengestalt oder Göttin mit Füllhorn, wie ich es mir früher gewünscht hätte, sondern nur der Schutzheilige des Feuers (und der Feuerwehrautos), Florian, eine sanfte Gestalt mit einem steinernen Eimer, mit dem er alle Flammen löscht, die ihm in die Quere kommen. Die Kirche, deren kleiner Friedhof die Westseite des Platzes einnimmt, ist ihm geweiht. Sie gleicht eher einer Dorfkirche: weiß getüncht und mit einem Zwiebelturm, drinnen nur eine schlichte Madonna, aus Holz geschnitzt, mit einem Jesuskind auf dem Schoß. Ich kenne alle Gräber auf dem Friedhof: Familie Steiner (Geranien), Familie Heinrid (Kruglilien), Familie Schmidt (vernachlässigt und zugewuchert, aber überall im Gras sprießen wilde Glockenblumen).
An der Ostseite schirmen fünf Kastanien den Platz gegen die belebte, schmale Walterstraße ab; und dort steht mit dem Rücken zum Verkehr General Madensky auf seinem Sockel. Ich hätte ihn gern hoch zu Ross gesehen – da wäre auch für die Tauben mehr Platz geblieben –, doch dafür war er wohl nicht bedeutend genug.
Er hatte in den italienischen Feldzügen gekämpft und war in der Schlacht von Solferino gefallen, eine tragische Schlacht, bei der alle verloren. Der Kaiser verlor seinen Ersten Offizier im Nebel, die Offiziere verlegten ihre Truppen, und Österreich verlor die Lombardei und Venedig. Madensky soll ein freundlicher Mann gewesen sein. Er wollte, dass alle seine Soldaten dunkle Schnurrbärte trugen, und verteilte Farbe an diejenigen, die das Pech hatten, mit hellem Haar geboren worden zu sein. Man erkennt das in seinem Gesicht: den Wunsch, dass die Dinge geordnet und simpel sind.
Aus dem Fenster konnte ich unten auch das Schild meines Ladens sehen. Anfangs wusste ich nicht, wie ich ihn nennen sollte; dann entschied ich mich einfach für meinen Vornamen: Susanna. Und es funktionierte! »Wir treffen uns bei Susanna«, sagten die Leute jetzt, oder: »Geh zu Susanna, die findet schon das Richtige für dich!«
Es gibt nur drei Läden auf dem Platz, alle an der Südseite: rechts von mir ein Antiquariat, links ein Sattler. Ich in der Mitte – zwei Schaufenster, Rahmen und Tür glänzend goldschwarz lackiert – wirklich schön!
Gegenüber, im Café an der Ecke Walterstraße, war Joseph dabei, Tische und Stühle auf den Bürgersteig zu stellen, das sicherste Zeichen, dass der Frühling angebrochen war. Das Café Strauß ist nicht gerade ein Literatentreffpunkt: Jeritza wird hier auf dem Heimweg von der Oper kaum Station machen, und Hugo von Hofmannsthal schreibt seine Oden anderswo. Zwanzig Leute in das Café zu quetschen wäre schon eine reife Leistung, aber Josephs Eier im Glas sind berühmt, und das Mohnkipferl-Rezept seiner Mutter stammt noch aus der Zeit der türkischen Besatzung.
Ebenfalls gegenüber, allerdings auf der anderen Seite neben der Kirche, in dem hellgrünen Biedermeierhaus der Schumachers, hängte Lisl, das Dienstmädchen, ihr Federbett aus dem Mansardenfenster. Dann verschwand sie, und ich wusste, sie lief nach unten, um Frau Schumacher, die ihren langersehnten Sohn erwartete, das Frühstück ans Bett zu bringen. Zur Familie Schumacher gehören sechs kleine Mädchen: Mitzi und Franzi; Steffi und Resi; Kathi und Gisi – aber das neue Baby wird bestimmt ein Junge. Niemand kann sich vorstellen, dass der liebe Gott es über sich bringt, Herrn Direktor Albert Schumacher schon wieder zu enttäuschen, wo er doch unbedingt einen Erben für seine Holzhandlung braucht. Lisl, die im Kloster erzogen wurde, hat versprochen, uns sofort nach der Geburt ein Signal zu geben. Bei einer guten Nachricht wird sie ein weißes Handtuch heraushängen, andernfalls eine schwarze Schürze.
»Wie Theseus mit seinem Segel, Frau Susanna«, erklärte sie.
Niemand nennt mich Fräulein Susanna, obwohl ich nie verheiratet war. Auch meinen Nachnamen, Weber, verwendet kein Mensch, der taucht nur auf Rechnungen und Lieferscheinen auf.
Nun wartete ich noch auf das Ereignis, das bei uns den eigentlichen Tagesbeginn einläutet: Die Tür des schäbigen Wohnhauses direkt gegenüber öffnete sich, ein kurzbeiniger schwarzer Schnauzer, am Halsband eine Geldbörse, watschelte wichtigtuerisch die drei Stufen hinunter und bog in die Walterstraße ein. Bis er die Neue Freie Presse für seine Herrin, die Hausmeisterin Frau Hinkler, geholt hat, ist Rip geistesabwesend und unzugänglich, doch sobald die druckfrische Zeitung ihr zu Füßen liegt, widmet er sich den öffentlichen Belangen, hockt im Hauseingang und wägt ab, was er zulassen kann und was er verhindern muss. Er hat den Quadratschädel eines Schnauzers und den Schwanz einer Bisamratte, aber seine Träume und seine kurzen Beine erinnern eher an Napoleon.
Bis ich den Kaffee aufgebrüht und zum Fenster mitgenommen hatte, waren die Chorknaben unter der Obhut von Pater Anselm aus dem Pfarrhaus neben dem Sattler gekommen. In St. Florian wird nur einmal wöchentlich eine Messe gesungen, sodass der Knabenchor unter der Leitung des Paters auch in anderen Kirchen auftritt. Die süßen kleinen Jungen mit ihren scharlachroten Mänteln und marineblauen Hosen werden oft auf Schritt und Tritt von gefühlvollen Seufzern begleitet, aber ich seufzte nicht. Wie immer galt meine besondere Aufmerksamkeit Ernst Bischof, dem Meisterschüler. Seine Mozart-Soli rühren die Gemeinde zu Tränen, aber er ist ein wahrer Satansbraten. Ich konnte gerade noch sehen, wie der liebe Kleine einem anderen Jungen einen heftigen Tritt vors Schienbein verpasste. Den Tag von Ernst Bischofs Stimmbruch werden Frau Schumacher und ich mit Champagner feiern.
Und jetzt kamen nach und nach die vertrauten Gesichter der Leute, die den Platz regelmäßig als Abkürzung zu den Trambahnen an der Ringstraße nutzen.
Professor Starsky trug heute einen ziemlich ramponierten Strohhut, unter dem sein schütteres graues Haar wie ein Heiligenschein hervorstand. Er kommt jeden Morgen vorbei und trägt meistens irgendein braunes Paket bei sich: eine Eidechse mit Lungenproblemen oder eine Schildkröte, die in ihrem Panzer verendet ist. Er ist Professor für Reptilienkrankheiten, und die Menschen schicken ihm ihre Lieblinge aus dem ganzen Königreich. Als er mich sah, wie ich mich wie Rapunzel ungebührlich aus dem Fenster lehnte, lüftete er den Hut.
»Guten Morgen, Frau Susanna.«
»Guten Morgen, Herr Professor. Was haben S’ denn heute?«
Er hob das Päckchen hoch. »Eine Stutzechse. Vom Besitzer einer Tierhandlung in Bozen.«
Vor drei Jahren traf ich den Professor auf dem Friedhof, wo er traurig am Grab seiner Frau stand, und lud ihn zu einer Tasse Kaffee ein. Im vergangenen Sommer, als er in meinem Laden vor einem Platzregen Zuflucht suchte, machte er mir einen Heiratsantrag.
»Ich würde natürlich nicht von Ihnen erwarten, dass Sie mich lieben«, sagte er, »eine so schöne und erfolgreiche Frau wie Sie. Aber ich habe ein Haus, wie Sie wissen, und eine Villa am Grundlsee – und ich würde die Arbeit natürlich nicht mit nach Hause bringen« – an dieser Stelle berührte er das steife Bein eines Chamäleons, das aus dem Packpapier herausragte – »wenn Sie mir die Ehre erweisen würden.«
Es war ein netter Heiratsantrag; ich lehnte ebenso nett ab, und wir blieben Freunde.
Nach Professor Starsky kam die englische Miss, die ihre Setterhündin immer im Volksgarten spazieren führt. In ihrem gesprenkeltem Tweed, vollbusig und langbeinig wie ihr Hund, ist sie eine solche Augenweide, dass jeder auf dem Platz ihr wohlgefällig nachschaut. Joseph vergaß seinen Wischlappen und starrte sie an; Herr Schumacher ließ seine sechs Töchter am Frühstückstisch sitzen und eilte zum Fenster. Und Rip lief die drei Stufen vor seiner Tür herunter, zitterte, wagte sich vorwärts … und rief sich dann selbst zur Vernunft, denn die Hündin gehörte, genau wie ihr Frauchen, in die unerreichbare Welt der Legenden und Träume.
Die Uhr vom Stephansdom schlug sieben, und unsere eigene Kirchenglocke tat es ihr eineinviertel Minuten später nach. Jetzt tauchte Gretl, meine Näherin, aus der Walterstraße zwischen den Kastanienbäumen auf, in der Hand mein Frühstückskipferl und eine Milchkanne. Es wurde Zeit, den Tag zu beginnen.
Als ich mich vom Fenster abwandte, hörte ich wieder die Klänge, die seit einigen Wochen genauso zu unserem Leben gehören wie das Plätschern des Brunnens oder die Kirchenglocken: Jemand übte Klavier. Die Töne kamen aus der kleinsten, schäbigsten Mansarde im obersten Stock des Wohnhauses direkt gegenüber – das Haus, das von Rip, dem Schnauzer, bewacht wurde –, und zwar pausenlos von morgens bis abends. Los geht es mit Tonleitern, Dutzenden von Tonleitern: chromatischen, welchen in Oktaven, Arpeggios … dann Etüden von Chopin, von Czerny, von sonst wem; Präludien von Bach, ein paar Stücke von Liszt … und neuerdings eine Beethoven-Sonate, die dann irgendwo im letzten Satz plötzlich abreißt. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie jemanden so unentwegt, mit solcher Energie üben hören, und das Seltsame ist, ich weiß nicht, wer da spielt. Wir sahen, wie das Instrument ins Haus gehievt wurde, ein magerer, gebeugter Mann mit schütteren Koteletten, vermutlich aus Osteuropa, geht aus und ein, doch einmal meinte ich, die Musik zu hören, nachdem er gerade über den Platz davongegangen war.
Ich lauschte noch einen kurzen Moment. Dann zog ich mich an, steckte mein Haar hoch und stieg hinauf ins Dachgeschoss, um Nini zu wecken.
Eigentlich ist es nicht meine Aufgabe, meine Direktrice zu wecken. Sie sollte von allein aufwachen und um sieben Uhr dreißig an ihrer Nähmaschine sitzen, aber Nini ist überzeugte Anarchistin und hat den vergangenen Abend auf einer Revolutionärsversammlung in Ottakring verbracht. Sie hatte Sandalen mit hohem Absatz getragen, die sie beinahe drei Wochenlöhne gekostet hatten, und eine Boa aus Straußenfedern, die sie aus dem Laden ausgeliehen hatte. Warum ich ihr das durchgehen lasse, weiß ich selbst nicht.
Nähen lasse ich vorwiegend in Heimarbeit, aber im Atelier hinter dem Laden ist Platz für zwei Ganztagskräfte. Gretl, die außer Haus schläft, ist ein richtiger kleiner Packesel, willig und anspruchslos. Sie erledigt Botengänge, näht Säume und Einfassungen; ihr Leben kreist um ihren Bräutigam und seinen Feuerwehrwagen, eine Primadonna von einer Maschine, die jetzt von der Mechanisierung bedroht wird.
Nini ist ein anderes Kaliber. Ihre Stiche sind so klein wie meine, sie hat einen unfehlbaren Geschmack, und wenn sie auch eigentlich zu mager ist für ein Modell, lasse ich sie trotzdem im Salon Kleider vorführen.
Sie wachte gerade auf, räkelte sich und streckte einen Fuß unter der Bettdecke hervor. Einen Fuß, dessen lang gestreckte El-Greco-Zehen voll blutiger Blasen waren.
Ich wurde sofort wütend.
»Mit Demonstrationen für die Revolution in so ungeeigneten Schuhen ist jetzt ein für alle Mal Schluss, hörst du! Ich dulde nicht, dass du blutverschmiert an meine Stoffe gehst und meine Kleider vorführst!«
Nini sah mich vorwurfsvoll an. Sie ist neunzehn und könnte meine Tochter sein – aber dazu vielleicht später mehr.
»Es war der Jahrestag des Textilarbeiterstreiks in Jaroslaw«, erklärte sie. »Wir sind direkt am Donaukanal entlangmarschiert, und alle haben sich mit uns solidarisiert.«
»Und ich kriege dann demnächst wieder Besuch von der Polizei. Du gibst erst Ruhe, wenn sie dich eingesperrt haben.«
»Wer den Fortschritt will, muss leiden«, murmelte meine Direktrice, erhob sich mühsam und humpelte zum Waschtisch. Schwarzes, zerzaustes Haar, kühn geschwungene madjarische Augenbrauen, Hakennase und ein unnatürlich langer Hals, der jede ihrer Bewegungen unvergesslich macht.
»Hier geht’s doch gar nicht ums Leiden. Das nimmst du bestimmt mit Wonne auf dich. Aber die Läuse …« sagte ich – und Nini zuckte zusammen.
Aber ich verstand sie natürlich. Ich zog sie auf und verzweifelte an ihr, wenn sie einerseits zehn Minuten brauchte, um eine Spinne vom Waschtisch zu entfernen, andererseits Pläne schmiedete, Erzherzöge umzubringen und die Bourgeoisie zu beseitigen, aber ich verstehe sie. Sie wünscht sich eine bessere Welt für die Armen und Unterdrückten – und will bei diesem Kampf auch noch gut aussehen. Tun wir das nicht alle?
Ich entdeckte Nini, als sie für Paul Ungerers Aktklasse in seinem Atelier am Schottenring Modell saß. Resolut und nackt thronte sie auf einem Rohrsessel, das schwarze Haar wallte ihr über den Rücken, ein Bein hatte sie lässig ausgestreckt. Mit dem Hintern saß sie dicht am Ofen, einem schwarzen, launischen Monster ähnlich dem, das Émile Zola umgebracht hat.
Paul Ungerer ist ein eingebildeter Narr, der ein schwarzes Samtberet trägt und sich für Delacroix hält, doch seine Frau ist eine gute Kundin, und ich hatte damals versprochen, ihr das bestellte Eislaufkostüm vorbeizubringen.
Die Studenten zeichneten das Modell, und Paul Ungerer stolzierte im Atelier umher und gab sich sarkastisch, als ein dumpfer Schlag ertönte; der Stuhl auf dem Podest war umgekippt – das nackte Modell lag ohnmächtig auf der pflaumenblauen Samtdekoration.
Ninis Oberschenkel waren rot-weiß kariert, wo das Geflecht des Sessels sich in ihre Haut gegraben hatte, und die Verbrennungen an ihrem Po waren nicht zu verachten. Ich geigte Paul Ungerer die Meinung, was den Studenten gefiel, und nahm Nini mit nach Hause.
Ich wollte sie eigentlich nur ein wenig aufpäppeln, aber dann stellte sich heraus, dass ihre Mutter Näherin gewesen war. (Der Vater, ein Ungar, ein eitler Husar, ganz Säbel und sapkas und große Klappe, hatte die beiden sitzen gelassen).
Seltsamerweise war es der Anarchismus, der Nini zu einem so guten Modell machte. Beim Vorführen darf man auf keinen Fall unterwürfig auftreten, und dieses leicht wahnsinnige Arbeitermädchen konnte hochmütig an einer Bürgermeistergattin vorbeigleiten und sie aus schwarzen Augen verächtlich anblitzen, bis die arme Frau geradezu nach jedem Kleid lechzte, das sie trug.
Normalerweise gehe ich nach dem Frühstück gleich hinunter und schließe den Laden auf, aber heute blieb ich, wegen des schönen Frühlingswetters, noch ein bisschen draußen und plauderte mit meinem Birnbaum.
Mein Hof grenzt an den des Buchhändlers, Augustin Heller, dessen geschichtsträchtiger und außergewöhnlicher Laden in die Walterstraße hinausragt. Heller ist alt und verbringt den ganzen Tag damit, seine antiquarischen Bücher zu lesen. Es ärgert ihn sehr, wenn die Kundschaft ihm ein Buch abkaufen will, bevor er es fertiggelesen hat. Gestern ist seine elfjährige Nichte Maia zu Besuch gekommen und entwischte jetzt im Nachthemd in den Garten.
»Du willst nicht unbedingt nach Madagaskar?«, hörte ich sie sagen. »Wirklich nicht, Mitzi? Willst du nicht die Welt bereist haben, bevor du stirbst?«
Sie ist ein starkes Mädchen mit rabenschwarzem Haar, eine Leseratte und Abenteurerin.
»Nein, will ich nicht«, antwortete die arme Mitzi, das älteste der sechs Schumacher-Mädchen. »Ich will den besten Guglhupf in Wien backen, bevor ich sterbe.«
Der Verkaufsraum meines Ladens ist ganz in Gelb und Weiß gehalten, als säße man in einem Gänseblümchen. Die Vorhänge an den Fenstern und um die hohen Spiegel haben die Farbe von frisch gepflückten Zitronen (nicht zu vergleichen mit Eigelb), und die Wände sind elfenbeinfarben, wie die Schalen, in die ich immer frische Blumen stelle. Der Teppich ist grau, die Sessel und Sofas mit austernfarbenem Samt bezogen, und auf den Tischchen liegen nicht nur Modezeitschriften, sondern stehen auch Aschenbecher, damit die Herren, die vorbeikommen und die Silhouetten ihrer Frauen oder Mätressen in die Luft zeichnen, sich auch wohlfühlen.
Im Atelier sieht es natürlich anders aus. Es fehlt an Platz, und deshalb brummt es dort wie im Maschinenraum eines Schiffs. Die beiden Nähmaschinen, an denen die Mädchen arbeiten, stehen neben den Flügeltüren, die auf den Hof führen; der Zuschneidetisch nimmt eine Wand ein, der Schrank die andere. Die Regale mit den Stoffballen reichen fast bis an die Decke, und jedes Nadelkissen, jede Schachtel mit Schneiderkreide und Maßband hat einen festen Platz.
Zwischen Atelier und Salon liegen die beiden Räume für die Anprobe: sehr ruhig, sehr intim, aber verschwenderisch ausgestattet wie die Zelte von Süleyman dem Prächtigen.
An diesem Morgen war alles bestens. Der Empfangsraum strahlend hell. In dem einen Schaufenster ein braunes Samtkleid mit schwarzer Verschnürung, ein Rückblick auf den Winter; im anderen ein grün besticktes Musselinkleid, meine Huldigung an den Frühling. Beide sind wunderschön, aber nichts im Vergleich zu dem cremefarbenen Seidenkleid, das ich mir in meiner Phantasie ausgemalt hatte und das den Verkehr vor dem Schaufenster bald zum Erliegen brächte, weil die Damen sich die Nasen an der Scheibe platt drücken würden.
Ich schloss gerade die Tür auf, als die alte Blumenfrau Anna über den Platz auf mich zusteuerte.
»Da hab ich was für Sie«, sagte sie und stellte ihren Korb ab. »Extra für Sie aufgehoben.«
Sie hatte Veilchen aus Parma, Osterglocken und Narzissen aus dem Süden der Dolomiten dabei – und drückte mir ein Sträußchen winziger Blumen in die Hand, keine davon viel länger als mein Daumen.
»Ich wusste, dass die was für Sie sind«, sagte sie und ließ ihren Goldzahn aufblitzen.
Wilde Alpenveilchen! Die hab ich immer mit meiner Mutter auf den Waldwiesen über der Donau gepflückt, in der Wachau, wo ich geboren bin. Mir erschienen sie damals als Kind fast menschlich: die Blütenblätter wie gespitzte Koboldohren, die dicken silber gesprenkelten Blätter wie Schutzschilde.
Das Bild, das ich mir damals von Wien machte, als ich noch Sanna war, die barfüßige Tochter des Dorfschreiners, habe ich bis heute nicht vergessen. Die Kaiserstadt, das Herz des Reichs. Wie deutlich ich alles vor mir sah: den Kaiser in seiner goldenen Uniform, der mit der weiß behandschuhten Hand winkte, wenn er in seiner Karosse mit den goldenen Rädern von der Hofburg in seine Sommerresidenz Schönbrunn fuhr … Die eleganten Menschen, die auf der Prater-Hauptallee flanierten, das Marmorvestibül der Oper mit den funkelnden Kandelabern … Und nun, da Wien für mich zu einem realen Ort geworden ist, mit klappernden Mülleimerdeckeln und albernen Hunden, liebe ich es sogar noch mehr. Es war ein mühsamer Weg, der mich bis zu diesem Laden auf diesem Platz führte. Ich ließ keine Hilfe zu, nicht einmal von dem Mann, den ich liebe, aber seit ich hier bin, erwache ich jeden Morgen mit dem Gedanken: Ich bin, wo ich sein möchte. Das ist mein Zuhause.
Ich glaube nicht an die Gerüchte, die Joseph im Café gegenüber gelegentlich herumtratscht: dass es Pläne gibt, die Walterstraße zu verbreitern und die Häuser um den Platz teilweise abzureißen. Nicht mal Herr Willibald Egger, der für Stadtentwicklung zuständige Minister, würde so haarsträubende Maßnahmen ergreifen. Und trotzdem: Als ich die Blumen in einer Schale arrangierte, verspürte ich plötzlich das Bedürfnis, etwas festzuhalten, zu bewahren … meinen Alltag hier auf dem Madensky-Platz. An die Tragödien, die Dummheiten, die großen Feste werde ich mich erinnern – daran erinnert sich jeder. Aber was ist mit den ganz normalen Dingen, den kleinen Momenten? Wer interessiert sich für sie?
So sitze ich jetzt am Ende dieses ersten Frühlingstages an meinem Fenster und beginne mein Tagebuch. Ich werde versuchen, es ein Jahr lang zu führen, und ich schreibe es, um mich zu erinnern … aber auch, damit es die Person, für die ich lebe – falls man das von jemandem, dem man nie begegnen wird, so sagen kann, vielleicht sollte ich besser sagen, die Person, der ich mein Leben widme –, damit diese Person es vielleicht eines Tages findet und sagt: »Ah, verstehe. So war es also damals in einem Modesalon mitten in Wien. So war es also bei Susanna …«
April
Wenn es jemanden gibt, den ich aus tiefstem Herzen verabscheue, dann ist das der russische Impresario Sergei Djagilew. Warum hat er seine glamourösen Ballerinen und ausgefallenen Kostüme nicht in St. Petersburg gelassen? Musste er sie unbedingt hierher importieren, nur um arme Schneiderinnen wie mich zu quälen?
Um zehn Uhr früh reichte mir Frau Hutte-Klopstock, Gattin des Stadtgartenamtsdirektors, eine Zeitschrift und erklärte, sie wolle aussehen wie die Karsawina in Der Feuervogel.
»Etwas Durchsichtiges, hab ich mir gedacht. Schimmernd … in flammendem Rot oder Orange.«
Frau Hutte-Klopstock ist robust und muskulös; ein kräftiger, sportlicher Typ. Sie klettert. Eine kleine Bergspitze in der Hohen Tatra wurde nach ihr benannt, und das ist eine tolle Angelegenheit. Aber als Primaballerina? Du lieber Himmel!
Ich brachte sie in den Anproberaum, zu ihrem Double, einer von Nini mit drei Lagen auswattierte Schneiderpuppe, was ihren Eifer freilich keineswegs dämpfte.
»Meine Schwester hat die Ballets Russes in Paris gesehen. Sie sollen unglaublich gewesen sein! Sie hatte auch die Idee, Ihnen das Kleid in Auftrag zu geben.«
Die Wunschvorstellungen unserer Kundinnen langsam, geduldig herunterzuschrauben, bis sie nicht mehr absurd sind, das ist für uns Schneiderinnen die schwierigste Aufgabe. Es kostete mich eine halbe Stunde, von dem flammenden Rot auf ein zartes Perlmuttrosa zu kommen und ihr nahezubringen, dass es ihrem Mann sicher lieber wäre, wenn der durchsichtige, fließende Georgette auf einem Unterkleid drapiert würde, wenn sie das neue Kleid zum nächsten Empfang im Rathaus tragen wollte. Sie ließ sich Gott sei Dank überzeugen. Bis zu ihrem nächsten Besuch in einem Monat, wenn sie dann aussehen will wie Sarah Bernhardt in L’Aiglon.
Meine nächste Kundin kostete mich auch Kraft, obwohl Lea Cohens Anforderungen im Grunde einfach sind. Jedes Kleid muss teuer sein, man muss es ihm ansehen, und es muss unbedingt kostspieliger sein als alles, was ihre Schwägerin Miriam möglicherweise tragen könnte.
Ich hatte mich auf kleine Perlen an Kragen und Ärmelaufschlägen sowie ein mit Silberstickerei verziertes Mieder eingelassen. Jetzt wollte sie aber auch noch Pailletten haben …
»Nein, ausgeschlossen«, erklärte ich entschieden, während ich die Ärmel aus smaragdgrünem Moiré absteckte. Ich arbeite seit sieben Jahren für Lea, wir sind befreundet. »Ich muss an meinen Ruf denken.«
»Aber es ist für eine Bar-Mizwa – der Sohn meines Cousins, ich hab’s Ihnen ja erzählt.«
»Das ist mir egal. Und wenn es das Beschneidungsfest des Schahs von Persien wäre, aus meinem Salon geht niemand so aufgedonnert wie zu einer Maskerade! Von mir aus lass ich Ihnen die Rechnung einrahmen, die können Sie sich dann als Brosche anstecken und Miriam zeigen, aber Pailletten – nur über meine Leiche!«
Da musste sie lachen, doch gleich darauf traten ihr zu meiner Bestürzung Tränen in die Augen.
»Ach, meine Liebe, ich weiß nicht, was ich ohne Sie anfangen soll«, erklärte sie und suchte nach ihrem Taschentuch.
»Er will also immer noch weggehen?«
Lea nickte. »Das verzeih ich diesem Theodor Herzl nie. Seit Heini sein Buch gelesen hat, ist er wie ausgewechselt. Wer um alles in der Welt braucht einen jüdischen Staat? Was hab ich in Palästina verloren?«
Ich unterdrückte ein Lächeln. »Vielleicht kommt es ja gar nicht so weit. Es ist nicht einfach, sich von seinen Wurzeln zu lösen. Ihrem Mann würden seine Patienten sicher fehlen.«
Sie zuckte die Schultern. »Ich weiß, er ist verrückt. Der beste Arzt von Wien, und der will Orangen züchten. Ausgerechnet Orangen! Sie sollten mal das Theater erleben, wenn ich frisches Obst auf den Tisch stelle. Da braucht er eine extra Serviette wegen dem Saft, ein besonderes Obstmesser und mindestens drei Fingerschalen … und dann wäscht er sich hinterher trotzdem noch zehn Minuten lang die Hände.« Sie tupfte sich die Augen ab und schniefte. »Es ist schon schlimm genug, dass man sterben muss, um in den Himmel zu kommen. Aber muss man wirklich vorher noch ins Gelobte Land?«
Zwischen zwei und vier Uhr schließe ich mein Geschäft. Gretl, die nur zehn Minuten entfernt wohnt, geht zum Mittagessen nach Hause, während Nini (ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist) bei mir isst.
Heute schwiegen wir uns beharrlich an, wobei mir meine Direktrice über ihr Gulasch hinweg finstere Blicke zuwarf. Ich wollte am Nachmittag einen Fiaker zum Palais Metz nehmen und das graue Tageskleid aus gerippter Seide abliefern, das ich für die alte Gräfin gemacht habe – und von der Gräfin Metz hält Nini gar nichts.
Ich erinnere mich noch genau, wie die Kutsche der Gräfin zum ersten Mal hier vorfuhr. Nini arbeitete damals noch nicht bei mir. Deshalb fluchte niemand im Atelier vor sich hin, während Gretl der Gräfin die Tür aufhielt, ganz aufgeregt und unterwürfig. Die Kutsche war uralt, der Diener, der das Trittbrett herunterklappte, konnte kaum noch laufen, der Pekinese, den er aufs Trottoir setzte, war inkontinent und halb blind, aber das Wappen an der Wagentür deutete auf einen bis zu Karl dem Großen zurückreichenden Stammbaum hin.
Hätte ich damals schon gewusst, was ich heute weiß, hätte ich der alten Frau, die hinter dem Hund den Laden betrat, kurzerhand die Tür vor der Nase zugeschlagen. Die Gräfin Metz ist klein und untersetzt, hat ein arrogantes Pfannkuchengesicht und eine purpurrote Nase. Beim ersten Mal blieb sie eine Stunde und ließ mich jeden einzelnen Stoffballen, den ich besaß, herausholen, während ihr Pekinese sich unter einem der bis zum Boden verhangenen Tische verkroch und eine Pfütze hinterließ. Als ich das bestellte Kleid fertiggestellt hatte, mäkelte sie sechs Monate lang an der Rechnung herum und schickte schließlich ihren Diener mit der Hälfte des Betrags und einer angeblich wertvollen chinesischen Vase.
Seitdem hat sie kein einziges Mal einen angemessenen Preis bezahlt und mir letztes Jahr statt Geld eine Nippes-Sammlung geschickt, für die mir der Pfandleiher in der Dorotheergasse kopfschüttelnd eine Summe zahlte, die kaum den Stoffpreis deckte. Und trotzdem kleide ich diese krankhaft geizige, hässliche alte Schachtel weiterhin ein. Warum? Das ist nicht leicht zu erklären …
Das Palais Metz ist eines der kleinsten in Wien, alt und düster. Es liegt in einer industrialisierten Vorstadt; Richtung Norden grenzt es an ein Lagerhaus, und in den meisten Räumen braucht man schon mittags künstliches Licht. Die Gräfin hat alles von Wert verkauft oder verpfändet: nur die weißgoldenen Öfen, von denen im Winter viel zu wenige beheizt werden, sind noch in alter Schönheit erhalten. Die ihr verbliebenen Diener sind zu alt und zu gebrechlich (nicht etwa zu pflichttreu, meine ich), um zu gehen. Sie hat keinen Ehemann, keine früheren Liebhaber, soweit bekannt, und ihr einziger Bruder, ein Oberst, ist seit Langem tot. In diesem düsteren Palais lebt die alte, nicht gerade reinliche Frau. Ihr einziges Vergnügen besteht in einer monatlichen Essenseinladung nach Schönbrunn, wo Kaiser Franz Joseph bekanntlich die miserabelste Küche in Europa führt.
Doch die Gräfin Metz liebt Mode. Sie liebt sie leidenschaftlich, um ihrer selbst willen, losgelöst von jedem Zweck. Als ich diesmal durch den muffigen, dunklen Salon zu ihrem Boudoir ging, wartete sie schon mit glitzernden Augen, und als ich das Kleid auspackte, strichen ihre geschwollenen, fleckigen Hände andächtig über den Seidenrips.
»Ich will es anprobieren«, erklärte sie gebieterisch.
»Selbstverständlich, Gräfin.«
Ihre altersschwache Zofe erschien, die Gräfin watschelte zu einem bestickten Paravent und kam bald darauf wieder zum Vorschein. Die Zofe wurde entlassen, und die alte Frau verharrte stumm vor dem Ankleidespiegel. Im ganzen Palais gab es nicht eine Menschenseele, die sich für diese alte Frau interessierte, kein Blick blieb auch nur eine Sekunde länger als nötig an ihr hängen. Selbst ihr Hund war inzwischen tot. Aber als sie sich dann drehte und wendete und von allen Seiten im Spiegel betrachtete, hätte sie ebenso gut eine Neunzehnjährige sein können, die ihrem ersten Ball entgegenfiebert.
»Da ist eine Schleife zu viel«, verkündete sie schließlich.
Das war mir auch schon aufgefallen. Wir hatten auf dem Unterrock eine Reihe kleiner grauer Samtschleifen angebracht, von der Taille bis hinunter zum Saum. Vierundzwanzig Schleifen waren es insgesamt, perfekt angeordnet, vollkommen symmetrisch. Nur die letzte Schleife war dann doch zu viel des Guten.
Ich bückte mich und trennte sie ab.
Sie nickte, als ich sie entfernte – die winzige Schleife am Unterrock eines Kleides, das kein Mensch je sehen würde, in einem Haus, das nie jemand betrat. Dann seufzte sie zufrieden, drehte sich nochmals um sich selbst, betrachtete sich hingerissen im Spiegel.
Und das ist wohl der Grund, warum ich auch weiterhin für die Gräfin Metz arbeite.
Nach meinem Besuch bei der Gräfin brauchte ich Trost, also räumte ich nach Ladenschluss den Tisch im Arbeitsraum frei und begann, das cremefarbene Seidenkleid, das mir im Schlaf eingefallen war, zuzuschneiden. Es ist ein unvergleichlicher Moment, wenn der Ballen aufgerollt wird, der Stoff sich verlockend bauscht und man in seinen Falten, wie in einem Spiegel, die fertige Fasson sieht. Ich hatte den Stoff einem Händler abgekauft, dessen Großvater noch die alte Seidenstraße bereist hatte, von Antioch über Merw nach Samarkand und dann durch die Wüste nach China.
Er hatte mir von den Frauen erzählt, die körbeweise frisch geerntete Maulbeerblätter heranschleppen, als Futter für die verwöhnten Raupen, die die wertvolle Seide spinnen. Diese Tierchen sind nämlich sehr empfindlich. Den Geruch von Fleisch oder Fisch ertragen sie nicht, laute Geräusche versetzen sie in Stress, und sie müssen um alles in der Welt vor Dürre geschützt werden. Selbst die Kaiserin von China ist sich nicht zu schade für die Arbeit mit den Seidenraupen.
Die Geschichten des alten Kaufmanns stecken alle in dem Stoff – und natürlich auch in seinem Preis. Dies wird das schönste Kleid, das ich je gemacht habe, aber wohl auch das teuerste!
Irgendwo in der Stadt lebt die Glückliche – vielleicht gibt sie ihren Kindern gerade einen Gutenachtkuss oder zieht sich ihre Handschuhe für den Restaurantbesuch über –, die noch keine Ahnung hat, dass unwiderstehliche Kräfte sie bald zu meinem Laden führen werden, zu dem Kleid, das wie geschaffen für sie sein wird …
Ich arbeitete ein paar Stunden. Dann wurde ich auf einmal müde, holte ein Glas eingeweckte Marillen aus meinem Vorratsschrank und ging hinüber zu Frau Schumacher.
Lisl öffnete mir und führte mich als gute Bekannte zuerst in das Zimmer, wo die kleinen Mädchen in ihren Messingbetten lagen.
Die vier Jüngsten im ersten Raum schliefen bereits. In ihren weißen Nachthemden unter den weißen Bettdecken strömten sie einen zarten Geruch nach Talkpuder und Teerseife aus. Ich ging langsam an den aufgereihten Betten entlang und betrachtete die Mädchen.
Die Kleinste, Gisi, schlief noch in einem Gitterbett und nuckelte an einem Schnuller; Kati, deren Haar gerade lang genug ist, um es zu einem Zopf zu flechten, hatte sich selbst im Schlaf dem Baby zugewandt, das sie tagsüber mit schonungsloser Mütterlichkeit durch die Gegend schleppt; die wieselflinke Resi, die ständig in Bewegung ist, aus Bäumen purzelt oder in Geländern stecken bleibt und jetzt im Schlaf zuckte wie ein Windhund; und Steffi, die Schönheit der Familie, die auf dem Rücken lag, makellos. Die Mädchen waren alle blond und blauäugig, aber bei Steffi hatten die typischen Schumacher-Zutaten eine ganz besondere Mischung ergeben, nach der sich die Leute auf der Straße umdrehen.
Die beiden Ältesten im Nebenzimmer waren noch wach. Franzi lag auf der Seite, kaute an ihrem Zopf; ich lächelte ihr zu und ging dann schleunigst an ihrem Bett vorbei, weil ich wusste, dass sie sich gerade eine Geschichte erzählte. Sie ist nervös und introvertiert; nicht ganz so hübsch wie die Übrigen, aber mit der größten Phantasie.
Mitzi, die Älteste, saß aufrecht im Bett, hielt ein schweres Buch in den Händen und schaute bekümmert drein.
»Was gibt’s, Mitzi?«, flüsterte ich. »Was liest du da?«
»Es geht um Patagonien.« Ihr süßes, rundes Gesicht legte sich in Falten, während sie eine wirbelnde Karte voller Berge und Fjorde betrachtete. »Maia hat es mir ausgeliehen.«
»Ich dachte, sie will nach Madagaskar?«
»Das war letzte Woche.« Mitzi seufzte, und mein Herz flog ihr zu. Mitzi Schumacher ist wirklich durch und durch häuslich veranlagt, ein Heimchen am Herd. Sie bettelt darum, in die Küche ihrer Mutter zu dürfen, wie andere Kinder darum betteln, in den Prater zu gehen, aber Maia gibt in der Freundschaft den Ton an.
Frau Schumacher lag auf der Chaiselongue in ihrem Schlafzimmer und häkelte einen Schal für den erwarteten Sohn; sie begrüßte mich freundlich wie immer, sah aber sehr müde aus.
»Meine Liebe, wie reizend, Sie zu sehen! Sie tun mir immer gut – schon Ihr Anblick! Wie dieses Blau Ihre Augen hervorhebt!«
»Da sollten Sie erst mal das Kleid sehen, an dem ich gerade arbeite!« Ich erging mich in einer ausführlichen Beschreibung der cremefarbenen Robe, die sich nur eine Millionärin würde leisten können.
Wir plauderten eine Weile unbeschwert, aber als das Baby sich plötzlich heftig bewegte und Frau Schumacher beinahe die Häkelnadel fallen ließ, trafen sich unsere fragenden Blicke. War das nun ein Fußtritt des künftigen Chefs von A. Schumacher, Holzhandlung und Import – oder nicht?
»Haben Sie sich schon für einen Namen entschieden?«
Frau Schumacher nickte. »Ferdinand Anton Viktor«, deklamierte sie bühnenreif.
»Und wenn’s ein Mädchen wird?«
»Bitte, Frau Susanna, das dürfen Sie nicht mal denken! Ich weiß nicht, was ich dann tun soll. Beim letzten Mal ist Albert die ganze Nacht weggeblieben und war so betrunken, dass man ihn in einem Wäschezuber heimschaffen musste … na, Sie wissen ja. Und dabei könnte es kein hübscheres Baby geben als Gisi.«
»Sie ist entzückend. Das sind sie alle.«
»Ich garantiere Ihnen – noch ein Mädchen, und er dreht durch. Die beiden Jüngsten übersieht er ja jetzt schon. Ich bezweifle, dass er sie seit der Geburt überhaupt mal auf den Arm genommen hat.«
Ich muss wütender dreingeschaut haben, als ich wollte, denn ich konnte die Geburt einer Tochter nun wirklich nicht als Unglücksfall betrachten; aber Frau Schumacher hatte plötzlich das Bedürfnis, ihren Mann zu verteidigen.
»Es geht um sein Geschäft, verstehen Sie. Der Arzt hat ihm noch mal erklärt, dass ich keine Kinder mehr haben darf, und wenn’s wieder kein Junge wird, muss Albert den Sohn seines Bruders aus Graz aufnehmen.«
Beim Gedanken an Herrn Schumachers durch und durch männliche Welt verstummten wir. Die Werkstatt mit den Sägemaschinen, die Karren, die über das Kopfsteinpflaster rumpelten, die Schuppen, in denen sich die Bretter aus Buchen-, Rüster- und Ahornholz bis zur Decke stapelten …
»Kein besonders netter Bub, der Sohn seines Bruders. Als er das letzte Mal hier war, hat er das Wasser aus dem Aquarium der Mädchen abgelassen und den Goldfisch an die Katze verfüttert. Aber die Hebamme meint, ich wär diesmal sehr stark geworden – das ist doch ein gutes Zeichen, gelt?«
Ich umarmte sie, legte meine Wange an ihre. »Es wird schon gut gehen, Helene. Was auch passiert, es wird schon gut gehen, Sie werden sehen.«
Als ich den Platz eine halbe Stunde später wieder überquerte, spielte der unbekannte Pianist immer noch. Seine Art zu spielen ist mir rätselhaft: die Kraft, die Vitalität – und dann plötzlich versagt er bei bestimmten Passagen. Ich habe den Mann mit den Koteletten jetzt schon mehrere Male gesehen; er wirkt zu müde, zu niedergeschlagen, um derartige Klangkaskaden zu entfesseln.
Ich werde wohl meinen Mut zusammennehmen und die übellaunige Hausmeisterin fragen müssen. Frau Hinkler hat eine verwachsene Schulter, vielleicht ist sie deshalb so unleidlich und unzugänglich. Andererseits gehört ihr Rip, der Schnauzer. Vermutlich wird das eines der Rätsel dieser Welt bleiben: wie eine so unangenehme Frau einen so liebenswerten Hund haben kann.
Jedes Jahr, wenn der Frühling kommt, bin ich von seiner Pracht überwältigt. Jedes Jahr erscheint sie mir noch größer als je zuvor. Ich kann nicht glauben, dass die Hyazinthen an den Fenstern der Schumachers jemals so leuchtend, die Knospen des Flieders neben dem Friedhof jemals so prall waren! Mein Birnbaum im Hof kann noch nie zuvor so üppig und fabelhaft geblüht haben. Zumindest Letzteres stimmt aber wirklich. Ich bin mir sicher, dass der Baum dieses Jahr endlich seine erste echte Birne hervorbringen wird.
Gegen Ende der Fastenzeit verliert meine Kundschaft immer ein bisschen den Kopf. Ständig ruft irgendjemand an, um sicherzugehen, dass das Gewand, das die Gemeinde am Ostersonntag in den Bann ziehen soll, rechtzeitig fertig wird, und um neue Kleider für die anstehenden Regatten und Gartenfeiern in Auftrag zu geben. Frau Hutte-Klopstock will zum Sommerball der Wiener Stadtgärten aussehen wie Isadora Duncan, wenn sie barfuß zu Beethoven tanzt. Ich konnte ihr diesen vermessenen Wunsch aber nicht übel nehmen, weil sie mir von einem Malheur berichtete, das Jaquetta unterlaufen war. Ihr Laden in der Kärntnerstraße, Chez Jaquetta, ist mit goldenen Vogelkäfigen und Blumenvasen so vollgestopft, dass man sich kaum um die eigene Achse drehen kann. Jaquetta hat sich alle Mühe gegeben, mir das Leben schwer zu machen, und die Geschichte von dem Kutschpferd, das die drei Affenkopfpilze, mit denen sie das Oberteil einer Klientin verziert hatte, mit einem Happs verspeiste, bereitete mir größtes Vergnügen.
»Das Tier kann nichts dafür«, sagte Frau Hutte-Klopstock. »Der Schmuck sah einfach zu sehr nach Rosenkohl aus.«
Inzwischen trudeln die ersten Touristen ein. Man sieht die Ärmsten rund um das Kunsthistorische Museum, wie sie ihren Führern hinterherwackeln oder von Geburtshaus zu Todeshaus hetzen oder zu dem Haus, in dem Beethoven angeblich einen Wassereimer über sich ausgekippt hat. Die Donau stellt für Besucher aus dem Ausland ein besonderes Problem dar: Gelb-grau wälzt sie sich entlang der nördlichen Industriegebiete der Stadt.
»Jemand sollte diesen Johann Strauss verklagen«, schimpfte eine erschöpfte Amerikanerin, als sie sich in meinen austernfarbenen Samtsessel sinken ließ. »Die Blaue Donau – dass ich nicht lache. Obwohl man ihn für die toten Katzen wohl kaum verantwortlich machen kann.«
»Haben die Ihnen erzählt, sie wäre nur blau, wenn man verliebt ist?«
»Ja, ganz genau«, sagte sie grimmig. Eine nette Frau. Nini präsentierte ihr das Kleid aus grün gesprenkeltem Musselin, und sie kaufte es sofort.
Bisher konnte ich nur hin und wieder zwischendurch an meinem cremefarbenen Kleid weiterarbeiten, aber schon jetzt steht fest, dass es ein Meisterwerk wird.
Es war ein strahlender Ostermorgen, ein zögerliches Klingeln weckte mich. Vor der Tür stand Mitzi Schumacher, ganz in Weiß, ein Körbchen voller Stroh im Arm.
»Mama hat gesagt, ich darf Ihnen unsere Eier zeigen. Die haben wir selbst gemacht. Na ja, außer Gisi, der haben wir geholfen.«
Ich bewunderte Mitzis Ei, das sie mit bunten Schleifen verziert hatte, und Franzis, das mit Blättergirlanden geschmückt war. Resi, die immer kopfüber an irgendwelchen Bäumen hängt, hatte zu viel Energie ins Eierbemalen gesteckt. Die Schale war angeknackst, sodass ein Muster aus Blitzen entstanden war.
»Aber das sind ja sieben Eier, und ihr seid nur zu sechst. Wem gehört denn das siebte?«, fragte ich.
Mitzi strahlte. »Dem neuen Baby.« Sie reichte mir ein äußerst maskulines Ei: Es sah sehr hart gekocht aus und war mit einer roten Eisenbahn bemalt, aus der kleine schwarze Rauchwolken aufstiegen. »Papa hat gesagt, wir sollen einen Zug malen, weil Jungs Züge gern mögen.«
»Mädchen mögen Züge auch gern, Mitzi.«
»Ja, aber Papa ist ein guter, hart arbeitender Mann. Deshalb wird Gott uns einen Bruder schenken«, sagte Mitzi. Dann beugte sie sich vertraulich zu mir und flüsterte: »Wir haben alle neue Hutbänder bekommen. Meins ist blau, es passt zu meiner Schärpe. Es passt ganz genau.«
Am Ostersonntag bietet St. Florian einen unvergleichlichen Anblick. Kaum zu glauben, dass bei meinem Besuch vor zwei Tagen die Muttergottes noch schwarz verhüllt war, Pater Anselm sein violettes Messgewand trug, und selbst die Ziegelsteine schienen untröstlich über die Kreuzigung. Und nun prangten Tulpen und Narzissen in den Vasen, der Altar schimmerte golden, und der Kopf der Madonna war mit weißen Jasminblüten bekränzt.
Ich ließ den Blick durch die Kirche schweifen. Alle Anwohner des Madensky-Platzes waren versammelt. Sogar der alte Augustin Heller, der seinen Buchladen fast nie verließ. Und neben ihm saß seine Enkelin mit ihrem rabenschwarzen Haar. Maia beugte sich über ihr Messbuch, aber ich sah genau, dass sie zwischen den Seiten eine Landkarte versteckt hatte.
Neben ihnen auf der gleichen Bank saß mein anderer Nachbar, der Sattler. Herr Schnee ist bärbeißig und wortkarg, aber stets hilfsbereit, wenn Taten, nicht Worte, gefordert sind. Ich beneide ihn oft um seine Kundschaft: sanftmütige Kutschpferde und beherzte Traber, und keins von ihnen will aussehen wie Karsavina in The Firebird oder Isadora Duncan mit bloßen Füßen. Zwei Reihen weiter, neben Frau Schumacher aufgereiht wie die Orgelpfeifen die Köpfe der sechs kleinen Mädchen …
Pater Anselm verkündete die Auferstehung. Ernst Bischof (der tags zuvor einen rötlich gelben Kater, der sich auf der Sakristeimauer gesonnt hatte, erbarmungslos mit Steinen beworfen hatte) sang das Gloria, als sei er eigens dafür vom Himmel herabgestiegen. Gegen Ende des Gottesdienstes wappnete ich mich, Frau Hinkler abzufangen und sie zu fragen, wer in der Mansarde Klavier spielte.
Ich wusste, dass sie in der Kirche war, denn ich hatte Rip draußen warten gesehen. An dem hübschen schmiedeeisernen Tor am Kirchenvorplatz hängt ein Schild, auf dem steht: Hunde müssen draußen bleiben. Und Rip weiß das. Pater Anselm, der noch so jung ist, dass sein Adamsapfel unter dem römischen Kragen herumhüpft, hat das Schild nicht aufgehängt. Und Gott würde es auch nicht gutheißen, da bin ich mir sicher.
Aber Rip, ein gesetzestreues österreichisches Tier, würde den Kirchenvorplatz nie betreten. Er liegt geduldig da, den Kopf zwischen den Pfoten, und seufzt nur ab und zu, wie Wartende es häufig tun.
Ehe ich mich jedoch auf die Suche nach Frau Hinkler machen konnte, kam Professor Starsky auf mich zu und begrüßte mich. Er hatte viel Mühe auf sein Äußeres verwendet. Sein Wildseidenanzug war kaum zerknittert, auf der Krawatte keine Salzsäureflecken – aber er wirkte verstört.
Und das war verständlich, denn die Geschichte, die er mir erzählte, als wir in den Sonnenschein hinausgingen, war herzzerreißend. Eine fanatische Vivisektionsgegnerin hatte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion dreihundert weiße Ratten und zwei Käfige voller Meerschweinchen aus dem Zoologielabor der Universität freigelassen.
»Und meine Sumpfschildkröten«, klagte der Professor. »Sie hat sie alle in einem Eimer mitgenommen und in den Brunnen gekippt. Die Enten haben natürlich kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Und dabei wollte ich sie doch gar nicht sezieren, Frau Susanna – das wäre sinnlos gewesen. Ich hab bloß gemessen, wie sich Spinat auf ihr Wachstum auswirkt.«
Bis ich den Professor getröstet und für die kommende Woche zum Abendessen eingeladen hatte, war die griesgrämige Frau Hinkler samt ihrem Rip im Haus verschwunden und die Tür geschlossen.
Meine engste Freundin in Wien ist Alice Springer. Sie ist drei Jahre älter als ich, immer freundlich und heiter, redet zwar wie ein Buch, aber sagt nie etwas Verletzendes oder Taktloses. Alice singt im Chor der Volksoper – ein schweres Schicksal voll Dirndln und Um-pa-pa –, in meinen Augen eine sträfliche Verschwendung, denn sie hat ein echtes Talent zur Modistin. Hüte kommen Alice in den Sinn wie mir Kleider; sie kann sich haarklein an jeden Kopfschmuck erinnern, der irgendwann ihr Interesse erregt hat.
Sie beklagt sich zwar nie, das ist nicht ihre Art, aber ich weiß, in letzter Zeit hat sie viel durchgemacht. Bildhübsch, Augen und Haar im gleichen Haselnussbraun, aber beinahe vierzig, wird sie im Chor neuerdings immer öfter in die zweite Reihe abgeschoben, meist neben einen Heuhaufen oder auf einen Melkschemel. Und von da ist es bekanntlich nur ein kleiner Schritt in die hinterste Reihe – graue Perücke, Dorfälteste und Spinnrad.
Oft hole ich sie vom Theater ab, und wir gehen noch auf einen Gespritzten ins Café Landtmann. Heute hatte sie mir ein Billett hinterlegt, und so kam ich in den Genuss eines Gastspiels aus Deutschland, der Operette Alt-Heidelberg. Alice stand wieder in der zweiten Reihe und stemmte gewaltige Bierkrüge, weil das Ganze in Studentenkreisen spielte. Über das Stück selbst möchte ich mich lieber ausschweigen.
Aber dem übrigen Publikum gefiel es offenbar. Ich registrierte vor allem einen wohlbeleibten Mann in meiner Reihe. Sein rotblondes Haar war in der Mitte gescheitelt, das runde rote Gesicht passte farblich überhaupt nicht zum Schnurrbart, und er war unverkennbar gerührt über die Vorgänge auf der Bühne. Während des Lieds über den Neckar seufzte er tief, während des Duetts, in dem der adelig geborene Student und das verarmte Mädchen vom Lande sich die Ehe versprachen, beugte er sich mit offenem Mund nach vorn, und während des Solos der Heldin und ihrer (natürlich nur kurzzeitigen) Abkehr von ihrem Geliebten wurde er so von seinen Gefühlen übermannt, dass er sich das Gesicht mehrmals mit einem großen weißen Taschentuch trocknen musste.
Nach der Vorstellung ging ich zu Alice in die Garderobe, wo sie sich gerade ein vogelnestartiges Gebilde auf die Locken drückte.
»Was für ein wunderbarer Hut, Alice.« Ich umarmte sie.
»Nicht wahr? Ich habe ihn bei Yvonne gekauft. Aber stell dir vor: In ihrem Schaufenster lagen drei identische Strohhüte mit identischen Krempen. Eine mit Rosen, eine mit Mimosen und eine mit Kirschen. Also wirklich, Sanna, dreimal genau die gleiche Krempe!«
Ich war ebenso schockiert wie sie. Rosen, Mimosen und Kirschen in einen Topf zu werfen! Bei Rosen muss die Krempe breiter und weicher sein, für Mimosen (denen ich sowieso kritisch gegenüberstehe – man kommt sich schnell vor wie in einer Brutkammer für Miniaturhühner) braucht man viel Grünzeug, und Kirschen gehen wirklich nur auf einem Boater. Man muss schon sehr schnittig und unverfroren sein, um Obst zu tragen.
Es war ein wunderschöner Abend; aus dem Rathauspark wehte Narzissenduft zum Café Landtmann herüber; der Ober, der uns kennt, suchte uns einen ruhigen Tisch, denn Alice und ich können, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, kaum verhindern, unbeaufsichtigte Herren in Verlegenheit zu bringen … Während Alice Wein und Mineralwasser einschenkte, schwatzte sie heiter, aber ich spürte den Kummer, der sich dahinter verbarg.
»Wie geht’s Rudi?«, erkundigte ich mich – und ich lag richtig.
»Er ist so erschöpft, Sanna. So müde und aschgrau – und er arbeitet unentwegt. Seine Frau ist inzwischen Vegetarierin und gibt ihm nicht mal ordentlich zu essen! Ich muss ihm Gulasch kochen, wenn er kommt. Das ist ungerecht, findest du nicht? Für Gulasch sind die Ehefrauen zuständig, nicht die Geliebten – wir haben sowieso schon viel zu wenig Zeit für uns. Und sie – sie lässt sich Gurkensandwiches aufs Zimmer bringen, während sie an Vorträgen zu Goethes Naturlyrik arbeitet. Und dann ist ein Gerichtsverfahren im Gange, wusstest du das? Die Universität verklagt sie: Sie ist offenbar nachts eingebrochen und hat massenhaft Ratten und Mäuse freigelassen. Du kannst dir vorstellen, wie Rudi zumute ist – einer der angesehensten Anwälte von Wien muss einen Kollegen bitten, die Verteidigung seiner Frau zu übernehmen.«
»Sie war das also! Ich hab schon von Professor Starsky davon gehört. Er hat dabei auch noch sämtliche Sumpfschildkröten verloren.«
»Wenn du wüsstest, was für ein guter Mensch Rudi ist, Sanna. Sollte ihm irgendwas passieren …« Sie schnäuzte sich.
Was für ein guter Mensch Rudi Sultzer ist, wusste ich nur allzu genau. Es hat mich nie gewundert, dass Alice’ Herz schon so viele Jahre lang diesem Anwalt mit den krummen Beinen und beginnender Glatze gehört. Rudi Sultzer ist ein Atlas: Klaglos unterhält er eine riesige, finstere, überladene Wohnung in der Garnisongasse und eine Villa in St. Pölten, die er aus Zeitmangel nie nutzt, sowie eine Frau und eine erwachsene Tochter, die ihn verachten, weil er Western liest und gerne Karten spielt.
»Ich mach mir sicher zu viel Sorgen«, meinte Alice schließlich. »Rudi ist erst fünfundvierzig – eigentlich im besten Alter.« Sie schüttelte ihre Ängste ab. »Sag mal, Sanna, hast du heut in deiner Reihe einen dicken Mann mit rotblondem Haar gesehen?«
»Ja. Der war ganz hingerissen. Richtig gerührt!«
»Ja, genau den meine ich. Er kommt fast jeden Abend.«
»Ist er verliebt in dich?«
»Ach, wo denkst du hin. Das ist ein Fleischermeister aus Linz – Spezialität Wurstwaren. Er heißt Ludwig Huber. Ich habe ihn kennengelernt, als er an einem Theaterausflug seiner Innung teilnahm. Sie kamen hinter die Bühne, und wir unterhielten uns. Er ist ein bisschen schwerfällig, aber wirklich lieb. Und jetzt hör gut zu, Sanna, das könnte wichtig für dich sein. Er ist sehr wohlhabend – Besitzer einer ganzen Reihe von Läden überall in Oberösterreich. Seine Frau ist vor zwei Jahren gestorben, und jetzt heiratet er wieder. Ich hab ihm gesagt, dass für die Brautausstattung niemand infrage kommt außer dir!«
»Aber wieso kauft er die Kleider? Ist sie Waise, oder was?«
»Ihre Familie ist sehr arm. Vornehm, aber keinen Kreuzer, da hat er angeboten, das Ganze zu übernehmen. Das wird eine große Rechnung! Als Geschäftsmann soll er hart sein, aber Frauen gegenüber ein Kavalier. Von dir lässt er sich bestimmt um den Finger wickeln.«
»Und die Braut?«
»Die hab ich nicht kennengelernt. Angeblich hübsch und sehr jung. Aber das ist noch nicht alles. Wer, meinst du, wird Brautjungfer?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Rudis Tochter! Edith!«
»Wirklich?«
»Jawohl! Edith. Offenbar waren die beiden zusammen auf der Schule. Ich hab Herrn Huber gesagt, das Brautkleid und das Kleid für die Brautjungfer müssen im selben Salon entworfen werden. Also wird Edith auch bei dir erscheinen!«
Ich wiegte den Kopf hin und her. »Wenn sie so unansehnlich ist, wie du immer sagst, wird das eine schwierige Angelegenheit.«
»Na ja, unansehnlich ist sie schon. Sehr sogar. Und auch eingebildet und überheblich. Als sie noch klein war, soll sie reizend gewesen sein, sagt Rudi, aber dann wollte ihre Mutter wohl ein Wunderkind aus ihr machen.«
Ich war Edith nie begegnet, aber ich wusste eine Menge über sie, zum Beispiel über die Nacht ihrer Empfängnis.
Im Frühjahr 1891 saß ein junger Anwalt namens Rudi Sultzer bei einer Vorlesung an der Universität neben einem ambitionierten, literaturbesessenen jungen Mädchen namens Laura Hartelmann. Normalerweise hätte das keinerlei Konsequenzen gehabt, doch genau an diesem Morgen hatte Rudi das letzte Glas der Himbeermarmelade gegessen, die seine Mutter vor ihrem Tod eingekocht hatte. Der Verzehr von Marmelade einer Person, die kurz darauf verstorben ist, ist schon an sich eine traumatische Erfahrung, und Rudi hatte seine Mutter geliebt. Sie war eine intelligente und wunderschöne Frau gewesen, die ihn kaum behelligt hatte, weil sie, eine Tschechin, lieber in Prag hatte leben wollen. Und so stiegen ihm während einer Vortragspause Tränen in die Augen. Laura, die durch Kummer stets zu beeindrucken war, tröstete ihn.
Sie heirateten und machten ihre Hochzeitsreise nach Weimar, wegen Lauras Verehrung für Goethe. Dort zog sich die Braut in ihr Schlafzimmer (mit Blick auf die Goethestatue) zurück, warf ein weißes Baumwollnachthemd über und las eine Stunde lang in der Trilogie der Leidenschaft des Meisters, während ihr frisch angetrauter Ehemann einen Stock tiefer wartete. Dann klappte sie das Buch zu, öffnete die Tür und rief mit ihrer hohen, klaren Stimme: »Du kannst dich mir nähern, Rudi!«
Rudi näherte sich ihr, und neun Monate später wurde Edith geboren.
Die Ehe mit einer derart ambitionierten Frau begann schon bald Spuren bei Rudi zu hinterlassen. Nach einem arbeitsreichen Tag in der Kanzlei fand er statt einem liebevoll gedeckten Tisch an der Schlafzimmertür seiner Frau einen Zettel: Bitte nicht stören! Frau Sultzer liest Faust. Auch wenn Botschaften dieser Art eher dem Zimmermädchen galten als ihm, wurde Rudi (der außerdem kleiner ist als seine Frau und an irdischen Genüssen wie Essen durchaus Gefallen findet) bald klar, dass er seiner Frau nicht würdig war. Schließlich verstand sie nicht nur Goethe, sondern auch Schopenhauer, Leibniz und Lyrik. Und als seine kleine Tochter ebenfalls anfing, Goethe zu zitieren, und ihr Spielzeug an arme Kinder verschenkte, da lernte er Gott sei Dank meine liebe Freundin Alice kennen.