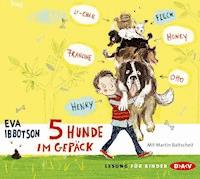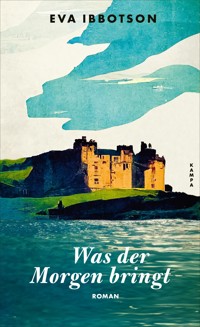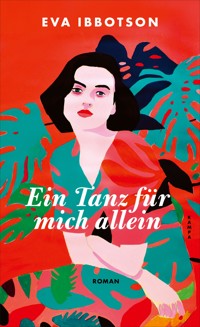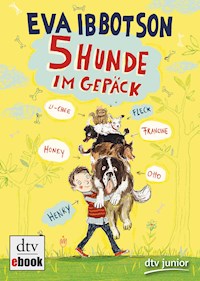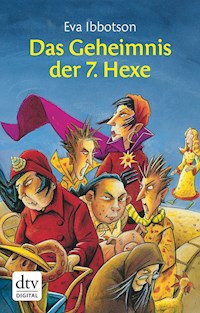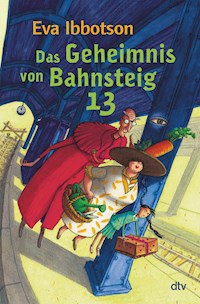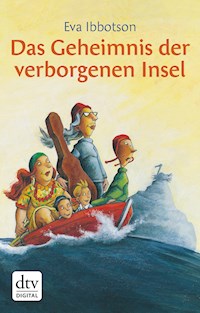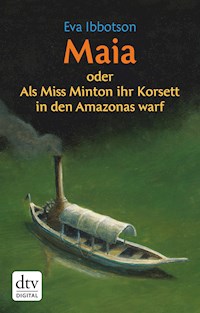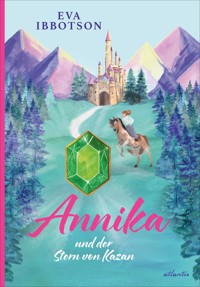
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Kinderbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Eigentlich führt Annika ein wundervolles Leben: Sie hat zwei Mütter – die Köchin und das Hausmädchen in einem Professorenhaushalt –, drei Väter – ebenjene Professoren: nicht sehr lebenspraktische, aber liebenswerte Intellektuelle – und viele Freundinnen und Freunde, mit denen sie in ihrem geheimen Garten Menschenfresser oder Pharaonen spielt. Und dann ist da noch die alte Nachbarin, die so viele Geschichten von damals zu erzählen weiß, von ihrer Zeit am Theater, ihren vielen Verehrern und deren Geschenken, wie zum Beispiel dem geheimnisvollen Stern von Kazan. Aber ein Wermutstropfen bleibt: Wie jedes Findelkind sehnt Annika sich nach ihrer leiblichen Mutter. Bis eines Tages eine elegante Adelige vor der Tür steht und behauptet, ebendiese Mutter zu sein. Als Freifrau von Tannenberg ihre Tochter mit in ihr Schloss nach Norddeutschland nehmen will, ist Annika ganz verzaubert. Aber schnell stellt sich heraus: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eva Ibbotson
Annika und der Stern von Kazan
Aus dem Englischen von Sabine Ludwig
Atlantis
Für Rowan
1Das Findelkind
In die Kirche war Ellie nur wegen ihrer Füße gegangen. Das istsicher nicht der beste Grund, eine Kirche zu betreten, aber Ellie war korpulent und auch nicht mehr ganz jung, außerdem taten ihr die Füße weh. Sie taten ihr sogar schrecklich weh.
Es war ein schöner, sonniger Junitag, und Ellie und ihre Freundin Sigrid (die so dünn wie Ellie beleibt war) hatten schon sehr früh den Zug aus Wien in die Berge genommen, um auf den Pettelspitz zu steigen.
Jeden letzten Sonntag im Monat, an ihrem freien Tag, gingen sie in die Berge. Sie vertauschten ihre Schürzen mit Dirndlkleidern und füllten ihre Rucksäcke mit Wurstbroten und Stücken von Gugelhupf, sodass sie oben auf dem Berg die Aussicht genießen konnten, ohne dabei hungern zu müssen. Das war der wohlverdiente Lohn für eine Woche harter Arbeit: Für die drei Professoren, bei denen sie angestellt waren, mussten sie waschen und kochen, einkaufen und putzen, und ihre Herrschaft war sehr pingelig, was diese Arbeiten betraf. Ellie war Köchin und Sigrid Hausmädchen, und beide waren seit vielen Jahren befreundet.
An diesem besonderen Sonntag trug Ellie neue Stiefel, was wirklich töricht ist, wenn man eine längere Wanderung plant. Sie hatten den Berg halb erklommen, als sie an einer Blumenwiese vorbeikamen, an deren Ende ein kleines weißes Kirchlein mit Zwiebelturm stand.
Ellie blieb stehen. »Weißt du, Sigrid, ich glaube, ich werde für meine Mutter einen Rosenkranz beten. Ich habe letzte Nacht von ihr geträumt. Geh du doch schon mal vor. Ich treffe dich dann oben.«
Sigrid schnaubte. »Ich hab dir doch gleich gesagt, du sollst keine neuen Schuhe anziehen.«
Aber sie lief dennoch langsam voraus, und Ellie überquerte auf einer kleinen hölzernen Brücke ein Bächlein und betrat die Kirche.
Es war eine zauberhafte Kirche – eine von denen, die so aussehen, als hätte Gott sie höchstpersönlich für ein wundervolles Fest ausgeschmückt. Die Deckengemälde zeigten Engel und goldene Sterne und ein Bildnis der heiligen Ursula, die hilfreich ihre Arme ausstreckte, woraufhin Ellies Füße sich gleich besser fühlten. Auch die Heiligenreliquie hier war nicht etwa ein Zehenknochen oder eine verdorrte Hand oder sonst etwas Unappetitliches; stattdessen lag unter einem Glassturz die mit Perlen geschmückte Locke eines Heiligen. Obgleich die Kirche vom nächsten Dorf ziemlich weit entfernt war, hatte jemand eine Vase mit frischen Alpenrosen zu Füßen der Jungfrau Maria gestellt.
Ellie glitt in eine Kirchenbank und löste ihre Schnürsenkel. Sie sprach ein Gebet für ihre Mutter, die vor vielen Jahren gestorben war … und schloss die Augen.
Sie hatte nur wenige Minuten geschlafen. Als sie erwachte, war die Kirche immer noch leer, aber Ellie hatte das Gefühl, von irgendeinem Geräusch geweckt worden zu sein.
Sie sah sich genau um, konnte aber nichts entdecken. Dann beugte sie sich über die Kirchenbank und sah auf dem roten Teppich unterhalb des Altars – ein Paket.
Das Paket hatte ungefähr die Größe eines Kürbisses, eines ziemlich großen Kürbisses, und Ellies erster Gedanke war, dass es jemand als Erntedankgabe dort gelassen hatte. Aber das Erntedankfest war im Herbst und nicht im Juni. Und nun gab der Kürbis zu Ellies großem Erstaunen auch noch einen Laut von sich. Ein leises Maunzen … Ein Kätzchen? Ein Welpe?
Ellie band ihre Schnürsenkel fest und ging nach vorn, um nachzusehen. Aber es war kein Kätzchen und auch kein Welpe, es war viel schlimmer.
»Ach, du lieber Himmel«, murmelte Ellie. »Ach, du lieber, lieber Himmel!«
Sigrid hatte die Spitze des Berges erreicht. Sie hatte die Aussicht bewundert und ein Wurstbrot gegessen und sie hatte ein paarmal tief eingeatmet, aber von Ellie war immer noch nichts zu sehen.
Das war ärgerlich. Wenn man auf der Spitze eines Berges steht und die Aussicht bewundert, dann möchte man, dass jemand dabei ist, der dies mit einem teilt. Sigrid wartete noch eine Weile, dann packte sie den Rucksack und stieg den felsigen Abhang wieder hinunter, durch den Kiefernwald, bis sie zu der Wiese mit der kleinen Kirche kam.
Ellie war immer noch da, sie saß in der ersten Reihe, aber sie hielt etwas im Arm und sah ganz anders aus als sonst, völlig aufgelöst und über und über errötet …
»Das hat jemand hiergelassen«, sagte sie.
Sie schlug das Tuch zurück, und Sigrid beugte sich vor, um zu schauen.
»Herr im Himmel!«
Das Baby war noch sehr klein, nicht mehr als ein paar Tage alt, aber es war erstaunlich lebendig. Strömte Wärme aus, dampfte wie ein frisch gebackenes Brot, seine Beinchen strampelten unter dem Tuch. Und als Sigrid einen knochigen Zeigefinger ausstreckte, um seine Wange zu berühren, da öffnete es seine Augen, und als es sie anblickte, da traf sie dieser Blick mitten ins Herz.
»An dem Tuch war ein Zettel befestigt«, sagte Ellie.
Seien Sie bitte gut zu meiner Tochter und bringen Sie sie nach Wien zu den Nonnen, stand auf dem tränendurchweichten Papier.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Sigrid. Sie war sehr aufgeregt. Weder sie noch Ellie waren je verheiratet gewesen, sie kannten sich mit Babys nicht aus.
»Wir nehmen es mit nach Wien zu den Nonnen, genau wie es da steht. Was sollten wir wohl sonst tun?«
Sie brauchten eine Stunde, um das Baby nach Pettelsdorf zu bringen. Niemand wusste dort etwas von einem Baby, keiner hatte jemanden in die Kirche gehen sehen.
»Die Mutter muss von der anderen Seite, über den Pass, gekommen sein«, sagten die Leute.
Eine Bauersfrau gab ihnen eine Flasche und etwas verdünnte Milch von ihrer Kuh, und sie zogen weiter zu dem kleinen Bahnhof am See, um auf den Zug nach Wien zu warten.
Es war schon spät, als sie mit ihrem feuchten, quengelnden Bündel in der Stadt ankamen, und die beiden Frauen waren sehr müde. Das einzige Kloster, von dem sie wussten, dass es Findelkinder aufnahm, war vom Haus der Professoren, wo sie wohnten und arbeiteten, weit entfernt. Und sie hatten kein Geld für einen Fiaker.
Also nahmen sie die Straßenbahn, und obwohl es eine von den neuen, elektrischen war, war es fast dunkel, als sie den Weg zum Kloster des Heiligen Herzens hinaufgingen.
Das schmiedeeiserne Tor war geschlossen, aus dem niedrigen weißen Gebäude ertönte Gesang.
»Hier wird es ihr gut gehen«, sagte Ellie und strich dem Baby über den Kopf.
Sigrid zog an der Glocke. Sie hörten das Geläut drinnen widerhallen, aber niemand erschien.
Sigrid läutete noch einmal, und sie warteten.
Schließlich kam eine ältere Nonne über den Klosterhof geeilt. »Was ist los?«, fragte sie und linste in die Dunkelheit.
»Wir bringen Ihnen ein Findelkind, Schwester«, sagte Sigrid. »Man hat es in einer Kirche in den Bergen ausgesetzt.«
»Nein, nein, auf keinen Fall!« Die Nonne erhob abwehrend beide Hände. Sie schien zu Tode erschrocken. »Bringen Sie das Kind weg, bleiben Sie keine Sekunde länger hier. Sie hätten nicht kommen dürfen! Wir stehen unter Quarantäne wegen Typhus. Drei Schwestern sind schon erkrankt, und nun breitet sich die Krankheit unter den Kindern aus.«
»Typhus!« Ellie schauderte. Das war eine grauenvolle Krankheit, das wusste jeder.
»Bringen Sie es fort, schnell, schnell!«, sagte die Nonne und schlug mit den Armen, als wollte sie Gänse verscheuchen.
»Aber wo sollen wir das Kind denn hinbringen?«, begann Sigrid. »Es muss doch einen Platz geben.«
»Niemand in Wien wird ein Kind aufnehmen, solange die Epidemie anhält«, sagte die Nonne. »Das wird noch mindestens sechs Wochen dauern.«
Wieder allein, sahen sich die beiden Freundinnen an.
»Wir müssen sie mit nach Hause nehmen und es morgen noch einmal versuchen.«
»Aber was werden die Professoren sagen?«
»Sie müssen es ja nicht wissen«, sagte Ellie. »Wir behalten das Baby unten bei uns. Unsere Herrschaft kommt doch nie in die Küche.«
Aber da irrte sie sich.
Die drei Professoren lebten immer noch in ihrem Geburtshaus.
Es stand am südlichen Ende eines kleinen Platzes im ältesten Teil der Stadt, nicht weit von der Hofburg und der Spanischen Hofreitschule entfernt. Wenn man sich aus einem der oberen Fenster beugte, konnte man die Tauben sehen, die um die Türme des Stephansdoms kreisten. Der Stephansdom steht im Herzen der Stadt und für die Wiener somit im Herzen der Welt.
Doch obgleich man von dem Platz zu all den Sehenswürdigkeiten zu Fuß gehen konnte, wirkte er wie abgeschnitten von Trubel und Lärm. In seiner kiesbestreuten Mitte erhob sich das Denkmal von General Brenner auf seinem Schlachtross. Die Kinder liebten es sehr, denn mit so einem Reiterstandbild kann man eine Menge anfangen: so tun, als ob man auf dem Pferd reitet, es tätscheln oder sich bei Regen darunter verstecken. Der General war ein Held gewesen, er hatte gegen Napoleon gekämpft, und deswegen hatte man den Platz nach ihm benannt: Brennerplatz.
Neben dem General auf seinem Pferd gab es einen Springbrunnen mit einem großen flachen Becken und einer breiten Steinumrandung. Manchmal schwamm ein Goldfisch darin, denn die Kinder, die im Prater, dem Vergnügungspark im Nordosten der Stadt, einen Fisch gewannen, warfen ihn auf dem Heimweg nicht selten dort hinein.
An der westlichen Seite des Platzes stand eine Kirche, die nach dem heiligen Florian benannt war, dem Schutzpatron gegen Feuer. Es war eine hübsche Kirche mit einem Friedhof, auf dessen Rasen sich wilde Blumen ausgesät hatten. Der Kirche gegenüber standen aufgereiht Kastanien in eisernen Schutzgittern, die den Platz vom Lärm der Straße abschirmten, die in die Stadtmitte führte. An einer Ecke gab es einen Buchladen und an der anderen ein Kaffeehaus mit einer gestreiften Markise davor. Es war also alles vorhanden, was der Mensch so braucht.
Das Haus, in dem die Professoren lebten, stand in der Mitte der Häuserzeile. Es war das größte und schönste, hatte einen schmiedeeisernen Balkon im ersten Stock und Blumenkästen vor den Fenstern sowie einen Türklopfer in Form eines Eulenkopfes.
Professor Julius war der Älteste der drei Geschwister. Er hatte einen grauen Spitzbart und war groß und ernst. Vor vielen Jahren hätte er beinahe geheiratet, aber seine Auserwählte war eine Woche vor der Hochzeit gestorben, und seither war Professor Julius ein feierlicher und strenger Mensch geworden. Er war Wissenschaftler, Geologe, und hielt Vorlesungen an der Universität, wo er Studenten alles über Flussspat und Granit beibrachte und wie man ein Stück Fels mit einem Hammer zerschlug, ohne dass man einen Splitter ins Auge bekam.
Sein Bruder Emil war ganz anders. Er war klein, rundlich und fast kahlköpfig, und beim Treppensteigen schnaufte er ein wenig, aber er war ein fröhlicher Mann. Sein Fach war Kunstgeschichte, und er musste nur den Fuß eines gemalten Engels sehen, um zu wissen, ob das Bild von Tintoretto oder Tizian stammte.
Der dritte Professor war eine Professorin, ihre Schwester und die Jüngste der drei. Sie hieß Gertrud und war Musikerin. Sie unterrichtete Harmonielehre und Kontrapunkt, außerdem spielte sie Harfe im Stadtorchester. Eine Harfe ist wie ein großes launisches Kind, das herumgetragen, vor Zugluft geschützt und in Droschken bugsiert werden muss, und wie viele Harfenisten sah auch Frau Professor Gertrud oft besorgt und beunruhigt aus.
Es muss wohl nicht betont werden, dass keiner der drei jemals in seinem Leben ein Ei gekocht, ein Paar Socken gewaschen oder sein Bett gemacht hatte. Und wenn Ellie und Sigrid ihren freien Tag hatten, bereiteten sie jedes Mal ein kaltes Mittagessen vor. Aber auch am Abend benötigten die Professoren ihre Hilfe. Professor Julius musste ein Whiskysoda aufs Zimmer gebracht werden, damit er einschlafen konnte. Professor Emil, der einen empfindlichen Magen hatte, brauchte ein Glas heiße Milch mit Honig, und Frau Professor Gertrud bekam wegen ihrer kalten Füße eine Wärmflasche ins Bett.
An dem bewussten Tag warteten die drei auf die Rückkehr ihrer Dienstboten. Normalerweise waren Ellie und Sigrid an ihrem freien Tag um neun Uhr abends wieder da – heute jedoch nicht.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Professor Julius und streckte den Kopf aus der Tür seines Zimmers.
»Ich denke, wir sollten nach unten gehen und nachschauen«, schlug sein Bruder vor.
Also gingen sie die Treppe hinunter, am Wohnzimmer und der Bibliothek vorbei, durch die dicke, mit grünem Filz gepolsterte Tür, die das übrige Haus von der Küche trennte.
Vorsichtig öffneten sie die Tür. Der große Tisch war weiß gescheuert, die Kamingitter poliert, der Herd brannte noch.
Aber wo waren Ellie und Sigrid? Und wo waren der Whisky, die warme Milch und die Wärmflasche?
Genau in diesem Augenblick öffnete sich die Hintertür, und die beiden Frauen traten ein. Sigrids Hut war zerknautscht, Ellies Haar aufgelöst und Ellie trug etwas im Arm. Alles schwieg.
»Was … äh … ist das?«, wollte Professor Julius wissen und zeigte mit dem Finger auf das Bündel.
»Das ist ein Baby, gnäd’ger Herr. Ein Mädchen. Wir haben es in einer Kirche gefunden. Man hat es ausgesetzt«, sagte Sigrid.
»Wir wollten sie zu den Nonnen bringen«, ergänzte Ellie, »aber das Kloster steht unter Quarantäne wegen Typhus.«
Das Baby drehte den Kopf und schnüffelte.
Professor Emil starrte es erstaunt an. Er war an Bilder gewöhnt, die Jesus als Baby zeigten, steif und still im Arm seiner Mutter; aber das war etwas ganz anderes.
»Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir hier im Haus ein Baby dulden«, sagte Professor Julius. »Auch nicht einen Tag lang.«
Professor Emil nickte. »Allein der Lärm …«
»Diese Unruhe«, sagte Frau Professor Gertrud. »Mal davon abgesehen, was später aus ihm wird …«
»Es ist ja nur, bis die Quarantäne zu Ende ist«, sagte Ellie. »Ein paar Wochen …«
Professor Julius schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall. Ich erlaube es nicht.«
»Sehr wohl, gnäd’ger Herr«, sagte Ellie gleichgültig. »Wir bringen sie gleich morgen früh zur Polizei. Da gibt es sicher eine Stelle für unerwünschte Kinder.«
»Polizei?«, fragte Professor Emil.
Das Kind bewegte sich und öffnete die Augen. Dann tat es etwas, das sogar ganz kleine Babys können. Es schaute. Es sah die Professoren einfach an.
»Herr im Himmel!«, sagte Professor Julius.
Es war wirklich nicht der Blick von jemandem, der auf ein Polizeirevier gehört, zusammen mit all den Kriminellen und Betrunkenen. Professor Julius räusperte sich. »Sie darf uns nicht unter die Augen kommen. Auf keinen Fall«, sagte er.
»Sie darf keinen Mucks machen«, sagte Professor Emil.
»Sie darf uns nicht beim Arbeiten stören, auch nicht eine Minute«, sagte Frau Professor Gertrud.
»Und sobald die Quarantäne vorüber ist, kommt sie ins Kloster. Und nun, wo bleibt mein Whisky?«
»Und meine heiße Milch?«
»Und meine Wärmflasche?«
Die Professoren waren zu Bett gegangen. Das Baby trug eine geborgte Windel und lag auf einer zusammengefalteten Decke in einer Schublade, aus der die Tischdecken entfernt worden waren.
»Sie sollte einen Namen bekommen, auch wenn wir sie nicht behalten können«, sagte Sigrid.
»Ich würde ihr gern den Namen meiner Mutter geben«, sagte Ellie träumerisch.
»Wie hieß sie?«
»Annika.«
Sigrid nickte. »Annika. Jawohl, das passt.«
2Die goldene Stadt
Wien war die Hauptstadt des österreichisch-ungarischenReichs, zu dem um 1900 dreizehn verschiedene Länder im Herzen Europas gehörten.
Dieses Reich wurde von Kaiser Franz Joseph I. regiert; er besaß einen Winterpalast in der Stadtmitte und einen Sommerpalast außerhalb Wiens, wo die Luft immer frisch war. Der Kaiser war ein sehr einsamer alter Mann, denn seine Frau Sisi war von einem Anarchisten ermordet worden, und sein Sohn hatte sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Aber Kaiser Franz Joseph arbeitete schwer. Jeden Morgen um fünf Uhr früh stand er auf und las Regierungspapiere. Er schlief in einem eisernen Bett wie seine Soldaten. Und jeden Gründonnerstag wusch er die Füße von zwölf Bettlern, die man zu ihm brachte, denn er wollte ein guter Mensch sein.
Weil er so alt war, passierten ihm lauter Missgeschicke. Wenn ihm kleine Mädchen Blumensträuße überreichen wollten und er sich bückte, um sie in Empfang zu nehmen, fuhr es ihm in den Rücken, und seine Adjutanten mussten ihn wieder aufrichten. Einmal hatten Wiener Schulkinder rosa Papierherzen für ihn ausgeschnitten, und als sie diese auf den vorbeireitenden Kaiser warfen, blieben ein paar an seinem Bart hängen, kribbelten ihn in der Nase, und er musste niesen.
Und trotzdem liebten ihn die Wiener. Sie liebten seine Starrköpfigkeit (so weigerte er sich hartnäckig, ein Auto zu besteigen; wenn er nicht ritt, fuhr er in einer Kutsche durch die Straßen und winkte jedem zu, der ihn grüßte). Die Wiener liebten auch das Feuerwerk, das er an seinem Geburtstag anzünden ließ, und die militärischen Uniformen, in die er sich bei bestimmten Anlässen – Paraden oder Feiern – zwängte: die rosa Hose und blaue Tunika des Husarenregimentes … das Grünsilber der Tiroler Gebirgsjäger … und dazu den großen Helm mit dem riesigen Federbusch darauf.
In jeder Wiener Schule hing ein Bild von Kaiser Franz Joseph und sein Gesicht mit dem Backenbart war den Kindern so vertraut wie das ihres Großvaters.
Aber Wien war nicht nur berühmt als Kaiserstadt, sondern auch als Stadt der Musik. Fast jeder berühmte Komponist hatte in Wien gearbeitet: Mozart und Schubert, Beethoven und Strauß. Musik drang aus den Häusern, in jedem Kaffeehaus wurden Walzer gespielt, sie erklangen von den Drehorgeln auf den Straßen – und in dem pompösen Opernhaus sangen sich die Sänger jede Nacht die Seele aus dem Leib.
Und dann war da noch das Essen. Die Wiener essen gern, und so waren die Straßen erfüllt von den köstlichsten Gerüchen – nach Vanille, frisch gemahlenem Kaffee, Zimt und Sauerkraut. Selbst Gurkensalat, der in anderen Städten nach nichts riecht, hatte in Wien einen eigenen Geruch.
Beim Zuckerbäcker konnte man kleine Frösche kaufen oder getupfte Marienkäfer und Schnecken mit Häuschen, alles aus Marzipan. Es gab Mäuse aus Zucker, die so täuschend echt waren, dass die Kinder kaum wagten, ihnen den Kopf abzubeißen, sowie komplette Lebkuchenhäuser, vor denen schreckliche Hexen aus Nugat standen mit spitzen Lakritzhüten auf dem Kopf. In den Konditoreien gab es allein sieben verschiedene Sorten von Schokoladentorten und köstliches Gebäck aus mit Haselnusscreme bestrichenen Waffeln. Es gab Teigschiffchen, gefüllt mit Beeren aus dem Wienerwald: köstliche Walderdbeeren, so glühend rot, als ob in ihnen ein Feuer brannte, und Blaubeeren, jede eine perfekte kleine Kugel.
Doch es gab auch anderes, weswegen man gern in Wien lebte: Da war der Prater, ein königlicher, von alten Bäumen beschatteter Park, in dem jedermann spazieren gehen oder reiten konnte, und der Wurstelprater, ein Vergnügungspark, in dem jüngst das größte Riesenrad der Welt aufgestellt worden war. Es gab die Donau, die sich um den nördlichen Teil der Stadt zog; mit einem Raddampfer konnte man flussaufwärts bis nach Bayern fahren oder flussabwärts bis nach Budapest in Ungarn. Und es gab die Alpen, die man in einer Stunde Zugfahrt erreichen konnte.
Wiens größter Stolz waren die weißen Dressurpferde der Spanischen Hofreitschule. Die Spanische Hofreitschule befand sich nicht in Spanien, sondern gehörte zur Hofburg mitten in Wien, und die barocke Reithalle mit den Deckenwölbungen und den Säulenreihen war bestimmt die schönste der Welt. Die Pferde dort – Lipizzanerhengste – wurden extra in einem Dorf namens Lipizza im Süden des Reiches gezüchtet und nur einige wenige, die besten, wurden an den kaiserlichen Hof gesandt. Untergebracht waren sie in einem ehemaligen prinzlichen Palais; sie fraßen aus Marmortrögen und mussten vier Jahre lernen, zu Musik bestimmte Bewegungen auszuführen, die einmal im Krieg so wichtig gewesen waren. Unglaubliche Bewegungen mit so klingenden Namen wie Kapriole, Pirouette, Levade …
Wenn Besucher in Wien gefragt wurden, was sie am liebsten sehen wollten, lautete die Antwort für gewöhnlich: »Die Lipizzaner. Die tanzenden weißen Hengste. Können wir die bitte sehen?«
3Der Untergang der Medusa
Kaum war sie erwacht, öffnete Annika ihr Dachfenster undblickte hinaus auf den Platz. Das tat sie jeden Morgen; sie wollte sich überzeugen, dass alles in Ordnung war, und an diesem Tag war es das. Die Tauben hockten wie immer auf General Brenners Haupt, die Fontäne im Brunnen sprudelte, und Josef stellte die Kaffeehaustische aufs Pflaster, was bedeutete, dass der Tag schön werden würde. In dem baufälligen kleinen Haus an der gegenüberliegenden Ecke öffnete sich eine Tür, und Annikas Freund Stefan trat heraus und lief mit einer Kanne über das Pflaster, um Milch zu holen. Er war der Mittlere von fünf flachshaarigen Jungen, und Frau Bodek, seine Mutter, erwartete dieser Tage das sechste Kind. Sie sagte, wenn es wieder ein Junge würde, wollte sie ihn weggeben.
Nun kam ein Hund zwischen den Kastanienbäumen hervor und lief über den Platz. Ein Hund, den sie nicht kannte, und Annika schaute gespannt hinaus – wenn es ein Streuner, ein herrenloser Hund war, dann konnte Ellie ihr doch sicher nicht abschlagen, ihn zu behalten, oder? Schließlich hatte Ellie auch sie aufgenommen, als sie herrenlos war, sie war ebenfalls eine Art Streuner gewesen, den man in einer Kirche abgelegt hatte.
Aber nun erschien hinter dem Hund eine Dame mit einer Leine in der Hand. Die Kirchturmuhr schlug sieben, und Annika wandte sich vom Fenster ab, um sich anzuziehen. Heute war Samstag und keine Schule – also konnte sie ihr Haar offen lassen, musste es nicht zu Zöpfen flechten, und sie musste auch nicht den Schulkittel anziehen. Aber es gab noch viel zu tun, bevor sie sich draußen mit ihren Freunden treffen konnte.
Es waren fast zwölf Jahre vergangen, seit Annika in das Haus der Professoren gebracht worden war. Als die Typhusepidemie vorbei gewesen war und das Kloster zum Heiligen Herzen ihnen mitgeteilt hatte, die Quarantäne sei aufgehoben, hatte Ellie das Baby eingewickelt und sie und Sigrid waren die Treppe hinauf zu ihren Arbeitgebern gegangen.
»Wir wollen uns verabschieden«, sagten sie. »Wir werden sie schon irgendwie durchfüttern, denn trennen können wir uns nicht mehr von ihr.«
Die Professoren waren gekränkt. Und verwirrt. Sie waren verletzt.
»Haben wir uns über das Baby beschwert?«, fragte Professor Julius steif.
»Haben wir irgendwelche Einwände gehabt?«, fragte Professor Emil.
»Ich bin sicher, dass ich nie etwas gesagt habe«, sagte Frau Professor Gertrud und sah sehr verletzt aus.
Sigrid und Ellie sahen einander an.
»Sie meinen, Annika kann hierbleiben?«
Professor Julius nickte. »Natürlich erwarten wir, dass sie sich nützlich macht«, sagte er.
»Das wird sie!«, rief Ellie. »Sie wird das nützlichste Kind von ganz Wien sein.«
Und das war sie wirklich geworden. Als sie sieben war, konnte Annika eine dreistöckige Schokoladentorte backen und glasieren und einen Braten auftragen. Mit neun konnte sie eine Gurke in so dünne Scheiben schneiden, dass man die Zeitung hindurch lesen konnte, und wenn man sie auf den Markt schickte, dann gaben ihr die Marktfrauen stets das beste Obst und Gemüse, denn das kleine Mädchen war bekannt für seinen kritischen Blick. Sigrid hatte ihr beigebracht, wie man das Parkett polierte (indem man mit Lappen an den Füßen darüber hinwegglitt); auch wie man Silber putzte, häkelte, strickte und nähte, wusste Annika – und von beiden Frauen hatte sie gelernt, dass Arbeit etwas war, das getan werden musste, ganz gleich, wie man sich dabei fühlte.
Aber weder Ellie noch Sigrid hatten ihr beigebracht zu träumen. Die Fähigkeit, sich in ihre eigene Welt im Kopf zurückzuziehen, kam von den unbekannten Eltern, die sie im Stich gelassen hatten.
Ellie war gerade damit beschäftigt, Kaffee zu mahlen und Semmeln zum Warmhalten in den Ofen zu legen, als Annika in die Küche kam. Aber sie drehte sich um und umarmte ihre Adoptivtochter. Sie befürchtete zwar längst nicht mehr, dass es jeden Moment an die Tür klopfen und eine fremde Frau Annika für sich beanspruchen würde, aber dennoch war sie jeden Morgen dankbar, wenn Annika aus ihrem Dachstübchen zu ihr herunterkam.
»Hast du dich auch hinter den Ohren gewaschen?«
Annika nickte und machte ein Ohr frei zum Beweis. Sie war ein kräftiges Mädchen mit dickem maisblondem Haar, nachdenklichen grauen Augen unter geschwungenen Brauen und einem breiten Mund. Auf dem Land gab es viele solcher hübscher, helläugiger Mädchen – sie hüteten Gänse, melkten Kühe oder brachten im Sommer das Vieh auf die höher gelegenen Almen, aber die wenigsten hatten Annikas Intelligenz. Und nicht nur das, sie war ein Kind, das andere Menschen trösten konnte. Das war schon immer so gewesen.
Als Annika Ellies Umarmung erwiderte, sog sie den Geruch nach grüner Seife und frisch gebackenem Brot ein, der Ellies weißer Schürze entströmte, und kräuselte erfreut die Nase. In die Küche zu kommen bedeutete, nach Hause zu kommen. Niemals änderte sich hier etwas: Der Tisch war stets weiß gescheuert, über dem Herd hing ein Porträt des Kaisers und auf dem Fensterbrett neben einem Topf mit Kräutern stand ein Kalender, der jedes Jahr von einer bayerischen Wurstwarenfabrik geschickt wurde. Auf einem besonderen Bord neben der Anrichte lag das abgegriffene schwarze Rezeptbuch, das schon Ellies Mutter und Großmutter gehört hatte.
Aber es war an der Zeit, mit der Arbeit zu beginnen.
Annika holte die Aprikosenmarmelade für Professor Julius heraus, die Himbeerkonfitüre für Professor Emil und den Honig für Frau Professor Gertrud und trug alles die Treppe hinauf. Dann legte sie die Servietten zurecht, prüfte, ob die Zuckerschale gefüllt war, ging wieder hinunter in die Küche, um einen Eimer mit heißem Wasser für Professor Julius’ Waschschüssel zu holen und dann noch einen für Professor Emil.
Währenddessen hatte Sigrid die unteren Räume gewischt und aufgeräumt und danach frühstückte sie zusammen mit Ellie und Annika in der Küche. Dann erklang die Glocke aus dem Zimmer von Frau Professor Gertrud, und Sigrid holte den frisch gebügelten schwarzen Seidenrock, an dessen Saum noch ein Stückchen Käse geklebt hatte, und gab ihn Annika, damit sie ihn hinaufbrachte. Professor Gertrud spielte Harfe bei einer Matinee, und man musste immer darauf achten, dass ihre Kleidung sauber und ordentlich war, bevor sie das Haus verließ.
Bald darauf ertönte die Glocke wieder. Diesmal war es Professor Emil, der seine Krawatte nicht finden konnte, gefolgt von Professor Julius, der Annika mit einem Kreuzer in den Zeitungsladen um die Ecke schickte, um Wien heute zu kaufen.
»Jacobson, dieser Idiot, hat einen Artikel über den Ursprung vulkanischen Gesteins veröffentlicht, absoluter Schwachsinn«, schimpfte er. »Ich habe eine Gegendarstellung verfasst, die müsste heute drinstehen.«
Also lief Annika über den Platz und durch die Kastanienbäume in die Kellerstraße und hoffte, dass man den Brief abgedruckt hatte; wenn nicht, würde sich der Professor sehr aufregen.
Die Dame im Zeitungsladen kannte Annika gut und hatte bereits den Brief des Professors in der Zeitung entdeckt. »Dann hat er heute gute Laune«, sagte sie und fügte hinzu: »Ich hab gehört, dass das Bodek-Baby jeden Augenblick kommen kann.«
Annika nickte. »Wenn es wieder ein Junge wird, gibt sie ihn weg.«
Als Annika mit der Zeitung zurückgekommen war, wurde sie gleich noch einmal losgeschickt, um Blumen bei der Blumenverkäuferin zu kaufen, die mit ihrem Korb neben dem Brunnen saß. Es war Annikas Aufgabe, die Blumen auszuwählen, die Professor Julius jeden Samstag vor das Bild seiner Liebsten stellte – seine Verlobte, die kurz vor der Hochzeit gestorben war. Heute, der Sommer hatte gerade begonnen, entschied sich Annika für Enzian und Edelweiß aus den Bergen und brachte sie in das Arbeitszimmer des Professors, wo der gerade den Brief las, den er nun schon zum dritten Mal an die Zeitung geschickt hatte.
Das Bild seiner Liebsten, die Adele Fischl geheißen hatte, stand auf einem Tisch neben dem Fenster, und während sie die Blumen arrangierte, dachte Annika, wie traurig es doch war, dass Adele nicht mehr lebte. Sie war eine ernsthaft dreinblickende Frau mit ausgeprägter Nase gewesen, und Annika war sicher, dass sie sehr gut zum Professor gepasst hätte.
Danach ließ Sigrid sie die silbernen Kerzenleuchter putzen, und dann war auch schon Zeit für das zweite Frühstück – ein Glas schäumende Milch und ein goldbraunes Vanillekipferl frisch aus dem Ofen. Annika nahm beides mit hinaus auf den gekiesten Hof hinter dem Haus.
Annika liebte den Hof mit seiner von wildem Wein berankten Tür, die auf die rückwärtige Gasse führte. Von der Waschküche aus war eine Wäscheleine über den Hof gespannt, einen Holzschuppen gab es und den alten Stall, in dem längst keine Pferde und keine Kutsche mehr standen, sondern altes Gerümpel aufbewahrt wurde. Im Hof standen Ellies Geranien- und Petunientöpfe und in einer sonnigen Ecke gab es eine blaue Bank, auf der die Dienstboten gern saßen, wenn sie mal eine Minute für sich hatten.
Aber heute war keine Zeit, in der Sonne auszuruhen. Die Wäsche musste aufgehängt werden, die Teppiche ausgeklopft und die Erbsen für das Mittagessen gepalt werden. Und dann musste Annika in die Kellerstraße laufen und unter den dort wartenden Fiakern einen passenden für Frau Professor Gertrud auswählen, einen, der groß genug für die Harfe war und von einem friedlich aussehenden Pferd gezogen wurde, sodass das Instrument nicht allzu sehr durchgeschüttelt wurde.
Dann schnell zurück in die Küche, um Ellie mit dem Mittagessen zu helfen. Das Mittagessen am Samstag bestand aus mehreren Gängen: Heute gab es Erbsensuppe, Rindsragout mit Klößen und zum Nachtisch Palatschinken mit Pflaumenmus gefüllt. All das musste von der Küche hoch ins Esszimmer getragen werden, wo die beiden Professoren saßen, die Serviette in den Kragen gesteckt, und mit gutem Appetit aßen.
Nun nahmen Sigrid, Ellie und Annika ihr Essen in der Küche ein und danach kam der Abwasch – Berge und Berge von dreckigem Geschirr.
Aber am Samstagnachmittag hatte Annika frei.
Zuerst ging Annika zum Buchladen an der Ecke. Es war ein Antiquariat, was hieß, dass dort alte Bücher verkauft wurden. Das hieß allerdings auch, dass nicht sehr viele Leute in den Laden kamen. Keiner wusste so recht, womit Herr Koblitz, dem der Laden gehörte, seinen Lebensunterhalt bestritt. Er war kein sehr umgänglicher Mann, und wenn jemand ein Buch kaufen wollte, das er noch nicht zu Ende gelesen hatte, konnte er sehr brummig und unfreundlich werden.
Heute las er gerade in einem Buch über ägyptische Mumien.
»Ist Pauline fertig?«, fragte Annika.
Pauline war Herrn Koblitz’ Enkelin. Sie wohnte bei ihm, denn ihre Mutter arbeitete als Stationsschwester in einem Krankenhaus in Linz und schlief auch dort. Genau wie Annika musste auch Pauline bei der Hausarbeit helfen, die Bücherregale abstauben, den Boden fegen, die Bücher aufstapeln.
Herr Koblitz nickte. »Sie ist hinten.«
Auch Pauline las. Sie war ein dünnes Mädchen mit wirrem schwarzem Haar und dunklen Augen. Pauline war klug, sie konnte sich stets an alles erinnern, was in den Büchern stand, die sie verschlang. Sie hatte ein Album, in das sie wichtige Artikel klebte, die sie aus der Zeitung ausschnitt. Artikel über mutige Taten von Leuten, die nur ein Bein hatten oder blind waren oder die man als Baby auf den Kopf hatte fallen lassen. »Ich sammele sie, damit ich mutig werde«, erklärte Pauline.
Aber Annika meinte, es sei blödsinnig, schlau und mutig zugleich sein zu wollen. »Du bist genau richtig so, wie du bist«, sagte Annika oft, aber Pauline glaubte ihr nicht. Sie war ein furchtsames Mädchen, das ungern die Buchhandlung verließ, fremde Menschen und unbekannte Orte machten ihr Angst. Aber sie wusste, dass sie gegen diese Furcht angehen musste, wenn sie all das, was sie nicht richtig fand auf der Welt – dass zum Beispiel Reiche alles besaßen und Arme nichts –, später einmal ändern wollte. Nun klappte sie das Buch zu – es war eine Geschichte über ein Schiff namens Medusa, das im Atlantik untergegangen war – und folgte Annika hinaus auf die Straße. »Ich glaube, es wäre genau richtig für uns«, sagte sie. »Es ist sehr aufregend mit all den Leuten, die da auf dem Rettungsboot zusammengepfercht sind und später vom Meer verschlungen werden.«
Annika nickte. »Erzähle, wenn wir da sind, dann kann Stefan es auch hören.«
Stefans Familie, die Bodeks, lebte im Untergeschoss des kleinsten Hauses am Platz. Sie war sehr arm. Herr Bodek arbeitete als Platzwart im Wurstelprater und Frau Bodek als Wäscherin, aber wenn man fünf Jungen durchzufüttern hatte, blieb natürlich kaum etwas übrig.
Und doch war es Frau Bodek gewesen, die an dem Abend, als Annika ins Haus gekommen war, einen Stapel frisch ausgekochter Windeln und ein paar Babysachen für das Findelkind vorbeigebracht hatte. Stefan, der mittlere ihrer Söhne, war genauso alt wie Annika, die beiden waren zusammen aufgewachsen, hatten ihre wenigen Spielsachen miteinander geteilt und in der Küche krabbeln gelernt. Die Bodek-Jungen waren alle freundlich und fröhlich, aber Stefan war etwas Besonderes. Annika hätte ihm blindlings ihr Leben anvertraut.
»Ich hab nicht viel Zeit«, sagte er jetzt. »Das Baby kann jeden Moment kommen, und ich soll die gute Nachricht überbringen.«
Aber er setzte seine Kappe auf, und die drei Kinder liefen zusammen den Durchgang neben der Kirche hinunter, eine gepflasterte Gasse entlang und hielten bei einer bröckeligen Mauer, die mit Efeu überwuchert war.
Die Mauer war ziemlich hoch, aber wenn man an einer bestimmten Stelle den Efeu beiseiteschob, konnte man ein Loch erkennen. Die drei krochen hindurch, und dann waren sie im Garten.
Jedes Mal, wenn alles noch so war wie immer, überflutete sie Erleichterung – denn der Garten war dem Untergang geweiht, das wussten sie. Er gehörte der Stadt Wien, und es sollten Geschäftshäuser darauf gebaut werden. Jeden Tag konnten die Arbeiter kommen, und die Zerstörung würde beginnen.
Aber heute noch nicht. Marienkäfer flogen über das hohe Gras, Disteln und Löwenzahn bewegten sich sacht im Wind, eine große Zeder breitete ihre Äste aus. Am Kopf einer Treppe aus zerborstenen Steinstufen stand die Statue einer Venus ohne Arme und blickte ungerührt auf die Reste eines Springbrunnens, im Teich blühten zwischen all dem Unkraut noch Seerosen.
Der Garten gehörte zu der Ruine eines Hauses, in dem einmal ein österreichischer Adeliger gewohnt hatte, der vor über hundert Jahren nach Wien gekommen war, um dem Kaiser zu dienen und sein Glück zu machen.
Und das hatte er, er hatte ein Vermögen verdient. Leider war er ein Spieler und hatte nach und nach all das Geld wieder verloren. Sein schönes Haus wurde verkauft und wieder verkauft. Dann stand es lange leer, ein Feuer brach aus … und nun war von der einstigen Villa nur noch ein Haufen umgestürzter Säulen und zerbrochener Steine übrig geblieben.
Aber der Garten hatte überlebt. Er war schöner denn je, verwildert und geheimnisvoll.
»Wir lassen alles, wie es ist … wir werden noch nicht einmal das Unkraut aus den Blumenbeeten zupfen«, hatte Annika beschlossen, als sie den Garten entdeckt hatten, und die anderen waren einverstanden gewesen.
Aber einen Platz gab es, den sie schrubbten und pflegten. Inmitten eines Gebüschs, überwachsen von Flieder und Goldregen, stand eine grün gestrichene Hütte. Sie hatte einst als Geräteschuppen gedient und war, anders als das Haus, unversehrt, der Schornstein intakt, die Fenster heil, die Tür ließ sich ordentlich schließen.
Diese Hütte war ihr Hauptquartier. Sie hatten sich eine Decke als Teppich besorgt und ein paar Becher, in einer Flasche steckte eine Kerze, und Stefan hatte ein Vorhängeschloss für die Tür aufgetrieben.
Zu Beginn hatten sie noch gespielt, dass die Hütte ihr Zuhause war. Hatten Nüsse und Beeren zum Essen gesammelt und so getan, als gingen sie schlafen oder erwachten. Aber nun waren sie älter, und die Hütte war der Ausgangspunkt für ihre Phantasien geworden. Mal war sie die von Buren belagerte Stadt Mafeking in Südafrika, mal ein Pharaonengrab im Tal der Könige, das von Grabräubern bedroht wurde. In der vergangenen Woche war die Hütte das Schloss gewesen, in dem Maria Stuart, die schottische Königin, auf einer Insel im Loch Leven gefangen gehalten worden war.
Für gewöhnlich war es Pauline, die die Geschichten aus einem ihrer Bücher hatte. Manchmal mussten Rollen doppelt besetzt werden, und sie waren erst Soldaten und gleich darauf das Volk, auf das die Soldaten schossen. Es war eine Mischung aus Spiel und Schauspielerei, und dabei vergaßen sie alles um sich herum.
Heute erzählte ihnen Pauline von der Medusa, einem Sklavenschiff, das ein korrupter und unfähiger Kapitän vor der afrikanischen Küste aufgrund gesetzt hatte.
»Die reichen Passagiere haben sich in die Rettungsboote geflüchtet und die Sklaven sich selbst überlassen. Also haben die sich ein großes Floß gebaut und trieben tagelang auf dem Meer, aber allmählich verdursteten die Ersten oder wurden ins Meer gespült oder einfach verrückt. Die anderen haben dann sogar das Fleisch der Toten gegessen – und als endlich ein Schiff auftauchte, das sie an Bord nahm, da waren von über hundert Menschen nur noch fünfzehn am Leben.«
Annika nickte. »Die Hütte kann die Medusa sein, und die Decke legen wir ins Gras, die ist dann das Floß und das Gras drum herum das Meer. Stefan könnte aufgegessen werden, und seine Überreste werfen wir ins Wasser, danach kann er ja der Kapitän von dem Rettungsschiff sein.«
Sie änderte oft die Geschichten, um sie zu vereinfachen oder dramatischer zu machen und jedem die Chance zu geben, zu ertrinken, erschossen zu werden oder sich unter einem Hagel von Pfeilen in die Hütte zu flüchten.
Ein paar Stunden lang litten sie nun unter Schiffbruch, Durst, Terror und Kannibalismus. Und plötzlich war alles vorbei. Sie aßen ihre Brote – Pauline und Annika teilten ihre immer mit Stefan, da seine Mutter ihm nichts mitgeben konnte. Als die Uhr sechs schlug, tauchten sie aus ihrer Welt wieder auf, säuberten und verschlossen die Hütte und krabbelten durch das Loch in der Mauer auf die Gasse zurück.
Auf dem Platz trennten sie sich und wurden wieder ihr vormaliges Selbst.
Später am Abend, als Annika gerade in der Küche saß und Brotstreifen in ihre Eier im Glas tauchte, klopfte es an die Hintertür, und Stefan kam herein. »Es ist da«, sagte er. »Das Baby.«
Alles wartete gespannt.
»Ein Junge«, sagte Stefan.
Annika stieß ihr Glas von sich. »Gibt sie ihn wirklich weg?«
Stefan grinste: »Sie doch nicht. Sie wiegt ihn und herzt ihn und erzählt uns, was für ein süßes Baby er ist. Sie glaubt sogar, er hätte schon Haare.«
Ellie stand auf und holte eine Decke, die sie für das Baby gestrickt, und eine Haube, die Sigrid gehäkelt hatte.
»Seid ihr ganz sicher, dass sie ihn nicht weggibt?«, fragte Annika etwas ängstlich, als Stefan fort war.
»Sie nicht«, sagte Ellie. »Mütter geben ihre Babys nicht einfach weg«, begann sie und brach ab, als sie Annikas Gesicht sah. Sie legte ihre Hand auf die des Mädchens. »Deine Mutter hätte dich sicher behalten, wenn sie gekonnt hätte, das weißt du doch, nicht wahr?«
Ja, das wusste Annika. Wenn sie in ihrem Dachstübchen im Bett lag und das Licht gelöscht hatte, dann erzählte sie sich eine Geschichte, jede Nacht dieselbe.
Sie begann mit dem Läuten der Türglocke – der Glocke an der Vordertür! –, und eine Frau stieg aus einer Kutsche. Unter ihrem Samthut quoll dickes kastanienbraunes Haar hervor. Ihre Augen waren von der gleichen Farbe, einem vollen, warmen Braun. Sie war groß und elegant gekleidet, genau wie die Dame auf dem Bild, das in Professor Emils Arbeitszimmer hing und den Titel trug The Lady of Shalott. Sie rauschte durch die Tür ins Haus und fragte: »Wo ist sie? Wo ist meine verlorene Tochter? Oh, bringt mich zu ihr!« Und dann … dann schloss sie Annika in ihre Arme. »Mein Schatz, mein geliebtes Kind«, sagte sie und erklärte, warum sie Annika in der Kirche abgelegt hatte.
Diese Erklärung zu finden war gar nicht so einfach, und jedes Mal, wenn Annika sich die Geschichte erzählte, dachte sie sich an der Stelle etwas anderes aus. Heute Abend war sie zu müde, und so übersprang sie diesen Teil und machte an der Stelle weiter, wo ihre Mutter zurück zur Kutsche ging und ein Hund heraussprang – ein Golden Retriever mit seelenvollen, feuchten Augen …
»Er gehört dir«, sagte ihre Mutter. »Ich war mir ganz sicher, dass du gern einen Hund hättest.«
Und spätestens hier war Annika stets eingeschlafen.
4Weiße Pferde
Es gab nur ein Mädchen in der Nachbarschaft, das Annika nichtausstehen konnte. Ihr Name war Loremarie Eckhart, und sie lebte in einem großen Haus am Platz gegenüber dem der Professoren.
Die Eckharts waren sehr reich, denn Loremaries Großvater war Federbettenfabrikant gewesen, er hatte Daunendecken und Daunenkissen hergestellt. Diese wurden mit Federn von ungarischen Gänsen gefüllt, die zusammengetrieben und bei lebendigem Leib gerupft wurden. Die Eckharts interessierten sich aber nicht für Gänse, sie interessierten sich nur für Geld.
Loremaries Vater bezog immer noch Geld aus der Federbettenfabrik, aber er war ein einflussreicher Hofrat geworden und Mitglied des Reichsrates, wohin er jeden Tag – eine Blume im Knopfloch – ging und sich langweilige Gesetze ausdachte und seine Untergebenen mit einer Stimme anschrie, die lauter war als ein Nebelhorn.
Mehr als alles auf der Welt wünschte er sich, ein Denkmal zu werden. Kein Reiterstandbild, das hätte nicht zu ihm gepasst, nein, einfach eine Statue auf einem Sockel. In Wien gab es viele solcher Statuen: Statuen von Generälen und Hofräten und Politikern, und Herr Eckhart dachte, wenn er einmal so endete, dann hätte sich sein Leben gelohnt.
Loremaries Mutter, die Frau Hofrat, verbrachte ihre Zeit damit, ihre Tochter zu verziehen, Geld auszugeben und zu klatschen und tratschen. Auf all ihre Nachbarn sah sie herab, vor allem auf die Familie Bodek, die ihrer Meinung nach am Brennerplatz nichts zu suchen hatte. Überallhin ließ sie sich in dem funkelnagelneuen Automobil ihres Gatten fahren. Es war kanariengelb, hatte riesige Messinglampen und eine Hupe, die man noch drei Straßen weiter hören konnte. Frau Eckhart beschäftigte nicht nur Mädchen vom Land, die im Haushalt arbeiten mussten, sondern auch einen hochnäsigen Diener namens Leopold, der Loremarie den Ranzen auf ihrem Schulweg hinterhertrug.
Unnötig zu erwähnen, dass es Loremarie natürlich strengstens untersagt war, mit einem »Küchenmädchen« wie Annika zu spielen, sodass es nicht allzu schwer war, ihr aus dem Weg zu gehen.
Nach dem Kirchgang am Sonntagmorgen pflegte Annika sich darüber zu informieren, was in der Stadt geschah. Dazu ging sie langsam um die große rote Litfaßsäule herum, die gegenüber den Kastanien stand, und studierte die Plakate und Werbezettel, mit denen die Säule beklebt war. Da stand, welche Stücke gespielt wurden und was man in der Oper gab. Militärparaden wurden angekündigt, das Gastspiel eines Zirkus, spezielle Matineen im Theater und Empfänge, die der alte Kaiser in dem jeweiligen Palast gab, in dem er sich gerade aufhielt. Natürlich gab es auch Werbung für Magenpillen und für Mittel gegen Haarausfall und das Bild eines Mannes mit schwellenden Muskeln, die er bekommen hatte, weil er eine ganz bestimmte Sorte Leberwurst aß.
Heute gab es etwas Neues, ein großes Plakat, auf dem ein schneeweißes Pferd abgebildet war mit goldenen Zügeln und einem Sattel mit goldener und purpurroter Schabracke. Das Pferd hockte auf den Hinterbeinen, die Vorderbeine hatte es erhoben und angezogen. Auf seinem Rücken saß ein Mann in einem kaffeebraunen Frack mit einem Zweispitz auf dem Kopf – und Annika (wie wohl jedes Kind in Wien) wusste, dass dieses Pferd einer der berühmten Lipizzanerhengste war, der gerade eine Levade vollführte. Und es war nicht irgendein Hengst, sondern Maestoso Fantasia, der älteste und stärkste Hengst und der Liebling des Kaisers.
Auf dem Plakat stand:
GALAVORSTELLUNG
INDERSPANISCHENHOFREITSCHULE
am 14. Juni 1908
zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit
König Edward VII. von Großbritannien
In Anwesenheit Seiner Majestät
Kaiser Franz Joseph I.
Es spielt die Kapelle der Österreichischen Grenadiere
(Eine begrenzte Anzahl von Plätzen steht für das
allgemeine Publikum zur Verfügung)
Annika starrte die Vorankündigung lange an. Sie ging oft an den Stallungen der Lipizzaner vorbei, ja, sie hatte sogar schon einmal einen Blick hineinwerfen können, denn Stefans Onkel arbeitete dort als Hufschmied, aber sie hatte noch nie eine richtige Vorstellung in der Hofreitschule miterlebt.
Die Eintrittskarten waren unglaublich teuer, sodass Ellie und Sigrid es sich einfach nicht leisten konnten, Annika dorthin mitzunehmen, daran war nicht im Traum zu denken.
Annika sah noch wehmütig auf das Plakat, als sie eine hohe herrische Stimme hinter sich vernahm.
»Wir gehen zu der Gala, nicht wahr, Miss Smith?«
Es war Loremarie mit ihrer englischen Gouvernante, einer langen, traurig dreinblickenden Person. Loremarie hatte bereits viele Gouvernanten gehabt, aber eins hatten alle miteinander gemein: Nach ein paar Monaten mit Loremarie sahen sie alle traurig aus.
»Wir nehmen natürlich Plätze im ersten Rang, erste Reihe«, prahlte Loremarie und schielte zu Annika.
Sie trug einen Schottenrock und eine Mütze im gleichen Karo, obwohl die Eckharts gar keine Schotten waren. Ihre kleinen dunklen Augen saßen tief in ihren bleichen Wangen, und sie hatte eine eigentümliche Art zu gehen: Sie streckte ihren Po heraus, als ob sie allen zeigen wollte, dass ihre Hinterseite genauso bedeutend war wie ihre Vorderseite.
»Die Karten sind sehr, sehr teuer«, tönte Loremarie noch. Dann zog die Gouvernante sie schnell mit sich, um sie zu ihrer Ballettstunde zu bringen.
Da niemand genau wusste, wann Annika geboren worden war, feierten Ellie und Sigrid nicht ihren Geburtstag, sondern ihren »Findetag«, den Tag, an dem sie das Bündel mit dem Kind auf den Altarstufen in der Pettelsdorfer Kirche gefunden hatten.
An diesem Tag verließen sie Wien stets sehr früh am Morgen und nahmen den gleichen Zug in die Berge wie damals, um in der kleinen Kirche ein Dankgebet zu verrichten. Doch zuerst mussten sie durch das Dorf gehen, immer in Sorge, dass ihnen jemand erzählen könnte, eine unbekannte Frau wäre aufgetaucht und hätte Fragen gestellt. Aber als die Jahre vergingen und nichts dergleichen geschah, entspannten sie sich. Es schien wirklich so, als hätte sich die Frau, die ihre Tochter auf den Altarstufen abgelegt hatte, in Luft aufgelöst.
Als Annika noch ein Baby war, hatten Ellie und Sigrid sie an diesem Tag bei den Bodeks gelassen, aber sobald sie laufen konnte, hatten sie sie mit in die Berge genommen. Der 12. Juni war immer ein besonders schöner Tag gewesen. Die Kiefern verbreiteten ihren würzigen Duft, der Bach glitzerte und glückliche Kühe grasten zwischen dicken Büscheln von Klee, Primeln und Glockenblumen, die das saftige Gras schmückten.
»Ich bin froh, dass ich hier gefunden wurde und nicht an irgendeinem langweiligen Ort«, pflegte Annika zu sagen.
Doch wenn sie die Kirche betraten, überfiel sie Trauer und so etwas wie Ärger. »Ich war es, die du weggegeben hast«, hätte sie ihrer abwesenden Mutter am liebsten gesagt. »Nicht irgendjemand, ich war es.«
Aber dann fühlte sie sich jedes Mal schuldig, und wenn sie dann am Abend im Bett lag und sich wieder die Ankunft ihrer Mutter ausmalte, kannte die Liebe zwischen ihrer Mutter und ihr keine Grenzen.
Der feierlichste Teil des Findetages folgte dann am nächsten Samstag, wenn Annika sich von den Professoren eine besondere Freude erbitten durfte, etwas, woran das ganze Haus teilnehmen konnte. Im Jahr zuvor waren sie auf einem Raddampfer auf der Donau bis nach Dürnstein gefahren, und im Jahr zuvor waren sie in der Oper gewesen und hatten Hänsel und Gretel gesehen.
Dieses Jahr nahm Annika all ihren Mut zusammen und fragte, ob sie die Galavorstellung der Spanischen Hofreitschule zu Ehren des englischen Königs besuchen könnten. Sie hatte genug von Loremaries Spötteleien.
»Natürlich nur, wenn es nicht zu teuer ist«, sagte sie.
Es war teuer, sehr teuer, und die Professoren waren mit Annikas Wahl nicht sehr glücklich, denn sie fanden, dass der Kaiser viel zu viel Geld in seine schönen weißen Pferde steckte, Geld, mit dem man die Universitäten besser hätte ausstatten können, besonders die Bereiche, in denen die drei arbeiteten.
Auch Sigrid hielt nicht allzu viel von den Lipizzanern. »Mit dem, was diese Tiere kosten, könnte man in der ganzen Stadt neue Krankenhäuser bauen«, sagte sie.
Aber die Professoren gaben nach und kauften nicht nur Eintrittskarten für sich und ihre Angestellten, sondern auch für Stefan und Pauline.
Diesen Geschenken voraus gingen jedoch immer pädagogische Unterweisungen. Bevor sie zum Beispiel nach Dürnstein gefahren waren, hatte Professor Julius Annika darüber belehrt, wie tief der Fluss an dieser Stelle war, wie hoch die Strömungsgeschwindigkeit und aus was für einer Art von Sandstein das Schloss gebaut worden war.
»Wir haben in der Schule ganz viel über die Pferde der Hofreitschule gelernt«, sagte Annika in der Hoffnung, diesmal um eine Lektion herumzukommen.
Sie wusste bereits, dass die Pferde in Lipizza in der Nähe von Triest gezüchtet wurden, eine Kreuzung aus Arabern und spanischen Pferden. Erzherzog Karl hatte vor ungefähr dreihundert Jahren die Ersten nach Wien gebracht. Sie wusste, dass die Pferde bei der Geburt nicht weiß, sondern dunkelbraun oder schwarz waren, so wie Dalmatinerwelpen noch keine Flecken haben, und dass jeder Hengst seinen eigenen Bereiter hatte, der ihn sein ganzes Leben in der Hofreitschule begleitete.
Aber das reichte Professor Julius nicht. Er nahm Annika mit in sein Arbeitszimmer und breitete eine Karte des Karstes aus, der Hochebene, auf der Lipizza lag.
»Der Boden ist sehr karg und felsig, sodass die Pferde früh lernen, die Beine zu heben. Man sagt, dass ihnen das später bei der Dressur sehr nützlich ist. Das ganze Gebiet besteht aus Kalkstein, der sehr porös ist und …« Schon schweifte er ab, denn er war schließlich in erster Linie Geologe, und Kalkstein interessierte ihn mehr als Pferde. Es dauerte eine Stunde, bis Annika endlich erlöst war.
Professor Emil nahm sie und Pauline mit ins Museum. Die beiden Mädchen kannten das Gebäude mit seinen Marmorfußböden und den Bildern von halb bekleideten Damen mit Grübchen am Knie sehr gut. Aber diesmal führte Professor Emil sie zur spanischen Malerei des 17. Jahrhunderts. Riesige Schlachtengemälde hingen da, sie sahen sich aufbäumende Rösser und sterbende Soldaten; von den Schwertern tropfte das Blut.
»Hier könnt ihr sehen, wie das Pferd seine Vorderbeine über dem feindlichen Soldaten erhebt«, sagte der Professor und zeigte auf einen grauen Hengst mit geblähten Nüstern und wilden Augen. »Das nennt man eine Courbette. Im nächsten Moment werden die Hufe den Mann zu Brei treten. Und das Pferd da drüben ist das des Herzogs von Mailand, es sieht aus, als flöge es. Es vollführt eine Kapriole. Seht nur, wie es mit den Hinterbeinen ausschlägt!«
Und er erklärte, dass die berühmtesten Dressurfiguren der Pferde – Schule über der Erde genannt – ursprünglich einmal für den Krieg entwickelt worden waren, wo sie dem Reiter helfen konnten zu fliehen oder seinen Widersacher zu töten.
Als sie dann schließlich in zwei einspännigen Fiakern losfuhren – Annika mit den Professoren im ersten und Sigrid, Ellie, Stefan und Pauline im zweiten –, bereute Annika fast ihren Wunsch. Als sie nämlich erfuhr, dass Loremarie auch bei der Gala sein würde, hatte Sigrid entschieden, dass Annika ein neues Kleid brauchte, und hatte eine Rolle meergrüner Seide erstanden. Sie war eine vorzügliche Näherin, und das Kleid war einfach prachtvoll geworden. Annika trug das Haar offen mit einem passenden Seidenband darin, aber sie fühlte sich, als ob sie zu einer Prüfung ginge, die statt von Menschen von Pferden abgehalten werden sollte. Doch als sie die Stufen hinaufging und die Reithalle betrat, vergaß sie all ihre Bedenken.
Es sah hier aus wie in einem Ballsaal: die Kristalllüster mit ihrem gleißenden Licht, die strahlend weißen Wände und roten Samtpolster, das riesige Porträt von Karl VI. auf seinem Ross. Die Kapelle spielte leise Musik, und der gelbliche Sand unter ihr war in Wirbel geharkt, sodass er aussah wie das Meer.
Loremarie saß am anderen Ende der Reihe und machte sich furchtbar wichtig, aber Annika achtete nicht auf sie.
Nun spielte das Orchester die Kaiserhymne und alles erhob sich von den Plätzen, weil der Kaiser in seiner weißen Uniform hereinkam, begleitet von seinem Gast, dem beleibten englischen König – und Ellie seufzte vor Behagen. Sie liebte den Kaiser, der so alt, so allein und so stur seine Pflicht erfüllte. Dann setzten sich alle wieder hin, der Radetzkymarsch erklang, die großen Flügeltüren öffneten sich – und zwei Dutzend schneeweiße Pferde traten auf.
Stolz, in perfekter Formation und im Einklang mit der Musik hoben und senkten sie ihre Beine, und als sie vor dem Platz des Kaisers ankamen, hielten sie wie auf ein geheimes Kommando an, und die Reiter nahmen ihre kokardengeschmückten Hüte ab und verbeugten sich.
Dann begann die Vorstellung mit einer einfachen Bewegung, der Passage, einer Art schwebendem Trab. Es folgte die Piaffe, bei der die Pferde im exakten Rhythmus auf der Stelle traten, der fliegende Galoppwechsel, die Drehung um die Hinterhand … Die Reiter in ihren weißen Reithosen aus Hirschleder saßen ganz still, führten die Pferde mit fast unmerklichen Bewegungen, vielleicht auch nur mit ihren Gedanken. Das Zusammenspiel von Tier und Mensch war in vielen Jahren Training eingeübt worden.
Nun verließen die jüngeren Tiere die Manege, und die Kapelle spielte ein Menuett von Boccherini. Drei der am besten ausgebildeten Hengste vollführten einen Pas de trois, verbanden ihre Schritte zu einem komplizierten und fehlerlosen Tanz.
Dann verschwanden die drei Hengste durch die riesige Tür. Die Pferde, die nun auftraten, waren reiterlos. Ihre Bereiter folgten ihnen, hielten sie nur am langen Zügel. Das waren die erfahrensten Hengste, die die Schrittfolgen allein ausführen konnten. An erster Stelle das Lieblingspferd des Kaisers, Maestoso Fantasia, dasjenige, das Annika auf dem Plakat gesehen hatte.
Wenn Annika ursprünglich beschlossen hatte, sich die Aufführung anzusehen, weil sie es Loremarie gleichtun wollte, so hatte sie dies längst vergessen. Neben ihr beugte sich Pauline, die eigentlich vor den stampfenden, schnaubenden Pferden Angst hatte, gespannt über die Balustrade.
Nach der Pause folgte der Höhepunkt, die Frucht all der harten Jahre des Übens, die berühmte Schule über der Erde. Es begann mit einer Levade, bei der der Reiter keine Steigbügel benutzt. Die Kinder in Wien kennen diese Figur von den vielen Reiterstandbildern, wo das Pferd fast auf seinen Hinterbacken sitzt und die Vorderbeine in der Luft anwinkelt … es folgte die Courbette, wo die Pferde sich nicht nur aufbäumen, sondern mit den Hinterbeinen einen Sprung vollführen und man ihre Muskeln sehen kann, die sich wölben und vor Anstrengung zittern … und dann das Schwierigste von allem, die verblüffende Kapriole, wo es scheint, als ob die Pferde wirklich flögen. Annika, wie die anderen Zuschauer auch, konnte vor Erstaunen nur ein gehauchtes »Oh!« ausstoßen.
Die Aufführung endete mit der berühmten Schulquadrille, dem »Ballett der weißen Hengste«, an der alle Tiere teilnahmen.
Im Gegensatz zu den anderen Kindern im Publikum konnte Loremarie einfach nicht still sitzen. Sie zappelte ständig herum, ließ ihr Täschchen fallen und hob es wieder auf … Nun stand sie auf und zeigte auf ein Pferd, das sich mitten zwischen den anderen befand, die sich jetzt fehlerfrei durch die Säulen schlängelten. »Das Pferd da hat die falsche Farbe!«, rief sie laut. »Es ist braun und nicht weiß. Es hat hier nichts zu suchen!«
Natürlich wiesen nicht etwa ihre Eltern sie zurecht, sondern ein Herr in der Reihe dahinter sagte, sie solle sich wieder hinsetzen und still sein. »Du hättest vor deinem Besuch besser die Tradition der Spanischen Hofreitschule studieren sollen«, sagte er streng.
Loremarie zuckte nur mit den Schultern, setzte sich widerwillig, und das Pferdeballett ging weiter.
Noch einmal schwenkten die Reiter ihre Hüte vor dem Platz des Kaisers, die Ohren der Pferde stellten sich in Erwartung des donnernden Beifalls auf – und dann war es vorbei.
»Da ist man doch stolz darauf, Österreicherin zu sein«, sagte Ellie, als sie sich erhob, und keiner sprach mehr davon, dass das Geld besser für die Universität hätte ausgegeben werden sollen.
Die Eckharts führten Loremarie ohne ein Wort zu sagen hinaus und brausten in ihrem riesigen gelben Automobil davon. Die Professoren lenkten ihre Schritte zum Sacher, wo sie einen Tisch bestellt hatten. Am Findetag waren sie immer sehr demokratisch und speisten zusammen mit ihren Dienstboten.
Am Ende der Mahlzeit hatten sie Annika etwas Wichtiges mitzuteilen. »Wir haben beschlossen, dass du uns von nun an nicht mehr mit Professor anreden musst. Du kannst uns Onkel nennen«, sagte Professor Julius. »Also nicht länger Professor Julius, sondern Onkel Julius.«
»Und nicht länger Professor Emil, sondern Onkel Emil«, sagte Professor Emil.
Und sie nickten lächelnd, so stolz waren sie auf diese Geste. Frau Professor Gertrud sagte nichts davon, dass Annika sie Tante nennen sollte, denn sie war mit ihren Gedanken schon wieder ganz woanders; sie komponierte im Geist eine Harfensonate. Aber auch sie lächelte und nickte.
Alles in allem war es ein wundervoller Abend, und als sie in der Kellerstraße aus der Pferdebahn stiegen und auf den Brennerplatz gelangten, war die ganze Gesellschaft bester Laune. Man sang und scherzte.
Plötzlich blieben sie stehen.
Vor dem Haus der Eckharts stand ein motorisierter weißer Krankenwagen mit einem roten Kreuz auf den Seiten.
Hatte es einen Unfall gegeben? Niemand mochte die Eckharts, aber das hieß natürlich nicht, dass man ihnen Schlechtes wünschte.
Die Tür des Krankenwagens öffnete sich, und zwei Schwestern in marineblauen Uniformen stiegen aus. Dann wandten sie sich wieder dem Wagen zu und holten etwas heraus, das aussah wie ein Bündel aus Schals und Decken.
Die erste Schwester hielt das eine Ende des Bündels und die zweite das andere und gemeinsam trugen sie es ins Haus.
»Was ist das?«, flüsterte Annika, denn das Bündel schien mehr zu wiegen als nur ein Haufen Decken.
In diesem Moment bewegte sich das Bündel und sagte etwas. Es gab einen Ruck, und eine Nachthaube mit Schleife fiel aufs Pflaster. Es war also kein Bündel, sondern ein Mensch. Ein sehr ungehaltener Mensch, wie es schien.
Inzwischen war der Fahrer ausgestiegen und zog an der Türglocke der Eckharts. Ein Dienstmädchen erschien, gab Anweisungen und zeigte nach oben. Von den Eckharts war nichts zu sehen. Aber Annika bemerkte, dass sich die Vorhänge im Esszimmer bewegten.