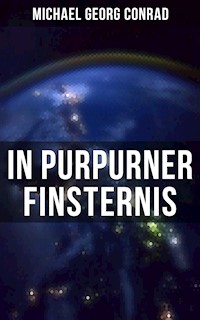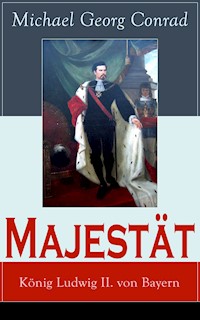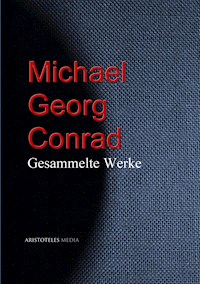1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Michael Georg Conrad's Buch "Majestät" ist ein fesselnder historischer Roman, der die Geschichte einer jungen Königin erzählt, die mit den politischen Intrigen und Herausforderungen der königlichen Welt des 16. Jahrhunderts konfrontiert wird. Der Autor zeichnet ein lebendiges Bild der Zeitperiode mit authentischen Details und bietet dem Leser einen Einblick in das Leben am königlichen Hof. Conrads Schreibstil ist packend und einfühlsam, und er schafft es, die Spannung bis zur letzten Seite aufrechtzuerhalten. Dieses Buch ist ein Meisterwerk des historischen Romans und wird Liebhaber von Geschichten über mächtige Frauen und politische Intrigen begeistern. Michael Georg Conrad ist ein renommierter Autor, der für seine gründliche Recherche und seine lebendigen Charaktere bekannt ist. Sein Interesse an der Geschichte und sein Talent für das Erzählen fesselnder Geschichten kommen in "Majestät" voll zur Geltung. Als Experte für die Zeitperiode des 16. Jahrhunderts verleiht Conrad seinem Werk Authentizität und Tiefe. Dieses Buch ist ein Muss für Leser, die historische Romane und komplexe Charaktere lieben. Wer auf der Suche nach einem eindringlichen und mitreißenden Leseerlebnis ist, wird in "Majestät" fündig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Majestät
Inhaltsverzeichnis
Der König hatte sich seit Tagen nicht mehr vom Bett erhoben. Er war krank von der Reise heimgekommen.
Wer sein Wesen kannte, wußte, daß es ein Schlimmes sein mußte, das ihn danieder hielt. Ganz fein empfindende Zuschauer, mit sicherer Witterung in tiefen Seelengründen – gewöhnlich gibt's die nicht unter den Hofleuten – hätten deutliche Zeichen gehabt, daß seit langem nur noch Lebensschein vorhanden, Nachglanz eines verflackerten Lichts.
Nun lag der König wirklich im Sterben. Selbst die stumpfesten Oberflächenmenschen begannen es zu merken, daß es wie Sensenschwingen unheimlich über dem Bette des Königs leuchte.
Eigentlich hatte es nichts von einem Kampf, nichts von heroischem Ringen um den letzten Rest eines Königslebens. Auf keiner Seite stand ein Held. Der herrische Tod hatte es nicht auf ein großes Kampfspiel mit diesem schlichten, geduldigen König angelegt. Ein geringer Leib, ohne heftige Lebensinstinkte, ohne starke Säfte und Triebe – ein verarmtes Blut.
Eine tückisch schleichende Krankheit, die schon früh eingesetzt, diskret, mit einer gewissen höfischen Verbindlichkeit in der Verschleierung der mörderischen Absicht. Das waren die Partner.
Die Seele des Königs wußte wenig dreinzureden. Sie war von je zur Friedfertigkeit gestimmt und nicht auf Gewaltsamkeiten eingeübt. Sie war allerwege für konstitutionelle Ordnung und gestattete sich keine persönlichen Übergriffe.
Was sie in diesem Falle auch gesagt hätte, es wäre für den Ausgang so belanglos gewesen, wie die Praktiken der Heilkünstler und die wortreichen, schön gesetzten Wundergebete der Priester. Ein mittlerer Wille, der nie auf hohe Lebenspolitik im Heldenmaß lossteuerte, eine verschüchterte Daseinskraft lag von der Krankheit hingestreckt und atmete sich aus in kurzen, zaghaften Zügen. Was dem Vorgange des Ablebens seinen besonderen Stempel gab, war die Auffassung, daß der Sterbende einen König darstellte, einen verfassungsmäßigen Monarchen über ein kleines altes Reich, das in gewohnter Treue zu seinem Fürstenhause hielt und diesem König vor allen seine Sympathien widmete als einem braven, rechtlichen Manne, der nie die bürgerliche Sitte gekränkt, nie der untertänigen Gesinnung eine schwere Stunde bereitet.
Alles an ihm war seinem Volke verständlich und vertraut. So lebten Fürst und Volk in gegenseitigem Wohlgefallen. Er war einst zur Krone gekommen durch freiwillige Abdankung seines Vorgängers, der eine stürmische, nichts weniger als leichtfaßliche Natur gewesen, einer, dem es in seinen Herrschergrenzen oft unleidlich enge geworden und der am Befehlen schließlich den Geschmack verloren. Ein dekadenter König – würden die neuesten Staatspsychologen sagen, ein reaktionärer und eigenwillig gewalttätiger, so sagten die damaligen. Als Politiker aber war er klug genug, daß er wußte, mit seinem Nachfolger dem Lande ein Geschenk zu machen, für das es Dank in Fülle zu ernten gab.
Kaum ein Menschenalter hatte nun dieser gütige König regiert, der jetzt im Sterben lag. Ja. gütig und gewissenhaft, wie's die Leute in der patriarchalischen Zeit zu schätzen wußten. Eine schlichte, strebsame Arbeitsseele. So gut eingewöhnt in den königlichen Dienst, daß sie wohl auch das Sterben wie ein Pensum empfand, das es mit ruhiger Würde abzuarbeiten galt, als hätte sie sich's selbst aufgelegt.
Dieser König pflegte sich in der Tat täglich sein Pensum aufzuerlegen. Er hätte es viel bequemer haben können, ohne etwas Wichtiges zu versäumen oder gegen ein Staatsgrundgesetz zu verstoßen. Aber er wollte sich mühen. Nie hat er es anders gewußt und gewünscht, als daß er Tag für Tag arbeiten müsse, zum Wohle seines Staates, für das Glück seiner Untertanen, wie die überlieferte Formel lautet. Und seiner höchsten Stellung in seinem angestammten Königreiche entsprechend, nannte er seine Arbeit Regieren oder Herrschen, welcherlei Umfang und Bedeutung sie auch haben mochte. Ein königlicher Tagwerker, in allem sauber, korrekt, musterbeamtenhaft, weitab von der genialen Hitze und phantastischen Laune seines Vorgängers.
Und so sollte auch einmal sein Nachfolger werden, daraufhin hatte er seine Erziehung angelegt, mit strengem System, spartanisch, fern von dem weichen, verlockenden, zu Fährlichkeiten drängenden Leben.
Daß er das alles mit weisem Bedachte geordnet und seither so regelrecht geführt, das gab ihm sein bestes Gefühl beim Einschlafen und Aufwachen. Er war ein König des guten Gewissens und gefestigter Theorien. Alles war bei ihm verstandesmäßig, ohne eine Spur von schöpferischer Phantasie. Aber auch nichts Gemeines war seinem Wesen beigemengt, und von dem königlichen Extrastolz seines Hauses befaß er nicht mehr, als ihm die Höflinge einzureden und die Maler in seinen Bildnissen anzubringen vermochten.
Seine Gattin schien gut zu ihm zu passen. Körperlich gesund, zur Fülle neigend, liebvoll zärtlich, geistig unbedeutend und anspruchslos, war sie wie dazu geschaffen, ihrem königlichen Gemahl gemütliches Herzensfüllsel zu sein und eine gute Kameradin zu bleiben, nachdem sie dem Herrscherhause zwei blühende Prinzen geboren. Von Politik und Regierungsgeschäften verstand sie nichts, besaß auch keinerlei Ehrgeiz, sich auf diesem Gebiete irgendwelchen Einfluß zu erwerben. Ihr Umgang ließ dem König selbst in der ehelichen Liebe die Anspruchslosigkeit und Regelmäßigkeit im Tun und Erleiden schätzbar werden.
Von seinem Vater hatte er's anders gesehen. Sie waren aber so wenig kongeniale Naturen, daß Blut und Lebensbeispiel ohne suggestive Gewalt blieben. Sie begegneten sich seit Jahren nur ganz selten. Ein majestätischer Kunstzigeuner, lebte der alte Herr bald im Norden, bald im Süden, trotz seiner hohen Jahre immer noch voll Unrast und Begehrlichkeit nach starken Lebenseindrücken haschend, oft sehnsüchtig zurückschauend in die köstliche junge Zeit, wo er noch Krone und Zepter getragen und die Welt mit allerlei stolzen Unternehmungen verblüffte.
Der König lag im Sterben.
Er fühlte, es war seine letzte Tagesarbeit. Schlecht und recht, mit tapferem Herzen wollte er sie leisten. Ob es in seinem Leben zu früh sei, jetzt schon aufzuhören? Warum, wenn es der Wille der Vorsehung ist, sich nicht mit christlicher Ergebung in die frühe Stunde fügen? Übrigens war's ihm jetzt selbst so, als ob er sein Leben damit begonnen, alt und weise zu sein, als ob seine Seele wenig von eigentlicher Jugendlichkeit gespürt, jedenfalls nichts von deren flatterleichter Art, nichts vom Drängen und Stoßen ins Ungemessene und Regelwidrige. Und war's nicht gut so? Wenn man seinen Söhnen einmal das Buch seines Lebens aufschlägt, Seite für Seite, werden sie dann nicht ein doppelt segensreiches Vorbild eines wahrhaft von Gottes Gnade geleiteten ernsten Fürsten vor sich haben? Ja, sein Lebenslauf war wie ein wohldurchgearbeitetes Predigtthema für seine Söhne: wer Ohren hat zu hören, der höre.
So fand er das Ende in Ordnung, sobald es das Ende, der ewige Feierabend, sein mußte. Er spürte keinen wehen Kontrast, als durch die schweren seidenen Vorhänge seines Sterbegemachs die Sonne ihre goldenen Pfeile schoß, die Osterglocken von den hohen Türmen jubelten, Finken und Drosseln im Hofgarten Auferstehungslieder schmetterten in heißer Liebesglut: der Lenz ist da und rüstet sich zum Siegeszug durch die verjüngte Welt!
Ach, schwer ist dem Weisen das Sterben nicht, dachte der König, nur scheint es etwas langwierig zu sein. Und umständlich auch und indiskret, weil das Hofzeremoniell viele Leute herbeiruft, die bei diesem höchstpersönlichen und allerintimsten Vorgang dabei sein mußten, wie bei einem Staatsgeschäft. Minister und Generale in Uniformen, Gelehrte und Priester, Kammerherren und Zutrittsberechtigte, mit jenen überfeierlichen Mienen – und dazu eine zahlreiche Verwandtschaft. Nie hatte der König Freude an Prunk und Schaustellung – und plötzlich fühlte er sich ohnmächtig und hilflos einer Welt gegenüber, der er nicht mehr gewachsen war, und die mit dem überlegenen Blicke des Lebens seinem Sterben zusah.
Er erblickte seine beiden Söhne, den dunklen und den hellen, schlanke Jünglinge, der Schule noch nicht entwachsen, beide bildschön, unheimliche Unergründlichkeit in den Augen. Forschend wollte er noch in ihren Seelen lesen. Aber es waren verschlossene Knospen.
Artig war der Verkehr zwischen Vater und Söhnen immer gewesen, innig und kameradschaftlich nie.
In Gefühlsäußerungen war der König karg und unbeholfen. Sie stiegen nie bis zum freien Überfließen. Er hatte keine Sonne in seinem Blute, kein quellendes Lachen, keine mitreißende Heiterkeit. Er war den Söhnen gegenüber wie ein leutseliger Geheimrat, soweit ein Geheimrat leutselig zu sein vermag.
Und nun nahm er seine schwindende Kraft zusammen und betrachtete lang seinen Erstgeborenen. Der sollte nun König werden, die Bürde des höchsten und schwersten Amtes tragen.
Dieser Jüngling, aus dem seine Erzieher oft nichts herauszuholen vermochten als eine rätselhafte Überlegenheit. Der so oft ihre Kreise störte durch Züge eines ungewohnten Andersseins, als sonst Prinzen aus diesem Stamme zu sein pflegen. Und sie sprachen dem Könige davon unter verlegenem Kopfschütteln: ungeheure Idealität, geniale Schwärmerei, sensitivste Traumhaftigkeit und plötzlich resolutes Aufschäumen in persönlichster Selbstbewußtheit und Unabhängigkeit!
Wie oft standen sie ratlos, die guten Erziehungsmeister, vor diesem Königssprößling!
Klagten sie dem König die Herbheit des Kronprinzen und seinen Hang zur Einsamkeit, so tröstete sie der befriedigte Vaterstolz mit dem Hinweis auf die sprichwörtlichen stillen Wasser, die tief und unzugänglich seien. Den letzten großen Schritt in der Erziehung, die Einführung in Leben und Deutung alles Problematischen im Herrschertum, hatte sich der König höchstpersönlich vorbehalten. Die Lehrer und Erzieher sollten ihm darin nicht vorgreifen, sie sollten sich auf die bildenden Abstraktionen, auf die bewährten klassischen Theorien beschränken, damit die Jünglinge bis zu ihrer vollkommenen Reife von keinem Widerspruch, keinem feindseligen Gegensatz zwischen Lehre und Leben, zwischen traditionellem Ideal und schmerzlich sich entwickelnder Gegenwartssachlichkeit beunruhigt würden.
So wurden die Prinzen seither wie kostbare exotische Pflanzen unter einem Glassturz gehalten. Den Glassturz im rechten Augenblick vorsichtig zu heben, wollte nur des königlichen Vaters eigene Hand berechtigt sein.
Wie aber, wenn diese Hand jetzt im Tode erlahmt? Wenn der Kronprinz mit erschütternder Plötzlichkeit mündig erklärt und in volle Freiheit gesetzt wird? Wenn alle Führung mit einem Schlage vor dem herrschend gewordenen Selbstwillen zurückweicht, aller geübte Druck aus Hirn und Herz, Phantasie und Gemüt vor der Souveränität des Achtzehnjährigen wie Nebel vor der Morgensonne zerfließt?
Ein Seufzer entrang sich der Brust des sterbenden Königs. Wie von lechzenden Flammen umzuckt, stand vor ihm in der wachsenden Dunkelheit der Todesstunde das schwermütig stolze Bild seines Prinzenpaars.
Fragend und hilfesuchend gingen die Augen des Sterbenden von einer Gruppe zur anderen. Wie mit bedauerndem Lächeln verweilten sie auf den Gelehrten, den Historikern und den Poeten.
Seine Symposionsgenossen.
Lauter kostbare Gewächse. Seit anderthalb Jahrzehnten hatte er sie zusammenbotanisiert, mit Vorliebe im Norden, seinen königlichen Residenz-Geistesgarten damit aufzufrischen und zu schicken. Sie sollten ihm die bajuwarische Flora stark machen helfen, diese berühmten Setzlinge, diese grellblütigen Streber und kryptogamen Großborussen, diese klassischromantischen Epigonen und vornehmen Ritter vom Zeitungsgeist. Mit reichen Jahrgehältern hatte er sie gedüngt, an buntlackierten Stäben mit Titeln und Orden und Ehrenämtern festgebunden, daß sie gesicherten Wachstums sich erfreuten und Glanz und Duft über alle Beete der bajuwarischen Kultur verbreiteten. Nie zweifelte er, daß er mit seiner königlichen Verschwendung Herrliches und Dauerndes ins Werk gesetzt. Seine reine Absicht war ihm Bürge eines glänzenden Erfolges.
Warum sollten diese auserlesenen Gnadenpflanzen nicht Wurzel schlagen in der süddeutschen Volksseele und hundertfältige Frucht bringen? Dem lernbegierigen, sammelfreudigen Schutzherrn dünkten sie wertvollster Erwerb. Er ließ sich einreden, daß er eine geniale patriotische Tat getan. Was an nüchterner Erwägung kulturpolitischen Wettbewerbs mit anderen deutschen Staaten dabei im Spiele war, rechnete er nicht weniger seiner Staatsweisheit zugute. Mochten die anderen deutschen Fürsten ganz in materieller Politik und Diplomatie aufgehen und plumpe Großmachtsträume hegen, er wollte mit sublimer Geistigkeit alle übertrumpfen und über sein Königreich eine Epoche wissenschaftlich-ästhetischer Kultur heraufführen, die alle in Schatten stellte. Die alte literarische Dumpfheit sollte von den vornehmen Ständen und dem höheren Bürgertum genommen und eine rege Beteiligung an allem geschaffen werden, was von je die gebildetsten Geister fesselte in historischer Wissenschaft und idealistischer Dichtung. Und selbst neue Forschungszweige, wie die nützliche Chemie, sollten dabei nicht zu kurz kommen. Die naturwüchsige Entwicklung seines Volkes sollte eine herrliche Ergänzung und Geschmeidigung erfahren. Eine strahlende bajuwarische Renaissance! Eine feingeistige Hochkultur im Lande der schweren Maßkrüge durch königliche Munifizenz!
Wie sein genialer Herr Vater, der Archäologe und Dichterkönig, Bilder, Skulpturen und Architekturen gesammelt und den ganzen Süden Europas, Hellas und Italien geplündert, seine Residenz damit zu schmücken und die Museen zu füllen, so wollte er, sein Nachfolger auf dem Throne, auch sein Nachfolger in erhabener Kulturmission werden und die erleuchtetsten Männer der Wissenschaft, namentlich die neuesten Lichter des Nordens an seinen Hof ziehen.
Während die beiden Vormächte des deutschen Bundes in feindseligen Machtfragen sich befehdeten und – jetzt erst diplomatisch in der Eschenheimergasse der freien Reichs- und Bundesstadt Frankfurt durch den plötzlich obenauf gekommenen Junker Bismarck – um ihre Zukunftsstellung rangen, wollte er sein Königreich zu einem friedfertigen Zentrum deutscher Nationalkultur gestalten, zum Entzücken aller vornehmen Geister der alten und neuen Welt. In diesem Idealreich auf Erden sollten ihm die berufenen Nordlichter als Sterne erster Größe leuchten.
Mit bedauerndem Lächeln ruhte jetzt sein brechendes Auge auf diesen Sternen. Der königliche Mäzenas mußte die Erde verlassen, ohne die Großtaten seiner dichtenden und geschichteschreibenden Günstlinge erlebt zu haben. Das große epochemachende Drama hat noch keiner von ihnen geschrieben, auch keinen Roman, kein Epos, nicht einmal ein lyrisches Gedicht, das alle überwältigt und seinem Autor den unbestrittenen ersten Platz auf dem neuen Parnaß gesichert hätte. Nichts als Versuche, Besprechungen, artige Kleinigkeiten, meisterliche Durchschnittswerke bis auf diesen Tag, keine einzige umwälzende, auf ungeahnte Höhen führende Leistung.
Aber der Sterbende ist nicht ungetröstet. Täglich gaben ihm seine Lieblinge eine politische Maxime, einen eleganten Vers, eine historische Glosse, einen schön gedrechselten Sinnspruch, eine naturwissenschaftliche Hypothese, irgendeine geistreich geformte Nichtigkeit in die Schreibtafel, die der fleißige Mäzenas stets bei sich trug. Und die Historiker erfreuten ihn mit braven Berichten aus ihren Kommissionen, die sehr viel Papier und Tinte zum Ruhme Bajuwariens verbrauchten auf königliche Rechnung. Und die Künstler erfanden an ihren Reißbrettern neue Baustile für ihn und belegten sie schmeichelnd mit seinem Namen. Zwar in blühender Kraft des Lebens und echter Schönheit schien sie nicht erzeugt zu sein, diese höfische Kunst. Die Architekten mochten wohl so wenig überschüssige Tugend in ihren Lenden haben wie die würdigen Hofpoeten und Hofhistoriographen. Aber braves Sitzfleisch hatten sie gewiß und löblichen Eifer, mittels mechanischer Anstrengungen des Gehirns stückchenweise neuscheinende Formen aus mißhandelten alten zusammenzuklittern.
Seine Symposien hat's der König genannt, wenn er mit diesen Meistern der Historie, der Poeterei und der verstandesmäßig geübten Künste mäßige Gelage feierte in regelmäßigen Zusammenkünften, fern von Sturm und Drang schöpfermächtigen Zukunftsgeistes, fern von der olympischen Rücksichtslosigkeit der großen Göttin und aller Künste Urmutter Phantasie. Seine Symposien hat er's genannt, das Wochenfest seiner Zuchtmeister in Züchten und Ehren, auf den Höhen des Geistes glaubte er zu wandeln, wenn er mit Nüchterlingen Erkenntnisse, Gelehrsamkeit und Leierkastenpoesien tauschte.
Was war das nur? Jetzt, wo die Schatten des Todes seine Sinne immer dichter umfingen, gewann seine Seele hellsichtige Schärfe? Lernte er in seiner letzten Stunde plötzlich hinter Masken blicken und in meisterlich verlarvten Gesichtern die wahren Züge der Natur lesen?
Scharenweise umdrängten sie sein Lager. Alle, denen er sein Leben lang Huld und Gnade erwiesen, füllten wie ein Spuk das Gemach. Träumte er? O, diese Zudringlichen! Und wie Steckbriefe in Flammenschrift grinste ihr Verborgenstes und Geheimstgehaltenes aus ihren gierigen Augen. Mit bösen Dünsten hauchten sie ihn an, zum Ersticken.
Der Sterbende stöhnte. Jener Gelehrte dort mit dem angreifenden Luchsblick, nie hätte er ihn für schlimm und gefährlich gehalten, nie. Und dennoch, siehe, wie er sich jetzt verrät! Jener Poet, o wie er sich in die Brust wirft mit herausfordernder Gebärde und auf ihn zielt, als hätte er den Bogen gespannt und wollte ihn mit todbringendem Pfeil mitten ins Herz treffen. Und dort, jenes Musterexemplar des wissenschaftlichen und religiösen Menschen, kichert er nicht in sich hinein wie ein anmaßlicher, boshafter Zwerg? Und seine Handlanger, seine politischen Werkzeuge, wie lassen sie ihre Blicke kalt und höhnisch über ihn hinschleichen gleich giftigen Schlangen! Und er hört, wie sie züngeln und tuscheln. Wer hat seither dirigiert und kommandiert? Wer ist bei äußerer Unterwerfung eigentlich doch der führende Wille gewesen, he? Und wer wird der führende Wille in deinem Staate sein? Du nicht, du sterbender König, du nicht, du todwunde Majestät! Deines Hauses Politik wird von anderen gemacht, wehre dich, wenn du kannst!
Er streckte die zuckende bleiche Hand aus und versuchte sich aufzurichten. Ja, die Königin, die gute Trösterin. Sie umfaßte ihn mit ihren liebetreuen Armen. Einen Augenblick fühlte er sich geborgen. Die häßlichen Visionen schwanden.
Sie bleibt seinem Hause die grundgütige Frau und Landesmutter. Was hat sie nicht alles für ihn getan! Hat sie nicht ihren alten Glauben aus freien Stücken ihm zuliebe verlassen und ist in aller Stille in seine Kirche eingezogen, nur damit auch nicht der Schatten einer Kluft, nicht der Buchstabe eines Dogmas sie von ihrem Gatten und ihren Kindern trenne? Neue, innigere Gebete hat sie für ihn gelernt, den Kreis der himmlischen Fürsprecher für ihn erweitert, stärkere mystische Bande um ihre und seine Seele geschlungen. Nach kurzer Trennung werden sie in alle Ewigkeit vereint sein.
Der König lag in den letzten Zügen.
In den Kirchen wurde das Allerheiligste ausgestellt.
Die Priester sprachen die vorgeschriebenen Gebete und übten die ritualgemäßen Gebräuche, die hohen Staatsbeamten und Generale senkten die Köpfe, die Verwandtschaft war gerührt, die Hofdamen brachen in Tränen aus, die Königin schluchzte in tiefem Weh, die Kinder standen stumm erschüttert. Volk umlagerte den Palast und drängte sich auf die Treppen in Teilnahme und Neugier.
Der König hatte seine Lebensarbeit vollbracht. Er war still entschlafen.
Trauerflaggen wurden gehißt, die Glocken der Stadt erhoben ihr dumpfes Getön, die Glocken des Landes folgten nach. Der Minister des königlichen Hauses nahm das Protokoll auf. Der Aufbahrungs- und Bestattungspomp wurde nach feierlichem Zeremoniell zugerüstet. Die Leibärzte machten sich an ihre letzte Arbeit. Das Herz des Königs wurde ausgeschnitten, in kunstvoller silberner Kapsel verwahrt, um an einem fernen Wallfahrtsort der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter, der Patrona Bavariae, als Opfer dargebracht zu werden.
Die Zeitungen erschienen mit breitem Trauerrand und wetteiferten mit sorgfältig vorgearbeiteten Prunkartikeln über den glorreichen Lebenslauf des verstorbenen Herrschers. Einfach und ehrlich klangen die Beileidsäußerungen des Volkes über das Hinscheiden des Landesfürsten, dessen leutselige Art und prunklose Lebensführung allezeit seinen Beifall hatte.
Nur einer wußte nichts von Landestrauer und offiziellem Beileid: der Frühling warf sich jubelnd in heißer Lust über die Erde und riß alles Lebendige in seine stürmische Bahn, daß es tat, was es immer getan im Überschwang jung steigender Säfte. Lenzes Gebot achtet keinen Tod. Halleluja, Miserere, Evoe: ewige Wandlung, ewige Auferstehung, ewige Wiederkehr. Der König ist tot? Es lebe der König! Was kümmert's den Frühling!
Der Kronprinz, kaum neunzehnjährig, ein blasser Jüngling, mit süßem, schwellendem Mund und den abgrundtiefen, berückenden Dunkelaugen einer Odaliske, dem reichen, schwarzglänzenden Lockenhaar eines Südländers und dem hohen Wuchs des Germanen, hatte den Thron bestiegen.
Wie Feuer durchflutete es das Netz seiner Adern und ließ alle seine Nerven vibrieren, als er die Krone des Herrschers auf dem kindlichen Haupte fühlte und die königlichen Geschmeide um Hals und Brust, der wallende Hermelinmantel mit Purpur und Gold um die Schulter sich legte, des Prunkschwertes edelsteinschimmerndes Gehänge seine geschmeidigen Lenden preßte, Reichsapfel und Zepter in seiner zarten, weißen Hand ruhten. Von Gottes Gnaden! Nicht mehr abhängig von Pedanten und Erziehungsmeistern! Majestät, deren Quell und Schutz über allem Irdischen liegt und die königliche Person heilig und unverletzlich macht! Ein Gesalbter des Herrn –
Und seine Seele stieg wie aus dunklem Kerker und schwang sich in den Glanz des Thrones. Der gestern kaum in nichtigen Dingen seinen eigenen Willen haben durfte, reckte sich heute in stolzem Bewußtsein empor, jeder Zoll ein König, wie berauscht von seiner höchsten Würde, zu der ihn Gott auserwählt nach der unantastbaren Lehre, und wie Sphärenmusik umbrauste sein inneres Ohr der klassische Gesang aus der Antigone: »Vieles Gewaltige lebt, doch ist nichts gewaltiger als der Mensch . . . . .« Und voll naivem Entzücken lauschte er in sich hinein. Heldisch und innig klang's, märchenhaft, und war doch alles Wahrheit. Nicht der Traum eines Entrückten, aber Wirklichkeit, die überreiche Träume aus sich gebar, fabelhaft, bunt, in unendlichem Wechsel. Nur mußte er alles für sich behalten, wie seither. Noch hatte er niemand gefunden, dem er sein Innerstes erschließen konnte. Keine Schwesterseele hatte sich ihm offenbart, die er durch sichere Zeichen als die Vertraute seines tiefsten seelischen Schauens und Wünschens erkannt hätte. Und in seiner Vereinsamung rief er mit Schillers Jüngling am Bache die Klage in die Luft:
»Sehnend breit ich meine Arme Nach dem teuren Schattenbild. Ach, ich kann es nicht erreichen, Und mein Herz bleibt ungestillt.«
Vom schönen Klang bezaubert, sagte er sich dann auch die anderen Verse vor mit schwelgerischem Behagen an der süßen Wehmut, die jedes Wort für ihn atmete:
»Fraget nicht, warum ich traure In des Lebens Blütenzeit! Alles freuet sich und hoffet, Wenn der Frühling sich erneut. Aber diese tausend Stimmen Der erwachenden Natur Wecken in dem tiefen Busen Mir den schweren Kummer nur.«
»Majestät befehlen?« »Majestät geruhen?« »Zu Füßen Eurer Majestät!« – Wahrhaftig, er ertappte sich auf einem Selbstgespräch. Aber war es nicht getreu der Wirklichkeit nachgesprochen? Und in dem gleichen Atem fiel er elegisch in seinen Schiller zurück:
»Was soll mir die Freude frommen, Die der schöne Lenz mir beut?«
Nein, es war doch alles zu plötzlich über ihn gekommen. Es war wie eine Verwandlung in einer Theaterfeerie. Ohne alle fühlbare Vorbereitung. Schlag auf Schlag.
Tief verneigten sich die Höflinge und hohen Staatswürdenträger vor ihm. Bei jedem Schritt war's ihm, als wandle er durch ein Spalier von bedeutenden Menschen, die sich vor ihm beugten wie Halme, über die der Wind streicht. Ein unsichtbares Spalier. Die Unsichtbarkeit war das Schönste daran. Eigentlich war er verzagt vor dem fremden Unterwürfigkeitsblick. Er spürte etwas Lauerndes darin, das ihn beengte.
Es fiel ihm eine Hoftafel im Schloß zu Nymphenburg ein. Im vorigen Jahre erst war's gewesen. Der Fürstentag hatte den preußischen Staatsminister Bismarck hergeführt, einen Menschen von unheimlichem Wuchs und einer unter den glattesten und gewandtesten Formen versteckten Überlegenheit des Auftretens. wie er's noch nie an einem Minister seines Vaters beobachtet hatte. Bei der Hoftafel wurde diese wuchtige Persönlichkeit zwischen ihn und die Königin gesetzt. Da sollte er nun von der Schülerbank weg als Kronprinz repräsentieren und sich mit dem fremden Riesen unterhalten. Was sollte er ihm sagen? Er forschte in den Arabesken der Decke, bis es wie eine Erleuchtung über ihn kam, rasch einige Gläser Wein hintereinander zu trinken, um sich das Herz leicht und die Zunge beweglich zu machen. Wie wenig war er des Weintrinkens bis dahin gewohnt! Es überkam ihn auch ein seltsamer Schwung. Kaum hatte er das letzte Glas hastig geleert, da war's ihm, als hätte der fremde Riesenblick ihm unversehens mit beharrlicher Energie jedes Glas und jeden Tropfen vom Munde ab nachgezählt, und so beklommen machte ihn dieser Eindruck, daß er dem Gaste nichts als eine unbedeutende Redensart sagen konnte, unter Ärger und Herzklopfen.
Er wußte es: diese äußere Welt und jene innere, die er glühend in seinem Busen trug und die er seither so ängstlich hüten mußte, um dem Tadel seiner Eltern und Erzieher zu entgehen, harmonierten nicht. Wie oft, wenn er sich hinreißen ließ, den Schleier seines Seelenlebens zu lüften, konnte er am Verhalten seiner Umgebung merken, daß man seines Wesens reinste Ursprünglichkeit als Phantasterei deutete. Es half ihm nichts, sich arglos zu geben und ganz er selbst zu sein – sein Anderssein genügte der Alltagsgewöhnlichkeit, ihn schlimmer Absichtlichkeit zu zeihen. So wurde er verschüchtert und trotzig zugleich, bis die Fessel gefallen, ihm plötzlich erworbene Majestät gestattete, sein eigener Herr und seines Willens stolz und froh zu sein.
»Aber Eure Königliche Hoheit müssen sich ja langweilen, so ohne Beschäftigung dazusitzen, weshalb lassen Sie sich nicht etwas vorlesen?« bemerkte eines Tages der Stiftsprobst Döllinger, als er den Kronprinzen allein auf dem Sofa sitzend im verdunkelten Zimmer antraf – verdunkelt, weil der Kronprinz längere Zeit heftig an den Augen litt.
»Langweilen?« entgegnete der Kronprinz. »O, ich langweile mich nie, wenn ich allein bin. Ich denke mir die schönsten Dinge aus und unterhalte mich sehr gut dabei.«
Nie fand er Mitbegeisterung bei seinen Pädagogen, wenn ihn ein seltsam hoher Gegenstand, eine wundersame poetische Impression begeisterte. Nie war unter seiner Begleitung eine tiefteilnehmende Seele, die seinem Ideenflug zu folgen innige Lust trug. So bekam er frühzeitig eine schmerzlich sichere Empfindung dafür, daß seine besten Regungen und Ausschwünge von den anderen als »Schwärmereien« kühl abgelehnt oder mit nichtigen Phrasen erwidert wurden.
Selbst seine Mutter – wie ihn das schmerzte! – vermochte ihn nicht zu verstehen. Mit der ersten besten nüchternen Bemerkung schnitt sie seine begeistertsten Auseinandersetzungen ab. Brachte ihn ein erhabener Gedanke, ein schönes Bild, ein großer Eindruck in Ekstase, so lachte die werte Familie wie auf Verabredung über seine »Überspanntheit« hellauf. Seine Freude an schönen Formen, auch im Umgang, sein künstlerisches Vergnügen an den wirklich ästhetischen und phantasievollen Zügen und dem symbolischen Sinn der Etikette wurde ihm als »Verstiegenheit« zur Last gelegt.
In der edlen Reitkunst war er schon als Knabe Meister, und er liebte diesen ritterlichen Sport bis zur Tollkühnheit. Dagegen fand er keinen Geschmack an militärischen Drill und Paradespielen. Er hatte eine tiefe Abneigung gegen diese Art, die Massen zu brutalisieren und das menschliche Einzelwesen zum individualitätslosen Maschinenteil herabzudrücken . Sprach er das laut aus, erfuhr er herben Widerspruch, wenn nicht direkte Zurechtweisung, denn alles Militärische galt für sakrosankt, auch in seinen unmenschlichen Geschmack- und Geistlosigkeiten. Er mußte es beizeiten fühlen lernen, daß der militärische Mechanismus in der zerschmetternden Wucht seines Gefüges und seiner Disziplin keinerlei ernsthafte Kritik dulden mochte.
Diese schlimme Gegensätzlichkeit seiner genialen Natur in ihrer unmittelbaren Schönheitsbegeisterung zu der nüchternen und sklavisch konventionellen Umwelt hatte er als eine Lebenstatsache empfinden müssen, die ihm wie ein tiefer, schmerzlicher Riß bis aufs Mark ging. Aber jetzt in der plötzlichen Erhöhung seiner Stellung vom unverstandenen und gedrückten Prinzen zum souveränen Kronenträger überkam es ihn wie ein Rausch der Macht. –
Er selbst, ganz er selbst! In der Idealität seines Vollmenschentums und seiner reinen Herrennatur, im Sturm und Drang seiner neunzehn Jahre auf der obersten Sprosse der Herrlichkeit, an der Spitze des Staates, nur sich selbst verantwortlich und seinem Gott.
Und die hohen Würdenträger und Höflinge verneigten sich tief vor ihm, die Priester und Politiker blickten erwartungsvoll zu ihm auf – und blinzelten sich zu – das Volk jubelte, die Presse sparte sich keine Überschwenglichkeit. Der Weihrauch stieg in dicken Schwaden. Weißblau war die Farbe des glücklichsten Reiches der Welt.
Eide wurden geschworen, die Armee auf den neuen Kriegsherrn verpflichtet. An den Wappenschildern erschienen andere Initialen. Auf den Staatsdokumenten mit dem königlichen Siegel prangte eine ungewöhnlich große, phantastisch verschnörkelte und kühn ansteigende Unterschrift mit breiten Grundstrichen.
Rätselrater und Zeichendeuter, die in Gesichts- und Handzügen, in Augen, Kopfhaltung, Gang und Schrift geheime Offenbarung lesen, orakelten: »Ihr werdet Wunder erleben. Aus dieser ungewöhnlichen Königsseele wird die Gottheit in Verhängnissen sprechen.« –
Abendfrieden. Der jugendliche König stieg nachdenklich die Treppe zum obersten Stockwerk des sogenannten Königsbaus im Residenzschloß empor. Niemand sollte ihm folgen. Er wollte allein sein. Mit einem kleinen Schlüssel öffnete er die Tür zum »Sanktuarium« seines hochseligen Vaters.
Der verstorbene König hatte sich hier ein Gemach eingerichtet, in das er sich zurückzuziehen pflegte, sooft es galt, einen wichtigen Entschluß zu fassen, und das außer ihm kein Mensch betreten durfte. Eine verborgene Tür führte aus seinem gewöhnlichen Arbeitszimmer dahin. Kaulbach hatte die Wand mit einem allegorischen Gemälde geschmückt: die Verklärung eines rechtschaffenen Herrschers. Zwischen den Fenstern lud ein Betschemel vor dem Bilde des Gekreuzigten zu andächtiger Sammlung und Gewissensforschung ein. Der Fries des Gemaches war mit Bildern ausgefüllt, welche die sieben Regententugenden in Gestalten bayerischer Fürsten verkörperten. An den Wänden hin standen Bronzebüsten ausgezeichneter Männer alter und neuer Zeit. Neben jeder Büste lag die Lebensbeschreibung mit Aussprüchen und Bibelzitaten, die zur Erweckung und Nachfolge aufforderten, gleich Stimmen aus der Geisterwelt.
Hier hing der verstorbene König mit Vorliebe seinen politischen Utopien nach: »bei dem Bunde« und »durch den Bund« die Wiederherstellung der nationalen Einheit und unter Österreichs Leitung die Wiedergeburt und Neugestaltung eines einigen, mächtigen Deutschlands zu bewirken, worin Bayern durch die glanzvolle Pflege alles Wahren, Schönen und Guten in Wissenschaften und Künsten tonangebend werden und das Wittelsbacher Haus die ideale Führung übernehmen sollte. Alles sollte auf friedlichem Wege erreicht werden, lediglich durch die Macht der Vernunft, durch die wachsende Einsicht in die höhere Zweckmäßigkeit und durch lauterste Vaterlandsliebe. Daß Preußen und Österreich innerlich schon längst nicht mehr »bei dem Bunde« waren und jedes »durch den Bund« nur seine eigene Vorherrschaft zu begründen trachtete, erachtete der verstorbene König für eine vorübergehende Verirrung. Die brutale Deutlichkeit der Trennungsbestrebungen beider Staaten in der Besetzung der schleswigholsteinischen Herzogtümer auf eigene Faust und durch ihre eigenen Heere versuchte er sich durch allerlei freundliche Abstraktionen zu verschleiern. Der »Bund«, der »historische Bund«! So wurde die Politik des seligen Königs ein Opfer seines abergläubischen Vertrauens auf die Macht der »Historie« und auf die reformierende Gewalt »friedlicher Entwicklung«. Nur keine brutalen Eingriffe, nur keine neuen Wirren. »Frieden will ich haben mit meinem Volke«. Und jedesmal schied er getrösteten Herzens aus seinem »Sanktuarium« und kehrte mit dem rührendsten Enthusiasmus des gutmütigen Gedankenspinners für »großdeutsche Ziele« zu seinen »Staatsmännern« zurück. Seinem Nachfolger auf dem Throne glaubte er einst mit dieser »Idealrealpolitik«, die natürlich auch des vollen Beifalls der Weltgeschichts-Rhapsoden seiner Symposien sich erfreute, eine köstliche Erbschaft zu hinterlassen.
Und nun stand sein Nachfolger, ein neunzehnjähriger, bislang dem Wirklichkeitsleben mit raffinierter Pedanterie fern gehaltener Jüngling, im »Sanktuarium« des hochseligen Königs. Und er lauschte, den verklärten Geist seines Vaters in diesem Raume deutlicher zu vernehmen. Aber er vernahm nichts, trotz der Weihe des Ortes und der Stunde. Er betrachtete die Bilder, er betrachtete die Büsten – keine Stimme sprach zu seinem Ohr, kein Klang zog durch sein Gemüt, kein Reiz überflutete seine Seele. Ein toter Raum voll toter Gegenstände.
Der jugendliche König ließ sich auf dem Betschemel nieder und hob den Blick zu dem Gekreuzigten. Leise meldete sich das Bild des sterbenden Vaters, und er vernahm dessen letztes Wort. »Und nun, mein Sohn, wünsche ich dir, daß du dereinst ein ruhiges Ende haben mögest, wie ich es habe.« Ein ruhiges Ende! Seltsamer Wunsch: warum überhaupt ein Ende? War nicht die ganze Ewigkeit sein? Welchen Wert hätte der Traum des Lebens, nähme er je ein Ende? Eingebettet in unsterbliche Schönheit, einverleibt dem majestätischen Kosmos, wer vermöchte sich ein Ende zu wünschen, ein ruhiges oder ein anderes, im Ring der ewig belebten Unendlichkeit? – Und die Gedanken des jugendlichen Königs jagten in dem toten Gemach von Sonnenwelten zu Sonnenwelten. Licht und leicht ward es in ihm, als wäre er selbst ein schwebender Strahl, erweckt zu urewigem Glanze.
Er erhob sich und befühlte seine Tasche. Nie mehr wollte er diesen Raum betreten, doch sollte ein Erinnerungszeichen an seinen Besuch in diesem unerfreulichen »Sanktuarium« zurückbleiben. Er fand nichts als sein Portemonnaie. Sein erstes Portemonnaie! An seinem achtzehnten Geburtstage, also ein Jahr vor seiner Thronbesteigung, hatte er's von seinem Vater zum Geschenk erhalten, mit einigem Geld. Von jeder in Bayern geprägten Münze ein Stück. Vorher hatte er weder Portemonnaie noch Geld besessen. So kindisch streng und armselig wurde er gehalten bis zu seinem achtzehnten Jahre von dem guten Manne, der sein Vater war. Und der ihm zum Abschiede nichts zu wünschen wußte, als ein »ruhiges Ende«. Was hat der Beschenkte mit dem ersten Gelde getan? Oh, er weiß es noch deutlich, denn es hat ihm eine erste Beschämung vor Fremden gebracht. Zu dem Hofgoldschmied ist er gestürzt, um für die Mutter ein Medaillon zu kaufen, einen winzigen goldenen Schwan mit Edelsteinaugen, eine Kleinigkeit. Aber als er bar bezahlen wollte und den Inhalt des Portemonnaies auf den Ladentisch ausschüttete, da bedeutete ihm der Juwelier, daß das Geld nicht ausreiche. »Königliche Hoheit, ich werde die Rechnung in die Residenz schicken.« Und die Freude war ihm verdorben. Sein Spenderstolz wurde ihm mit Beschämung und Bitterkeit gelohnt. Freilich, die gute Mutter war entzückt von dem niedlichen Geschenk. Mit ihrem Danke konnte sie jedoch die drollige Bemerkung nicht unterdrücken: »Mein Kind, du scheinst wenig Verständnis für den Wert des Geldes zu haben.« Und die Mahnung: »Daß du mir nicht wieder so in den Tag hinein verschwendest!« Da war's nun allerdings an ihm, die königliche Mama auszulachen, daß sie wegen eines winzigen goldenen Schwans mit Edelsteinaugen von Verschwendung reden mochte.
Der König legte das Portemonnaie auf den Betschemel . »Da soll es nun als Zeichen der Erinnerung geopfert werden.«
Als er die Tür des Sanktuariums hinter sich geschlossen hatte, beschäftigte ihn noch der Gedanke an seine Mutter, die tieftrauernde Witwe. Es schmerzte ihn, daß sie nun fortan, ihr ganzes Leben lang, diesen Titel offiziell führen sollte: »Königin-Witwe«. Wie melancholisch das klingt! Diese stete herbe Trauermahnung, war sie notwendig? Konnte sie nicht ausgelöscht werden? Mit einem einzigen Federzug? Von seiner eigenen königlichen Hand?
Ohne jemand ein Wort zu sagen, eilte er in das Geheimkabinett, ließ sich Papier und Feder reichen und schrieb mit mächtigen Buchstaben. »Es ist mein königlicher Wille, daß Ihre Majestät Königin-Witwe fortan den Titel führe ›Königin-Mutter‹. Danach ist das Weitere zu verfügen.« Sein Auge strahlte glücklich, als er diese seine erste Titelverleihung überlas. Gewiß habe er der guten Frau damit eine Freude bereitet, dachte er, daß er sie nicht als Schmerzensmutter, als mater dolorosa, bei offiziellen Akten figurieren lasse, sondern daß sie als das erscheine, was sie seinem kindlichen Herzen ewig bleiben werde: die Königin-Mutter!
Da lag noch ein Schriftstück, das er blitzenden Auges eilig überflog. Es war die Niederschrift der kurzen Rede, seiner ersten öffentlichen, die er als Antwort auf die Anrede des Ministerpräsidenten bei der Eidleistung auf die Verfassungsurkunde gesprochen hatte: »Der allmächtige Gott hat meinen teuren, vielgeliebten Vater von dieser Erde abberufen. Ich kann nicht aussprechen, welche Gefühle meine Brust durchdringen. Groß ist und schwer die mir gewordene Aufgabe. Ich baue auf Gott, daß er mir Licht und Kraft schicke, sie zu erfüllen. Treu dem Eid, den ich soeben geleistet, und im Geiste unserer durch fast ein halbes Jahrhundert bewährten Verfassung will ich regieren. Meines geliebten Bayernvolkes Wohlfahrt und Deutschlands Größe seien die Zielpunkte meines Strebens. Unterstützen Sie mich alle in meinen inhaltsschweren Pflichten.«
Er wandte sich an den Kabinettssekretär: »Stimmt das, Wort für Wort?« Und auf die Bejahung erwiderte er: »Ich hoffe, daß die Minister meinen Appell an ihre Unterstützung nicht als den Hilferuf eines geängstigten Gemütes auffassen. Es ist mein königlicher Wille.«
Er behielt die Leute seines Vaters ohne Unterschied im Dienste, befahl regelmäßigen Vortrag durch die Minister und freie persönliche Erörterung aller Staatsgeschäfte. Man sollte bald die Überzeugung gewinnen von der zuverlässigen Kraft seines Urteils, von der Energie seines Willens und seiner nie ermüdenden Arbeitslust.
Der jugendliche König und sein königlicher Bruder gingen Arm in Arm zum letztenmal in ihre alten Gemächer, um Abschied zu nehmen von den Räumen, wo sie den öden Druck der Schulpedanten und Drillmeister in langen Erziehungsjahren erduldet.
»Unsere Folterkammer!« rief der jüngere und riß die Mütze von seinem Blondkopf und schleuderte sie gegen den Plafond: »Fang sie auf, Bruder! Wir sind frei – frei! Hurra! Hörst du? Oh, wie herrlich ist das! Das Leben braust und schreit nach uns. Du! Das Leben schreit nach deiner königlichen Umarmung, Aus voller Kehle schreit es nach dir, es läßt sich nicht mehr das Maul –«
»Den Mund, bitte!«
»Maul verstopfen. O komm! Laß uns Sprünge machen, daß die alten, scheußlichen Kerkerwände wackeln!«
Er hopste über Tische und Stühle und schrie wie besessen: »Mir nach! Wer ein guter Bayer ist, mir nach!«
Der königliche Bruder erhob Einspruch.
»Ach, geh mir mit deiner Würde. Jetzt pfeift ein anderer Wind.«
Plötzlich faßte ihn der König mit nervigem Griff am Arm: »Achtung fordere ich! Auch du mußt die Majestät respektieren und die Possen lassen!«
Hehr stand er aufgerichtet, wie ein Göttersohn aus einer andern Welt, und maß den ausgelassenen Sausewind mit strengem Blick.
»Du bist wohl verr–!«
»Huldige mir, hier unter vier Augen! Freiheit ist Schönheit, innerste Lust, nicht wüstes Toben.« Und er beschrieb mit dem Arm eine gebietende Linie: »Huldige mir!«
»Da kannst du lange warten, Bruderherz!« lachte der blonde Prinz. »Ich werfe mich dem Leben an die Brust und den schönsten Mädchen, aber nicht vor deiner steifen Majestät auf die Knie! Das heißt: dir schon, dir werf ich mich auch an die Brust, weil du noch schöner bist als das schönste Mädel!« Und er umarmte den König stürmisch und küßte ihn und stürzte lachend davon.
An der Tür kehrte er sich um, salutierte militärisch: »Allerhöchster Kriegsherr, das sage ich dir, von jetzt an gibt's Aufbesserung der Menage und jeden Tag wenigstens eine Leibspeise. Die königliche Mannschaft hat lange genug gehungert. Servus! Das Leben genießen – jeden Tag wenigstens eine Leibspeise. Servus!« Und draußen war er.
Der König stand sinnend.
Nach einer Weile kam der Bruder wieder herein, ein Buch in der Hand. Mit erstaunlicher Verwandlungskunst mimte er in Gang, Haltung und Gesichtsausdruck den Religionsprofessor.
Die Erscheinung wirkte so drastisch, daß der König hellauf lachen mußte. Und er setzte sich unwillkürlich auf seinen alten Schulplatz.
»Bitte, Königliche Hoheit, ernst zu bleiben, wenn wir in den Heiligen Schriften von Schlangen lesen, die gesprochen haben, oder von Kühen, die sich gegenseitig aufgefressen.«
Er karikierte mit Stimmklang und Betonung den Lehrer in der Tat ganz vortrefflich.
»Bei welchem Abschnitt der biblischen Geschichte sind wir das letztenmal stehen geblieben?« – und er blätterte mit komisch gespreizten Fingern in dem Buch – es war ein Kochbuch. »Richtig, bei jenem höchstbemerkenswerten, wunderbaren Ereignis von dem Familienessen bei den Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob, richtiger oder wenigstens genauer gesagt, bei jenem Picknick, wo der heilige Jakob den dummen Esau mit dem Essen angeschmiert hat – es war eine ganz gewöhnliche Linsensuppe ohne eine Spur von Erbswurst. Ähnliches geschieht zwar in der profanen Welt auch heute noch, wenn der eine Bruder dem andern ablockt, was er selber gern möchte. Aber da ist die Sache nicht so wunderbar, und man wird dafür auch nicht gleich unter die Erzväter versetzt. Weiter im Text! Und daß dann Jakob hineinging und auch den alten Isaak mit einem jungen Lammsbraten anführte, den er dem ehrwürdigen und jedenfalls sehr hungrigen Herrn als Rehbraten servierte und richtig aufschwatzte, das, Königliche Hoheit, war ein famoses Schelmenstück. Und das Fell, das er sich als Handschuhe über seine verzärtelten Pfoten zog, damit sie sich anfühlen sollten wie rauhe, wetterfeste Weidmannshände, oh, das war auch nicht von schlechten Eltern.«
»Nun genug«, lachte der König, weniger laut und herzlich als vorhin. »Wir wollen uns keiner Profanierung schuldig machen. Mein Kompliment, du hast Schauspielertalent.«
»Wie ein echter Erzvater, nicht? Sieh mal, jetzt erst im Spaß geht mir selbst ein Licht auf, daß der alte Jakob eigentlich ein rechter Schuft war, ein abgefeimter Schwindler.«
»Bitte, ein Werkzeug in der Hand Gottes. Gott war mit ihm.«
»Ja, alle mußten sich vor Jakob beugen, denn er hatte sie alle zum besten. Gott war mit ihm. Das ist sein Geheimnis. Schließlich, die Hüfte hatte er ihm doch verrenkt, daß der Kerl hinkte sein Leben lang. Seine Schlaumeierpolitik imponiert dir?«
Der König sagte träumerisch: »Ein Werkzeug Gottes. Wer's fassen kann, der fasse es.«
»Jawohl, ich fasse es. Immer, wenn eine Sache verdächtig wird, bringt man Gott ins Spiel. Der betrogene Isaak schöpft Verdacht und wundert sich, daß das Leibgericht, der Wildbraten, so flink zur Hand ist. Was tut der brave Jakob, um den argwöhnischen Alten zu beruhigen? Er erklärt prompt und mit genialer Spitzbubenschlagfertigkeit: Gott selbst hat mir den Rehbock in die Küche gejagt. Bravo!«
Von Satz zu Satz war der blonde Prinz aus der Rolle gefallen. Er karikierte nicht mehr den Religionslehrer, seine eigene Persönlichkeit war sachte an dessen Stelle gerückt. Die richtige Disputation kam in Zug.
»Du übersiehst einen Faktor in der Geschichte: das Weib!« fiel der König ein, sich erhebend. »Ohne Mitwirkung des Weibes wäre selbst Gott mit der Weltgeschichte nicht fertig geworden. Ohne das Weib gäbe es weder Altes noch Neues Testament, weder Sünde noch Gnade, weder Himmel noch Hölle.« Und während des Sprechens ging er mit großen Schritten auf und ab. »Storchengang« hat es der blonde Prinz einmal genannt.
»Das Weib! Was hat es nur für Kriege auf dem Buckel! Nicht bloß den trojanischen – und der war schon haarsträubend genug.«
Der König, seine eigenen Gedanken verfolgend: »Gott und das Weib! Hier liegt eigentlich etwas Frappantes. Ich mag es kaum aussprechen, wie sich's mir vorstellt. Ein grausiges Bild. Das allerhöchste Wesen, die causa movens aller Dinge, muß sich bei allen Hauptaktionen unter den Unterrock flüchten. Sieh dir die Geschichte einmal daraufhin an, die heilige und die profane. Und die Macht der Geistlichkeit? Denke dir einmal das Weib weg, was war's dann mit der Macht der Geistlichkeit? Könnte sie noch überall dabei sein und diese Rolle spielen? In der Politik und überall – es ist ein furchtbarer Gedanke. In deiner kleinen alten Erzvätergeschichte von vorhin, das ist ja verhältnismäßig harmlos.«
»Ich bitte dich,« fiel der blonde Prinz heftig ein, »harmlos? Die Rebekka half bei der Betrügerei, und die Rahel stahl ihres Vaters Götzenbilder, die jedenfalls kostbar waren, und setzte sich darauf.«
Dieses »und setzte sich darauf« belustigte den König. »Ja, das tat sie. Und dann sammelten sie, die Weiber und der edle Gemahl, was zu sammeln war an Land und Gütern und Herden und hatten viele Nachkommen. Denn der tugendreiche Erzvater ging von Bett zu Bett, zwischen Ehefrauen und Kebsinnen und Mägden machte er keinen Unterschied –«
»Eigentlich ein großartiger Kerl!« platzte der blonde Prinz heraus und klatschte in die Hände. »So dick er's auch trieb, Gott war beständig mit ihm. Jeder seiner Streiche hatte die allerhöchste Sanktion. Esau, der dumme, brave Tölpel, hatte überall das Nachsehen. Moral: ›Gott ist mit den Schlauen‹.«
»Das ist nun wieder voreilig geschlossen. Gott hat eben auch seine Staatsräson, sozusagen«, bemerkte der König mit kluger Würde.
»Machiavelli!« lachte der Bruder und erhob komisch drohend den Finger.
»Was willst du? Auch der muß dabei sein als der dritte im Bunde. Damit die Geschichte einen praktischen Sinn bekomme und Hand und Fuß. Mir sehr wenig sympathisch. Wie's scheint, dennoch ein ewig unentbehrliches Requisit der Staatslehre. Es gehört viel angeborene Befähigung dazu, es richtig zu handhaben. Die fabelhafte Spezialität des Jesuitismus. Um nur eins zu sagen. Wie uns neulich noch der Geschichtsprofessor mit den Philippischen Reden des Demosthenes quälte, glaubte ich auch bei dieser großen klassischen Ehrlichkeit machiavellisch-jesuitische Spuren zu entdecken. Ich behielt meine Entdeckung für mich, der biedere Professor wäre ja aus allen seinen Himmeln gefallen.«
»Na, Gott und das Weib hätten ihn wieder hineingehoben«, gähnte der Blonde.
Die Sache begann offenbar zu versanden und die Brüder zu ermüden.
»Wodurch wird nun eigentlich das Weib so mächtig und gefährlich?« fragte der König nach einigem Schweigen wie aus voller Unschuld der Seele heraus.
Wie aus der Pistole geschossen die Antwort des Bruders. »Weil es unentbehrlich ist. Und weil es weiß, daß es unentbehrlich ist.«
Der König stutzte.
Und nun leistete sich der Prinz in naiver Altklugheit noch eine Variante seiner kühnen Behauptung: »Keine Berechnung ist sicher, wo das Weib dabei ist, und jede Berechnung ist falsch, wo das Weib nicht dabei ist.«
Der König sah ihn groß an.
Der Bruder verbeugte sich vor ihm mit komischer Grandezza. »Na, was geruhen Eure Majestät dazu zu sagen? Wie stehe ich jetzt da?«
Darauf der König mit sonderbarer Miene : »Wärst du jetzt an meiner Stelle der König, würde ich dir als dein Hofnarr die Wahrheit sagen.«
»Ist mir zu hoch«, versuchte der Bruder lachend zu erwidern, aber das Lachen klang verlegen und unsicher.
Ein greller Lichtstrahl brach durch die Scheiben.
Mit rascher Wendung machte der Prinz einen Vorschlag: »Gehen wir in die Schönheitengalerie!«
»Ach so, du meinst –«
»Na ja, in den gemalten Harem der bajuwarischen Unschuld vom Lande. Großväterchens Lieblingspuppen aus Ölfarbe und Leinwand. Wir durften da zu zweit auch noch nicht hinein ohne allerstrengste Führung. Nichts für Kinder, hieß es. Was die sich für einen Begriff von uns gemacht haben müssen!«
Der König ließ sich von dem blonden Ungetüm fortziehen.
»Einen Begriff – wie meinst du das?«
»Na so, als ob wir unser Brot als ehrsame Spießer und Seifensieder verdienen müßten. Das gemalte Weibsvolk hätte unsere Karriere verderben können.«
»Nein, uns gewiß nicht«, sagte der König treuherzig. »Übrigens hat man Beispiele –«
»Geh! So was kommt doch nur in den allerfeinsten Familien vor!« spottete der Prinz. Er fühlte sich wieder unbändig munter ausgelegt.
Nachdem sie einen langen Korridor durchschritten, standen sie vor der verschlossenen Tür.
Der Prinz eilte fort, den Schlüssel zu holen. Den König fröstelte in der dumpfen, kalten Luft. Kein Teppich war gelegt, die getünchten Mauern ohne Schmuck, alles kellermäßig, lebensunfreundlich, schönheitsfeindlich. Keine Sonne und kein Stern drang da herein, kein erheiterndes Spiel warm glänzender Lichter. Der König blickte verstimmt um sich. Er dachte, das sei doch nichts weniger als ein menschenwürdiges Schloß, eher ein Gelaß für Mumien – eine Art Katakomben.
Im Sturmschritt nahte der Prinz, den Schlüssel schwingend.
»Stell dir vor, die verehrten Herrschaften da unten wollten mir Schwierigkeiten machen. Du mußt einmal mit deinem Machtwort dreinfahren. Das geht doch nicht, daß man sich vom Gesinde bevormunden läßt. Ich sage dir, wäre ich König geworden, na, ich danke für die Erbstücke. Die müßten alle fliegen auf eins, zwei, drei!«
Während er die Worte keuchend hervorstieß, flog die Tür auf. Er hatte seinen Ärger noch nicht völlig entleert. Auf der Schwelle faßte er seinen Bruder am Arm. »Na, Majestät, sag selbst, leben wir in der neuen Zeit oder noch in der Verbannung?«
Der König mit einer gewissen Feierlichkeit, halb flüsternd, als könnte er von Unberufenen belauscht werden: »Ich muß dich bitten, die Majestät nicht vergeblich oder zum Scherz im Munde zu führen. Wir leben in der neuen Zeit. Das soll die Welt in und außer der Residenz bald gewahr werden. Damit wir sie bändigen, müssen wir uns selber fest in der Hand behalten. Wir können kein straffes Regiment führen, wenn wir uns gehen lassen. Richte dein Verhalten danach, ein für allemal.«
»Danke für die gnädige Lektion!« rief der Prinz ein wenig verärgert. Plötzlich brach er los. »Ich beschwöre dich, das soll eine Galerie von Schönheiten sein.« Von Bild zu Bild eilend: »Alle die gleichen Nasen, die gleichen Augen, die gleiche Gesichtsfarbe, den gleichen faden Ausdruck – zwölf machen ein Dutzend, den Rest geb' ich als Zuwage. Die könnten ebenso ruhig in einem Mönchskloster hängen, an diesen Schönheiten würde sich keiner versündigen.«
»Historische Kostümstudien«, sagte der König kurz.
»Laß mich aus mit der Historie und den Kostümen. Davon hat man im Nationalmuseum mehr als genug. In einer Schönheitsgalerie will ich doch etwas ganz anderes. Da pfeife ich aufs Kostüm und die ganze Historie.«
»Du bist schon wieder exzessiv.«
Der blonde Prinz fuhr sich durch die Locken. »Na, wenn das Natürlichste exzessiv ist, dann Pardon. Ich meine also unmaßgeblichst und devotest, wenn dieser gemalte Harem lebendig wäre, eine Eunuchengarde brauchte er nicht zur Bewachung, es genügte ein halber Hatschier.«
Der König gutmütig lächelnd: »Harem, Eunuch, Hatschier – du redest einen sehr gemischten Salat.«
»Aber sieh,« rief der Prinz in erneut überschäumender Lustigkeit, »da fehlt eine, da ist ein Platz leer. Die ist ausgerissen. Die ist auf und davon. Das war jedenfalls die Gescheiteste. Der ist die zahme Gesellschaft von lauter Friseurstöcken zu dumm geworden.«
In der Tat fehlte das Bild der Tänzerin Lola Montez.
Der König überhörte absichtlich die Bemerkung, machte dafür die folgende, mehr für sich, als für seinen Bruder: »Die Augen sind meist schön. Nur haben sie keinen Blick, keine Tiefe der Seele. Schön sind auch die Frisuren und die Kostüme, nur nicht charakteristisch für das Wesen ihrer Trägerinnen. Es ist alles verkünstelt zusammengestellt. Darum macht auch wohl keine einzige auf mich einen Eindruck. Ich wünschte sie auch in ganzer Figur und in bewegterer Stellung. Zur feierlichen Pose sind sie alle viel zu leer.«
»Nun, welches wäre dein Ideal vom Weib?« fragte der Prinz leichthin, zu seinem Bruder tretend.
»Eine schöne Seele, sehr schön angezogen. Mit einer Stimme wie Musik und einem Duft wie von Lilien und Jasmin.«
»Aber so etwas kann man nicht malen.«
»Ist auch nicht nötig. Man kann's träumen.«
»Chacun à son goût«, schloß der Prinz lakonisch.
Weder der König noch der Prinz betrat jemals wieder die Schönheitsgalerie.
Schier tiefe Mitternacht war's, der neunzehnjährige Landesvater saß noch, über Druck- und Handschriften und Zeichnungen gebeugt, an seinem Arbeitstische.
Er stand auf, reckte sich und seufzte. Dann ging er mit kurzen, hastigen Bewegungen ans Fenster und blickte durch die Scheibe. Schwarz lag der Hofgarten in regenschwerer Nacht. Unwirsch schüttelte der Wind die Baumwipfel und riß an den Ästen der mächtigen, vielhundertjährigen Kastanien, daß sie ächzten.
»Was tut's schließlich, wie's draußen aussieht«, sagte er halblaut vor sich hin und setzte sich, entschlossen, die Nacht durchzuarbeiten, wieder an den Schreibtisch. Vom Turm der Theatinerkirche hallten dumpfe Schläge. Der König sah nach der Uhr, mechanisch, ohne die Zeit vom Zifferblatte zu lesen, so hart bedrängte ihn ein ganz anderer Gedanke.
Er hatte kurz zuvor ein Gedicht in einer alten Nummer der »Allgemeinen Zeitung« gelesen. Es war eine Huldigung der schleswigholsteinischen Landesdeputation am Sarge seines edlen Vaters. Ja, edel, das war er, und hochstrebend und von goldreiner Gesinnung, trotz alter Mißgriffe und Irrgänge – das fühlte der Sohn mit jedem Tage deutlicher, je mehr er sich in die Archivalien und privaten Dokumente aus seines Vaters Regierungszeit hineinlas. In dem Huldigungsgedicht standen aber auch einige Strophen, die sich auf ihn selbst bezogen, und die mächtig in seine Seele schlugen, trotz der poetisch armen Form des Ausdrucks. Gleich hier in der zweiten Strophe – zunächst ein Wehruf an seinen Vater:
Weh, Dir war auf hohem Meere Jäher Untergang bestimmt. Doch die Flagge Deiner Ehre Oben auf den Wellen schwimmt.
Dann der Ruf an ihn selbst, aus dem Herzen der fernen Nordlandsmänner heraus:
Ludwig, Sproß der Wittelsbache, Auf, bewähre Dein Geschlecht. Reiß empor des Vaters Flagge, Hoch empor – das deutsche Recht!
Ja, wenn er ein Souverän wäre in dem herrlichen autokratischen Sinne der großen Herrscherzeiten! Wenn er dem wogenden Drängen in Herz und Hirn zu stolzesten Zielen folgen könnte wie auf den Sonnenhöhen der Heroengeschichte die Auserwählten – mit einem »der Staat bin ich«, denn ich bin der waltende Wille und meines Gedankens Macht reißt an sich und bindet jede andere, wie ein Riesenmagnet! Je mehr er hineingesehen in die wirbelnden Wirren der Gegenwart und in die Zwiespältigkeiten und Verzagtheiten seines eigenen Staatsrates – bis zum Ersticken stieg's in ihm auf, in dieser kurzen Spanne seiner Herrschaft, das Wehegefühl und der Ekel über das Mißverhältnis seines königlichen Selbst- und Pflichtbewußtseins und der jammervollen Kargheit der ihm zu Gebote stehenden Machtmittel. Hoch empor – und jäh der Fall. Ikarus!
Nun aber die folgende Strophe, die alle Dämonen seiner Brust entfesselt und sein Denken hineinstürzt in ein Pandämonium blutiger Visionen:
An den Alpen Deiner Grenze, Dort, wo Hohenschwangau ragt, Wo Du selbst im Jugendlenze Schmetterlingen nachgejagt, Hat vordem Germaniens Wonne, Konradin, als Kind gespielt, Er, dem in Neapels Sonne Anjou nach dem Haupt gezielt.
Um Dein Ahnenschloß im Kreise Mahnt der Wald an uns und ihn. Rauscht es heimlich, flüstert's leise –
Ludwig, Stern auf dunklen Wegen, Auch an Dich, an Dich geglaubt!
Mit der Krone nimm Dir alles, Ehr' und Liebe, Macht und Dank.
Nachdem er hinter die letzte Zeile ein riesiges rotes Fragezeichen gemalt, zerriß er das Blatt in kleine Fetzen und warf's in den Papierkorb. In wütenden Schritten, die Hände auf dem Rücken, durchmaß er das Gemach kreuz und quer: »Ludwig, Stern auf dunklen Wegen –« Was wußten denn die Leute? Hatten sie auch nur eine Ahnung? – Aber sie dichten drauflos. »Natürlich: erst binden sie dem König mit Verfassungen und alten Höllenzwängen der Instanzen Hände und Füße – und dann wundern sie sich, daß er nicht wie ein Simson rennt und die Welt aus den Angeln hebt oder sämtliche Großtaten des Herkules verrichtet, einschließlich des Stallausmistens.«
Mit einem Lachen, durch das viel Bitternis und Wehmut klang, warf er sich in den Armstuhl. Er brütete vor sich hin, bis plötzlich sein Blick auf ein großes, gelbgetöntes Briefpapier fiel, mit feinen und doch resoluten Schriftzügen bedeckt. Es schimmerte so goldig vom Schreibtisch aus wie ein fröhlicher Morgengruß. Er griff danach. Zwar wußte er den Inhalt auswendig, so oft hatte er den geheimnisvollen Brief gelesen – »Nein, der Magie dieser Hand und dieser Seele, wer vermöchte ihr zu widerstehen. Egeria, ganz gewiß keine verkappte Teufelin – aber warum zeigt sie nicht ihr holdes Gesicht?« Und er liebkoste das Blatt mit der Hand und las, andächtig lächelnd :
»Mein großmächtiger schwarzer Löwe!