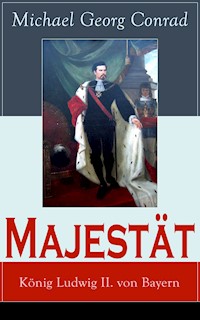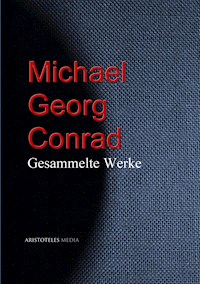Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1883 zog es den Franken Conrad nach München wo der führende Schriftsteller des Naturalismus immer wieder das geistige Klima beeinflusste. Seine Verbundenheit zur Stadt München schildert er in seinen Erzählungen: Münchner Frühlingswunder Am Tisch der Ungespundeten Schicksal Anna-Mia Die Stimme des Blutes Die goldene Schmiede Das Beispiel Die gute Haut
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein München – Geschichten aus der Stadt
Michael Georg Conrad
Inhalt:
Michael Georg Conrad – Biografie und Bibliografie
Münchner Frühlingswunder
Am Tisch der Ungespundeten
Schicksal
Anna-Mia
Die Stimme des Blutes
Die goldene Schmiede
Das Beispiel
Die gute Haut
Mein München, M. Conrad
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849626310
www.jazzybee-verlag.de
Michael Georg Conrad – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 5. April 1846 zu Gnodstadt in Franken, verstorben am 20. Dezember 1927 in München. Studierte neuere Sprachen und Pädagogik, war dann drei Jahre als Lehrer in Genf, darauf in Paris journalistisch tätig und ließ sich später in München nieder. Hier begründete er 1885 die der modernen Richtung dienende Zeitschrift »Die Gesellschaft«, von der er die Jahrgänge 1–8 allein, 9–13 mit H. Merian, 14–16 mit L. Jacobowski redigierte. Als Journalist freigesinnt und agitatorisch durchgreifend, schrieb er zahlreiche politisch-pädagogische Schriften, wie »Erziehung des Volkes zur Freiheit« (1870; 3. Aufl., Münch. 1885), »Flammen! Für freie Geister« (Leipz. 1882), »Deutsche Weckrufe« (das. 1890) u. a. Literatur- und Volksstudien lieferte er in den Schriften: »Parisiana, Plaudereien über die neueste Literatur und Kunst der Franzosen« (Münch. 1880); »Französische Charakterköpfe« (Leipz. 1881, 2 Tle.); »Madame Lutetia«, neue Pariser Studien (das. 1883); »Lutetias Töchter« (das. 1883); »Pumpanella« (das. 1889); »Gelüftete Masken. Allerlei Charakterköpfe« (das. 1890); »Ketzerblut. Sozialpolitische Stimmungen und kritische Abschlüsse« (München 1893); »Von Emil Zola bis Gerhart Hauptmann« (Leipz. 1902) u. a. Als Erzähler, oft derb, oft ironisch und humoristisch, bewährte er sich in: »Totentanz der Liebe«, Münchener Novellen (Leipz. 1884); »Die klugen Jungfrauen«, Roman (das. 1889, 3 Bde.); »Was die Isar rauscht«, Münchener Roman (das. 1889, 2 Bde.; 3. Aufl. 1898), dazu als 3. Teil: »Die Beichte des Narren« (das. 1893); »Fantasio«, Geschichten und Lebensbilder (das. 1889). In »Bergfeuer. Evangelische Erzählungen« (Münch. 1893) trägt C. die Geschichte des Neuen Testaments vor, in »Purpurner Finsternis«, Roman (Leipz. 1895), entwirft er ein satirisches Zukunftsbild aus dem 30. Jahrh., in »Majestät« (Berl. 1902) behandelt er das Verhältnis Ludwigs II. zu Richard Wagner. In den Gedichten »Salve Regina« (Berl. 1899) gibt er sozialistische Reflexionen und Selbstbekenntnisse. Auch als Dramatiker versuchte er sich in dem Lustspiel »Die Emanzipierten« (Leipz. 1888) und dem Schauspiel »Firma Goldberg« (das. 1889), beide mit L. Willfried verfaßt.
Münchner Frühlingswunder
Nein, es hat wirklich keinen Sinn, dem guten alten lustigen München unangenehme Dinge zu sagen.
Es hat auch keinen Zweck. Es ist gar nichts damit ausgerichtet, gegen die gute Lebensart zu verstoßen und sich unverbindlich zu geben, wenn man von München spricht. Von diesem großen, urbajuwarischen Dorf, das die wertvollsten Kunst- und Kulturschätze aller Zeitalter und Weltgegenden in sich aufstapeln, die heißblütigsten Fortschrittskämpfe und die widerborstigsten Ideen in sich toben, die mächtigsten und raffiniertesten Schöngeister in sich sinnieren und schaffen läßt, ohne einen Tropfen von seinem braunen Gebräu weniger zu verzapfen, ohne eine Kalbshaxe mit geringerem Appetit zu verspeisen, ohne die hehre Ruhe und den bald barocken, bald derbnaturalistischen Humor Philisterias zu verlieren und in gemächlichem blinden Triebe nie versagender Energie dennoch ein Stückchen moderner Großstadt ums andere »mit allem Komfort der Neuzeit« bei sich anzupflanzen.
Von allem Alten hat sich München neben nichtigem Kulturtrödel die kostbarsten und charakteristischsten Lebensstücke bewahrt, von allem Neuen läßt es sich schenken, und in seinen besten Stunden bringt es aus Altem und Neuem Eigenartiges hervor, Reiz für das Auge, Erquickung für das Gemüt, Sporn und Fund für den Forscher.
Wo findet sich etwas im Militärstaat wie Münchner Kunstleben?
Es ist wie Frühlingswunder, aber nicht im zerfließenden, lyrischen Sinn, sondern geographisch und meteorologisch scharf bestimmt. Genau in der Artung dieser seltsamen Landschaft zwischen alpinem Hochgebirge und Donautal.
Diese hochgeschobene Ebene, auf der die Winde niemals schlafen, die Sonnenlichter in bald mächtig massiven Einbrüchen, bald südlichen Kontrastwirkungen und subtilsten Differenzierungen auf den Farbensinn und die Temperamente der Menschen einstürmen, die Vegetation in zauberhaftem Wechsel üppige Wälder, melancholische Öden, blühende Moore, saftige Wiesen um die zahlreichen Seebecken und Flußläufe hinlagert, diese hochgeschobene Ebene hat bei aller Fülle und allem Widerspruch des Details einen großen Stil, eine alles phantastische Episodenwerk in die richtigen Massen zwingende epische Einheit. Aber es bedarf vorurteilsfreier Augen und beweglicher Sinne, um das Ganze im schönen Zusammenhange zu erfassen und auszukosten.
Münchner Frühling? Und Wunder? Gewiß, dem Nichtmünchner ist das dickste Fragezeichen erlaubt. Und einem modern nervösen Menschen, der aus anderen Witterungszonen und Großstadtkulturen kommt, werden die Münchner Frühlingswunder nicht immer die angenehmsten Rätsel aufgeben.
Je nachdem ers trifft, wird er, als korrekter Kalendergläubiger zumal, den Münchner Frühling überhaupt leugnen. Er wird ihn etwa als dekadenten Winter mit jammervollen Rückfällen oder als senilen Vorsommer mit krankhaft heißen Wallungen und verzweifelten Anläufen empfinden und als meteorologische Mißgeburt definieren. Höhenmenschen, gewöhnt an Höhenluft und Höhenlicht, in robustem Widerstand gegen das schroffe Wechselspiel der Elemente geübt, werden in ihren Nerven und ihrer Genußkraft andere Formeln finden und sich heiter bejahend zu dem Münchner Frühling und seinen Wundern stellen – in Natur, Kultur und Kunst.
Der Münchner Frühling ist zugleich das Sinnbild des Kulturverlaufs dieser eigentümlichen Stadt der Gegensätze, die einen kindlichen Mönch im Wappen und zwei zu Riesentürmen ausgewachsene Maßkrüge als Wahrzeichen hat.
Wie im Frühling der widerspruchsvolle Charakter aller Witterungsproben des Winters und des Sommers die bayrische Hochebene beherrscht, so verleiht das Rückständigste und Fortgeschrittenste der Kultur der bayrischen Hauptstadt das kennzeichnende Gepräge. Die Linien des ab- und des aufsteigenden Lebens liegen hart nebeneinander und in fast gleicher Verehrungssphäre.
Ein absolutes Gerümpel wie das Sendlingertor erfreut sich der rührendsten Bewunderung und der beißendsten Verhöhnung – aber es rührt sich keine Hand weder zu seiner Erhaltung noch zu seiner Zerstörung. Umflossen vom Bierdunst, hat es etwas so still Versöhnendes und zur Milde Stimmendes, daß es schließlich von Freund und Feind seinem natürlichen Schicksale überlassen wird. Als der Sozialistenführer und königliche Offizier a.D. Georg v. Vollmar unter der Tyrannis der Ausnahmegesetze im Gefängnis saß, wanderte mit einer gewissen Regelmäßigkeit der leckere Nachtisch von der Tafel königlicher Prinzessinnen durch die Hand einer verehrungswürdigen hochbetagten Aristokratin in die Gefängnisküche als süße Zukost für die schmale Atzung des Umstürzlers. Der jüngst verstorbene Kultusminister Dr. v. Müller hatte in seiner zärtlichen Neigung für das Schwarze und Violette in der religiösen Sparte, der er reichliche Subvention aus Staatsmitteln zuzuschanzen wußte, zugleich eine innige, wenn auch diplomatisch verheimlichte Schwäche für die extremsten Farben geistigen und künstlerischen Fortschritts, und zwischen den drängenden Besuchen hoher kirchlicher Würdenträger und landtäglicher Zentrumsstreber fand er immer noch willkommene Muße zu einem Plauderstündchen mit einem der radikalsten Vertreter der Moderne. Sein Widerstand gegen die Sezession der Maler fand wenig günstige Beurteilung und bot ihm auch kaum Gelegenheit, seiner geschmeidigen diplomatischen Meisterkunst Lorbeeren zu erringen. Ohne seine Mitwirkung wäre aber doch Franz Stucks mäßiges Sensationsbild »Der Krieg« nicht für die Staatsgalerie angekauft worden und zwar um einen übermäßigen Erwerbungspreis. Eine seiner letzten amtlichen Nebenhandlungen war der Besuch in der Villa Wahnfried zu Bayreuth. Er hatte sich vorgenommen, Frau Cosima zu vermögen, für entsprechende Gegenleistungen eine Aufführung des »Parsifal« an der Münchner Hofbühne, die aus der Zeit der Separatvorstellungen Ludwigs II. noch eine prunkvolle Parsifal-Ausstattung besitzt, von zwei zu zwei Jahren zu gestatten. Man wurde nicht handelseinig. Trotzdem wird München, das einst mit so ungestümem ultramontanen Eifer den Meister Wagner aus seinen Toren jagte, zu allen anderen Wagnerherrlichkeiten sicher auch noch seinen kleinen Festspielhügel mit »Parsifal« haben. Vorher aber wird es, nachdem es bereits seit einigen Jahren ein halbes Dutzend Kirchen aller Konfessionen und Stilarten zu bauen unternommen hat, dem unglücklichen Mäcenas und Wagnerfreund Ludwig II. eine majestätische Votivkirche errichten. An den Ufern des Sees, in dessen geheimnisvoller Flut Ludwig II. in tragischer Bedrängnis seinen Geist ausgehaucht, wird jetzt der Bau eines zyklopischen Bismarckturmes in Angriff genommen, ganz in der Nähe der königlichen Unglücksstelle, die nur ein schlichtes Eisenkreuz auf Sandsteinsockel bezeichnet. Zur Erhaltung dieses gewaltigen Bismarckdenkmals für ewige Zeiten hat sich in Bayern ein »Bismarck-Verein« gebildet. An seiner Spitze stehen hohe bayrische Staatsbeamte, Künstler und Kommerzienräte, und der Prinzregent Luitpold hat das Protektorat übernommen. Die Münchner Künstlergenossenschaft hat das achtzigste Geburtsfest Bismarcks in überschwenglicher Weise auf dem Königsplatze gefeiert und zwar in einer Veranstaltung griechischen Stils, obwohl Bismarck niemals weder amtlich noch außeramtlich mit klassischer Kunst so wenig wie mit moderner ein intimeres Verhältnis zu gegenseitiger Förderung gesucht hat. Als der erste Bürgermeister Münchens, Wilhelm Borscht, ein geborener Rheinpfälzer, sich als offizieller Gratulant der bayrischen Hauptstadt nach Friedrichsruh begeben, hat er wie ein siegreich reisender Heldenspieler seine Amtsgarderobe in einem großen Koffer mitgenommen, und als der feierliche Aktus begann, fand der künstlerisch angehauchte Mann keine geeignetere und für den Überschwang seiner Hochgefühle pathetischere Anrede an den Reichskanzler a.D. als: »Hochgebietender Fürst!«
Im Reichstage jedoch läßt sich München seit Jahren schon und vermutlich noch für lange Zeit nicht von einem Bürgermeister noch sonst einer Hochgebietendheit vertreten, sondern sendet ohne Amtsgarderobe, jedoch mit gebietender Stimmenzahl zwei echte und gerechte Sozialdemokraten nach Berlin. Doch auch dieser starke Stich ins Rote hindert die guten Münchner nicht, vor jeder Hofkutsche, auch wenn sie leer ist, respektvoll grüßend auf der Straße Front zu machen und jedes Schaufenster mit so viel kaiserlichen, königlichen, prinzlichen und fürstlichen Hoflieferanten-Wappen zu verzieren, als in dieser bösen Zeit lauteren und unlauteren Wettbewerbs aufzutreiben sind. Daneben leben sie treugehorsamst dem Worte ihres Königs Ludwig nach: »Man ehrt mich nur in meinen Landesfarben!« – und hängen an nationalen Feiertagen in verschwenderischer Fülle blauweiße Fahnen aus den Fenstern. Nur emanzipierterer patriotischer Farbensinn tupft und streift hie und da etwas Schwarzweißrot dazwischen. Nun aber läßt der deutsche Kaiser selbst, der seit der Schack'schen Gallerie-Erbschaft persönlicher Hauseigentümer in der bayrischen Hauptstadt geworden, zwei monumentale Flaggenmaste vor seinem Kunstpalais in der Briennerstraße errichten, dem florentinischen Lenbach-Palazzo schräg gegenüber, zwanzig Schritte vom altdeutschen Haus des Dr. Georg Hirth und vom griechischen Prunktor, den Propyläen. Was rückt hier auf dem engen Fleck nicht alles aneinander an heiteren Widersprüchen und verträgt sich friedsam wie in den Vitrinen eines kulturhistorischen und soziologischen Museums!
Aber das ist das Auszeichnende der Münchner Natur, daß sie Lenzesfrische, Sturm und Drang in diesem Wirrsal überlieferter toter und absterbender Dinge, Gefühle, Stimmungen und Ideen bewahrt und den Weg herausfindet zu einer heiteren, schaffens- und daseinsfröhlichen Modernität, die nach keinerlei Schablone schmeckt. Und der Abglanz dieses starken Eigenlebens in der Gegenwärtigkeit fällt zurück auf das Vergangene und Überwundene und verleiht ihm jene künstlerische Beleuchtung, die ihm das Starre und störend Historische nimmt, so daß selbst für den empfindlicheren Sinn ein anmutig befriedigendes Wechselspiel reizvoller, das Lebensgefühl steigernder Bezüge zwischen dem Alten und Neuen entsteht.
Keine Partei, kein Stichwort, keine Schule, nichts hat den Münchner Geist zu unterjochen vermocht. Keine Großstadt der Welt hat sich von der Herrschaft der Presse und ihrer papiernen Vormundschaft in allem was Unheil und Geschmack betrifft, frei zu erhalten gewußt, wie die bajuwarische Residenz- und Kunststadt. Kein politisches Blatt, und wäre es von lauter Ministern, Diplomaten, Parlamentariern und Professoren geschrieben, kann sich rühmen, über das Münchner Volk das Szepter zu schwingen. Das Beste und Neueste und Kraftvollste, das sich unablässig im Münchner Kulturprozeß entwickelt, kann der Fremde nicht einmal aus den lokalen Tageszeitungen von dem Range der »Neuesten Nachrichten« oder der »Allgemeinen Zeitung« schöpfen. Es kann nicht durch Lesen erfahren, es will durch Mitleben erworben werden.
Die künstlerischen Kämpfe zum Beispiel! Es ist einfach erstaunlich, wenn man bedenkt, auf welchen Wegen und Umwegen und mit wie verhältnismäßig schwachen materiellen Mitteln und ohne jedes bürokratische System das große bajuwarische Dorf an der Isar in kaum einem halben Jahrhundert sich zur ersten deutschen Kunststadt, sowohl nach der schöpferischen als nach der merkantilen Seite, entwickelt hat. So wenig man auswärts das Münchner Bier nachmachen kann, obwohl man das Rezept weiß, oder die »Fliegenden Blätter«, die sich so innig mit dem Bier vertragen und mit ihm die Welt erobert haben, so wenig kann man auswärts das Münchner Kunstleben nachmachen, obwohl dasselbe keinerlei Rezept noch Geschäftsgeheimnis hat. Wie gesagt, nicht einmal im Merkantilen. München ist nach Paris der erste Kunstmarkt des Kontinents. Und nun ist es noch keine hundert Jahre her, daß die Kunst, soweit sie höfische Luxuskunst war und sich hauptsächlich in der Oper, im Schauspiel und deren Nebenkünsten ausgestaltete, mit Hochdruck von Italienern und Franzosen bearbeitet wurde. Die Verwechslung schien nahezu vollständig zu sein, als mit dem »teutschen« Ludwig I. endlich auch einheimische Kräfte zu leitendem Einfluß gelangen konnten. Und so kraftvoll entwickelte sich dann das Eigenleben über all die bizarren Abschwenkungen zum Hellenischen und Akademisch-klassizistischen hinweg, daß bereits in der Mitte dieses Jahrhunderts der Typus der Münchner Kunst in seinen Hauptcharakterzügen unverwischbar und weit in die deutschen Lande strahlend festgestellt war. So war dann der Boden bereitet, auf dem sich die Kämpfe um die neue Kunst in der Musik, in der Oper, im Drama, in der Malerei und Bildnerei erfolgreich abspielen konnten. Und die alten Meister kamen neben den modernen nicht zu kurz. Wie man neben Wagner, Liszt, Berlioz usw. Mozart, Beethoven, Bach, Händel in musterhaft treuen und schwungvollen Aufführungen in der Münchner Oper, in den großen Odeons- und Museumskonzerten gerecht wird, weiß alle Welt. Daß neben den unermüdlichen Versuchen, Shakespeare, Goethe usw. zu stetig stil- und eindrucksvolleren Darstellungen zu verhelfen, die neue Dramatik mit Henrik Ibsen zuerst und am beharrlichsten an der Münchner Hofbühne Fuß fassen und liebevolles Verständnis gewinnen konnte, ist geschichtliche Tatsache. Daneben kamen Volksdichtungen, wie die des genialen Anzengruber in München zu ihrem vollen künstlerischen Recht zu einer Zeit, wo anderwärts, in und außer dem Reiche, sich die Kritiker wie die Theaterfreunde über die möglichst geringe Schätzung dieses Wiener Vollblutdramatikers noch nicht einigen konnten. Wie schließlich die Sezession unter den Malern die letzten Fesseln sprengte und siegreich das Banner der neuen Kunst in der Prinzregentenstraße aufpflanzte, wer wüßte das nicht und wem jubelte nicht das Herz darüber?
Aber es wäre nicht vollmünchnerisch, wenn man jetzt den großen mutigen Geschichtschreiber der modernen Kunst, den trefflichen Richard Muther, auf der Suche nach einem Lehrstuhl nicht nach Breslau ziehen ließe. Das Vergnügen wird um so intensiver sein, wenn man ihn nach einigen Jahren im Triumphe an die Münchner Hochschule zurückholen kann.
Die akademische Jugend spielt keine geringe Rolle in der kraftvoll ruhigen und zielbewußten Entwicklung unseres heutigen Kunst- und Literaturlebens. Als die »Gesellschaft für modernes Leben« infolge polizeilichen Drucks und strammer Militärverbote zur Rettung der Seelen unserer Einjährigfreiwilligen ihre Säle schloß, nahm der »Akademisch-dramatische Verein« die besten Teile des Programms in seinen Arbeitsplan auf und leistete in theatralischen Aufführungen für München nichts Geringeres, als was die freien Bühnen für Berlin mit größerem Zeitungslärm ins Werk gesetzt. Und was das Beste ist, der »Akademisch-dramatische Verein« ist heute nicht bloß eine wichtige Ergänzungsanstalt zu den etwas zimperlich gewordenen öffentlichen Bühnen, er ist der Schöpfer eines Kristallisationspunktes und einer Tradition für alle höheren poetischen und künstlerischen Bestrebungen unserer studierenden Jugend in München, welche hier viel weniger als anderwärts der Versuchung erliegt, abseits vom Volke, in allerlei Gigerlhaftigkeiten, Patentmeiereien und streberischen Korpssimpeleien, sich um die edelsten Genüsse zu betrügen. Handelt sich's um gesellig-künstlerische Veranstaltungen übermütig-lustiger und phantastischer Natur, stellt die Münchner Jugend in erster Linie ihren Mann, sie ist aber nicht weniger prompt auf dem Platze, wenn sich's um ernste Verteidigung bedrohter Kulturideale handelt. Die erste und größte Massendemonstration gegen die Umsturzvorlage hat in München stattgefunden, und die weiten Räume der Zentralsäle vermochten das Volk nicht zu fassen, das, jung und alt, herbeiströmte, seinen flammenden Protest gegen das Knebelgesetz abzugeben.
Spüren wir den Eigenschaften nach, welche die Münchner Bevölkerung ganz besonders befähigen, dieses stets sich verjüngende, fröhliche, gesunde Geistesleben mit seinem frühlingshaften Kunstglanze aus sich zu entwickeln, so finden wir Folgendes: Nervige Freude am Leben und seinen Kämpfen, Ruhe des Denkens und Sicherheit des Auges, also Ausschluß jener Eigenschaften, die zu Blasiertheit, Geilheit, Hast, Flüchtigkeit, Schnellfertigsein verleiten. Unübertrefflich ist der Münchner darin geübt, mit Geduld die Dinge an sich herankommen zu lassen, sie fest auf's Korn zu nehmen, sich jeder schnoddrigen Fixigkeit im Aburteilen zu enthalten, seinen kritischen Spruch hinauszuschieben, bis er mit Aug' und Herz das Wesentliche umfaßt und ausgekostet hat. Das sind vielleicht keine Tugenden und Fertigkeiten für den Politiker, der auf raschen Erwerb ausgeht, auch nicht für den Lebemann, den die lüsterne Genußgier von Sensation zu Sensation peitscht, bis die letzten Nerven reißen, aber es sind Tugenden und Fertigkeiten des Kunstmenschen, der den natürlich starken Willen hat, nicht nur das fertige Werk genießend in sich aufzunehmen, sondern sein Werden und Heranreifen liebevoll zu verfolgen und all die herrlichen Kämpfe geistiger Entwicklung in warmer Herzensbeteiligung mitzuerleben.
So wird es wohl, wie mit dem bierseligen Philistertum als dem Gegengewicht zu entzückt aufflatternder, hypernervöser Geistigkeit, auch mit dem kunstseligen Volkstum und seinen nie zu erschöpfenden Frühlingswundern seine Richtigkeit haben.
Nein, es hat wirklich keinen Sinn, dem guten alten lustigen München unangenehme Dinge zu sagen. Nicht einmal Friedrich Nietzsche hat das recht über das Herz gebracht, wie man bald in seinen biographischen Aufzeichnungen lesen wird.
Am Tisch der Ungespundeten
Am Tisch der Ungespundeten im Klosterbräu. »Der Militarismus ist unser Fluch. Er vernichtet die materielle, geistige und sittliche Kraft des Volkes.«
»Das ewige Deklamationsthema«, dachte der Umfallpolitiker, den der Zufall heute zum Gast dieser derben Tafelrunde gemacht.
Er unterdrückte mühsam das Gähnen.
Was lag ihm am Gejammer der Leute vom Militarismus! Seine Söhne machten einst gewiß brillante Karriere. Donnerwetter, sein Leutnant und sein Einjähriger, die konnten sich sehen lassen. Teuer, ja, unbändig teuer, aber wenn man sich's leisten kann?
Die erregten Wechselreden nahmen ihren Fortgang.
»Der Militarismus, meine Herren, ist auch eine der Hauptursachen der Entvölkerung des offenen Landes und der Überfüllung der Städte mit arbeitslosem Proletariat.«
»Sehr richtig. Aber schlimmer noch ist der geistige und moralische Schaden. Es ist nicht nur die Kasernierung und der Drill der Leiber, sondern auch die Kasernierung und der Drill der Geister, der sittlichen Fähigkeiten, was diesen modernen Militarismus so verhängnisvoll macht. Die intellektuelle Selbständigkeit des Individuums wird in diesem buntuniformierten Orden auf ein Minimum herabgedrückt. Es ist eine systematische Herabzüchtung zum Herdentier, eine brutale Verneinung des freien, edlen Menschentums.«
»Abwarten. Womit man sündigt, damit wird man bestraft. Der Militarismus untergräbt gerade das, was man durch ihn stützen will – den feudalkapitalistischen Staat, und vernichtet, was er angeblich schaffen soll – die Ruhe und Sicherheit der Völker. Nur abwarten. Das furchtbare Anschwellen der Sozialdemokratie ist ein deutliches Zeichen, wohin die Vermilitarisierung führt.«
Jetzt hielt's der politische Gast nicht mehr aus: »Ich glaube, Sie sehen zu schwarz oder vielmehr zu rot, meine Herren. Das ›deutliche Zeichen‹, von dem mein Nachbar zur Linken soeben gesprochen, das knallt man einfach nieder, sobald der geeignete Moment gekommen. Mit dem Militarismus können wir jeden Augenblick den ganzen Sozialismus zerschmettern. Gut Nacht. Allerseits angenehme Ruhe!«
Damit stand er auf und empfahl sich.
Zuerst Schweigen der Überraschung in der Runde.
Dann das erlösende Wort eines Ungespundeten: »Lumpenhund auf der Höhe staatsmännischer Einbildung. Das heißt – Aber Ihr versteht mich schon.«
Im Hochgefühl seiner loyalen Überlegenheit schritt der Biedere heim. Heute wollte der ein übriges an gutbürgerlicher Korrektheit tun, dieser ungespundeten Bande zum Trotz: In dieser Nacht sollte ihm – zur Abwechslung – sein trautes Eheweib genügen. Ein seltener Spaß. Die Holde wird Augen machen – Das ist ihr schon lange nicht mehr passiert –
Was soll das? Alle Wetter, das Nest ist leer!
Die Holde mit dem Geschäftsfreund und Parteigenossen abgeschoben!
Schlimme Post.
Noch schlimmere brachte die Frühe: Der Einjährige hat sich in der Kaserne erschossen. Aus Verzweiflung –
Unglaublich!
Der infam empfindsam Junge! Sich zu erschießen, weil er sich vom Unteroffizier nicht ins Gesicht spucken lassen wollte. Kann man das nicht abwischen? Kann man –
Ach, es ist zu schauderbar! Solche blutige Dummheiten! So sich um alle Zukunft zu bringen aus krankhaftem Selbstgefühl! –
Er heulte und fluchte wie ein alter Hiob.
Dann machte er Toilette, ließ einspannen und fuhr zu seiner neuesten Maitresse, – sich von ihr trösten zu lassen.
Schicksal
Endlich war er angelangt. Er nahm den breitrandigen grauen Filzhut ab und fächelte sich damit. »Die Nachmittags-Kaffeestunde im Hofgarten ist vorüber, wie es scheint...«
Unter den Arkaden war es in der Tat stille geworden. Nur die müden Schenkmädchen machten sich noch dort zu schaffen. Es waren meist aufgeschossene, bleichsüchtige, flachshaarige Dinger, die in ihren enganliegenden Baumwollkleidchen mit den häßlichen schwarzen Wachstuchschürzen wie in einem abgegriffenen Futteral aus dunklem Pappendeckel steckten.
Eine und die andere hatte in der Gegend, wo bei ausgewachsenen, gesunden Frauen der verlockend schwellende Busen thront, auf einer kümmerlich ausgestopften Wölbung ein verwelktes Blumensträußchen befestigt. Das machte einen bunten Fleck, setzte ein melancholisches rotes oder gelbes Licht mit einem grünlichen Rand auf die wollene Einöde. Kirchhofsblümchen über einem Grab, das die lebendig eingesargten Träume von Glück und Liebe und Lust einer zum Elend geborenen Mädchenseele deckt.
Die Mädchen trugen das Kaffeegeschirr ab und sammelten die umherliegenden Zeitungen. Dann stellten sie die eisernen, weißangestrichenen Stühle und Tischchen gruppenweise gegeneinander, damit das Wasser von der geneigten Platte ablaufen kann, falls die Nacht Regen brächte. Diese in frostigem Weiß schimmernden Möbelgruppen, die über die Arkaden hinaus auf den grauen Kies des Gartens unter die notdürftig grünenden Kastanien und Linden von jüngstem Wuchs oder hinsiechender Greisenhaftigkeit zusammengerückt waren, machten den ungemütlich langweiligsten Eindruck von der Welt, wie ihn eben nur die strapazierten Utensilien eines Feldlagers hervorrufen können, wo mit plumpen weißen Tassen und Kuchentellern von der zweifelhaftesten Porzellangüte täglich zur festgesetzten Stunde von einem ebenso gemischten als langweiligen Publikum die reizlose Kaffeeschlacht inszeniert wird.
»Ist das eine trostlose Welt!« seufzte der einsame Spaziergänger, der unter den Arkaden stehen geblieben war und das Gartenbild mit den hantierenden Schenkmädchen an dem verstaubten Juliabend mit traurigen Augen betrachtete. Einige hungrige Spatzen schlugen sich unter den Stühlen um die letzten Brotsämchen und erhoben dabei ein mörderisches Geschrei im höchsten Diskant.