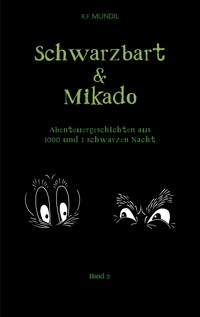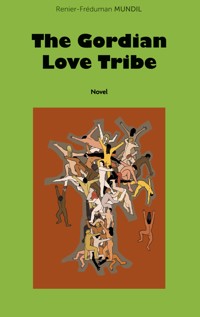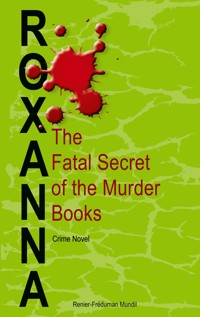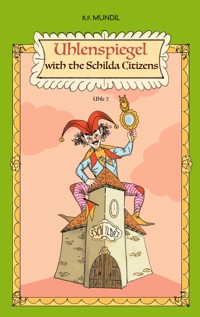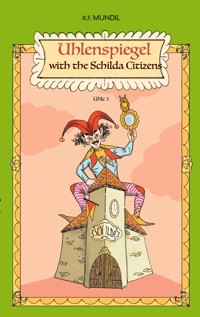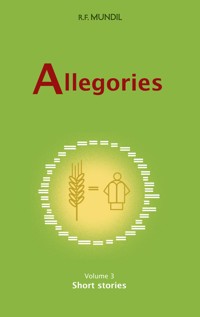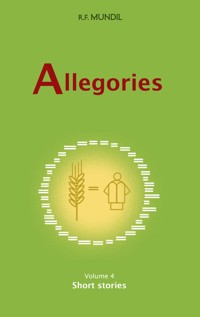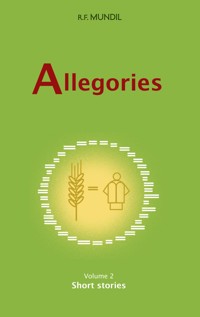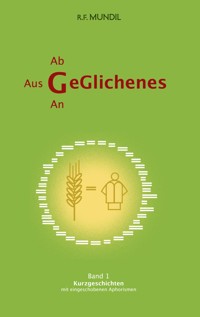Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Leben, mehrgleisig erzählt, begleitet in seiner Spur und gefolgt vom Tod. An einigen Stellen leuchten längst vergangene Punkte dieses Lebens auf, ein kurzer leuchtender Hauch, an dem es kurz innehält, bevor es vom Lebensstrom weitergezerrt wird und irgendwo, nicht spurlos aber für immer, verschwindet. Was bleibt? Auf jeden Fall der Tod, selbst wenn sich niemand mehr für die Reste dieser Lebensspur interessiert. Auch eine erzählerische Verarbeitung von Ritualen veschiedener Kulturen im Zusammnahang mit dem Sterben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An die Gewächse der Nacht
An einen Menschen
An uns
Begleitwort
„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ So fängt ein 14-strophiges Gedicht von Matthias Claudius an, jener Dichter, der übrigens mit dem Text „Der Mond ist aufgegangen“ das mit Abstand bekannteste deutsche Gedicht verfasst hat. Sein Reisegedicht führt zum Nordpol, nach Grönland, zu den Eskimos, nach Amerika und Mexiko, das Meer findet ebenso Erwähnung wie Kiel, Aysen, China, Bengalen, Japan, Otaheit (Tahiti) und Afrika. Alles Gebiete, die der nachts reisende Mond nach seinem Aufgang unendlich viele Male gesehen hat. Noch weiter herumgekommen ist wohl nur der Tod. Überall auf der Erde gibt es Leben und wo es Leben gibt, ist früher oder später der Tod zugegen.
Will einer viel erleben, bietet sich eine Reise mit dem Mond an, will einer noch mehr erleben, eine Reise mit dem Tod. Doch wie reist jemand mit dem Tod? Selbst wenn wir manchmal das Gefühl haben, unser Leben ist gleichförmig und triste, aber kein Leben ist eintönig. Wie bei einer Fuge wird es von zwei, drei, vier oder noch mehr Melodien begleitet. Am Rande bemerkt, Johann Sebastian Bach war der Meister der Fuge.
Das Nonplusultra aus Literatur und Musik wäre meines Erachtens das Gedicht „Der Mond ist aufgegangen“ als Fuge von Johann Sebastian Bach vertont.
Dass es dazu nicht kam, daran ist vermutlich (auch) der Tod schuld. Bach starb 1750, da befand sich Matthias Claudius erst in seinem zehnten Lebensjahr.
In diesem Buch ist lediglich eine der vielen Reisen beschrieben, die der Tod unternommen hat. Mit wem und wo? Ja, mit wem und wo reist der Tod? Zwei legitime Fragen. Jedoch lassen sich Fragen nicht allein deshalb beantworten, weil sie legitim sind. Andere Fragen tun sich auf. Wie sieht der Tod aus? Als Gevatter Tod, Schnitter, Knochenmann, Sensenmann soll er aufgetreten sein.
„Herin, wans nit der Schnitter is“ sagten die Menschen früher. Wer lädt schon gern den Schnitter, den Tod ein?
Aus diesem willkommenen Unwillkommensgruß wurde im Laufe der Zeit „Herein wenn’s kein Schneider ist!“
Auf diese Weise würde der Tod als Schneider verkleidet reisen. Nicht so abwegig, wer kann sich besser verkleiden, als Schneider von Berufs wegen befähigt, die unglaublichsten Verkleidungskostüme zu faden.
Aber lassen wir das. Es geht um eine Reise, eine solche muss irgendwann anfangen, auch wenn es eine Reise mit dem Tod ist.
Eingesang
Gewesenes kehrt nicht wieder, weil alles längst da ist. Vergangenheit hat ihre Wurzeln in der Zukunft.
Gegenwart gibt es nicht, weil wir den Augenblick nicht festhalten können, um ihn zu vermessen.
Der Tod ist die Kette, die alles verbindet.
Gleichwie Lufttropfen rutschen wir durch die Öffnungen dieser Kette, unwissend, ob wir jemals vom Traum des Lebens erwachen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Abgesang
1.
Na Muttchen, Du bist neu bei uns!
Die pralle Frau setzte sich auf die Lehne des Stuhls und strich mechanisch das faltige Gesicht. Muttchen war der neue Zugang, fast täglich hatten sie hier Zugänge, Zugang, was für ein Wort. Die meisten konnten nicht einmal gehen, sie wurden gegangen, wurden am trostlosen Ende ihres Lebens ein registrierter Zugang, inventarisiert und verwaltet, Gegenstand, der Arbeit und Lebensunterhalt für andere bedeutete.
Die pralle Frau erhob sich. Die wuchtige Gestalt quoll aus dem sterilen weißen Kittel hervor, dessen makelloses Weiß sich vom Grau der Zugänge seltsam fremd abhob.
Jetzt bleib hier sitzen, Muttchen, und nachher, nachher holen wir Dich!
Die Alte starrte nach vorn. In den Abgründen ihrer müden Augen flackerte regungsloses Entsetzen, zu spärlich aber, um als Energiequelle ihre Beine in Bewegung zu setzen, sie zum Ausgang zu treiben. Wie ein Geisterzug schlürften alte Gestalten an ihr vorbei, den Kopf weit nach unten gebeugt, mechanisch die Füße über den Boden schiebend, eine zähe Masse, die klebrig am Leben haftete und sich langsam auf den Speisesaal zubewegte.
Nachher holen wir Dich!
Zwei Stiefel schmetterten gegen die feinzisilierte Holztür, die bereitwillig aus ihrer Fassung sprang und krachend zu Boden stürzte. Endlich ein neues Gefühl für eine Tür, nicht immer das willenlose Öffnen und Schließen, wenn Andere hindurchtraten.
Die Stiefelabsätze bohrten sich in die liegende Tür und das alte Holz kam sich seltsam bedeutend vor unter den neuen Schritten der Zeit. Im Innern des Hauses teilten sich die Stiefel, bald trieben sie aus jedem Zimmer Menschen, peitschten sie mit der Gewalt ihrer Worte nach draußen. Stiefeltritte bohrten sich in die Leiber, die anhaftenden Holzsplitter glitten aus dem weichen Gummi in die wohlige Wärme der fliehenden erhitzten Körper.
Die kleine Marla starrte aus dem Schlitz der Wäschetruhe auf die fliehenden Menschen, die da abgeholt wurden. Die winzigen Augen begannen zu weinen, salziges Wasser kugelte über die zarte Haut und verschwand im verzerrten Mund. Marla versuchte zu schreien, doch ihre Schwester Manu presste ihr die Hand auf den Mund, als wollte sie ihr die Stimme zerdrücken. Plötzlich wurde es still. Die fliehenden Leiber hielten inne, die schwarzen Stiefel machten Halt und drehten sich um.
Wenn sich jemand versteckt hat? Na und, den holen wir später.
Auftrag ist Auftrag, und zwar jetzt!
Ich durchsuch‘ doch nicht den verlausten Dreckstall. Aber ich hab‘ eine andere Idee.
Was denn?
Die Hände der anderen Stiefel bewegten sich auf die Höhe des Hosenbundes und zogen einen schwarzen Gegenstand hervor.
Kurz darauf durchlöcherte eine Salve von Schüssen den Wäscheschrank, die Kugeln bohrten sich in die weichen Daunen der Bettdecken, weiße reine Federn schwebten wie Schneekristalle durch den Raum.
Nein, nicht die Truhe! Eine hysterische Frauenstimme gellte durch den Raum. Ein Stiefel trat ihr heftig in den Leib, ohne Seufzen verstummte der Schrei.
Mit der Unendlichkeit eines Augenblicks bohrte sich die Kugel durch das alte Eichenholz der Truhe, schwebte durch die Wäsche, erschrak ein wenig, als im Dunkeln plötzlich das unschuldige kleine Gesicht auftauchte, setzte dennoch ihren aufgezwungenen Weg fort.
Das heiße Blei verschmolz mit dem Weiß der Haut, überzog sich mit einer triefenden roten Hülle, bevor es gegen die zarten Schädelknochen schmetterte.
Die schwarzen Stiefel grinsten. Manu spürte, wie das Blut ihrer Schwester über ihre Haut lief, warm, schwerfällig, in rhythmisch versiegenden Stößen. Sie drückte ihre Schwester an sich, wollte sie wie ein Schutzschild umschließen, damit kein Stückchen Leben den kleinen Körper verlassen konnte. Ihre Tränen vermengten sich mit dem roten Strom und legten sich wie angenehmer Tau über die kleine Hülle. Dann war es vorbei.
Na Muttchen, jetzt ist aber Zeit fürs Essen. Ich soll Dich holen.
2.
In einer langen Prozession zogen die Mönche durch die kahle Gebirgsgegend. Ihre Stimmen vermengten sich mit den Tönen der mitgeführten Instrumente, prallten gegen die Felsen und stiegen von dort verzerrt in den Himmel. Es dauerte eine Weile, bis sich der erste Vogel am Himmel zeigte. Schwerfällig ließ er sich von der mit Klängen angefüllten Luft tragen und kreiste wie ein Flugzeug in der Warteschleife über die Prozession. Er öffnete seinen Schnabel, stieß dumpfe Töne aus, die sich mit den Stimmen der Mönche und den Klängen der Instrumente zu einer flüchtigen Symphonie fugten. Bald darauf erschienen andere seiner Artgenossen, zwanzig, dreißig massige Körper kreisten in der Luft. Die Mönche zogen weiter, gefolgt von den angelockten Vögeln.
Hinter der Bergkuppe erschien ein kleines Plateau. Aufgebahrt auf aneinander gefügten Steinen war eine regungslose menschliche Gestalt zu erkennen. Unruhige Furchen waren von der unwirklichen Witterung im Laufe der Zeit ins Gesicht gegraben. Regungslos starrten die Augen aus dem toten Körper, als wollten sie die dunklen Flecken über sich fixieren.
Etwas abseits endete die Prozession, die Gesänge fortführend. Schwerfällig landeten die großen Vögel in kurzer Entfernung. Tapsig hüpften sie über das Plateau, umringten den leblosen, aufgebahrten Körper. Beinahe fragend blickten sie für einen Moment zu den Mönchen, um danach ihre massigen Schnäbel in das tote kalte Fleisch zu hacken.
Regungslos und stumm verfolgten die Mönche das Schauspiel. Von Zeit zu Zeit durchbrachen Laute von berstenden Knochen die Stille. Wie in Trance beobachteten die Mönche den Kreis der Vögel, darauf wartend, dass die Tiere durch ihre Arbeit die Seele des Verstorbenen aus dem Gefängnis des kalten Leibes befreiten.
Zurück blieb ein graues Knochenskelett. Die Gitterstäbe der Rippen, Gefängnis des Lebensodems, zerbrochen, die Vertiefungen des Schädels ausgehöhlt. An einigen Stellen hatten die Vögel den Knochen mit ihren Schnäbeln so blankgewetzt, dass ein reines Weiß zum Vorschein kam und sich seltsam von der grauen Felslandschaft abhob.
Auf einmal zog ein schwarzer Adler durch die Luft. Schwerelos glitt er zu Boden, die vollgefressenen Geier trotteten behäbig zur Seite. Der Adler schnappte sich einen freigelegten Knochen und stieg damit in die Luft. Von hoch oben ließ er den Knochen zu Boden stürzen, wo er am scharfen Felsen zerschellte. Der Vogel glitt hinterher, landete inmitten des zersplitterten Knochens und begann, die spitzen Reste zu verschlingen.
Komm Muttchen, ich soll Dich holen.
3.
Am .. .. .. , das Datum ist gleichgültig, es hat sich millionenfach wiederholt, wurde Marla, die kleine Schwester von Manu, geboren. Es war Herbst, der Wind begann, das Samtgrün aus den Blättern zu treiben, aus der unsichtbaren Luft krochen wundersame Farben in die Bäume, verwandelten sie in leuchtende Blumen, die ein letztes Mal aufblühten. Durch die Alleen trotteten die Menschen, vereinzelte Fahrzeuge huschten vorbei, Menschenfüße zertraten achtlos schrumpelige Äpfel, die die müden Bäume abgeworfen hatten, nicht ahnend, dass sie nur wenige Jahre später meterweise mit ihren nackten Fingern den Boden durchpflügen würden, um eine alte runde essbare Frucht zu finden.
Oben in der Luft kreisten Flugzeuge, ruhig, geschmeidig, nur das etwas ratternde Motorengeräusch ließ erahnen, für welchen Zweck sie gebaut waren, dass sie dabei waren zu üben, den Tod vom Himmel auf die Erde zu schmettern.
Die kleine Marla lag geborgen an der warmen nackten Brust ihrer Mutter, saugte naseflügelnd an der dunklen Warze, saugte gierig am neuen Leben. Ihre große Schwester, bereits zehn Jahre durchströmt von diesem Leben, stand wortlos daneben. Es mochten noch zehn Jahre werden, dann würde sie so liegen, die Augen geschlossen, ein kleiner nackter Körper an ihrem Busen, einen Teil ihres Lebens aufsaugend. Sie erinnerte sich, die großen Fische, die bergauf durch das kalte Wasser schwammen, nur um erschöpft und müde ihren Laich abzulegen, um danach zu sterben.
Wie gut, dass Mama kein Fisch war, sonst würde sie auch bald sterben und sie musste das kleine Wesen durch die Welt schleppen.
Na Manu, gefällt sie dir?
Das Mädchen nickte wortlos. Ihre Faszination hatte ihr die Sprache verschlagen, still blickte sie auf das neue Leben.
Was ist, Manu, bist du traurig?
Ihre Mutter zog sie an sich, zog das Gesicht auf die andere Brust. Manu spürte das warme, weiche Pulsieren der nackten Haut. Sie blickte direkt in die Augen des neugeborenen Lebens, doch die Blicke des kleinen Wesens gingen unverwandt an ihr vorbei, durchbohrten die trüben Fenster und zogen in die neue Welt.
Die alte Holztür sprang auf, knarrend, schwerfällig, und Manus Bruder trat ein.
Manu komm‘, Papa sagt, ich soll dich holen.
Wohin? piepste Manu.
In die Stadt. Einkaufen. Vielleicht gehen wir auch auf den Rummel.
Manu blickte unschlüssig.
Geh Manu, deine Schwester läuft dir nicht weg. Geh Manu, lass dich holen.
Als die junge Frau nach Hause kehrte, ahnte sie bereits, was geschehen war. Die Ereignisse der letzten Wochen hatten ihr Gesicht von innen zerfurcht, nichts erinnerte in ihrem Antlitz vom pulsierenden Leben, das durch ihren unverbrauchten Körper brauste.
Ach Raisa, welch Unglück, Raisa, meine Gute. Raisa, meine Kleine.
Die junge Frau blickte in das Gesicht ihrer Mutter, die prallen Wangen wurden von einem Kopftuch zusammengehalten, Bäche von Tränen quollen aus den Augen, ihre Tropfen bildeten seltsame Lachen auf dem Oberkörper.
Meine Raisa, ach weh mir! Raisa sah, wie eine Gruppe älterer Männer neben dem Haus eine Grube aushoben. Der Winter stand vor der Tür, jede Nacht konnte der Frost hereinbrechen, den Lebensboden in Stein verwandeln. Die praktische Seite des Lebens rochierte mit einem Federstrich die Zeit der Trauer weg.
Wo liegt er? fragte Raisa mit erstickter Stimme.
Sie haben ihn ins Schlafzimmer gelegt.
Raisa ging zum Haus, ihre Mutter folgte. Unsanft stieß sie die alte Frau zur Seite:
Lass mich allein! Lass uns allein! ·
Verstört wich die alte Frau vom Weg, fiel schwerfällig auf eine alte Holzbank, die neben dem Holzschuppen stand. Raisa betrat das Schlafzimmer, ein letztes Mal war sie mit ihrem Mann allein in dem kleinen Raum, in dem sie ihre persönlichsten Stunden mit einem Menschen geteilt hatte.
Der tote Leib ihres Mannes lag auf ihrer Seite des Bettes. Wahrscheinlich war es in dem engen Raum zu schwierig gewesen, ihn auf seiner Seite aufzubahren, weil das Ehebett an seiner Seite hart an der Wand anschlug.
Regungslos blickte Raisa auf den Körper. Auf der Stirnmitte, dort wo sie ihn jeden Morgen zärtlich zum Abschied küsste, hatte sich eine verklebte Blutlache gebildet. Kopfschuss. Heckenschütze oder verirrte Kugel dieses verdammten Krieges. Warum war sie nicht fünf Zentimeter höher geflogen? Warum hatte nicht vorher eine Fliegerbombe den Heckenschützen zerfetzt?
Bis dass der Tod euch scheidet. Raisa dachte an ihre Heirat. Aus Peinlichkeit vor sich selbst drängte sie Gedanken an die Hochzeitsnacht in diesem Bett beiseite. Sie hatte sich manchmal daran erinnert, jetzt war nicht der passende Moment, diesem plötzlichen Gedanken zu folgen, die Zeit der Erinnerung daran war abgelaufen.
Sie verließ das Zimmer, ging in den Keller und kehrte mit Säge, Hammer und anderem Werkzeug zurück. Wie eine Maschine arbeiteten ihre Arme mit der alten Bügelsäge. Aufgeschreckt und verwirrt stürzte die Mutter beim regelmäßigen Schnarren des Sägeblatts in den Raum.
Raisa, nein Liebes, was ist mit dir?
Welches Unglück. Und nun das. War ihre Tochter irregeworden? Es wäre nicht ungewöhnlich in dieser Situation, man hörte oft davon. Die Ereignisse brachten die Menschen um den Verstand, einige wurden irre, andere gingen in die Irre oder ließen sich dorthin bereitwillig führen.
Raisa, mein Kind, was machst du?
Die alte Frau sah nur die Blutlache, die sich am Bettende, dort wo die Säge mechanisch hin und her glitt, langsam bildete.
Die Lache kam von ihrer Tochter. Sie hatte sich verletzt, unwillkürlich einen Teil ihres Blutes für den letzten Liebesdienst an ihren Mann geopfert.
Lass gut sein, Mutter, sagte Raisa, ich habe nie genauer gewusst, was ich zu tun habe als in diesem Augenblick. Ich werde mein Lager nie mehr mit einem Menschen teilen. Diese Hälfte des Bettes ist nicht weiter nötig, nie mehr, aber sie wird einen anderen Zweck erfüllen. Dabei lachte sie seltsam auf.
Mehrere Stunden drangen die Geräusche der Säge, das Schlagen des Hammers und das Stöhnen der jungen Frau unter der ungewohnten Arbeit nach draußen.
Keiner der Männer, die im Garten die Grube ausgehoben hatten, und auch die alte Frau nicht, trauten sich ins Haus. Endlich ging die Tür auf, Raisa erschien, abgekämpft, blass und verschwitzt stand sie unter dem niedrigen Türrahmen, suchte mit leblosen Blicken das graue Gehöft ab und ließ sich stumm auf die Holzbank fallen.
Kommt ihn holen!
4.
In der Nacht hörte man das leise Grummeln der Artillerie, das sich beharrlich dem kleinen Dorf näherte. Raisa schlief unruhig, der Tod ihres Mannes, der heranrückende Krieg vergönnten ihr die wohltuende, unbekümmerte Ruhe des Tiefschlafes.
Sie drehte sich zur Seite, um sich an ihren Mann zu schmiegen, so wie sie es jahrelang liebgewonnen hatte. Statt der Wärme eines anderen Menschen stürzte sie in ein schwarzes Loch, fand sich auf dem kalten Boden wieder, dort, wo noch vor einem Tag die andere Betthälfte gestanden hatte.
Raisa erwachte. Das Artilleriefeuer war jetzt bedrohlich laut zu vernehmen. Im Schutz der Nacht musste sich der Feind aus dem Wald heraus auf das Dorf zubewegt haben.
Sie sprang auf und lief ins Nebenzimmer. Sekunden später schlug eine Granate im Garten ein, Funkenflug erhellte die Umgebung. Raisa starrte aus dem Fenster. Die Granate war dort eingeschlagen, wo sie gestern ihren Mann beigesetzt hatten.
Die Gräber taten sich auf. Den Toten gönnte man keine Ruhe, warum sollten sie es besser als die Lebenden haben?
Draußen huschte eine schwarze Gestalt durch die Sträucher. Raisa kniff die Augen zusammen. Sie erkannte ihre kleine Tochter, mit einem Blumengebinde in der Hand lief sie zum Grab des Vaters.
Manu, Manu, ihre Stimme hallte durchs Haus, Fensterscheiben barsten, das kleine Familienfoto auf der Kommode stürzte zu Boden und zerschellte auf den nackten Brettern. Manu, Manu.......
Das Kind drehte sich um. Wie ein aufgescheuchtes Reh verharrte es unter dem alten Nussbaum, erstarrt in der Bedrohlichkeit des Augenblicks.
Eine zweite Gestalt tauchte im Garten auf, ihr Sohn. Er griff seine Schwester und zerrte sie zum Haus. Das Mädchen stürzte, das Blumengebinde wühlte sich in die schmutzige Erde, der Junge zerrte sie weiter durch die Dunkelheit, die von den hysterischen Schreien der Mutter zerschnitten wurde.
Eine letzte Detonation, heftiger, viel heftiger als die vorangegangenen. Dann trat eine Stille ein, wie sie nie zuvor über dem kleinen Dorf gelegen hatte.
Raisa schlug das alte schwere Buch auf, durch Generationen der Familie war es gegangen:
Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Er war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte: Weine nicht! Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann: Steh auf! Da richtete sich der Tote auf und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück.
Raisa schlug die Augen hoch. Vor ihr stand ihr Sohn, in seinen Armen hielt er die kleine Manu.
Lasst uns die anderen holen, sagte Raisa, es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen.
Während die Gestalt ihres Jungen verschwand, blickte sie im Schein einer Taschenlampe nach draußen. Der Nussbaum lag zerborsten über dem Grab ihres Mannes. Durch das Geäst erkannte sie Teile des Sarges, die die Erde unter der Wucht der Detonation ausgespukt hatte. Sie machte das Licht aus. Es gab Anblicke, die sie auch der Tod nicht gelehrt hatte, zu ertragen. Sie besaß nicht einmal mehr die Kraft zu weinen.
Manu, mein Kleines, lässt du mich holen? Mein Junge, wo bist du? Holt ihr mich nicht?
5.
Und jetzt zeige ich Ihnen erst einmal Ihr Zimmer!
Die pralle Frau, deren weibliche Rundungen aus dem Kittel quollen, griff den Rollstuhl und schob den Neuankömmling durch den schmalen Gang.
Früher war dies ein Herrenhaus gewesen, nach dem Krieg diente es als Getreidespeicher und zuletzt wurde es für die Alten hergerichtet. Türen öffneten sich und verhärmte Gestalten schoben ihre grinsenden Gesichter durch den Spalt nach draußen.
An der Tür stand ein Wesen, das mechanisch den Oberkörper hin- und herwog, bereits seit einer Stunde, die Pflegekräfte waren froh, dass sich die Gestalt auf diese Weise um sich selbst kümmerte.
Hier ist Ihr neues Zuhause!
Die Schwester wartete einen Augenblick ab, bis sich die Gestalt nach rechts wiegte und schob blitzschnell den Rollstuhl durch den für einen Bruchteil eines Augenblicks entstandenen Spalt durch die Tür.
Ein Zimmer mit unendlich hohen Decken tat sich auf. Alte Stuckreste hingen an den Wänden, unter den vielen Schichten von Farbe und Tapeten schimmerten alte Malereien, die von vergangenen prächtigen Zeiten zeugten. In der hintersten Ecke stand ein Bett, in dem eine alte ausgemergelte Frauengestalt lag. Zwei Schwestern hatten den geschrumpften Körper entkleidet und wendeten ihn gerade auf die andere Seite, um den Rücken abzuseifen. Gegenüber ein anderes Bett, die Gestalt einer Greisin starrte mit leeren Augenhülsen zum Fenster, wo das milde Sonnenlicht die kunstvollen Spinnweben umspülte, als suchte sie weit draußen in der Fremde etwas Vertrautes. Zusammenhanglos stammelte sie Worte, die als feine Schwaden durch die stickige Luft des Zimmers zogen.
Das dritte Bett war leer, seine Besitzerin stand noch immer an der Tür und schaukelte wie ein Perpetuum mobile von einer Seite des Türrahmens zur anderen.
Eine der Schwestern drehte sich um:
Ist sie inkontinent?
Die wohlbeleibte Kollegin schüttelte den Kopf.
Wenigstens das nicht, atmete die Andere erleichtert auf.
Sie kam zum Rollstuhl und beide packten die Neue unterm Arm, hoben sie an und legten sie aufs Bett.
Haben Sie eigentlich Kinder? fragte die Schwester.
Die Alte nickte.
Na dann werden sie auch bald Besuch bekommen.
Die alte Frau holte ein kleines Foto aus der Tasche:
Möchten Sie sehen?
Doch als sie aufblickte, waren die beiden Schwestern bereits verschwunden. Sie erkannte nur noch die Umrisse ihrer weißen Kittel, die in das dunkle Grau des Korridors eintauchten. Mit zittrigen Händen nahm sie das vergilbte Blatt, das auf die Rückseite des Fotos geklebt war, entfaltete es und las zum ungezählten Mal die ergrauten Buchstaben: