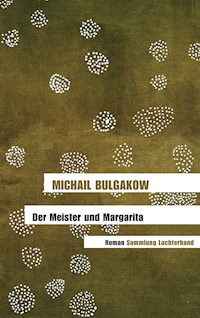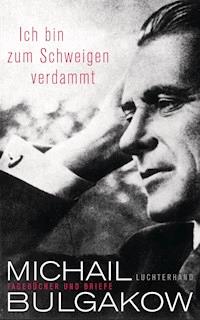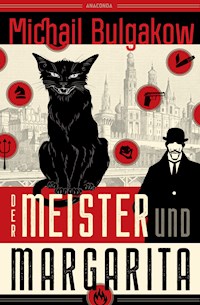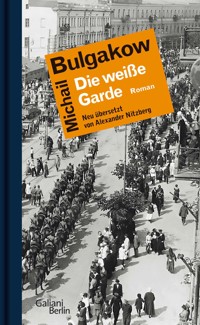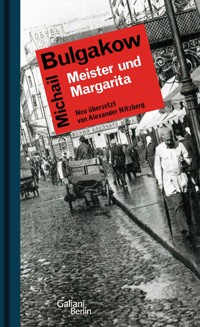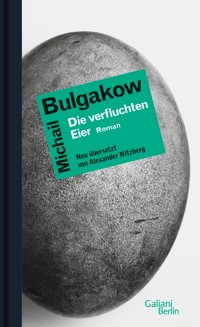11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In ›Manuskripte brennen nicht‹ hat die Oxforder Slawistin Julie Curtis die Früchte ihrer elfjährigen Forschungsarbeit zusammengetragen. Entstanden ist eine faszinierende Chronik des Lebens Bulgakows. Schon früh erhielt Curtis Einblick in das Tagebuch von Bulgakows Ehefrau, Jelena Sergejewna, in dem eindrücklich und detailliert die alptraumartige Atmosphäre während der Jahre des Stalinschen Terrors festgehalten wird. Julie Curtis hat Auszüge aus diesen Aufzeichnungen sowie aus den frühen Tagebüchern Bulgakows mit Briefen von und an den »Meister« zu einem lebhaften, gut lesbaren Bericht zusammengesetzt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 477
Ähnliche
Michail Bulgakow
Manuskripte brennen nicht
Eine Biographie in Briefen und Tagebüchern
Herausgegeben von Julie Curtis
Aus dem Russischen von Swetlana Geier
FISCHER Digital
Inhalt
Das Vorwort und die Kapiteleinleitungen wurden von Fredeke Arnim aus dem Englischen übersetzt. Anmerkungen und Personenverzeichnis wurden von Maria Mamontova und Elisabeth Ruge ergänzt bzw. erarbeitet.
Dieses Buch ist Professor Tony Cross und meinen Kollegen im Department of Slavonic Studies sowie dem Rektor und den Mitgliedern des Robinson College gewidmet, in Dankbarkeit für meine glücklichen Jahre in Cambridge.
Danksagung
Ich möchte der British Academy danken, die mich mit einem »Post-Doctoral Research Fellowship« unterstützte, sowie mit Stipendien im Rahmen des Austauschprogramms mit der Sowjetunion während der Zeit, in der ein Großteil dieses Buches fertiggestellt wurde.
Ich möchte auch Marietta Tschudakowa, Violetta Gudkowa, Irina Jerykalowa, Grigorij Fajman und Viktor Lossew sowie der inzwischen verstorbenen Ljubow Jewgenjewna Beloserskaja-Bulgakowa für ihre Hilfe und Ermutigung danken. Auch den Mitarbeitern des Puschkin-Hauses (des Literaturinstituts der sowjetischen Akademie der Wissenschaften), der Saltykow-Schtschedrin-Bibliothek und des Tscherkassow-Theaterinstituts in Leningrad sowie den Mitarbeitern in der Bibliothek der Union der Theaterschaffenden, im Museum des Moskauer Künstlertheaters, im Staatlichen Zentralarchiv für Literatur und Kunst und in der Handschriftensammlung und den Lesesälen der Lenin-Bibliothek bin ich zu Dank verpflichtet. Ich habe das Material zu diesem Buch aus zahlreichen Archiven, staatlichen wie privaten, zusammengetragen, und Bulgakows zweite Ehefrau Ljubow Jewgenjewna war in dieser Hinsicht besonders großzügig. Bulgakow behielt oft Kopien der Briefe, die er selbst geschrieben hatte, was bedeutet, daß manche Archive Kopien von Material besitzen, das ein anderes herausgegeben hat. Dies hat es mir erlaubt, Texte mit bereits Veröffentlichtem zu vergleichen, vor allem mit Publikationen Marietta Tschudakowas, Violetta Gudkowas, Grigorij Fajmans, Jelena Semskajas und Viktor Lossews und, hin und wieder, abweichende Lesarten vorzuschlagen. Viktor Lossew und Viktor Petelin sind die Herausgeber der umfassendsten – wenn auch keinesfalls vollständigen – Sammlung Bulgakowscher Korrespondenz, die 1989 in der Sowjetunion erschienen ist. Ich bin Viktor Lossew sehr dankbar, daß ich bereits Anfang des Jahres 1990 in der Lenin-Bibliothek Jelena Sergejewna Bulgakowas Tagebücher einsehen durfte.
Besonderer Dank gebührt Leslie Milne; allen meinen Kollegen in Cambridge und, wie immer, meinen Eltern und meiner Familie.
Ohne Ray wäre dies alles nicht möglich gewesen.
Vorwort
Michail Bulgakow ist ein Autor, dessen Bedeutung in den letzten Jahrzehnten ständig gewachsen ist, so daß er heute als gleicher unter den Großen der russischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts – Achmatowa, Zwetajewa, Mandelstam, Pasternak, Solschenizyn und Brodsky – steht. Bulgakows Geschichte ist jedoch eine besonders ungewöhnliche – er wurde zu seinen Lebzeiten so gut wie gar nicht veröffentlicht, weder im Osten noch im Westen, und seine Stücke erreichten nur mit größten Schwierigkeiten die Bühne. Dies war in der Tat die Zeit, in der Stalin die sowjetische Literatur in einem Würgegriff gefangen hielt, und Bulgakow war eines der prominentesten Opfer – und dennoch gab er nie auf. Erstaunlich war seine Ausdauer: wieder und wieder machte er sich an neue Werke, sobald er den Schock bewältigt hatte, daß erneut eines seiner Stücke verboten oder eines seiner Prosawerke nicht veröffentlicht wurde.
Wir sprechen von dem unbeugsamen Geist bestimmter Autoren, und in Bulgakows Fall trifft dies besonders zu. Während der dreißiger Jahre verbrachte er seine Nächte – und jeden freien Moment, den er dem Alltag entwinden konnte – damit, heimlich einen Roman zu schreiben, Der Meister und Margarita, der im allgemeinen als sein größtes Werk gesehen wird und als Meilenstein auf dem Wege zu jener internationalen Tradition des »Magischen Realismus«, zu der Márquez, Kundera und Salman Rushdie beigetragen haben. Der Roman ist eine außergewöhnliche Mischung aus satirischer Komik auf dem Hintergrund Moskaus während der dreißiger Jahre und einer gelehrten und eigentümlich intensiven Nacherzählung der Begegnung zwischen Christus und Pontius Pilatus. Er beginnt mit dem Besuch des eleganten Teufels Woland in Moskau, der – wie sich herausstellt – für die Macht des Guten tätig ist; aber das Buch ist auch eine Liebesgeschichte und die Schilderung der künstlerischen Integrität seines Helden in Gestalt eines Schriftstellers, des Meisters.
Obwohl Bulgakow immer wieder davon träumte, daß sein Roman veröffentlicht würde, war es völlig undenkbar, daß Der Meister und Margarita in der Sowjetunion der dreißiger Jahre erscheinen konnte. Als Bulgakow 1940 an einer erblichen Nierenerkrankung starb, blieb seiner Frau die Aufgabe, seinen Nachlaß zu bewahren und zu schützen, bis eine Zeit größerer Freiheit anbrach – sie folgte darin einer ehrenvollen Tradition großer Taten, die von sowjetischen Schriftstellerwitwen am Werk ihrer Männer geleistet worden sind. Erst ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod wurde die Veröffentlichung des Meister und Margarita genehmigt, 1966 und 1967 in einer von der Zensur gekürzten Fassung in der Zeitschrift Moskwa. Die vollständige Veröffentlichung des Romans 1973, in einem Band gemeinsam mit zwei weiteren Romanen, Die Weiße Garde und dem Theaterroman, war die literarische Sensation der Tauwetterperiode. Der begehrenswerte Band wanderte schon bald für das Fünfzigfache seines ursprünglichen Preises auf dem Schwarzen Markt von Besitzer zu Besitzer. Der Kult um Bulgakow und seine Werke, der sich seitdem entwickelt hat, machte ihn zu einem der beliebtesten Schriftsteller der russischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts.
Während der Breschnew-Ära wurden einige Werke Bulgakows veröffentlicht, andere aber nicht, selbst als Ausgaben im Westen erhältlich waren, und die Hindernisse, auf die Bulgakow-Forscher stießen, die sich Zutritt zu seinen Archiven verschaffen wollten, wurden zu einer cause célèbre. Während der siebziger und achtziger Jahre konnte allmählich durch die gemeinsame Anstrengung von sowjetischen und westlichen Experten mehr und mehr über Bulgakows Leben enthüllt werden, aber es blieb schwierig, die Authentizität von Texten wie von biographischem Material zu bestimmen. Mit dem Anbruch von Glasnost begannen sich die Dinge zu wandeln, obwohl die Rivalität zwischen Archivaren und Wissenschaftlern sowie die anhaltende Überzeugung einiger sowjetischer Literarhistoriker, das maßgebliche Bulgakow-Bild präsentieren zu müssen, hinderlich waren. 1989 konnte eine begrenzte Anzahl von Wissenschaftlern zum ersten Mal die Archive benutzen, und nun gibt es endlich die Aussicht auf Studien und Veröffentlichungen zu Bulgakow, an denen sowjetische und westliche Wissenschaftler gemeinsam beteiligt sind – etwas, was noch vor einigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Der hundertste Geburtstag Bulgakows im Jahr 1991 fällt daher auf einen sehr günstigen Zeitpunkt. Die Texte seiner vier Romane, zahlreicher Novellen und Erzählungen und vierzehn Theaterstücke sind nun sämtlich der sowjetischen Leserschaft zugänglich (obwohl noch eine Menge Arbeit zu leisten ist, was die endgültigen Fassungen einiger besonders umstrittener Texte angeht, so beispielsweise seiner literarischen Molière-Biographie, Das Leben des Monsieur Molière, und seiner Novelle Hundeherz). Einzelne Briefkonvolute sind inzwischen veröffentlicht worden sowie Auszüge aus seinen eigenen Tagebüchern und denen seiner dritten Frau, Jelena Sergejewna.
Bulgakows Werke sind in zahlreichen Studien analysiert worden, und seine Biographen, die vor allem in den frühen Jahren mit recht spärlichen Informationen arbeiten mußten, sind ihm trotz der Schwierigkeiten gerecht geworden. Alle Bulgakow-Forscher, ob im Osten oder im Westen, schulden Marietta Tschudakowa besonderen Dank. Sie hat, was die Literaturgeschichte im allgemeinen und Bulgakow im besonderen anbelangt, einen unermüdlichen Kampf für Glasnost gefochten, lange bevor der Begriff politisch in Mode kam. Ihre Bemühungen gipfelten in der 1987/88 in Moskau veröffentlichten außergewöhnlich detailreichen Chronik des Lebens Bulgakows Schisneopissanije Michaila Bulgakowa, die mit einer Fülle von Materialien ausgestattet ist. Ich habe mich, was das Hintergrundmaterial für das vorliegende Buch anbelangt, weitgehend auf ihre Biographie gestützt. Im Westen hat Bulgakow in A. Colin Wright (1978) und Ellendea Proffer (1984) entschlossene Biographen gefunden; und die grundlegende Studie von Lesley Milne (1991) konnte viele neuere Archiventdeckungen und Forschungsergebnisse miteinbeziehen. Dies sind Werke, die dem Leser eine umfassende Darstellung vom Leben Bulgakows bieten. Das Ziel dieses Buches ist ein anderes.
Es sind nunmehr etwa zehn Jahre vergangen, seitdem ich begonnen habe, Bulgakows Korrespondenz zu sammeln, die sowohl in privaten als auch in Staatsarchiven aufbewahrt wird. Diese Briefe von und an ihn mußten mit den vielen, verstreuten und sehr fragmentarischen Veröffentlichungen abgestimmt werden, die hin und wieder in sowjetischen und westlichen Zeitschriften und Büchern erschienen sind. Kürzlich hatte ich das besondere Glück, den vollständigen Text des Tagebuchs einsehen zu können, das Bulgakows dritte Frau, Jelena Sergejewna, auf seine Bitte hin ab September 1933 bis zu seinem Tod im Jahr 1940 führte. Jelena Sergejewna hat später eine besondere Version dieses Tagebuchs für eine mögliche Veröffentlichung vorbereitet, und da ich sowohl das Original als auch ihre Überarbeitung zur Verfügung hatte, habe ich manchmal Eintragungen aus beiden Versionen für dieses Buch zusammengefaßt. Die Tagebücher Jelena Sergejewnas sind inzwischen in Moskau erschienen. Allerdings basiert der von Viktor Lossew und Lidija Janowskaja edierte Text auf der für die Veröffentlichung überarbeiteten Fassung, während ich vor allem aus der Originalversion zitiere.
Ich hatte das Glück, den vollständigen Text eines Tagebuchs von Bulgakow lesen zu können, das er selbst in den frühen Zwanzigern geführt hat, kurz nachdem er sich als Schriftsteller in Moskau niedergelassen hatte. Dieser Text, von dem alle, Bulgakow eingeschlossen, annahmen, daß er vor über sechzig Jahren vernichtet worden sei, hat eine erstaunliche Geschichte. 1926 wurde Bulgakows Wohnung von der GPU (eine Vorläuferorganisation des KGB) durchsucht. Seine Tagebücher wurden zusammen mit dem Manuskript von Hundeherz beschlagnahmt. Da Bulgakow in diesen Fall eigentlich nur am Rande verwickelt war – die Geheimpolizei war auf einen Bekannten angesetzt –, begann er bald die Rückgabe seiner Manuskripte mit offiziellen Beschwerden zu verlangen. Etwa drei Jahre später, 1929, erhielt er sie schließlich zurück, worauf er das Tagebuch sofort verbrannte und beschloß, nie wieder eines zu führen. Seit jenen Tagen wurde angenommen, daß die Tagebücher für immer verloren seien, bis Glasnost den KGB veranlaßte zuzugeben, daß sie damals in den Zwanzigern eine Kopie des letzten Teils der Tagebücher angefertigt hätten und diese nach wie vor in den KGB-Archiven liege. Der Text wurde im Januar 1990 fast vollständig in der Sowjetunion veröffentlicht. Das Schicksal von Bulgakows Roman Der Meister und Margarita, der veröffentlicht wurde, nachdem er zu Lebzeiten des Autors ein Jahrzehnt lang und weitere sechsundzwanzig Jahre nach seinem Tod geheimgehalten worden war, sowie das erstaunliche Wiederauftauchen seines Tagebuchs nach sechzig Jahren, haben einem Satz aus dem Roman, der beharrlich die Integrität der Kunst verteidigte, eine besondere, eine geradezu prophetische Note verliehen: »Manuskripte brennen nicht.« Er ist in der Sowjetunion inzwischen eine weitverbreitete Redewendung.
In diesem Buch habe ich Auszüge aus den Briefen von und an Bulgakow mit Eintragungen aus seinen Tagebüchern der frühen Zwanziger und aus Jelena Sergejewnas Tagebüchern von 1933 bis 1940 verwoben, wobei ich Material aus meiner eigenen Sammlung auswählte, die sich auf etwa 1.600 Seiten beläuft. Die daraus entstandene Dokumentarbiographie behandelt natürlich nicht das gesamte Leben Bulgakows. Wenn überhaupt sind nur sehr wenige Dokumente aus seiner Kindheit und Jugend erhalten geblieben, und erst als Bulgakow in seinen frühen Zwanzigern war, scheinen die Briefe, die er schrieb oder erhielt, aufbewahrt worden zu sein. Was das erhaltene Material dem Leser in erster Linie bietet, ist ein lebhafter und unmittelbarer Einblick in das, was es bedeutete, als ein »konservativer« Schriftsteller in den zwanziger und dreißiger Jahren – unter Stalin – zu arbeiten.
Die Briefe und Tagebuchauszüge, die hier zusammengestellt sind, umfassen den Zeitraum unmittelbar nach der Oktoberrevolution bis 1940. Vor allem erlauben sie Bulgakow, seiner Frau und seinen Freunden, mit ihren eigenen Stimmen zu sprechen. Sie setzen ein, als Bulgakow, der gerade sein Medizinstudium beendet hatte, den Ersten Weltkrieg und die Revolution in weitentlegenen Provinzen verbringt. Er praktizierte dort als Arzt, wäre aber nur zu gerne anderswo gewesen. Seine Gefühle, vielmehr seine Abneigung gegen den von ihm gewählten Beruf, dagegen, in der Provinz festzusitzen, und gegen Rußlands neuen politischen Kurs, waren so stark, daß er während eines längeren Aufenthalts in Wladikawkas im Nordkaukasus seine medizinischen Qualifikationen verschwieg und sich als Dramatiker versuchte. Später fuhr er sogar südwärts zum Schwarzen Meer, mit der Absicht zu emigrieren. Aber die Geschichte, die in diesen Materialien tatsächlich skizziert wird, beginnt mit der Aufgabe dieses Plans und Bulgakows Ankunft in Moskau, fest entschlossen, eine große literarische Laufbahn zu beginnen. Er sollte mit der Bühnenfassung seines ersten Romans Die Weiße Garde zu wirklichem Ruhm gelangen, der als Die Tage der Turbins einer der großen Erfolge des Moskauer Künstlertheaters unter Stanislawskij wurde. Der politische Druck auf Bulgakow führte jedoch 1929 zum Aufführungsverbot, und von da an waren alle weiteren Versuche, veröffentlicht oder aufgeführt zu werden, vergeblich.
Die Materialien aus den dreißiger Jahren geben einen authentischen Eindruck von der Atmosphäre in der Moskauer geistigen Elite, von den Kreisen um das Moskauer Künstlertheater und das Bolschoj Theater und der glitzernden gesellschaftlichen Sphäre der amerikanischen Botschaft. Gleichzeitig zeigen sie aber auch, wie ein Schriftsteller als Maus fungieren konnte in einem der grausamen Katz-und-Maus-Spiele, die Stalin gerne mit solchen Künstlern wie Prokofjew, Schostakowitsch und Pasternak spielte – jenen Künstlern, die überleben durften. Bulgakows Briefe und Jelena Sergejewnas Tagebücher verzeichnen einen nicht enden wollenden Strom von Verhaftungen und Todesfällen unter ihren Freunden und Bekannten während der Jahre des Terrors, und sie geben ein schockierendes Bild jener Periode, als Stalin – mit Hilfe des Zentralkomitees der KP – nahezu lückenlos jeden einzelnen Schriftsteller kontrollierte. In Bulgakows Bekanntenkreis bewegte sich im Auftrag der Geheimpolizei und der Partei immer irgendein Spitzel, der mit verlockenden Aussichten auf eine Besserung der Bulgakowschen Geschicke ihn zu manipulieren versuchte. Eine kaum unterdrückte Hysterie kann in den Briefen und Aufzeichnungen des Ehepaars ausgemacht werden, bis Bulgakows neurotische Ängste Ende der Dreißiger in jene Krankheit einmündeten, die 1940 sein Leben beenden sollte.
1 1917–1921
Die Arbeit an Bulgakows erstem Roman, Die Weiße Garde, war ein Akt der Dankbarkeit gegenüber seiner Familie und seiner glücklichen Kindheit in der Ukrainischen Hauptstadt Kiew. In dem Roman wird eine Familie junger Erwachsener – eine Schwester und zwei jüngere Brüder, die vor kurzem ihre Mutter verloren haben – vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges und der Revolution in Kiew dargestellt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht das Haus, in dem sie gemeinsam leben. Ein Haus, das auf einem solch steilen Hang gelegen ist, daß die erste Etage zum Erdgeschoß wird, wenn man erstmal um das Gebäude herumgeklettert und vom Hof aus zur Vordertür eingetreten ist. Hinter seinen beigen Jalousien schimmert die Freundlichkeit des Hauses. Wie ein sicherer Hort schirmte es seine Bewohner ab von immer neuen politischen Coups, während draußen um Kiew Schlachten geschlagen werden, zwischen der prozaristischen weißen Armee, den belagernden deutschen Truppen, den ukrainischen bäuerlichen Nationalisten unter Petljura und der Roten Armee. »Die Einwohner Kiews nehmen an, daß es etwa achtzehn Machtwechsel gab. Manche häuslichen Memoirenschreiber zählten zwölf; ich kann Ihnen sagen, daß es genau vierzehn waren – und ich selbst habe zehn von ihnen durchlebt.« So äußerte sich Bulgakow später.
Bulgakows fiktive Familie, die Turbins – der Nachname stammte aus der Familie seiner Mutter –, übersteht gemeinsam mit ihren Freunden diese Unruhen aufgrund von Werten, die charakteristisch sind für ihre Klasse und ihre politischen Neigungen. Es sind dies Werte der Privatsphäre wie Liebe, Hingabe, ein instinktiver Gerechtigkeitssinn und ein moralisches Anliegen, das einer natürlichen und zurückhaltenden Religiosität entstammt. Die Turbins lachen viel, haben Romanzen und vergnügen sich in langen Nächten wie alle jungen Menschen, aber ihr Ehrgefühl erwacht immer dann, wenn jemand oder etwas, was sie achten, in Gefahr gerät: Alexej und sein jüngerer Bruder tun ihre Pflicht und ziehen im Namen des Zaren in den Bürgerkrieg, bis der Kampf sich als hoffnungslos erweist. Als Nikolajs Held Naj-Turs getötet wird, beschließt er, dessen Familie aufzusuchen und sie von dem Tod zu unterrichten, um anschließend einen grauenhaften Gang zum Totenhaus zu unternehmen und den Leichnam zurückzuholen – wobei er, wie vorauszusehen, sich in die Schwester seines Helden verliebt. Die Turbins wurden in Treue zum Zar erzogen, und am Ende des Romans kann man sich nur schwer vorstellen, daß sie das künftige Sowjetregime mit leidenschaftlicher Hingabe annehmen werden; solch eine Verwandlung hätte nur in einem sowjetischen Propagandaroman im Stil des Sozialistischen Realismus stattfinden können, was Bulgakows Weiße Garde entschieden nicht ist. Aber die Turbins werden überleben, denn das Ende des Romans zeigt politische Macht als ein vergängliches Phänomen: die Familie wird von ewigen Werten getragen, die ungeachtet des politischen Systems sich durchsetzen. Diese Werte sind zuvorderst eine Religiosität, die man als »zurückhaltend« charakterisieren könnte, weil sie sich weniger auf Kirchgang und Konventionen beruft als vielmehr auf eine höhere Bestimmung, die die Geschicke der Menschen lenkt und die Balance zwischen Gut und Böse regelt; zweitens – die Kunst, die in Form von Büchern und der Musik, die am Klavier gespielt und gesungen wird, den Turbins Trost und Freude spendet; und drittens – der familiäre Zusammenhalt, der Sicherheit bietet, ein Ideal, das es zu verteidigen gilt, und Maßstäbe, denen man gerecht werden muß.
Die Weiße Garde, die zwischen 1921 und 1923 geschrieben wurde, ist eines der deutlich autobiographischen Werke Bulgakows; natürlich nicht in jedem Detail, aber, was die Stimmung und Atmosphäre des Buches betrifft, so sind sie sicherlich eine Heraufbeschwörung dessen, was Bulgakow seiner eigenen Familie gegenüber empfand, und seiner Erlebnisse während der Revolutions- und Bürgerkriegsperiode. Michail Bulgakows eigene Familie war in Wirklichkeit viel größer als die in seinem Roman dargestellte: er wurde 1891 geboren, der älteste in einer Familie von sieben Kindern, von denen alle glücklich heranwuchsen. Seine Geschwister waren Wera (1892), Nadeschda (Nadja, 1893), Warwara (Warja, 1895), Nikolaj (Kolja, 1898), Iwan (Wanja, 1900) und Jelena (Ljolja, 1902). Ihr Vater, Afanassij Iwanowitsch, kam aus einer Priesterfamilie und schlug selbst eine Laufbahn als Theologe ein. Er wurde Professor für Vergleichende Theologie an der Theologischen Akademie von Kiew und veröffentlichte zahlreiche Aufsätze zu westeuropäischen Religionen, vom Katholizismus bis zum Methodismus. Afanassij Iwanowitsch lebte mit seiner jungen Frau Warwara Michailowna und ihrer ständig wachsenden Familie an verschiedenen Orten in Kiew, aber im Herbst 1906 zogen sie in eine große Wohnung im Haus Nummer 13 am Andrejewskij Hang, dem Haus, das in der Weißen Garde als Nummer 13 am Alexejewskij Hang beschrieben wird. In demselben Jahr jedoch erkrankte Afanassij Iwanowitsch an einem schweren Nierenleiden. Er starb 1907 im Alter von achtundvierzig Jahren und ließ den fünfzehnjährigen Mischa zurück, um seiner Mutter bei der Erziehung seiner vier Schwestern und zwei Brüder zu helfen. (Derselben Krankheit sollte schließlich Bulgakow selbst zum Opfer fallen, auch verhältnismäßig jung – er starb mit neunundvierzig Jahren.) Bulgakow hatte seinen Vater immer in liebender Erinnerung; er bewunderte und respektierte ihn als Gelehrten. Afanassij Iwanowitsch beherrschte Latein und Griechisch, auch Französisch, Deutsch, Englisch und die westslawischen Sprachen wie Polnisch und Tschechisch. »Das Bild einer Lampe mit grünem Schirm ist ein sehr wichtiges Bild für mich. Es stammt aus meinen Kindheitseindrücken – das Bild meines Vaters, der an seinem Arbeitstisch schreibt.«
Das Familienleben am Andrejewskij Hang 13 war nach wie vor erfüllt von Lachen und Freude, auch wenn das Einkommen der Familie nach dem Tod Afanassij Iwanowitschs um einiges schmaler geworden war. Drei Cousins lebten die meiste Zeit über in dem Haus und trugen zu der lebhaften Atmosphäre bei. Unter ihnen war Michails Cousin Konstantin, dem er als junger Mann besonders nahe stand, vielleicht weil seine eigenen Brüder, Nikolaj und Iwan, sieben und neun Jahre jünger waren als er. Alle Kinder erhielten dank der Kollegen ihres verstorbenen Vaters, die ihnen zu Stipendien verhalfen, eine gute Ausbildung, und die meisten schlugen dann eine akademische Laufbahn ein; sie waren belesen und sehr musikalisch, sie gingen oft ins Theater und vor allem in die Oper, um – unter anderen – Schaljapin zu hören. Auch Amateurtheater bereitete ihnen Vergnügen, und sie inszenierten oft eigene Stücke für ihre Familie und Freunde, zu Hause oder auf der Datscha, nahe Kiew in Butscha. Michail war besonders erfindungsreich, wenn es um komische Verse oder kleine Szenen oder Scharaden ging. Er überlegte sich sogar, ob er nicht eine Karriere am Theater oder als Sänger beginnen solle, aber schließlich entschied er sich im Jahr 1909 für das Medizinstudium. Dieser Beruf wurde ihm einerseits durch die zwei Brüder seiner Mutter nahegebracht, die beide Ärzte waren, andererseits durch den Familienfreund Iwan Pawlowitsch Woskressenskij, der sein Stiefvater werden sollte und dem sich alle Bulgakow-Kinder sehr verbunden fühlten. Als ein Weg zur literarischen Laufbahn – als der sie sich später erweisen sollte – bot die Medizin bedeutende Vorbilder in den Figuren Tschechows und Wikentij Weressajews, einem älteren Mann, der in Moskau Bulgakows Freund werden sollte. Der Schritt in Richtung Naturwissenschaft befriedigte auch Bulgakows neues Interesse am Darwinismus, der, laut seiner Schwester Nadja, ihn vor dem Jahr 1910 dazu gebracht hatte, sich vom Glauben abzuwenden, und in den folgenden Jahren zum Thema erbitterter Familiendebatten wurde, wobei Michail in seinem Atheismus von Iwan Pawlowitsch Woskressenskij, Warwara Michailownas künftigem Ehemann, unterstützt wurde.
Bulgakows Fortschritte als Medizinstudent waren nicht ganz geradlinig, vor allem, weil er sehr viel Zeit mit einer jungen Frau namens Tatjana Nikolajewna Lappa verbrachte. Er hatte sie 1908 kennengelernt, als sie aus ihrer Heimatstadt Saratow kommend ihre Tante in Kiew besuchte, und drei Jahre später sahen sie sich bereits so oft, daß der junge Bulgakow 1912 sein zweites Jahresabschlußexamen nicht bestand. Tatjana (Tassja) erinnerte sich später, daß sie all ihre freie Zeit zusammen verbrachten und mindestens zehn Mal im Jahr Gounods Faust sahen. Bulgakow vernachlässigte sein Studium auch zu Gunsten des Schreibens: 1912 zeigte er seiner Schwester Nadja einige Erzählungen, die er verfaßt hatte, und gestand ihr, daß er entschlossen sei, eines Tages Schriftsteller zu werden. Trotz der nicht unerheblichen Einwände der Eltern auf beiden Seiten heiratete der einundzwanzigjährige Michail im April 1913 Tatjana, kurz nachdem er sein Jahresabschlußexamen wiederholt und bestanden hatte, um ins dritte Studienjahr aufgenommen zu werden. Sie sollten elf Jahre zusammen verbringen, bis 1924.
Die sorgenfreie Zeit in Bulgakows Leben wurde mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 1914 beendet. Im folgenden Jahr wurde er, obgleich noch Student, eingezogen, um Verwundete in einem Krankenhaus in Saratow zu behandeln, und als er sein Diplom als Arzt erhielt, arbeitete er bereits nicht mehr als Freiwilliger des Roten Kreuzes, sondern leitete ein kleines Hospital tief in der Provinz – ohne jegliche Hilfe, außer der seiner Frau Tatjana, die ihm als Krankenschwester zur Seite stand. Die Erfahrung, unter derartigen Bedingungen zu arbeiten, ist in den Erzählungen festgehalten, die unter dem Titel Aufzeichnungen eines jungen Arztes in einem Band versammelt wurden. In ihnen beschreibt er sein Entsetzen angesichts der Primitivität der Landbevölkerung, die er behandelte; seine müßigen Versuche, die Syphilis einzudämmen, die sich aufgrund von schierer Ignoranz und Vorurteilen gefährlich ausbreitete; seine Angst davor, Operationen ausführen zu müssen, die er höchstens einmal als Student hatte beobachten können; und seine Sehnsucht, nach Hause, in die Zivilisation zurückzukehren. In einer Erzählung, die lange nicht in der Sowjetunion veröffentlicht wurde, beschreibt er auch die Erfahrung, morphiumsüchtig geworden zu sein. Dies passierte aufgrund eines Unfalls, während er einen Patienten wegen Diphterie behandelte. Er konnte die Sucht erst nach einem Jahr, dank Tatjanas entschlossener Hilfe überwinden.
Das erste Dokument in diesem Kapitel stammt vom Oktober 1917, dem Zeitpunkt der Bolschewistischen Revolution. Es ist ein Brief Bulgakows an seine Schwester Nadja in Moskau, abgeschickt aus der kleinen Stadt Wjasma, in die Bulgakow – zu seiner großen Erleichterung – im September versetzt worden war. Dort war er zumindest nicht völlig von seinen Arztkollegen abgeschnitten, doch während die Ereignisse des Oktobers voranschritten, wurde er immer unruhiger angesichts der Unmöglichkeit, Genaueres über das, was sich in Moskau zutrug, oder über seine Familie in Kiew zu erfahren. Seine Befürchtungen waren durchaus berechtigt: der Brief vom November 1917, der mitaufgenommen wurde, obwohl er weder an noch von Bulgakow geschrieben worden ist, belegt, in welcher Gefahr sich seine Mutter und sein Bruder Nikolaj in den Tagen unmittelbar nach dem bolschewistischen Umsturz am 25. Oktober befunden hatten. Nikolaj kämpfte zu dem Zeitpunkt als Soldat in der zaristischen Armee. Später beschlossen er und sein Bruder Iwan mit den übrigen Weißen zu emigrieren, und gelangten schließlich über Jugoslawien nach Paris, wo Nikolaj ein bedeutender Wissenschaftler auf dem Feld der Bakteriologie wurde, während Iwan einen für die weiße Emigration eher typischen Pfad einschlug: er wurde Balalaika-Spieler und Taxifahrer.
Zwischendurch hatte Bulgakow noch einmal die Möglichkeit, einige Zeit mit seiner Familie in Kiew zu verbringen, da er im Februar 1918 durchsetzte, aus gesundheitlichen Gründen von seinem Dienst beurlaubt zu werden. Über Moskau, wo er unvergeßliche Eindrücke von der Gewalt und den Schrecken der Revolution mitnahm, gelangte er nach Hause. Es ist dieser Zeitraum in Kiew, 1918 bis 1919, den er in dem Roman Die Weiße Garde beschreibt. Während das Land im Chaos versank und immer wieder neue Gruppierungen in Kiew die Macht übernahmen, war das Haus auf dem Andrejewskij Hang eine kostbare Zuflucht, und Bulgakow, der sich – ursprünglich ein Kinderarzt – auf syphilistische Erkrankungen spezialisiert hatte, eröffnete in dem Vorderzimmer, das die Straße überblickte, seine Praxis. Es stellte sich jedoch bald heraus, daß es gefährlich war, als Arzt zu praktizieren, denn die neuen Kräfte, die in die Stadt einzogen, zwangen meist alle medizinisch Ausgebildeten, für sie Dienst zu tun. Bulgakow gelang es einmal, nachdem er von Petljuras ukrainischen Truppen eingezogen worden war, zu entkommen und nach Hause zurückzukehren – ein offensichtlich traumatisches Erlebnis, bei dem er möglicherweise zum hilflosen Zeugen bei der Ermordung oder Folterung von Juden wurde. Irgendwann 1919, wahrscheinlich im Frühherbst, wurde er von den Weißen eingezogen und in die Hunderte von Kilometern entfernte Stadt Wladikawkas, im Nordkaukasus, abkommandiert. Wir wissen wenig über Bulgakows Gefühle, als er aus der Stadt Kiew aufbrach; obwohl man annehmen kann, daß er der Weißen Armee eine gewisse Sympathie entgegenbrachte, hat er wahrscheinlich nur ungern seine Familie und sein geliebtes Kiew erneut verlassen. Was er nicht wissen konnte, war, daß dieser Aufbruch einen Wendepunkt in seinem Leben und seiner beruflichen Laufbahn darstellte.
Erst 1988 wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen von Marietta Tschudakowa und Grigorij Fajman der erste von Bulgakow geschriebene und veröffentlichte Text in der Sowjetunion aufgespürt, der am 26. November 1919 in einer kleinen Zeitung in der Stadt Grosnyj im Nordkaukasus erschienen war. Bulgakow hat anschließend fast alle Spuren seiner Weißen-freundlichen Veröffentlichungen verwischt – was nicht überrascht, denn sein Artikel »Zukunftsperspektiven« (S. 31) zeichnet ein düsteres Bild zum voraussichtlichen Werdegang des Landes unter bolschewistischer Herrschaft. Bulgakow scheint ihn geschrieben zu haben, während er mit der Weißen Armee nach Wladikawkas unterwegs war. Er gibt unmißverständlich Auskunft über seine Verzweiflung angesichts der Zerstörung, die das Land während der Jahre des Kriegschaos erfahren hatte, und stellt fest, daß es keine Hoffnung für die Zukunft gebe, wenn nicht die Weißen die Kontrolle über das Land von Trozkij und den anderen Bolschewiki zurückeroberten. Während der Westen im Wiederaufbau begriffen sei und erstarke, sieht er voraus, daß Rußland immer weiter unter internen Kämpfen leiden wird. Wie Tschudakowa gezeigt hat, ist der Artikel auch in der Hinsicht bemerkenswert, als gleich zu Beginn der schriftstellerischen Laufbahn Bulgakows Themen wie Schuld und die unvermeidliche Vergeltung, die seine eigene Generation würde erleiden müssen, eingeführt werden, Themen, die im Zentrum vieler seiner späteren Werke stehen sollten.
Ende 1919 und Anfang 1920 arbeitete Bulgakow als Arzt für die Weißen Truppen, aber er widmete bereits immer mehr Zeit der Literatur und veröffentlichte ein oder zwei Erzählungen. Dann traf die Nachricht ein, daß die Rote Armee sich Wladikawkas nähere und die Weißen sich zurückziehen müßten. Bulgakow hatte schon beschlossen, seine Medizinerlaufbahn abzubrechen, die so viel unliebsame Aufmerksamkeit von Seiten des Militärs mit sich brachte, und nun war ein günstiger Zeitpunkt, diesen Plan zu verwirklichen – wenn auch unter erheblicher Gefahr. Denn während die Weißen den Rückzug vorbereiteten, erkrankte Bulgakow an Typhus und war lange Zeit beinahe gänzlich bewußtlos und in einem sehr ernsten Zustand. Nur Tassja betreute ihn, die Ende 1919 nach Wladikawkas gekommen war. Als er im März 1920 wieder das Bewußtsein erlangt hatte, war die Stadt bereits unter Kontrolle der Roten Armee. Das Durcheinander all dieser Ereignisse brachte ihm die günstige Gelegenheit, für sich selbst eine neue Identität als Schriftsteller zu schaffen, obwohl er immer Angst haben mußte, daß irgend jemand seine Vergangenheit preisgegeben könnte. Bulgakow mußte jedoch nie wieder als Arzt arbeiten.
Die Materialien in diesem Abschnitt stammen aus der ersten Hälfte des Jahres 1921. Es sind hauptsächlich Briefe an Bulgakows Verwandte, vor allem an seine Lieblingsschwester Nadja und seinen Vetter Konstantin. Er war hocherfreut, als er wieder Kontakt zu Kiew hatte, denn er hatte während der ganzen Zeit wenig über das Schicksal seiner Familie erfahren; von seinen Brüdern Nikolaj und Iwan war überhaupt keine Nachricht eingetroffen – seit dem Zeitpunkt, als sie 1919 mit der Weißen Armee Kiew verlassen hatten, bis Anfang 1922, als es Nikolaj gelang, seiner Mutter aus der Emigration eine Botschaft zukommen zu lassen. Die Briefe Bulgakows geben einen guten Eindruck über seine Empfindungen, als er 1920 und 1921 seine ersten Schritte als Dramatiker machte. Insgesamt schrieb er fünf Stücke während dieser Periode. Gleichzeitig half er der örtlichen bolschewistischen Administration die Literatursektion der Kulturabteilung zu organisieren, was vor allem bedeutete, daß er Vorträge hielt und öffentliche Diskussionen zum Thema russische Literatur veranstaltete. Er fand sich in tiefem Widerspruch zu dem ikonoklastischen Geist, der in der nachrevolutionären Kultur vorherrschte und in dessen Namen oftmals Schriftsteller der Vergangenheit aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit verworfen und ihre Werke als für das Proletariat von geringer Bedeutung abgetan wurden. Bulgakow war an einer besonders hitzigen Debatte am 26. Oktober 1920 beteiligt, als er Puschkin gegen den Vorwurf in Schutz nahm, er sei ein frivoler, schwülstiger Dichter, der sich am Hof Zar Nikolajs I. angebiedert habe. Aber sein Publikum war nicht leicht zu überzeugen, und Bulgakow wurde anschließend in der örtlichen Presse als bürgerlicher Reaktionär angegriffen.
Die fünf Stücke, die Bulgakow während dieser Phase schrieb, waren Selbstverteidigung, Die Turbin-Brüder, Die Tonbräutigame, Die Pariser Commune und schließlich Die Söhne des Mullahs (das er gemeinsam mit einem örtlichen Anwalt verfaßte). Sie waren sehr unterschiedlich und reichten von einer Farce bis hin zum historischen Drama; und die Art, wie sie in dem kurzen Zeitraum von zwölf Monaten aus der Feder flossen, sollte sich als charakteristisch erweisen für die bemerkenswerte Geschwindigkeit, mit der Bulgakow schrieb, und für die Produktivität der folgenden Jahre. Später, in Moskau, verbrannte Bulgakow diese Stücke, da er sie ernsthafter Erwägungen nicht für wert hielt, obwohl mindestens zwei von ihnen – Die Pariser Commune und Die Turbin-Brüder – sogar aufgeführt worden waren. Aber als sollte aufs neue sein eigenes Diktum aus dem Roman Der Meister und Margarita bestätigt werden, nämlich, daß »Manuskripte nicht brennen«, tauchte 1960 eine Kopie des Textes von Die Söhne des Mullahs auf. In seiner Erzählung »Bohème« schreibt Bulgakow über Die Söhne des Mullahs: »Wir schrieben es in siebeneinhalb Tagen, in anderen Worten, wir brauchten dafür anderthalb Tage länger als zur Erschaffung der Welt. Dennoch – was dabei herauskam, ist noch schlechter als die Welt.« Es ist besonders bedauerlich, daß uns der Text der Turbin-Brüder unbekannt blieb, denn dies war offensichtlich ein früher Versuch, die Geschichte seiner eigenen Familie vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse zu interpretieren. Die Tatsache, daß das Stück offensichtlich 1905 spielt, im Jahr der ersten Revolution – und nicht in den Jahren 1917 bis 1921, war vielleicht eine bewußte Verschleierung, um von der politischen Aktualität abzulenken. Die Turbin-Brüder wurde im Oktober 1921 in Wladikawkas aufgeführt; spätestens im Februar 1921 hat Bulgakow den Roman über seine Familie begonnen, der 1923 als Die Weiße Garde abgeschlossen wurde. Und erst, als er ihn beendet hatte, kehrte er zum Drama zurück und verwendete einen Teil des Materials aus der Weißen Garde für ein zweites Stück, die sehr erfolgreichen Tage der Turbins.
In all den Briefen, die Bulgakow während dieser Zeit an seine Verwandten schrieb, spürt man eine große Unzufriedenheit mit seinen damaligen Lebensbedingungen. Er ist angespornt von literarischem Ehrgeiz, und seine bescheidenen Erfolge in der Provinz können ihn nicht befriedigen. Teils träumt er davon, ein erfolgreicher Dramatiker in Moskau zu werden, auch wenn die dort vorherrschende kulturelle Atmosphäre ihm fremd ist; aber zugleich fragt er sich, ob er, solange es ihm noch möglich ist, in die Emigration fliehen solle – daher die kryptischen Bemerkungen darüber, daß er seine Familie womöglich lange nicht sehen werde, und die Anweisungen, was mit den Manuskripten der Prosaarbeiten, die er bereits in Kiew begonnen hatte, geschehen solle, falls er nach einer bestimmten Frist nicht wieder auftauche. Ein anderer Bereich der Ungewißheit war offenbar seine Ehe: er deutet an, daß Tassja vielleicht eine andere Zukunft bevorstehe als ihm selbst, wie immer sich seine eigene gestalten möge.
Jedenfalls brach Bulgakow Ende Mai 1921, zunächst alleine, auf, um nach einer Möglichkeit zu suchen, von einem der Häfen am Schwarzen Meer zu emigrieren. Er reiste von Wladikawkas auf einer sehr weitschweifigen Route über Baku am Kaspischen Meer nach Tiflis. Von dort aus schickte er Tassja eine Nachricht, in der er sie drängte, sich ihm anzuschließen, was sie dann auch tat, und gemeinsam reisten sie zur Hafenstadt Batum am Schwarzen Meer, geradewegs südwärts an die türkische Grenze. Sie verbrachten während des Sommers 1921 einige Monate in Batum, während Bulgakow versuchte, mit Artikeln für die örtlichen Zeitungen etwas Geld zu verdienen. Mehrmals hatte er Gelegenheit, mit dem Dichter Ossip Mandelstam, den er zu jener Zeit kennenlernte, darüber zu sprechen, wie man am besten in Moskau die Veröffentlichung eines Romans einfädelte. Gleichzeitig verhandelte Bulgakow jedoch mit den Kapitänen verschiedener Dampfer, die täglich nach Konstantinopel ausliefen, ob sie ihn nicht an Bord schmuggeln könnten. Gegen Ende des Sommers schickte er Tassja nach Moskau, während er weiterhin versuchte, das Land zu verlassen; und obwohl er ihr versicherte, er würde bei Gelingen dafür sorgen, daß sie ihm bald folgen könne, machte sie sich im August in der Gewißheit, ihn nie wieder zu sehen, auf den Weg. Wir wissen nicht genau, was dazu führte, daß Bulgakow seiner Unentschlossenheit ein Ende setzte, aber nach weiteren Wochen in Batum gab er schließlich seinen Plan zur Emigration auf. Er reiste nach Moskau, besuchte auf dem Weg seine Familie und traf Ende September 1921 bei Tassja in der Hauptstadt ein. Von da an war er entschlossen, eine große Laufbahn als Schriftsteller in der Sowjetunion zu verwirklichen.
Liebe Nadja,
erst gestern erfuhr ich aus dem Brief unseres Onkels, daß Du in Moskau bist und Dich dort auf die Prüfungen vorbereitest. […] Ich hatte schon immer vor, Dir zu schreiben, wußte aber Deine Adresse nicht. Schreibe mir, wann ist Dein Staatsexamen?
Ich habe überhaupt eine Bitte an Dich: Schreibe mir so oft es geht, soweit Du Zeit findest. Die Briefe meiner Angehörigen bedeuten für mich in dieser Zeit einen großen Trost. Bitte, schreibe mir auch Warjas Adresse. Aus Mamas letztem Brief weiß ich nur, daß Warja sich in Petrograd befindet. Ich habe mir schon lange vorgenommen, ihr zu schreiben, um mich zu erkundigen, wie es ihr geht. Auch von Mama habe ich seit Anfang September keine Nachrichten mehr. […]
Ich müßte in diesen Tagen dringend in eigenen Angelegenheiten nach Moskau fahren, aber ich kann meine Arbeit hier nicht für einen Augenblick liegen lassen und möchte Dich bitten, für mich in Moskau einiges zu erledigen, soweit es Dir keine besondere Mühe macht.
Bitte kaufe das »Praktische Lehrbuch der klinischen Chemie, Mikroskopie und Bakteriologie« von Klopstock und Kowarskij […] und schicke es mir. Könntest Du in Erfahrung bringen, welche der allerbesten Lehrbücher über Haut- und Geschlechtskrankheiten, russisch oder deutsch, in Moskau zu haben sind, und es mir schreiben, vorläufig ohne sie zu kaufen, mit Titel und Preis. […]
Schreibe mir, falls Du es weißt, was ein Paar Herrenschuhe (gute Qualität) in Moskau kostet. […]
Ich denke, daß der Bücherkauf Dir keine besondere Mühe machen wird. Du kommst doch wahrscheinlich gelegentlich in eine Buchhandlung?
Wenn es klappt, möchte ich in ungefähr einem Monat versuchen, für ein paar Tage nach Moskau zu kommen, um das Wichtigste zu erledigen. […]
Einen festen Kuß von Tassja und von mir.
Michail.
Ich kann mir denken, daß Ihr viele schreckliche Aufregungen durchgemacht habt, da auch wir hier einiges durchstehen mußten. Am schlimmsten war die Lage des armen Nikolaj als Junker. Er mußte Erschütterndes durchmachen, und in der Nacht vom 29. auf den 30. auch ich an seiner Seite: Wir sind buchstäblich um Haaresbreite dem Tod entronnen. Am 25. Oktober traf man in Petschersk Vorbereitungen für ein Gefecht, und der Stadtteil wurde von der übrigen Stadt abgeschnitten. Solange in der Ingenieurschule das Telefon funktionierte, konnten wir mit Kolja telefonieren, aber dann wurde auch die Telefonverbindung unterbrochen. Am 28. wurde das Arsenal geplündert, und die Waffen fielen Arbeitern und verdächtigen Banden in die Hände …
Meine Sorge um Kolja wuchs, und ich beschloß, mich zu ihm auf den Weg zu machen, und am 29. nachmittags war ich bei ihm. Auf dem Hinweg hatte ich Glück. Aber auf dem Rückweg, als Kolja und ich um halb acht abends den Versuch unternahmen (er bekam eine Viertelstunde Urlaub, um mich zu begleiten), in die Stadt zu gelangen, an der Konstantin-Schule vorbei – da begann der berüchtigte Beschuß dieser Schule. Wir hatten soeben die Mauer von der Konstantin-Schule hinter uns, als der erste Schuß fiel. Wir liefen zurück und suchten Schutz hinter einem kleinen Mauervorsprung: Aber sobald das Kreuzfeuer eröffnet wurde – auf die Schule und von ihr kommend –, fanden wir uns in der Feuerlinie, und die Kugeln trafen die Mauer, hinter der wir standen. Glücklicherweise befand sich unter dem zufällig zusammengelaufenen Publikum (etwa sechs Menschen), das hier vor den Kugeln Schutz suchte, ein Offizier: Er befahl uns, uns flach auf den Boden zu legen, so nahe an die Mauern wie möglich. Wir haben eine entsetzliche Stunde durchgestanden: Das Rattern der Maschinengewehre, das Gewehrfeuer, das Einschlagen der Kugeln in die Mauer und dann auch noch das Heulen der Granaten … Aber offenbar hatte unser Stündlein noch nicht geschlagen, und Kolja und ich blieben am Leben (eine Frau wurde getötet): aber wir werden diese Nacht nie vergessen …
In einer kurzen Feuerpause schafften wir es (auf Kommando desselben Offiziers), uns in die Ingenieurschule zurückzuflüchten. Hier waren bereits alle Lichter gelöscht, nur der Scheinwerfer flackerte auf: Die Junker traten in Kampfordnung an, und man hörte die Kommandos der Offiziere; Kolja reihte sich ein, und ich sah ihn nicht mehr … Ich saß auf einem Stuhl im Empfangszimmer und wußte, daß ich dort die ganze Nacht sitzen würde, denn an den Heimweg war in dieser schrecklichen Nacht überhaupt nicht zu denken, wir waren etwa acht Leidensgenossen, die in der Ingenieurschule von dem Ausbruch der Kampfhandlungen überrascht worden waren. Ich beruhigte mich nach den überstandenen Aufregungen, sobald das entsetzliche Herzklopfen sich gelegt hatte. Es ist unvorstellbar, daß mein Herz das Rennen über den offenen Platz zur Ingenieurschule ausgehalten hat. Als die Kugeln wieder um uns pfiffen, hatte Kolja beide Arme um mich gelegt, um mich vor den Kugeln zu schützen und mir beim Laufen behilflich zu sein. Armer Junge, er hatte solche Angst um mich, und ich um ihn … Die Minuten schienen Stunden, und ich malte mir aus, wie es zu Hause, wo ich erwartet wurde, wohl aussehe, und zitterte, daß Wanetschka mich suchen und in den Kugelregen geraten könnte. Und meine hilflose Lage verwandelte sich in eine Folter … Nach und nach wagte sich das Publikum aus dem Empfangszimmer auf den Gang hinaus, und dann bis zur Ausgangstür … Zu dieser Zeit standen dort zwei Offiziere und ein Junker aus der Artillerieschule, die ebenfalls unterwegs von dem Feuer überrascht worden waren, und da bot einer der Offiziere denen, die es wünschten, an, sie über den Artillerie-Übungsplatz zu den Schlachthöfen in der Demijewka zu geleiten, dieser Stadtteil wurde nicht beschossen … Unter den Unternehmungslustigen waren sechs Herren und zwei Damen (ich war eine davon). Und so machten wir uns auf den Weg … Aber was war das für eine unheimliche und phantastische Wanderung bei vollständiger Dunkelheit, bei Nebel, quer durch Schluchten und Gräben, durch tiefen zähen Morast, im Gänsemarsch und schweigend, die Herren mit dem Revolver in der Hand. An der Ingenieurschule wurden wir von einer Patrouille angehalten (der Offizier hatte einen Passierschein mitgenommen), und am Rand einer Schlucht, in die wir hinabsteigen sollten, erschien die schemenhafte Figur Nikolajtschiks mit Gewehr … Er erkannte mich, packte mich bei den Schultern und flüsterte mir leise ins Ohr: »Zurück! Das ist Wahnsinn! Wohin gehst Du? Sie werden Dich töten!« Aber ich bekreuzte ihn schweigend, gab ihm einen festen Kuß, der Offizier packte mich bei der Hand, und wir begannen den Abstieg in die Schlucht … Mit einem Wort: Um ein Uhr in der Nacht war ich zu Hause (mein Wohltäter, der Offizier, begleitete mich bis vor die Haustür).
Ihr könnt Euch vorstellen, wie sie mich erwartet haben! Ich war physisch und seelisch so erschöpft, daß ich mich auf den ersten besten Stuhl fallen ließ und in Tränen ausbrach. Aber ich war zu Hause, ich durfte mich auskleiden und ins Bett legen, während der arme Nikolajtschik, der schon zwei Nächte nicht geschlafen hatte, noch zwei weitere Tage und Nächte durchhalten mußte. Und ich war froh, daß ich diese entsetzliche Nacht mit ihm gemeinsam erlebt hatte. […]
Jetzt ist alles vorbei … Gestern wurde bei uns feierlich die Ukrainische Republik proklamiert, mit einer großen Parade. Das Schicksal der Fahnenjunker ist noch nicht entschieden. Für einen Monat hat man sie nach Hause geschickt. Die Ingenieurschule hat am wenigsten gelitten: Vier wurden verwundet, einer wurde wahnsinnig. Sie haben sich geteilt – die eine Gruppe trat ihren Urlaub an, während die andere freiwillig in der Schule geblieben ist, Dienst tut und Wachen aufstellt. Kolja schloß sich der zweiten an, obwohl ich es lieber gesehen hätte, wenn er sich nach all diesen Erschütterungen zu Hause ein wenig erholt hätte. Aber er hat sich schon immer für die Belange seiner Schule engagiert: Diese Ereignisse haben ihn noch mehr in ihren Bann gezogen, bei ihm entwickelte sich das Pflichtgefühl. Nun habe ich keinen Platz mehr zum Weiterschreiben …
Eure Euch liebende Mama.
Liebe Nadja,
mit den besten Grüßen zum Neuen Jahr wünsche ich Dir von ganzem Herzen, daß dieses neue Jahr in nichts dem alten gleiche.
[…]
Du schreibst mir nicht und hast mir auch Deine Adresse nicht angegeben, woraus ich schließen muß, daß Du auf einen Briefwechsel mit mir keinen besonderen Wert legst. […]
Ich bin verzweifelt, daß ich aus Kiew keine Nachrichten habe. Und ich bin noch mehr verzweifelt, weil es mir nicht gelingt, mein Geld von der Bank in Wjasma zu bekommen, um es Mama zu überweisen. In mir regt sich immer stärker der Verdacht, daß die zweitausend Rubel im Meer der russischen Revolution untergehen werden. Ach, wie gut könnte ich diese zweitausend gebrauchen: Aber ich habe keine Lust, mich umsonst aufzuregen und an sie zu denken! …
Anfang Dezember fuhr ich nach Moskau, um Verschiedenes zu regeln, und kehrte mit leeren Händen zurück. Nun bin ich wieder in Wjasma im alten Trott, arbeite wieder in einer mir verhaßten Atmosphäre inmitten mir verhaßter Menschen. Meine Umgebung empfinde ich als so widerwärtig, daß ich in völliger Einsamkeit lebe. Dafür habe ich weiten Raum zum Nachdenken, und ich denke nach. Der einzige Trost für mich sind meine Arbeit und die Lektüre am Abend. Gerührt lese ich die alten Autoren (alles, wie es gerade kommt, denn Bücher sind hier selten) und berausche mich an den Bildern der alten Zeit. Ach, warum bin ich so spät auf die Welt gekommen! Warum habe ich nicht vor hundert Jahren gelebt! Aber das läßt sich natürlich nicht korrigieren! Es zieht mich schmerzlich fort von hier, nach Moskau oder nach Kiew, dorthin, wo immer noch, wenn auch versickernd, Leben stattfindet. Vor allem nach Kiew! In zwei Stunden beginnt das neue Jahr. Was wird es mir bringen? Vorhin habe ich geschlafen, und mir träumte von Kiew, von den vertrauten, lieben Gesichtern, mir träumte, es würde Klavier gespielt.
Vor kurzem, auf der Reise nach Moskau und nach Saratow, wurde ich Augenzeuge von Bildern, die ich nicht noch einmal sehen möchte.
Ich habe gesehen, wie die Menge die Fensterscheiben der Züge einschlug, ich habe gesehen, wie die Menschen geprügelt wurden. Ich habe in Moskau zerstörte und niedergebrannte Häuser gesehen … Ich habe hungrige Menschenschlangen vor den Läden, gehetzte und erbarmungswürdige Offiziere gesehen, und ich habe die Zeitungen gesehen, in denen eigentlich immer dasselbe steht: über das Blut, das im Süden, im Westen und im Osten fließt … Das neue Jahr bricht an. Einen festen Kuß von Deinem Bruder
Michail.
P.S. Ich warte auf einen Brief.
»Zukunftsperspektiven«
Jetzt, da unsere unglückliche Heimat von der »großen sozialen Revolution« in den tiefsten Abgrund von Schmach und Armut gestoßen wurde, taucht vor manchem von uns immer häufiger derselbe Gedanke auf.
Es ist ein beharrlicher Gedanke.
Ein dunkler, ein düsterer Gedanke, erhebt sich in unserem Bewußtsein und fordert unabweisbar eine Antwort.
Er ist einfach: was wird weiter mit uns geschehen?
Sein Auftauchen ist ganz natürlich.
Wir haben unsere jüngste Vergangenheit analysiert. Oh, wir haben sehr deutlich jedes Moment der letzten zwei Jahre untersucht. Viele von uns haben sie nicht nur untersucht, sondern auch verflucht.
Die Gegenwart liegt vor unseren Augen. Sie ist derartig, daß man am liebsten die Augen schließen möchte.
Nur nichts sehen!
Es bleibt noch die Zukunft. Die geheimnisvolle, unbekannte Zukunft.
In der Tat: Was wird weiter mit uns geschehen? …
Kürzlich hatte ich Gelegenheit, einige Exemplare einer englischen Illustrierten durchzublättern.
Lange, wie verzaubert, betrachtete ich die wundervollen Photographien.
Und dann dachte ich lange, lange nach.
Ja, das Bild ist klar.
Riesige Maschinen in riesigen Anlagen fressen gierig Tag für Tag Steinkohle, donnern, hämmern, entlassen Ströme geschmolzenen Metalls, schmieden, reparieren, bauen …
Sie schmieden die Macht des Friedens, anstelle jener Maschinen, die erst vor kurzem, Tod und Zerstörung verbreitend, die Macht des Sieges geschmiedet haben.
Im Westen ist der große Krieg der großen Völker zuende. Jetzt lecken sie ihre Wunden.
Selbstverständlich werden sie genesen. Sie werden sehr bald genesen!
Und jeder, der endlich wieder zur Vernunft gekommen ist, jeder, der nicht länger an die jämmerliche Wahnvorstellung glaubt, daß unsere bösartige Krankheit auf den Westen übergreift und ihn infiziert, wird jenen mächtigen Aufschwung der titanischen Friedensarbeit erkennen, der die westlichen Länder auf den bislang unerreichten Gipfel friedlicher Machtfülle hinaufträgt.
Und wir?
Wir werden uns verspäten …
Wir werden uns so sehr verspäten, daß kein einziger zeitgenössischer Prophet uns sagen kann, wann wir sie endlich einholen und ob wir sie überhaupt je einholen werden?
Denn wir sind bestraft.
Wir können jetzt unmöglich aufbauen. Wir stehen einer schweren Aufgabe gegenüber – es gilt, die eigene Erde zu erobern, sie fremden Händen zu entreißen.
Die Stunde der Abrechnung hat geschlagen.
Die Helden Dobrowolzy[1] entreißen Trozkij die russische Erde Schritt um Schritt.
Und alle, alle – jene, die furchtlos ihre Pflicht erfüllen und die anderen, die jetzt in den südlichen Städten, fernab der Front, untergeschlüpft sind und dem bitteren Irrtum nachhängen, daß das Land auch ohne ihr Zutun gerettet werden kann, sie alle harren leidenschaftlich auf die Befreiung dieses Landes.
Und dieses Land wird befreit werden.
Denn es gibt kein Land, das nicht seine Helden hätte, und es ist verbrecherisch, zu glauben, die Heimat sei tot.
Aber man wird viel kämpfen, es wird viel Blut fließen müssen, denn solange im unheimlichen Schatten Trozkijs die von ihm verführten Toren mit Waffen in der Hand ihr Unwesen treiben, kann es kein Leben geben, wird es kein Leben geben, sondern nur Kampf auf Leben und Tod. Und man muß kämpfen.
Also, während dort, im Westen, die Maschinen für den Aufbau rattern, rattern bei uns Maschinengewehre, von einer Grenze zur anderen.
Die Raserei der beiden letzten Jahre stieß uns auf diesen furchtbaren Weg hinaus, und für uns gibt es kein Halten und keine Atempause. Wir haben den Kelch der Vergeltung an die Lippen gesetzt und müssen ihn leeren bis zur Neige.
Dort im Westen werden unzählige elektrische Lichter funkeln, Flieger sich in die gebändigte Luft bohren, dort wird gebaut, geforscht, gedruckt, gelernt werden.
Wir aber … wir werden kämpfen.
Denn es gibt keine Macht, die dies ändern könnte.
Wir werden unsere eigenen Metropolen erobern müssen.
Und wir werden sie erobern.
Die Engländer werden, eingedenk dessen, daß unser Blut wie Tau die Felder benetzte, daß wir mit Deutschland rangen, um es von Paris abzuziehen, uns auf Borg noch mehr Soldatenmäntel und Soldatenstiefel überlassen, damit wir schneller bis Moskau vorrücken.
Und wir werden bis Moskau vorrücken.
Die gesinnungslosen Schurken und Rasenden werden vertrieben, verjagt, vernichtet werden.
Der Krieg wird enden.
Und das blutende, zerstörte Land wird versuchen, auf die Beine zu kommen.
Jene, die über »Ermüdung« klagen, werden leider eine Enttäuschung erleben. Denn eine noch größere »Ermüdung« bleibt ihnen nicht erspart …
Nun gilt es, für die Vergangenheit mit immenser Arbeit zu bezahlen, mit strengem, asketischem Leben. Bezahlen – in der übertragenen und in der direkten Bedeutung dieses Wortes.
Bezahlen für die Raserei der Märztage, für die Raserei der Oktobertage, für verräterische nationalistische Autonomien, für die Demoralisierung der Arbeiter, für Brest, für den hemmungslosen Einsatz der Druckstöcke für die Geldfabrikation … für alles!
Und wir werden die Rechnung bezahlen.
Und erst dann, wenn es schon sehr spät sein wird, werden wir darangehen, das eine oder andere aufzubauen, um gleichberechtigt zu sein, um wieder Zugang zu den Sälen von Versailles zu erlangen.
Wer wird diese lichten Tage erleben?
Wir?
O nein! Unsere Kinder, vielleicht, aber vielleicht auch erst unsere Enkel, denn die Geschichte hat einen langen Atem, und ein Jahrzehnt »überfliegt« sie ebenso schnell wie ein einzelnes Jahr.
Und wir, Repräsentanten einer glücklosen Generation, werden auch noch auf dem Totenbett als erbärmliche Bankrotteure unseren Kindern sagen müssen:
»Bezahlt, bezahlt nach Ehr und Gewissen und gedenkt in alle Ewigkeit der sozialen Revolution!«
Lieber Kostja,
über Deinen Brief habe ich mich gestern sehr gefreut. Endlich eine Nachricht von meinen Lieben! […] Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich war und wie erstaunt, daß alle am Leben sind und gesund, und offenbar auch alle zusammen sind.
(Diese verflixte Tinte!) Das einzige, was ich bedauerlich fand – Dein Brief war viel zu kurz. Ich las ihn mehrere Male hintereinander … Du fragst, wie es mir geht. Eigentlich ein hübscher Ausdruck. Es »geht« mir nämlich irgendwie, »leben« kann man das nicht nennen …
Wir haben uns ungefähr vor einem Jahr zuletzt gesehen. Im Frühling war ich krank, Flecktyphus, rezidiv, das hat mich ans Bett gefesselt. Ich bin dabei fast draufgegangen und wurde im Sommer wieder krank. Ich weiß noch, daß ich Dir vor ungefähr einem Jahr geschrieben habe, daß ich manchmal für Zeitungen schreibe. Meine Feuilletons erschienen in mehreren kaukasischen Blättern. Im letzten Sommer bin ich laufend aufgetreten mit Erzählungen und manchmal Vorträgen. Und auch einige meiner Stücke sind aufgeführt worden. Am Anfang der Einakter »Selbstschutz«, eine Humoreske, und dann ein wer weiß wie hastig heruntergeschriebenes Drama, »Die Turbin-Brüder«, in vier Akten. Mein Gott, was habe ich nicht alles gemacht! Ich hielt und halte Vorträge über Literaturgeschichte […], ich spreche einleitende Worte und so weiter, und so weiter […].
Mein Leben ist mein Leidensweg. Ach, Kostja, Du kannst es Dir nicht vorstellen, wie gern ich Dich bei der Premiere der »Turbins« dabeigehabt hätte! Du kannst es Dir nicht vorstellen, wie schwer mir das Herz war, daß dieses Stück in einem Provinznest uraufgeführt wurde, daß ich mich um vier Jahre verspätet habe mit dem längst fälligen Auftrag, dem Schreiben.
Im Theater grölte man nach dem Autor und klatschte, klatschte … Als sie mich nach dem zweiten Akt auf die Bühne holten, trat ich mit gemischten Gefühlen an die Rampe. Mit gemischten Gefühlen sah ich in die geschminkten Gesichter der Schauspieler und in den tosenden Zuschauerraum. Und dachte: Nun ist mein Traum in Erfüllung gegangen … Aber so ganz anders: Statt einer Moskauer Bühne – ein Provinztheater, statt eines Dramas um Aljoscha Turbin, das ich in mir trug, ein eilig fabriziertes, unreifes Stück.
Das Schicksal treibt seinen Spott mit mir. […]
Aber ich beiße die Zähne zusammen und arbeite Tag und Nacht.
[…]
So geht es mir also.
Ich sitze hinter einem Schreibtisch, auf dem sich Manuskripte häufen … Zuweilen lese ich meine früher veröffentlichten Erzählungen (in Zeitungen! Zeitungen!) und denke: Und wo ist der Sammelband? Wo ist mein Ruf? Wo sind die verlorenen Jahre?
Ich arbeite beharrlich.
Ich schreibe einen Roman, das ist in der ganzen letzten Zeit das einzige Werk, das richtig durchdacht worden ist. Aber auch da das Unglück: ich widme mich dem individuellen Schaffen, während heute etwas ganz anderes an der Tagesordnung ist.
So geht es mir hinter den Kulissen, wo alle Schauspieler meine Bekannten, Freunde und Spießgesellen sind, der Teufel soll sie alle holen! Tassja war im Theater als Statistin beschäftigt. Jetzt ist die Truppe aufgelöst und sie arbeitslos.
Ich wohne in einem miesen Zimmer […]. Früher wohnte ich in einem guten, hatte einen richtigen Schreibtisch, jetzt habe ich keinen mehr und muß beim Licht der Petroleumlampe schreiben.
Wie ich gekleidet bin? Was ich esse? … Darüber zu schreiben lohnt nicht …
Was weiter?
Im Frühjahr oder im Sommer möchte ich Wladikawkas verlassen.
Wohin?
Es ist wenig wahrscheinlich, aber immerhin möglich, daß ich im Sommer auf der Durchreise nach Moskau komme.
Ich wünsche mich weit weg.
Ich erwarte Deinen Brief mit Ungeduld. Schreibe ausführlich. Wo lebst Du und wie? […]
Einen festen Kuß
Michail
P.S. Als Illustration meiner aufsehenerregenden und ruhmreichen Tätigkeit lege ich einen meiner zahlreichen Theaterzettel bei. Zur Erinnerung und für den Fall, daß wir uns nicht wiedersehen.
[…] In Wladikawkas bin ich in eine Lage geraten, wo es »weder vor, noch zurück« geht. Mein Wanderleben ist noch lange nicht zuende. Im Frühjahr muß ich entweder nach Moskau (vielleicht sehr bald) oder ans Schwarze Meer oder sonst irgendwohin … Laß mich wissen, ob Du eine Möglichkeit siehst, mich eine Zeitlang bei Dir aufzunehmen, falls ich nach Moskau kommen sollte. […]
Dein Michail
Für den Fall, daß ich für lange und weit verreisen sollte, bitte ich Dich um folgendes: In Kiew habe ich einige Manuskripte zurückgelassen […]. Ich habe Mama brieflich gebeten, sie aufzubewahren. Ich nehme an, daß Du in Moskau Wurzeln schlagen wirst. Laß diese Manuskripte aus Kiew kommen, sammle alles bei Dir und steck sie mit »Selbstsch.« und »Turb.« in den Ofen. Das ist meine eindringlichste Bitte …
Einen Kuß von Deinem Dich liebenden Michail
(P.S. […] Anbei einige Besprechungen und Programme. Falls ich verreise und wir uns nicht wiedersehen sollten, zur Erinnerung an mich.)
Liebe Wera,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Brief. […]
Ich bin sehr gerührt über Deine und Warjas guten Wünsche für meine literarische Arbeit. Ich kann es nicht ausdrücken, welche Qualen ich manchmal durchstehe. Ich denke, Ihr versteht das von selbst …
Ich bedaure, daß ich Euch meine Theaterstücke nicht schicken kann. Erstens ist es zu unbequem, zweitens sind sie nicht gedruckt, sondern in Schreibmaschinenabschriften und drittens sind sie alle Quatsch.
Es geht nämlich darum, daß mein Werk aus zwei scharf getrennten Teilen besteht: das Echte und das Abgerungene. […] Ach, wenn wir uns doch alle einmal sehen könnten! Ich würde euch etwas Komisches vorlesen. Ich träume davon, meine Lieben zu sehen. Wißt ihr noch, wie wir manchmal in Nr. 13 gelacht haben? […]
Einen Kuß von Deinem Dich liebenden Michail
Liebe Nadja,
eine Bekannte von mir, Olga Aristarchowna Mischon, wird nach Moskau kommen. Ich gab ihr einen Brief mit, in dem ich Dich bitte, unter meiner Wäsche das Beste und Nötigste herauszusuchen: und auch die weiße Hose und Tassjas Strümpfe und das weiße Kleid, und alles dieser Mischon mitzugeben, die nach Wladikawkas zurückkehren wird. […] Sollte sie eine bequeme Verbindung haben, dann gib ihr möglichst viel mit, wenn nicht, dann wenigstens ein kleines Päckchen. Ich brauche dringend Wäsche.
In der letzten Zeit schreibe ich weniger – ich bin übermüdet. […] Mit der Mischon keinerlei ärztliche Konversationen, auf die ich auch verzichte, seit ich mit der Naturwissenschaft fertig bin und mich der Journalistik widme. Mach das auch Konstantin klar. Er ist außerordentlich begabt für jede Art Lapsus.
Einen festen Kuß! Michail
Demnächst mache ich mich reisefertig. Wenn Sie es sich nicht anders überlegt haben, kommen Sie sobald als möglich. Ich würde mich freuen, einen solchen Reisegefährten wie Sie zu haben … Ich denke, daß Sie in nächster Zukunft Ihre Brüder wiedersehen werden …
Liebe Nadja,
heute reise ich nach Tiflis und Batum ab. Tassja bleibt einstweilen in Wladikawkas. Ich bin sehr eilig und fasse mich kurz. […]
Solltest Du mehr als ein halbes Jahr keine Nachricht von mir erhalten, gerechnet von dem Tag, da Du diesen Brief erhältst, wirf alle Manuskripte in den Ofen. […]
Sollte Tassja in Moskau auftauchen, so nimm sie wie eine Verwandte auf und stehe ihr in der ersten Zeit mit Deinem Rat zur Seite, solange ihre Lage sich noch nicht geklärt hat.
Einen Gruß an Konstantin. An alle. Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs bin.
Einen Kuß für Dich, liebe Nadja,
Michail
Meine lieben Kostja und Nadja,
ich lasse Tassja aus Wladikawkas nachkommen und ziehe mit ihr nach Batum, sobald sie da ist und sobald sich uns eine Gelegenheit bietet. Vielleicht finde ich mich eines Tages auf der Krim wieder …
»Die Turbins« schreibe ich zu einem großen Drama um. Deshalb in den Ofen damit. […]
Einen Kuß für alle! Wundert euch nicht über meine Wanderschaft, da ist eben nichts zu machen, es geht nicht anders. Was für ein Schicksal! Was für ein Schicksal! […]
Einen Kuß für alle! Michail
2 1921–1925
Das Moskau, in dem sich Bulgakow im September 1921 niederließ, war eine Stadt, die von sieben Jahren des politischen und gesellschaftlichen Durcheinanders erschöpft war. Die drei Jahre der Kämpfe während des Ersten Weltkriegs, die den Februar- und Oktoberrevolutionen vorangingen, hatten bereits deutliche Spuren im Land hinterlassen. Bürgerkrieg in verschiedensten Konstellationen bedeutete, daß die Kämpfe bis 1921