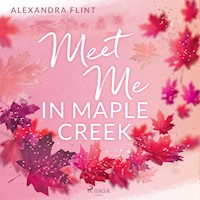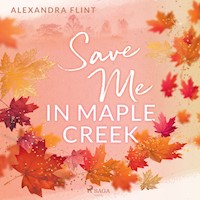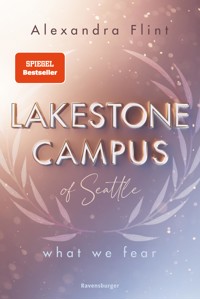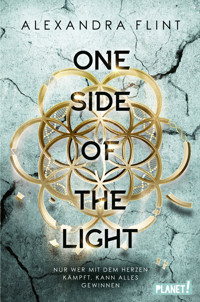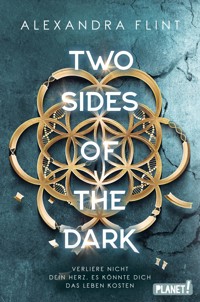Maple-Creek-Reihe, Band 1: Meet Me in Maple Creek (der SPIEGEL-Bestseller-Erfolg von Alexandra Flint) E-Book
Alexandra Flint
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Maple-Creek-Reihe
- Sprache: Deutsch
"Wer bist du?" "Ich bin derjenige, der dich in den Abgrund stürzen wird. Aber ich werde auch derjenige sein, der unten steht und dich auffängt." Plötzlich ist Miras Leben in Maple Creek nicht mehr so, wie es einmal war: Unerwartet steht ihr Zwillingsbruder vor ihr, von dem sie bisher nichts wusste. An seiner Seite ist sein bester Freund Joshka, dessen Narben Mira erahnen lassen, dass in seiner Welt in der New Yorker Untergrundszene andere Regeln gelten. Trotz aller Zweifel fühlt sie sich zu ihm hingezogen, und auch Joshka beginnt, seine harte Schale abzulegen. Doch seine Vergangenheit ist ihm wie ein Schatten nach Maple Creek gefolgt … Eine Leseprobe aus "Meet Me In Maple Creek": "Die plötzliche Sehnsucht nach ihr überkam mich mit so einer Macht, dass ich die Zähne zusammenbiss. Mira hatte vom Zauber dieser Stadt gesprochen – dabei war sie es. Sie war es die ganze Zeit gewesen. Wie ein Bann, mit dem sie mich belegt hatte und nicht mehr losließ. Und in diesem Moment wünschte ich mir nichts mehr, als mich dieser Magie hinzugeben. Doch ich hatte früh in meinem Leben gelernt, dass es nichts brachte, in Traumwelten zu wandeln. Sie waren nicht echt und zerstörten einen, bis nur noch Trümmer übrig blieben. Deswegen war ich ein Realist mit klaren Regeln geworden. Es wurde Zeit, dass ich diesen wieder folgte und mich am Riemen riss. Auch, wenn die Wirklichkeit beschissen und kalt und einsam war. Ein letztes Mal fuhr ich über Miras Haare, dann stand ich von ihrem Bett auf und verließ den Raum, ohne noch einmal zurückzublicken."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
TriggerwarnungDieses Buch enthält Themen, die potenziell triggern können. Hinten befindet sich ein Hinweis zu den Themen.ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.Als Ravensburger E-Book erschienen 2022Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag© 2022, Ravensburger VerlagText © 2022, Alexandra FlintDieses Werk wurde vermittelt durchdie Literarische Agentur Silke Weniger, Gräfelfing.Cover- und Umschlaggestaltung unter Verwendung von Motivenvon Adobe Stock (Aonprom Photo, millefloreimages)und Shutterstock (graphuvarov, Chim)Layout: Emely WenzelAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-51141-9ravenburger.com
Für meinen wundervollen Mann und besten Reisebuddy der Welt – ohne dich würde es diese Geschichte nicht geben.
»Die, die das Dunkel nicht fühlen, werden sich nie nach dem Lichte umsehen.« Henry Thomas Buckle
Playlist
Lost – Maroon 5
Greenback Boogie – Ima Robot
Start A Riot – BANNERS
Bad Habits – Ed Sheeran
Go Solo (feat. Tom Rosenthal) – Zwette, Tom Rosenthal
Cats In The Cradle – Ugly Kid Joe
Hold Me Like You Used To – Zoe Wees
Sword from the Stone – Gingerbread Mix – Passenger
Clocks – Coldplay
Fake It – Bastille
Stop This Flame – Celeste
Cheap Thrills (feat. Sean Paul) – Sia, Sean Paul
Because You Move Me – Tinlicker, Helsloot
I Follow – Loi
Drops of Jupiter (Tell Me) – Train
no body, no crime (feat. HAIM) – Taylor Swift, HAIM
Good Girls Gone Wild – Klaas
Wild Life – OneRepublic
Always – Gavin James
Wrecked – Imagine Dragons
Leap of Faith – Christopher
If I Didn’t Have You – Acoustic – BANNERS
Girls Like Us – Zoe Wees
KAPITEL 1
Letters in the Sky
Mira
Stille.
Es war so wunderbar still. Friedlich und ruhig, bis auf einen leichten Wind, der den Duft der Natur zu mir trug. Er fuhr durch das Blätterdach über mir, ließ es in den Ästen rauschen und verwirbelte die dunkelblonden Strähnen, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten.
Es war still – bis auf die kreisenden, lauten Gedanken in meinem Kopf. Dunkle Gedanken, Zweifel, die mich nicht mehr losließen und sich wie fiese Kletten mit Widerhaken in meinem Kopf festgesetzt hatten.
Dad würde das nicht tun. Er würde nicht …
Ich brachte diese Vorstellung erst gar nicht zu Ende, sondern schob sie resolut zur Seite, während ich gegen das Brennen in meinen Augen anblinzelte. Ein einzelner Sonnenstrahl brach durch die Bäume, als wollte mich die Natur daran erinnern, dass ich nicht allein war, auch wenn es sich gerade so anfühlen mochte. Seufzend lehnte ich mich nach hinten, stützte mich auf meine Arme und streckte mein Gesicht in Richtung Himmel.
Es waren Momente wie dieser, die mich immer wieder an diesen Ort zogen, den ich seit meiner Kindheit meinen magischen Ort nannte. Ich war als kleines Mädchen hierhergekommen, wenn ich mich mit Elias oder Tami, meinen besten Freunden, gestritten hatte, oder wenn bei meinem Dad Ben und mir der Haussegen mal wieder schief gehangen hatte. Was zugegeben auch heute noch ziemlich häufig der Fall war. Vermutlich, weil wir beide uns einfach zu ähnlich waren.
Jetzt, mit meinen neunzehn Jahren, trieb es mich an diesen Platz, wenn mir mein Studium über den Kopf wuchs, mir die Menschen um mich herum die Luft zum Atmen raubten, oder ich für einige Augenblicke eine Auszeit brauchte. Eine Auszeit von meinem Leben.
So wie jetzt.
Die Gründe, aus denen ich hierherkam, mochten sich geändert haben, aber der Zauber, der mich an diesem Ort wie eine warme Decke umgab, war der gleiche geblieben. Ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, das meine aufgekratzten Nerven beruhigte und den Druck von meiner Brust nahm.
Es war, als würde der spiegelglatte See, der den passenden Namen Mirror Lake trug, besänftigende Worte murmeln, die wie Balsam für meine Seele waren. Worte, die aus den Tiefen des Wassers zu mir kamen und von den Bergen, die den See im Norden einrahmten, widerhallten. Starke, uralte Ahornbäume säumten das Ufer und hielten ihre mächtigen Äste wie schützende Arme über den flachen Felsen, auf dem ich mich niedergelassen hatte. Überall um mich herum lagen ähnlich geformte Steine, ragten teilweise in den See hinein, als hätte ein Riese einen Sack gewaltiger Murmeln achtlos über die Landschaft verteilt. In der spätsommerlichen Sonne funkelten sie manchmal so, dass sie tatsächlich wie echtes Glas wirkten.
Ich hatte schon ganze Tage auf diesem Felsen verbracht. Vor mir der See, in dem sich die Berge spiegelten, hinter mir der Wald aus Ahornbäumen, der meiner Heimatstadt im Norden Oregons ihren Namen gab. Hier schien alles, was in Maple Creek auf mich wartete, meilenweit entfernt und belanglos zu sein. Als wären die Probleme und Konflikte dort nicht weiter von Bedeutung und würden schlichtweg nicht mehr existieren.
Und gerade heute wünschte ich mir nichts sehnlicher, als dass es wirklich so wäre. Dass dieser Ort die Macht hätte, Sorgen mit einem Fingerschnippen verschwinden zu lassen. Denn dann müsste ich nicht länger mit dem kämpfen, was mir heute Morgen den Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Dann könnte ich einfach nach Hause gehen, zurück in mein altes Leben, und so weitermachen wie bisher. Aber ich war alt genug, um zu wissen, dass Wünsche nur selten in Erfüllung gingen und einem oft nichts anderes übrig blieb, als sich mit der hässlichen Realität auseinanderzusetzen. Auch, wenn es schmerzhaft war. Auch, wenn man am liebsten aufgeben und für immer davonlaufen würde.
In meiner Tasche vibrierte etwas – und erinnerte mich daran, dass ich eigentlich nicht hier sein sollte, sondern in der Uni an der Seite meines besten Freundes. Nur hatte ich keine Ahnung, wie ich jetzt einfach zur Tagesordnung zurückkehren sollte, nachdem ich diesen verfluchten Brief in Dads Sachen gefunden hatte.
Der Sonnenstrahl, der eben noch mein Gesicht gewärmt hatte, verschwand hinter einer hellgrauen Schäfchenwolke. Kühler Wind frischte auf und ließ das Laub am Boden rascheln. Ein erster Vorbote für den Herbst, der bald in Oregon einfallen würde.
Wieder erklang ein drängendes Brummen, lauter dieses Mal und penetranter. Gut möglich, dass es mir auch nur so vorkam, weil sich der Zauber nach und nach verzog, während die Wirklichkeit ihre kalten Finger nach mir austreckte, um mich zurückzuholen.
Widerstrebend richtete ich mich auf, winkelte ein Bein an und zog meine Tasche auf den Schoß. Tami hatte sie mir bei einer unserer irren Shoppingtouren in Portland aufgeschwatzt mit der Begründung: Schätzchen, sie ist handgefertigt, aus veganem, weichem Leder, mit bunten Blumenstickereien und Innentaschen. Und es passt verdammt noch mal ein Buch hinein. Also nenn mir einen vernünftigen Grund, der gegen dieses Schmuckstück spricht.
Mit einem schiefen Grinsen hatte ich sie schließlich gekauft – auch wenn sie in meinen Augen viel zu teuer und in Anbetracht der Tatsache, dass meine Taschenschublade bereits überquoll, nicht unbedingt lebensnotwendig gewesen war. Aber einer Tamara McGivan schlug man eben nichts ab.
Mein Handy setzte zu einem dritten Klingeln an, als ich schließlich den Atem ausstieß und annahm.
»Wo zum Teufel steckst du, Mira?«
Ich kniff die Augen zusammen. Mist, er ist wirklich sauer. »Guten Morgen, Elias.«
Am anderen Ende der Leitung hörte ich ihn unzufrieden brummen. »Du weißt, was heute für ein Tag ist, oder? Ich stehe seit einer halben Stunde vor deinem Haus und warte auf dich. Was ist los?«
»Sorry, Eli. Ich habe die Zeit vergessen.« Was für eine bescheuerte Ausrede.
Ich sah meinen besten Freund förmlich vor mir, wie er ungehalten den Kopf schüttelte und sich dabei durch seine dunkelbraunen Wuschellocken fuhr. »Lügen konntest du noch nie. Geschweige denn, eine glaubwürdige Ausrede finden.«
»Manche würden sagen, gerade das sei etwas Gutes«, antwortete ich mit einem leisen Schnauben und griff nach meinem dunkelroten Strickpulli, den ich neben mich gelegt hatte. »Glaubst du mir zumindest, wenn ich dir verspreche, mich sofort auf den Weg zu machen?«
»Schwer zu sagen, aber ich hoffe es. Denn noch mal werde ich dir nicht aus der Patsche helfen.«
Entgegen meiner schlechten Laune und dem Chaos in meinem Kopf sprudelte mir ein trockenes Lachen über die Lippen. Der Druck auf meiner Brust wurde ein wenig leichter. Diese Wirkung hatte Eli schon immer auf mich gehabt. Seine ganz persönliche Superkraft.
»Natürlich würdest du mir helfen. Egal, wie sehr du dich auch dagegen sträubst. Das ist einer deiner Urinstinkte.«
»Ja, ja. Jetzt schwing endlich deinen hübschen Hintern hierher, Mira. Sonst grillt Professor Willingdale uns beide.«
Alles in mir sträubte sich dagegen, mein sicheres Versteck zu verlassen und mich der Welt da draußen – und damit unweigerlich auch meinem Dad und dem Brief – zu stellen. Aber Elias war mein bester Freund, und was ich gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Er würde mir immer helfen, ohne zu zögern für mich in die Bresche springen, also konnte ich im Gegenzug für ihn auch meine eigenen Dämonen zur Seite schieben. Zumindest für den Moment.
Ich schlüpfte in meinen Pulli, hängte mir meine Tasche über eine Schulter und sprang von dem großen Stein. Ein paar bunte Blätter wirbelten auf und raschelten unter den Sohlen meiner Ankle Boots, als ich mich in Bewegung setzte und dem schmalen Pfad durch den Wald folgte.
»Wir treffen uns bei mir. Ich bin in zehn Minuten da.«
»Besser in fünf. Bis gleich.« Dann hatte Eli auch schon aufgelegt.
Leise vor mich hin schimpfend, stopfte ich mein Handy in die Tasche und strich das cremefarbene Kleid, das ich unter dem Pullover trug, glatt. Mit einem wehmütigen Blick sah ich über die Schulter zurück zu meinem geheimen Ortund spürte, wie seine Magie verpuffte, während mich meine Schritte zurück in die Wirklichkeit führten.
Du hattest deine Auszeit, Mira, aber jede Auszeit hat ihr Ende.
Ich verzog das Gesicht und schob ein paar Äste zur Seite, ehe ich den Feldweg erreichte, auf dem ich meinen dunkelgrünen Jeep abgestellt hatte.
Zeit, sich der Realität zu stellen. Willkommen in deinem neuen Leben.
Ein paar Minuten später lenkte ich meinen Wagen mit klopfendem Herzen vor die Doppelgarage unserer Stadtvilla aus grauem, grobem Stein. Der Motor verstummte, genau wie das Radio, von dem ich während der Fahrt kaum etwas mitbekommen hatte, als ich den Schlüssel abzog und aufblickte. Dads Mercedes fehlte in der Einfahrt, was bedeutete, dass er schon in der Uni war und vermutlich genau in diesem Moment Schadensbegrenzung betrieb.
Großartig.
Meine Tasche in der einen, den Autoschlüssel in der anderen Hand, sprang ich aus dem Jeep und schlug die Tür unsanft hinter mir zu. Nur einen Herzschlag später kam Elias auch schon auf mich zu und wirkte alles andere als entspannt. Die Finger hatte er in seinen wilden Locken vergraben, während seine braunen Augen mir förmlich ein Loch in die Stirn brannten.
»Gerade heute, Mira! Wir reden seit Wochen von nichts anderem mehr als diesem einen Tag.«
Ich nickte, ein entschuldigendes Lächeln auf den Lippen, und spürte, wie mir das schlechte Gewissen sauer aufstieß.
Eli hatte recht. Wir hatten uns für diesen Tag beinahe zwei Monate lang den Hintern aufgerissen, gearbeitet bis zum Umfallen und unseren kompletten Sommer geopfert. Statt in der Sonne am See zu liegen, hatten wir jede freie Minute genutzt, um voranzukommen und etwas wirklich Großes auf die Beine zu stellen. Wir beide. Gemeinsam. Ihn hängen zu lassen, war eine miese Aktion gewesen. Das wusste ich selbst und ich bereute, dass es überhaupt so weit gekommen war, aber als ich heute Morgen den Brief gefunden hatte –
»Hallo? Mirella? Wo bist du bloß mit deinen Gedanken?« Eli schnipste vor meinen Augen und griff sanft, aber bestimmt nach meinen Schultern. »Du weißt, was heute alles auf dem Spiel steht, oder? Für uns beide.«
Etwas benommen blinzelte ich und nickte. Der Brief konnte – nein, er musste bis zum Abend warten. Ich würde Dad später darauf ansprechen und die Sache klären. Sofern man so etwas überhaupt klären konnte. »Es tut mir leid«, sagte ich, schluckte und kam mir dabei wie die größte Idiotin vor. »Meine Nerven … liegen blank. Das ist alles.«
Ungläubig zog Eli seine Augenbrauen zusammen und sah mich stirnrunzelnd an. »Du bist immer noch eine miese Lügnerin. Ist alles in Ordnung?«
Ich biss mir auf die bebende Unterlippe und nickte wieder bloß, unfähig, auch nur einen vernünftigen Satz zustande zu bringen.
Mein bester Freund ließ seine Hände von meinen Schultern gleiten und schüttelte den Kopf, ehe er mich ohne ein weiteres Wort in seine kräftigen Arme zog. Mit seinen eins neunzig war er gut eineinhalb Köpfe größer als ich und dank seines Einsatzes fürs Lacrosseteam unserer Uni muskulös und durchtrainiert. Normalerweise liebte ich seine Bärenumarmungen, doch in diesem Moment, in dem ich kläglich versuchte, meine Haltung zu bewahren, war sie alles andere als hilfreich.
»Mira, rede mit mir«, murmelte er an meinem Ohr, während er langsam über meinen Rücken strich.
Ich wollte es ihm sagen. Das wollte ich wirklich, weil ich ihm immer alles sagte. Wir hatten keine Geheimnisse voreinander – das hatten wir noch nie gehabt –, aber ich wusste, dass die Wahrheit in diesem Moment keinen Platz hatte. Nicht jetzt, wo wir uns voll und ganz auf unseren Vortrag konzentrieren sollten und keine Ablenkung gebrauchen konnten. Wir würden danach noch genug Zeit haben, über das zu sprechen, was ich heute in den Unterlagen meines Dads gefunden hatte. Über dieses eine dumme Stück Papier, das meine ganze Welt auf den Kopf gestellt hatte.
Später. Später. Später.
Ich musste es nur oft genug denken, dann würde ich ganz von selbst daran glauben. So war es doch immer.
Also holte ich tief Luft, setzte ein Lächeln auf und befreite mich aus seinen Armen. »Wirklich, es geht mir gut, Eli. Ich bin aufgeregt, habe Lampenfieber und mir ist wegen dieses bescheuerten Vortrags kotzübel, aber ansonsten ist alles in Ordnung.«
Sein Beste-Freunde-Röntgenblick fuhr ein weiteres Mal prüfend über mein Gesicht. Ich konnte die Skepsis in seinen haselnussbraunen Augen förmlich tanzen sehen und hoffte inständig, dass sie über mich hinweggleiten würde. Nur dieses eine Mal.
Nach einer kleinen Ewigkeit – zumindest kam es mir so vor –, in der ich unwillkürlich den Atem angehalten hatte, seufzte er schließlich und ließ von mir ab. »Das ist definitiv kein gutes Zeichen bei jemandem, der sonst nie nervös vor Präsentationen ist.«
Ich zuckte möglichst unbeschwert mit den Achseln und schob mir den Träger meiner Tasche über die Schulter. »Es geht ja auch um etwas, oder nicht?«
Noch einmal warf er mir diesen durchdringenden Blick zu, dann entspannten sich seine Züge endlich und sein typisches Lächeln kehrte zurück. Beinahe wäre mir ein Halleluja entfahren.
Gemeinsam liefen wir zu seinem Wagen, dem alten silbernen Honda Jazz seiner Mom, und waren wenig später auf der Hauptstraße. Sie führte einmal durch Maple Creek hindurch und war von ganz unterschiedlichen Lädchen, Bäckereien und Cafés gesäumt. Für einen Mittwochmorgen war es erstaunlich voll auf der Main Street, und wir mussten mehrmals abwarten, bis Fußgänger mit Taschen und Körben die Straße überquert hatten. In den ersten Schaufenstern erkannte ich schon Herbstdekoration, orange-rote Girlanden hingen in den Bäumen, die rechts und links auf den breiten Gehsteigen gepflanzt waren, und immer wieder sprang mir das bunte Plakat des Jahrmarkts entgegen, der in wenigen Wochen hier stattfinden würde. An den Straßenlaternen und über einigen Eingängen wiegte sich die Flagge unserer Stadt im leichten Wind. Ein orangefarbenes Ahornblatt über dem weißen Mirror Lake und die dunklen Berge im Hintergrund waren auf dem rotbraunen Stoff abgebildet.
»Ist deine Mom wieder beim Orga-Team für Fallington dabei?«
Keine Ahnung, wer irgendwann mal auf diesen glorreichen Namen für das Spektakel gekommen war, aber seit mittlerweile fünfundfünfzig Jahren war der Herbstmarkt mit seinen Attraktionen einer der Highlights des Maple Countys in Oregon. Und Maple Creek war zu Recht stolz auf das große Festival.
Elias warf mir einen kurzen Seitenblick zu und nickte. »Sie steckt seit Wochen in den Vorbereitungen. Ich bekomme sie noch weniger zu sehen als sonst. Sie lebt quasi auf dem alten Feld.«
»Macy ist auch die Beste, wenn es ums Organisieren geht. Ohne sie wäre Fallington nicht das, was es heute ist.«
Er lachte. »Lass sie das bloß nicht hören.«
Mit einem gemurmelten Fluch verstärkte er den Griff um das Lenkrad, als er ein weiteres Mal bremsen musste, während eine Gruppe älterer Damen seelenruhig über den Zebrastreifen wackelte. Es war unübersehbar, dass Elis Anspannung mit jeder Sekunde wuchs, die wir länger brauchten, um die Uni zu erreichen. Mir ging es da nicht anders – nur hatte meine Anspannung einen ganz anderen Grund.
»Mom glaubt schon jetzt, dass sie an jeder Stelle anpacken und überall auf dem Markt die Finger im Spiel haben muss, damit es ordentlich gemacht wird. Pete meinte, sie ist die reinste Glucke. Hütet ihr Ei wie einen goldenen Schatz und gibt nichts aus der Hand.«
Pete war Elias’ größerer Bruder und als Schreiner für den Aufbau der Hütten und Stände des diesjährigen Fallington zuständig. Ich konnte mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit Macy nicht einfach war. Sie war eine stadtbekannte Perfektionistin und machte weder halbe Sachen noch Ausnahmen, bis nicht alles genau so war, wie sie es sich vorstellte. Ihre akkurate Genauigkeit schien dabei nicht einmal vor ihrem ältesten Sohn haltzumachen.
»Treffender Vergleich«, kommentierte ich und hob einen Mundwinkel, als sich in meinem Kopf das Bild von Macy mit einem goldenen Ei in den Händen formte.
Mein bester Freund atmete mit einem leisen Seufzen aus und fuhr wieder an. Der schnellste Weg zum Campus war trotz Zebrastreifen und alten Herrschaften die Main Street, die an ein paar weiteren Lädchen und dem winzigen Kino vorbei aus dem Zentrum führte. Die Universität lag eine halbe Meile außerhalb, weswegen wir kurz nach dem Stadtkern den Creek überquerten, den wilden Fluss, der vom Mirror Lake kam und Maple Creek von Norden nach Süden durchlief. Auch hier säumten Ahornbäume die felsigen Ufer und bildeten zu beiden Seiten einen dichten Wald. Der Creek selbst war an dieser Stelle mehr eine Aneinanderreihung von Wasserbecken und kleinen Kaskaden, die sich wunderbar fürs Canyoningeigneten.
Elias lenkte den Honda auf die einspurige, dunkelgrüne Eisenbrücke, die über den Fluss führte, und fuhr im Schritttempo über die hölzernen Bohlen. An den Seitenspiegeln war jeweils nur knapp ein halber Meter Luft zu den verschnörkelten Geländern. Als eine der ältesten Brücken Nordamerikas war die Old Creek Bridge eines unserer wichtigsten Wahrzeichen und lockte jedes Jahr unzählige Touristen an. Ich hatte sie selbst schon viele Male fotografiert und liebte das Motiv, auch wenn mir das Knarren unter den Autoreifen jedes Mal eine Gänsehaut verursachte.
»Hast du dir die Mail, die ich dir gestern Abend geschickt habe, noch durchgelesen?«
»Du meinst die seitenlangen Anmerkungen von Ethan zu unserer Einleitung?« Fragend runzelte ich die Stirn.
Eli nickte. »Was hältst du davon?«
»Nichts. Wir bleiben bei unserem alten Konzept und lassen alles so, wie wir es mit Professor Willingdale durchgesprochen haben. Ethan mag Ahnung in der Forschung haben, aber er ist ein miserabler Redner. Ich schlafe regelmäßig bei seinen Vorträgen ein.«
»Ich bin froh, dass du das auch so siehst. So knapp vor unserer Präsentation hätte ich ungern noch etwas umgeschmissen. Selbst dann nicht, wenn die Vorschläge von ihm kommen.«
Ethan war der persönliche Assistent unseres Dozenten Professor Willingdale, der unsere Arbeit in den letzten Wochen betreut hatte. Ein Pilotprojekt und deswegen so ungeheuer wichtig für die Universität, den Prof, Eli und mich. Ein Grund mehr, warum ich meine Privatangelegenheiten, die lautstark in meinem Hinterkopf pochten, zurückstellen musste. Es stand zu viel auf dem Spiel: ein nachträgliches Vollstipendium für meinen besten Freund und mich, der Naturwissenschaftspreis der Westküste der USA und die Chance auf ein bezahltes Praktikum im weltweit größten Konzern für angewandte Forschung in Washington.
Eine ganze Menge.
Das alles konnte ich nicht einfach so riskieren, nur weil ich ein altes Schreiben gefunden hatte, von dem ich nicht einmal mit Sicherheit wusste, ob es wirklich das war, für das ich es im Strudel meiner Wut gehalten hatte. Dad und ich hatten keine Geheimnisse voreinander. Daran musste ich mich festhalten. Daran und an dem, was Elias und ich in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt hatten. Nur das zählte.
»Wir bekommen das schon hin, Mira. Ist ja nicht so, als hätten wir in den letzten Tagen irgendetwas anderes gemacht, als uns mit unserem Projekt zu beschäftigen. Wir rocken diese Präsentation und dann lassen wir es uns heute Abend im Cracked Pot gut gehen, was meinst du?« Eli stieß mich an und fuhr um ein Pärchen herum, das halb auf der Straße Selfies machte, ehe er wieder beschleunigte. »Oder hast du schon etwas anderes vor? Schließlich kommt Tami wieder.«
Der Name unserer quirligen besten Freundin reichte schließlich aus, um die grübelnde Stimme in meinem Kopf verstummen zu lassen. Ich hatte sie seit Wochen nicht gesehen und freute mich ungemein darauf, sie endlich wieder in die Arme schließen zu können.
»Hast du sie schon erreicht?«
»Nein, aber ich glaube, sie landet auch erst in einer halben Stunde in Portland.«
Tami war beinahe die gesamten Semesterferien in Florida bei ihrer Tante gewesen und hatte uns mit den schönsten Urlaubsbildern versorgt – gequält traf es wohl eher –, während Eli und ich nichts Besseres zu tun gehabt hatten, als die freie Zeit vor dem neuen Semester mit freiwilliger, unbezahlter Arbeit zu verbringen. Ein kleines bisschen hatten wir beide sie dafür gehasst, aber nur ein kleines bisschen und im besten Sinne der Freundschaft.
Das eindrucksvolle Hauptgebäude des Unicampus kam in Sicht und sorgte dafür, dass jeder Gedanke an Tami genauso schnell verschwand, wie er gekommen war. Stattdessen rückten der Vortrag und das nervöse Flattern meiner Nerven wieder in den Vordergrund. Zähneknirschend umklammerte ich meine Tasche fester.
Die Maple University of Oregon war eine Ansammlung von Gebäuden aus grauem Stein mit großen, weißen Fensterrahmen. Helle Säulen flankierten jeden Eingang, zu dem grob gehauene Treppenstufen führten, auf denen nicht ein trockenes Blatt lag. Unzählige Wege und kleine Plätze, die von Beeten und Holzbänken gesäumt waren, durchzogen den gesamten Campus, in dessen Mitte ein ovaler See lag. Gepflegtes, hellgrünes Gras war auf den Flächen zwischen den Gebäuden angelegt worden und auch hier dominierten alte Ahornbäume die Natur. In wenigen Wochen würden sie in einem kräftigen Orangerot leuchten. Für mich war der Campus in seiner Gesamtheit wunderschön. Es gab Türme und Erker, verspielte Giebel und spitze Dächer, die jedes Gebäude in ein historisches Kunstwerk verwandelten. Einer der Gründe, aus denen ich mich für diese Uni entschieden hatte, anstatt nach Harvard oder Yale zu gehen. Die MUO war allein optisch schon das reinste Paradies für eine Architekturstudentin.
Elias lenkte den Wagen zu dem größten der Gebäude, das der Administration, dem Direktor der Universität und der zentralen Verwaltung vorbehalten war. Dort befand sich außerdem die große Assembly Hall im Erdgeschoss, eine der vier Versammlungshallen und der Ort, an dem wir unsere Präsentation halten würden.
Der Motor und das leise Radio verstummten, als wir endlich in einer Lücke auf dem Parkplatz zum Stehen kamen.
»Mira, warte kurz.« Eli berührte mich sanft am Arm, als ich mich in Bewegung setzen wollte und hielt mich zurück. »Ich verstehe, dass du jetzt nicht mit der Sprache rausrücken willst – oder kannst –, mir geht auch der Arsch auf Grundeis, wenn ich an den Vortrag denke, aber ich hoffe wirklich, dass du danach mit mir sprichst. Ich kenne dich schon mein ganzes Leben, und ich sehe, wenn dir etwas auf der Seele liegt.«
Ich erwiderte seinen besorgten Blick und nickte seufzend. Dann schulterte ich meine Tasche und stieg aus. Über das Autodach hinweg schenkte ich ihm ein schwaches Lächeln, das es vermutlich kaum über meine Lippen hinaus schaffte. »Später, okay? Ich verspreche es.«
Eli neigte nur knapp den Kopf und schlug die Tür zu. Damit schien das Thema fürs Erste verschoben. Auf später. Langsam, aber sicher begann ich dieses kleine Wort zu hassen.
Im Eilschritt legten wir den restlichen Weg zum Oregon-Building zurück – jedes Gebäude hier war nach einem der Bundesstaaten von Amerika benannt. Wir hatten kaum die Eingangshalle mit der beeindruckenden Kuppel betreten, da stießen wir auch schon auf unser ganz persönliches Empfangskomitee. Es war ziemlich offensichtlich, dass weder die zwei Frauen im Kostüm und mit strengem Dutt noch die Männer in Anzug und Krawatte begeistert über unsere Verspätung waren. Elias versteifte sich neben mir merklich, als sich ihre Aufmerksamkeit auf uns richtete.
»Ms Aberdeen, Mr Morton, ich habe mich bereits gefragt, wann Sie beide hier auftauchen.« Professor Illman, Direktor unserer Universität und absoluter Pünktlichkeitsfanatiker – selbst mein Vater nannte ihn einen Korinthenkacker –, zupfte an den Manschettenknöpfen seines Sakkos herum und bedachte uns mit kühler Missbilligung auf den verkniffenen Zügen. Manchmal fragte ich mich, ob er überhaupt anders als unzufrieden schauen konnte. Neben ihm stand Professor Willingdale, der mindestens genauso unglücklich wirkte. Möglichst unauffällig wischte er sich einige Schweißtröpfchen von der Stirn und blickte immer wieder zwischen uns und den übrigen Anwesenden hin und her. Seiner Anspannung nach zu urteilen, mussten das die Vertreter der anderen Universitäten und des nationalen Forschungsausschusses sein.
Nur Dad, der rechts von Willingdale Stellung bezogen hatte, wirkte nicht, als stünde er kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Alles andere hätte mich auch ernsthaft überrascht, denn er hatte sich noch nie etwas aus Titeln gemacht. Mein Vater, Benedict Michael Aberdeen, berühmter Architekt und Ehrenmitglied des Rates der Maple University of Oregon, stand völlig entspannt mit den Händen in den Hosentaschen neben den Schlipsträgern und zwinkerte mir lächelnd zu, als wäre alles in bester Ordnung.
Unter normalen Umständen hätte ich das Zwinkern erwidert – das war so eine Sache zwischen Dad und mir –, aber jetzt konnte ich nur an diesen verdammten Brief denken. Ich musterte seine vertrauten Gesichtszüge, während ich mich fragte, ob er wirklich dazu fähig war, mir so etwas jahrelang zu verschweigen. Denn wenn ja, war absolut gar nichts in Ordnung.
»Wie dem auch sei, jetzt sind Sie ja hier. Darf ich Ihnen die Damen und Herren des Forschungsausschusses der Universitäten der Vereinigten Staaten vorstellen?« Illman gab irgendwelche hochtrabenden Titel zum Besten, bei denen er sich fast verhaspelte und über seine eigene Zunge stolperte. Mit leuchtenden Augen lobte der Dekan unsere Uni und Elias’ und meine Arbeit, sprach von unserem Engagement außerhalb der Vorlesungen und gab sich alle Mühe, unseren ersten Eindruck aufzupolieren. Vermutlich hätte ich ihn dabei unterstützen oder zumindest lächeln sollen, doch ich hörte kaum zu. Sah nicht einmal richtig hin. Meine Augen waren starr auf Dad gerichtet, bohrten sich in sein Gesicht, während sich die wenigen nüchternen Zeilen des Briefs wieder und wieder in meinem Kopf wiederholten. Nicht mehr als ein paar Sätze, die alles veränderten.
Als Dad meinen düsteren Blick bemerkte, runzelte er besorgt die Stirn und hob fragend eine Augenbraue, ein vorsichtiges Lächeln zupfte an seinen Mundwinkeln.
Ich presste nur wortlos die Lippen aufeinander und drückte meine Tasche fester an meine Seite, klammerte mich förmlich daran, während die Welt um mich herum zu schwanken begann. Meine Gedanken drehten sich immer schneller im Kreis und beschworen einen dicken Kloß in meinem Hals herauf, der mir die Luft zum Atmen nahm.
Er würde mir das nicht antun. Er ist mein Dad. Dad würde nicht … nicht bei mir, nicht bei so etwas … Würde er?
Ich ballte die Hände zu Fäusten und schluckte gegen den Kloß an.
Er würde es tun, wenn er glauben würde, es wäre das Beste für mich. Er. Würde. Es. Tun.
»Ms Aberdeen? Haben Sie gehört, was ich gesagt habe?« Professor Willingdales scharfe Stimme durchschnitt die Karussellfahrt in meinem Kopf und ließ mich zusammenzucken. Ich spürte eine Hand an meinem Arm – Elias – und riss meinen Blick von Dad los. Acht Augenpaare waren auf mich gerichtet und warteten darauf, dass ich irgendeine Reaktion zeigte, etwas Anstand, und mich entschuldigte, doch ich nahm sie kaum wahr. Es spielte keine Rolle. Ich konnte nicht vor diese Leute treten, einen Vortrag halten und so tun, als wäre alles in bester Ordnung. Als hätte ich diesen Brief nie gefunden. Ich war kein Roboter ohne Gefühle. Ich war ein Mensch, und es war absolut menschlich, dass ich das hier nicht mehr konnte. Dass ich eine Grenze erreicht hatte.
Ich wollte – ich brauchte – eine Antwort. Jetzt.
Ich schob das Kinn vor, blendete alle anderen um mich herum aus und fixierte meinen Vater. »Dad, wer ist Lilac?«
Mit einem Schlag wich jede Farbe aus seinen Zügen. Und diese stumme Reaktion sagte mir alles, was ich wissen musste.
Es stimmt. Jedes einzelne Wort dieses beschissenen Briefs stimmt.
Hier war sie also: die Gewissheit, vor der ich mich so sehr gefürchtet hatte.
»Mira …«
Kopfschüttelnd hob ich die Hände und machte einen Schritt rückwärts. Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen und jeden Moment umzukippen. »Nein, Dad, ich kann das jetzt nicht«, entgegnete ich heiser und kämpfte gegen die Tränen an.
Er wollte auf mich zukommen, doch ich hielt ihn mit einem warnenden Blick auf Abstand. Ich wollte jetzt keinen Trost, keine Entschuldigungen oder Ausreden. Ich wollte die Wahrheit. Ich wollte ihm ins Gesicht sehen und wissen, warum er mir das all die Jahre über verschwiegen hatte.
Ich schluckte und sog zittrig frische Luft in meine Lunge. »Sei nur dieses eine Mal ehrlich zu mir. Bitte. Wer ist Lilac und warum steht sein Name in meiner Geburtsurkunde neben meinem?«
KAPITEL 2
The Beginning of the End
Joshka
»Du bist irre. Absolut und vollkommen irre.« Ich schüttelte den Kopf und fuhr mir durch die Haare, die mittlerweile in alle Richtungen abstehen mussten. Der Wind, der durch das zugige Skelett des halbfertigen Hochhauses pfiff, tat sein Übriges. »Das ist bescheuert. Selbst für deine Verhältnisse. Hast du jetzt vollkommen den Verstand verloren, Lil?«
Einer der zwei Typen, die uns gegenüberstanden, gab ein belustigtes Hüsteln von sich und stieß feixend seinen dicklichen Partner neben sich an. Ich zog die Augenbrauen zusammen und schoss einen tödlichen Blick in Richtung dieser Idioten. Ich hatte mir erst gar nicht die Mühe gemacht, mir ihre Namen zu merken. Für mich waren sie nur weitere Beweise dafür, wie verkommen das geworden war, wofür ich mir jahrelang den Arsch aufgerissen hatte.
»Findest du nicht, dass das meine Entscheidung ist, Josh?«, entgegnete Lilac in gefährlich ruhigem Ton und wandte sich halb zu mir um.
Ich kannte diese Nuance in seiner Stimme und wusste, dass es unter der Oberfläche brodelte wie in einem Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch stand. Und ich wusste auch, dass ich der Grund dafür war. Wieder einmal.
Ich sah das Funkeln in Lilacs hellen Augen, seine angespannte Haltung, wie eine Bogensehne kurz vor dem Abschuss. Alles an ihm war eine stumme Warnung an mich, weil ich ihn vor diesen Typen aus unserer Szene vorführte. Ihn bevormundete und damit irgendeinen seiner verdrehten Pläne zunichtemachte. Mich interessierte das herzlich wenig. Das Einzige, das für mich eine Rolle spielte, war die Tatsache, dass sich Lil hier gerade kopfüber in einen Berg Scheiße manövrierte, der ihn das Leben kosten konnte.
Kosten würde. Und das würde ich nicht zulassen. Nur über meine Leiche.
»Wenn du diesen Climb machen willst, bitte, aber erwarte nicht, dass ich danebenstehen und zuschauen werde, wie du in den Tod stürzt«, erwiderte ich in demselben passiv-aggressiven Tonfall, hob herausfordernd eine Augenbraue und versenkte die Hände in den Hosentaschen meiner tief sitzenden, schwarzen Jeans. Meine Finger stießen auf die angefangene Zigarettenpackung und es juckte mich, mir eine anzustecken, aber mit all den Plastikplanen und den Chemikalien, die hier herumflogen, war mir das Risiko zu hoch. Und ich war kein Idiot – zumindest kein völliger. Mein Vater würde das vermutlich anders sehen. Er und der Rest der ganzen privilegierten Welt.
»Vielleicht solltest du auf ihn hören, Kleiner. Die Nummer ist etwas zu groß für dich. Komm in ein paar Jahren noch mal wieder.«
Das war vermutlich das Schlimmste, was der blonde Vollpfosten in dem viel zu großen Brooklyn-Bulls-Trikot hätte sagen können. Lilac mochte viele Macken haben, aber die Tatsache, dass er keiner Herausforderung widerstehen konnte – egal, wie idiotisch sie auch sein mochte –, war die gefährlichste von allen. Provokationen wie diese waren für ihn wie ein unberechenbarer Trigger, der ihn in eine tickende Zeitbombe verwandelte, und ich hatte schon oft genug miterlebt, was das aus ihm machte.
Unwillkürlich legte ich ihm eine Hand auf die Schulter und grub meine Finger warnend in seine Haut, doch Lil schüttelte mich mit Leichtigkeit ab und ging stattdessen auf die zwei Mistkerle zu. Ich wusste, dass er sich selbst verteidigen konnte. Wenn nötig, wäre er definitiv in der Lage, ihnen die Köpfe abzureißen, aber manchmal … manchmal vergaß ich einfach, dass er nicht mehr der kleine Junge von früher war. Dass Lilac mittlerweile ein junger Mann war, der seine eigenen Entscheidungen traf. Dumme, bescheuerte Entscheidungen, an denen ich nichts mehr ändern konnte. So sehr ich es mir auch wünschte.
Ich kannte uns beide gut genug, um zu wissen, dass ich diesen Kampf gegen ihn verloren hatte. Er würde diese Aktion durchziehen und mit großer Wahrscheinlichkeit daran scheitern. Ich sagte das nicht, weil ich Lil nicht vertraute oder ihm diesen Climb nicht zutraute. Ganz im Gegenteil: Ich wusste, dass mein kleiner Bruder ein Genie auf seinem Gebiet war. Ein Naturtalent, das hatte ich schon beim ersten Training gesehen, zu dem ich ihn vor elf Jahren geschleift hatte. Aber die Brooklyn Bridge? Das war der mit Abstand gefährlichste Climb in New York City. Eher ein Gedankenexperiment in den Köpfen der Leute aus der Parkour-Szene als eine wirkliche Aktion, die man durchzog. Das war quasi unmöglich.
Ich musste es wissen, denn ich hatte es versucht und war gescheitert. Es hatte mich zerlegt und es würde auch Lilac zerlegen. Die Brücke würde ihn zerlegen und wenn nicht sie, dann die Cops, und dieses Mal würde ihn nicht einmal mein Dad raushauen können, egal, auf welchen Deal ich mich mit ihm einließ. Nicht einmal meine wertlose Seele, auf einem Silbertablett serviert, könnte daran etwas ändern, denn der Daddy-regelt-das-schon-irgendwie-Zug war definitiv abgefahren.
Lil baute sich, wenn überhaupt möglich, noch bedrohlicher vor den zwei Idioten auf. »Sagt Cam, dass ich dabei bin. Halb zehn heute Abend. Und trommelt ordentlich Leute zusammen. Ich werde Geschichte schreiben.«
Die Typen, die Cam – seit ein paar Monaten der neue Obermacho im Untergrund New Yorks – geschickt hatte, um diesen Climb unter Dach und Fach zu bringen, stießen sich lachend an. Der Dicke verschluckte sich dabei fast an seiner eigenen Spucke, und ich spürte, wie mir langsam, aber sicher der ohnehin erschreckend dünne Geduldsfaden zu reißen drohte. Für sie war Lilac nur ein Witz. Es war ihnen scheißegal, dass er sein Leben aufs Spiel setzte, solange sie nur etwas zu sehen bekamen und die Taschen des Untergrunds durch die Wetten und Deals, die beim Climb abgeschlossen werden würden, füllen konnten. Ihr Verhalten, ihre ganze Existenz widerten mich an und mein Verlangen, ihnen ihr dämliches Lachen aus den Visagen zu prügeln, stieg ins Unermessliche.
»Oh-oh, jetzt nimmt der kleine Scheißer den Mund aber ganz schön voll. Hast du deine letzte Blamage denn schon verarbeitet? Cam amüsiert sich immer noch gerne über deinen Reinfall, Lilly.« Der Blonde im Trikot tat, als würde er sich eine Träne wegwischen und grinste breit.
Das reichte. Ich stellte mich einen Schritt vor Lilac und schob die Ärmel meines dunklen Hoodies hoch. So, dass man die Striche auf meinen Unterarmen sehen konnte. Diese Typen kannten mich und wussten, was alles auf meine Kappe ging. Was ich für meine damalige Stellung und meinen Ruf getan hatte. Dass ich im wahrsten Sinne des Wortes über Leichengegangen war. Ich selbst hatte nie getötet, aber das bedeutete im Umkehrschluss nicht, dass ich unschuldig war. Ganz im Gegenteil, ich hatte meine Liste. Trug sie auf meinem Körper. Linien, die für all die Namen standen, deren Leben ich zerstört hatte. Keine schöne Sache, wenn ich ehrlich war, aber wenn sie dazu beitrug, dass diese Mistkäfer lernten, wo ihr Platz war, dann waren die vielen Stunden vor Gericht, in Haft und bei der Sozialarbeit doch zumindest für eines gut gewesen.
Ein dunkler Anflug von Genugtuung durchzuckte mich, als ich die aufkeimende Furcht in den Augen der Idioten wahrnahm. Kluge Mistkäfer.
»Ihr habt Lil gehört. Der Climb steht. Und jetzt verzieht euch.«
Der Trikot-Typ hob abwehrend die Hände und nickte. »Ja, ja. Mann, schon gut. Lil, pfeif deinen Wachhund zurück.«
Lilacs Kiefermuskulatur arbeitete – ich meinte sogar seine Zähne knirschen zu hören –, dann stellte er sich wieder neben mich. Ich spürte die Missbilligung förmlich in Wellen von ihm abstrahlen. Jap, er war ziemlich wütend auf mich.
»Verpisst euch«, knurrte er und verschränkte die Arme vor der Brust.
Die zwei wechselten einen kurzen Blick und bleckten die Zähne wie Hunde in einem Kampf, in dem ihnen nicht viel mehr übrig blieb als zu bellen, weil sie nicht mehr beißen konnten. Wäre die Situation nicht so angespannt gewesen, hätte ich über sie gelacht.
Das sollen Cams beste Leute sein? Der Laden hat definitiv abgebaut.
»Vergiss die Startgebühr nicht, Kleiner. Und deine Windel. Hab gehört, es ist verdammt hoch auf der Bridge und man scheißt sich schneller ein, als man Good Old America sagen kann«, rief uns der Dicke über seine speckige Schulter zu. Dann drehten er und sein minderbemittelter Kumpel endlich ab und verschwanden über die nackte Betontreppe aus unserem Blickfeld.
Ich stieß meinen Atem mit einem gemurmelten Fluch aus und zerrte mir das schwarze Tuch von Mund und Nase, mit dem ich mein Alter Ego Tomber von Joshka trennte. Keine Ahnung, wie lange ich ihnen noch tatenlos gegenüber hätte stehen können, bevor ich dem Drang nachgegeben hätte, sie persönlich von den Gerüchten, die sich um mich rankten, zu überzeugen.
»Wann zum Teufel wirst du endlich damit aufhören, dich ständig in meine Angelegenheiten einzumischen?!« Lil stieß mich so fest vor die Brust, dass ich einige Schritte zurücktaumelte, und ballte die Hände zu Fäusten, als wollte er mich schlagen. Ich wusste, er würde das nie tun. Er war kein Schläger, nicht so wie ich, aber ich spannte trotzdem alle Muskeln an und biss die Zähne aufeinander.
Seine grünen Augen sprühten förmlich Funken, und auch wenn er knapp vier Jahre jünger war als ich, wirkte er in diesem Moment keineswegs wie der kleine Junge, den ich vor fast elf Jahren als meinen Bruder unter meine Fittiche genommen hatte. Ganz im Gegenteil. Der alte Hass in ihm kochte höher denn je. Ein Grund mehr, ihm entgegenzuwirken, bevor er wieder außer Kontrolle geraten konnte.
Ich lockerte meine Haltung, zupfte betont gelassen meinen Hoodie zurecht und zuckte mit den Schultern. »Wenn du aufhörst, dich wie ein hirnloser Arsch zu verhalten, denke ich vielleicht noch mal darüber nach. Du weißt, was Cam mit dieser Scheiße erreichen will. Dass es nicht nur um den Climb geht.« Der war schon schlimm genug, doch viel gravierender war, dass er nur als Tarnung diente. Ein illegales Event, das zum Umschlagpunkt der dunklen Geschäfte des Untergrunds wurde.
Lil fluchte und fuhr sich über das Gesicht. Aber immerhin verschwand das Lodern wieder aus seinen Augen. »Ich dachte, wir hätten das geklärt? Ich weiß, was ich tue und ich bin gut darin, okay? Ich packe das!«
»Schon klar. Das weiß ich, aber auch du hast Grenzen und die Brooklyn Bridge ist definitiv eine davon.«
»Das kannst du nicht wissen«, spuckte er mir sofort entgegen. »Nur, weil du gescheitert bist, heißt das nicht, dass ich es auch verkacken werde. Also lass deinen Frust nicht an mir aus. Ich bin nicht du, Joshka.«
Frieden hin oder her, das hier ging in die falsche Richtung und war ein Schlag unterhalb der Gürtellinie.
Ich überwand die Distanz zwischen uns, sodass uns nur noch wenige Zentimeter voneinander trennten. Wind fuhr durch das noch nicht fertiggestellte Hochhaus, in dem wir uns befanden, und fegte mir einige Strähnen meiner dunkelblonden Haare in die Stirn. Unwirsch wischte ich sie zur Seite. »Du bist ein noch größerer Idiot, als ich dachte, wenn du glaubst, das hier hätte irgendetwas mit meinem verletzten Stolz zu tun. Ich bin damals fast draufgegangen, Lil. Hast du das vergessen? Ich will nicht, dass du das Gleiche durchmachen musst, aber ich kann dir versprechen, dass du das wirst, wenn du diesen Climb annimmst.«
»Ich bin besser als du. Das hast du selbst gesagt.«
Frustriert senkte ich den Kopf und kickte einen kleinen Betonbrocken zur Seite. Ich war damals durch die Hölle gegangen, wieder und wieder, und Lil war mir zu wichtig, um ihn blindlings in die gleiche Scheiße laufen zu lassen. Auch wenn ich die Befürchtung hatte, dass ich in dieser Hinsicht längst auf verlorenem Posten kämpfte. Mal wieder. Es hatte mich Jahre und viele meiner Nerven gekostet, überhaupt so nahe an Lilac heranzukommen, um einen winzigen Blick auf das werfen zu können, was unter seiner unbeherrschten, harten Schale lauerte. Bis heute verstand ich kaum, was in ihm vor sich ging. Er war ein Buch mit weitaus mehr als sieben Siegeln und manchmal wusste ich nicht, warum ich mich seiner überhaupt angenommen hatte. Vielleicht, weil ich eine Aufgabe gebraucht und vielleicht auch ein Stück von mir selbst in diesem dürren Jungen gesehen hatte, den das Leben so achtlos zerquetscht hatte. Was auch immer es letztlich gewesen war, ich fühlte mich für ihn verantwortlich. Tat es jetzt, und wahrscheinlich würde es auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch so sein. Und dabei spielte es keine Rolle, dass in unseren Adern nicht das gleiche Blut floss und die Straße uns zusammengebracht hatte.
Ich atmete langsam ein und aus, ehe ich ihn wieder ins Auge fasste. Seine wütende Miene, die hellbraunen Haare, die unter seiner Cap hervorlugten, die zu weiten Klamotten mit den Löchern, dort, wo das Training sie zerschlissen hatte. Ich sah seine breiten Schultern, die kräftigen Muskeln und die sichtbaren und unsichtbaren Narben, die ihm das Schicksal verpasst hatte. Ich sah Lilac. Meinen kleinen Bruder, für den ich durch jede Hölle gehen würde. Auch, wenn es ihm nicht in den Kram passte.
»Du bist gut. Sehr gut. Und aus diesem Grund werde ich die Quali-Gebühr nicht zahlen. Nicht dieses Mal.«
Sein Atem entwich mit einem lauten Zischen. »Du bist ein Arschloch, Josh.«
Meine Lippen verzogen sich zu einem freudlosen Grinsen, als ich mit den Schultern zuckte. »Und wenn schon. Das ändert nichts an meiner Einstellung. Also hör auf, dich wie ein Kleinkind zu benehmen und blas die Sache ab, bevor es zu spät ist und sie dir um die Ohren fliegt.«
»Das kann ich nicht, und das weißt du auch. Du kennst die Regeln, schließlich hast du einen Großteil davon selbst gemacht.« Lil ließ seine Fingerknöchel knacken und zog dann sein Handy hervor. »Ich treibe das Geld schon auf. Auch ohne dich. Ich bin nicht auf dich angewiesen.«
Die Bitterkeit in seinen Worten ließ mich resigniert die Augen schließen.
»Lil …«, begann ich und wusste mit einem Mal nicht mehr, was ich sagen sollte. Vermutlich war es auch egal. Er hatte seine Position bezogen und würde keinen Rückzieher machen. Das hatte er in all den Jahren, die ich ihn nun schon kannte, noch nie getan. Manchmal glaubte ich, dass sein Starrsinn und seine Entschlossenheit, für das zu kämpfen, was er sich in den Kopf gesetzt hatte, die einzigen Gründe waren, aus denen er noch am Leben war.
»Mach dir keine Mühe. Wir sehen uns. Oder auch nicht«, murmelte er, tippte etwas ins Handy und sprang dann mit zwei großen Sätzen die Treppe runter.
Ich hörte, wie seine alten Turnschuhe dumpf auf dem groben Beton aufkamen. Und während sich seine Schritte entfernten, blieb ich allein zurück und verfluchte ihn. Ich verfluchte Lilac, das elende New York, die ganze Welt. Aber am allermeisten verfluchte ich mich selbst.
Um mich herum waren unzählige Jogger, Leute, die ihre Hunde ausführten, und Obdachlose, die ihre Nacht auf einer der Bänke verbringen würden und sich schon jetzt den besten Schlafplatz sicherten. Trotzdem fühlte ich mich mitten im belebten Central Park einsam. Vermutlich schaffte es nur ein wirklich verkorkster Mensch, sich in einer der überfülltesten und lautesten Städte der Welt einsam zu fühlen. Wäre diese Tatsache nicht so düster, hätte ich gelacht. Aber in diesem Moment war mir nicht nach Lachen zumute, denn ich wusste, was dieses Gefühl bedeutete. Ich kannte diese Leere, diese Kälte in meinem Inneren. Sie war wie ein stetiger Begleiter, eine stumme Erinnerung an alles, was ich bereits erlebt und getan hatte. Und eine Warnung, dass ich im Begriff war, eine Grenze zu überschreiten, nach der es kein Zurück mehr geben würde. Die Frage war nur, ob ich dieses Mal auf meine innere Stimme hören würde.
In meinem bisherigen Leben hatte ich mir im wahrsten Sinne des Wortes Stück für Stück meine Seele herausgerissen, bis nichts mehr davon übrig gewesen war. Mein Gewissen zum Teufel gejagt, mich selbst mit jeder Tat mehr zerstört und war schließlich zu der Person geworden, die ich nun war. Ich war nicht besonders stolz darauf, aber ich hatte gelernt, damit umzugehen. Irgendwie. Manchmal gab es sogar Augenblicke, in denen sich die Dunkelheit für ein paar wertvolle Sekunden zurückzog und mich in Frieden ließ. Momente, in denen ich einfach nur dankbar war und beinahe so etwas wie Glück verspürte.
Glück darüber, dass ich noch lebte, obwohl ich dem Tod unzählige Male ins Gesicht gesehen hatte.
Glück darüber, dass ich eine Familie hatte – auch, wenn sie noch so kaputt war und nicht wusste, wer ich wirklich war.
Und Glück darüber, dass mich irgendeine abgedrehte Fügung in dieser einen Nacht damals zu Lilac geführt hatte.
Aber diese Augenblicke waren selten, winzig, wie ein doppelter Sechser im Lotto, und ich war auf dem besten Weg, auch die letzten verbliebenen Momente unwiederbringlich zu zerstören. Vielleicht sogar mutwillig. Einfach, um nicht mehr so tief zu fallen, wenn ich in der kalten Realität erwachte.
Ich zog mir die Kapuze meines Hoodies tiefer in die Stirn und versenkte die Hände in der Tasche meines Pullovers, ehe ich mich wieder in Bewegung setzte. Ich spürte die skeptischen Blicke der Passanten auf mir kribbeln und wich ihnen so gut es ging aus, während ich immer weiter nach Norden lief. Weg von dort, wo Lilac in ein paar Minuten sein Leben auf Spiel setzen würde. Es war fast halb zehn, und ich hatte möglichst viel Abstand zwischen die Brooklyn Bridge, sein hirnverbranntes Vorhaben und mich gebracht. Auch, wenn es mich innerlich zerriss und die Finsternis nur weiter anstachelte. Aber ich wollte nicht dort sein, wenn Lilac versagte. Wollte nicht mitansehen müssen, wie er an sich selbst und diesem Climb scheiterte, von der Polizei abgeführt oder, schlimmer noch, von einem Krankenwagen weggebracht wurde. Ich konnte das ganz einfach nicht. Vielleicht machte mich das zu einem Feigling oder einem Heuchler, weil ich einem kleinen Jungen vor einer scheinbaren Ewigkeit gesagt hatte, dass ich immer auf ihn aufpassen würde. Dass ich ihn beschützen und an seiner Seite sein würde, egal, was auch passierte.
Fuck.
Ich kam abrupt neben einer Bank zum Stehen und hob den Kopf. Eine junge Frau sprang bei meinem Anblick instinktiv auf und flüchtete in die entgegensetzte Richtung, als würde sie sich vor mir fürchten.
Gut so. Ich war gefährlich. Ich zerstörte. Und Menschen taten gut daran, sich von mir fernzuhalten. Diejenigen, die mir zu nahegekommen waren, hatten sich nicht nur ein bisschen an mir verbrannt. Von ihnen war nach der Begegnung mit mir schlichtweg nichts mehr übrig gewesen und die, die geblieben waren und es überlebt hatten …
Lilacs wütendes Gesicht schob sich vor meine Augen, der Ausdruck, mit dem er mich bedacht und die Anspannung, die in seinen Gliedern gezittert hatte. Herrgott noch mal, er war nicht bei der Sache. Er war es bei der Abklärung des Climbs mit Cams Lakaien nicht gewesen und er würde es bei der Aktion auf der Bridge auch nicht sein. Das bedeutete seinen sicheren Tod. Ich kannte ihn und wusste, wie er an Parkour heranging, seine Philosophie dahinter und seine mühelose Art, Hindernisse zu überwinden. Für ihn war es nicht nur ein Sport, es war seine Lebenseinstellung, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen war. Etwas, das ihn aufrecht hielt, wenn ihn alles andere niederdrückte. Doch dieser Lilac war nicht derselbe, den ich heute auf der Baustelle vor mir gehabt hatte.
Kopfschüttelnd fixierte ich den Weg vor mir, der weiter in den Central Park hineinführte. Weiter weg von meinem Bruder, der Bridge, dem Climb, dem wohl größten Fehler, den er je begehen würde. Ich hatte ihm geschworen, auf ihn aufzupassen, ihn niemals im Stich zu lassen und über ihn zu wachen. Jahrelang hatte ich das getan. Hatte ihn vorwärtsgebracht, ihm gezeigt, dass es genügend andere Möglichkeiten für ihn gab, auch wenn das Glück nie auf seiner Seite gestanden hatte. Dafür hatte ich ihm den Rücken freigehalten. Immer. Ich zerstörte alles und jeden um mich herum, aber Lilac, den hatte ich nicht zerstört. Wir hatten einander überlebt und waren an der Gegenwart des anderen gewachsen. Ich hatte ihm auf die Beine geholfen, er hatte dasselbe für mich getan – auch, wenn ich das ihm gegenüber wahrscheinlich niemals offen zugeben würde.
Trotzdem war es die Wahrheit.
Der kleine Junge hätte die Nacht damals ohne meine Hilfe nicht überstanden, aber vermutlich wäre ich in den letzten Jahren genauso draufgegangen, wäre er nicht Teil meines Lebens gewesen. Und mit ihm die Aufgabe, ihn zu schützen. Sie hatte mich auf Kurs gehalten, wenn ich alles zum Teufel gejagt hatte. Sie hatte mich dazu gebracht, es besser machen zu wollen. Lil war stark genug gewesen, um bei mir bleiben, mich aushalten zu können, und er war auch jetzt stark genug. Aber nicht für das. Nicht für die Brooklyn Bridge.
Ich würde das nicht zulassen. Ich konnte und durftedas nicht zulassen. Oft genug hatte ich weggeschaut, weil es einfacher gewesen war. Doch dieses Mal würde ich nicht wegsehen. Nur über meine Leiche. Das war ich ihm und mir selbst schuldig.
Ich griff in die Hosentasche, fand mein iPhone und zog es hervor. Ohne darüber nachzudenken, wählte ich den Notruf und tat etwas, das mir Lil niemals verzeihen würde, sollte er jemals dahinterkommen.
»Notruf. Was kann ich für sie tun?«
Ich schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. »Auf der Brooklyn Bridge findet gleich ein illegaler Climbstatt. Und Tomber wird auch dort sein.«
Ohne auf eine Antwort zu warten, legte ich auf, zog die SIM-Karte aus meinem Handy und zertrat sie unter meiner Schuhsohle. Dann machte ich kehrt und lief in die entgegensetzte Richtung. Nach Süden. Zur Brücke.
Irgendwo heulten Sirenen auf und hallten in den Hochhäuserschluchten wider und ich betete, dass ich nicht längst zu spät war.
DAMALS
Just a Little Kid
Lilac, 10 Jahre, New York City
Ich drücke fester. Immer fester, aber es macht keinen Unterschied. Ich höre sie und ich höre ihn.
Ich höre ihre Schreie, ihr Wimmern, ihr Flehen und das Donnern seiner Stimme. Ich höre alles.
Irgendetwas kracht und die papierdünnen Wände erzittern. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis dieses Loch, in dem wir wohnen, zusammenbricht, und ob es so schlimm wäre, wenn mir das Dach jetzt einfach auf den Kopf fallen würde. Macht doch eh keinen Unterschied, wenn wir darunter begraben werden. Niemand vermisst mich und niemand vermisst Mommy. Wir sind Dreck. Mehr nicht. Höchstens das, was unter den Schuhen irgendwelcher Bonzen klebt, keinen Blick wert. Das habe ich früh gelernt und werde es ganz sicher nicht mehr vergessen. Er hat es schließlich oft genug gesagt. Es immer wieder in mich reingeprügelt. Ich bin gebrandmarkt und ich bin Dreck und es wird niemand kommen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Ich glaube ihm. Ich habe aufgehört, auf etwas zu hoffen, das sich niemals ändern wird.
Das stinkende, abgenutzte Kissen auf meinen Kopf gedrückt, sodass sich der letzte verbliebene Knopf in meine Haut bohrt, schließe ich die Augen. Das winzige Zimmer, eher eine versiffte Abstellkammer, in der ich schlafe, verschwindet, aber die Geräusche bleiben.
Ich höre das Klatschen, mit dem seine Hand auf meiner Mom landet, habe es vor Augen, ohne es sehen zu müssen. Das brauche ich nicht mehr, dafür habe ich es schon zu oft miterlebt. Habe es zu oft selbst gespürt. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Wie sehr es brennt. Deswegen bin ich hier oben. Weil ich feige bin. Ein kleines, feiges Arschloch, würde er sagen, mit einem schmierigen Grinsen im Gesicht, den fettigen, hellblonden Haaren und den versoffenen, aufgedunsenen Zügen. Dabei würde er sich an den Eiern kratzen und über die widerlichen Lippen fahren.
Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr, dass es mir Angst macht und dennoch bleibe ich hier. Verkrieche mich, anstatt das Messer, das mir Josh zugesteckt hat, zu benutzen. Ich weiß, er hat es mir nicht gegeben, um jemanden umzubringen, sondern um mich zu verteidigen, aber ich kann den Gedanken, die Klinge in den fetten Bauch dieses Bastards zu stoßen, nicht verdrängen. Genauso wenig wie das Schluchzen meiner Mommy.
Meine Finger krallen sich in das Kissen, fester und fester, aber es ändert nichts. Die Bilder von meiner Mom bleiben, er bleibt und das, was er mir angetan hat. Wieder und wieder. Es ist, als würde ich seine Finger noch immer auf mir spüren, seine heißen Zigarettenstummel, die mir die Haut versengt haben, die Scherben, die er mir ins Fleisch getrieben hat.
Ich sehe das Messer, höre es nach mir rufen, während Mom unten nach mehr Drogen bettelt und sich dafür verkauft. Ich beiße die Zähne zusammen, ziehe die Beine an die Brust, mache mich ganz klein und versuche, das alles zu verdrängen.
Herrgott noch mal, Knirps, du bist noch ein Kind, okay? Niemand erwartet von dir, dass du die Welt rettest. Schon gar nicht deine Mutter. Die kannst du nicht mehr retten. Nur noch dich selbst, also bleib verdammt noch mal am Leben!
Joshs Stimme rauscht durch meinen Kopf, vermischt sich mit Moms weinerlichem Flehen und den derben Ausdrücken des Mistkerls.
Mein Schädel dröhnt, droht jeden Moment zu platzen. Ich presse das Kissen noch fester auf meinen Kopf.
Ich bin nie ein Kind gewesen!
Ich habe ihm diese Worte ins Gesicht geschleudert, obwohl ich kaum weiß, was sie bedeuten. Als wäre das Josh nicht auch so klar. Als wüsste er nicht, wie mein Leben aussieht. Er weiß fast alles. Fast. Er weiß von Mom, von dem Arschloch, von dem Drecksloch, das ich mein Zuhause nenne. Von dem, was ich tun muss, um zu überleben.
Etwas fliegt gegen die Wand, Glas klirrt und Mom schluchzt auf. Mein Herz zieht sich zusammen.
Warum bin ich noch hier? Warum verschwinde ich nicht einfach?
»Du hast nichts, Jane, und dein dreckiger Körper interessiert mich nicht mehr!«, höre ich den Bastard brüllen.
Wieder zittern die Wände. Wieder erschaudere ich, denn ich weiß, was jetzt kommt und ich fürchte mich davor. Fürchte mich so sehr, dass mir die Tränen kommen. Dass ich mir beinahe in die Hose mache, wie ein kleiner Scheißer.
Herrgott noch mal, du bist noch ein Kind.
»Mein Sohn. Ich habe noch meinen Sohn«, sagt meine Mom, bietet mich an. Ich sehe sie förmlich vor mir, wie sie die Beine des Drecksacks umklammert und fleht. Um Drogen bettelt, das Einzige, das sie am Leben hält und gleichzeitig immer mehr auslöscht.
Josh hat gesagt, dass Drogen Teufelszeug sind. Dass meine Mommy nicht meine Mommy ist, wenn sie Drogen nimmt und nicht weiß, was sie tut. Ich liebe meine Mom, deswegen hoffe ich, dass Josh recht hat. Dass sie nicht weiß, was sie mir antut.
In mir wird alles ruhig, erstarrt, als ich sein finsteres Lachen höre. Und weiß, was es bedeutet.
Dann wird meine Tür aufgerissen, Licht blendet mich und dagegen zeichnet sich das schlimmste Ungeheuer ab, das ich je zu Gesicht bekommen habe.
KAPITEL 3
Welcome to My Broken Boulevard
Mira
Was zum Teufel …?
Was zum Teufel hatte ich mir dabei gedacht, dieses Thema kurz vor einem der wohl wichtigsten Vorträge meiner noch jungen Karriere anzusprechen?
Warum hatte ich nicht einfach den Rand gehalten, anstatt Elis und meine Arbeit mit diesen wenigen Worten zunichtezumachen?
Warum hatte ich meinen Drang, immer auf alles eine Antwort zu bekommen, nicht ein einziges Mal runterschlucken können?
Aber die wohl noch viel wichtigere Frage war: Was zum Teufel hatte sich Dad dabei gedacht, mich neunzehn Jahre lang zu belügen? Neunzehn Jahre.
Ich zog die Beine an und legte meinen Kopf auf die Knie. Kniff die Augen so fest zusammen, dass kleine bunte Punkte davor zu tanzen begannen, die im extremen Kontrast zu der wirbelnden Dunkelheit in mir standen. Vielleicht würde das ja alles verschwinden, wenn ich es mir nur lang genug einreden und mich in der Finsternis hinter meinen geschlossenen Lidern verstecken würde. Zugegeben, es war nicht sehr wahrscheinlich, aber wie pflegte mein Vater so schön zu sagen? Ich lebte ohnehin viel zu oft in meiner Fantasiewelt, da konnte ich genauso gut auf Wahrscheinlichkeiten pfeifen. Und wie es aussah, hatte Dad damit auch vollkommen richtig gelegen: Mein ganzes Leben war ein einziges Hirngespinst, das er nur erfunden hatte.
Er und meine Mutter.
Der Gedanke stieß mir sauer auf und ließ mich das Gesicht verziehen. Nicht, weil er so abwegig war, sondern einfach ungewohnt. Ich hatte nie viel über meine Mom nachgedacht. Aus dem schlichten Grund, dass sie für mich nie wirklich existiert hatte.
Meine Mutter war nur eine flüchtige Erscheinung gewesen, die nie eine große Rolle in meinem Leben gespielt hatte. Ein bisschen wie eine Figur, die man aus dem Spiel genommen hatte. Und ich hatte sie nie vermisst oder gebraucht. Ich hatte Dad, unseren Hund Flex, meine besten Freunde und Maple Creek. Das war mein Leben, und ich war zufrieden damit. Klar, mir war bewusst, dass ich eine Mutter hatte – alleine schon aus biologischen Gründen –, aber ich hatte sie nie kennengelernt, und Dad hatte auch nie ein Wort mehr als nötig über sie verloren.
Mit fünf Jahren hatte ich dann doch nachgefragt, wo meine Mommy war, weil jeder, den ich kannte, eine Mom hatte. Meine beste Freundin Tami sogar zwei, nur ich eben nicht. Mein Vater hatte mir damals erklärt, dass sie nicht mit uns zusammenleben wollte. Später, als ich älter gewesen war, hatte er es noch einmal deutlicher auf den Punkt gebracht: Mom war kurz nach meiner Geburt abgehauen, ist mit einem anderen Kerl durchgebrannt, der ihre selbstzerstörerische Art unterstützt hatte – im Gegensatz zu meinem überordentlichen Dad.
Harte Worte, die mich damals wie heute von jeder weiteren Nachfrage abgehalten hatten. Vielleicht war das immer seine Absicht dahinter gewesen. Keine Fragen stellen, nicht weiterbohren. Es stehen lassen, wie es war. Und es hatte funktioniert.
Bis jetzt. Denn jetzt begann ich, Fragen zu stellen. Ich fragte mich, was an Dads Geschichte überhaupt dran war. Ob meine Mom uns wirklich verlassen und was er mir all die Jahre über verschwiegen hatte.
Ich biss die Zähne zusammen und legte den Kopf in den Nacken. Über mir breitete sich der graublaue Himmel Maple Creeks aus, einzelne Schleierwolken zogen vorüber wie ungeordnete Pinselstriche, die nie zu Ende geführt worden waren. Der Geruch nach frischen Blättern, Herbst und Kaminrauch lag in der Luft. Um mich herum rauschte der frische Septemberwind in den Ahornbäumen unter mir und verwirbelte einzelne Strähnen meiner Haare vor meinen Augen.
Wie konntest du nur, Dad?
Ich spürte, wie Tränen in mir aufstiegen und fuhr mir rücksichtslos mit dem Pulloverärmel übers Gesicht. Wieder und wieder, aber das Brennen wollte nicht verschwinden. Genauso wenig, wie der stechende Schmerz in meiner Brust, den mir mein Vater mit seinem Ausdruck in den Augen und den wenigen Worten versetzt hatte. Wenn ich dieses verdammte Schreiben doch nie gefunden hätte …
Ich schluckte gegen das Schluchzen an, das in meiner Kehle saß, und starrte mit verschwommenem Blick auf die nassen Flecken, die meine Tränen auf dem Kleid hinterließen. Stumme Zeugen meines Kummers. Wütend wischte ich sie fort, aber sie liefen einfach weiter und erinnerten mich unaufhörlich daran, dass mein Leben gerade innerhalb von Sekundenbruchteilen in unzählige Scherben zerbrochen war. Bisher hatte ich angenommen, dass dafür mehr nötig war. Ein großes Ereignis, irgendetwas, das viel Lärm machte und sichtbaren Schaden hinterließ. Doch ich hatte mich geirrt. Zerstörung kam unangekündigt und schweigend. Unglück schlich sich lautlos auf stillen Pfoten von hinten heran und überraschte dich eiskalt.
Erschaudernd zog ich mir die Ärmel weiter über die Hände und schloss meine Finger dann wieder um die Umrandung des Dachs, auf dem ich saß. Meine Füße baumelten gute zwanzig Meter über dem Hof vor dem Indiana-Building. Mit seinen Türmchen und Giebeln gefiel es mir am besten, und das zugängliche Dach, auf dem ich mich zu gern versteckte, war definitiv ein weiterer Pluspunkt.
Ich beugte mich weiter nach vorn und sah nach unten. Auf dem halbmondförmigen Platz vor dem Gebäude standen einige Bänke um Bäume herum, verfärbte Blätter lagen auf dem Pflaster, und von hier oben wirkte es, als hätte jemand Farbspritzer über die grauen Steine verteilt.
Im nächsten Moment hörte ich hinter mir das leise Quietschen einer Tür, dann knirschende Schritte, die sich langsam über den Kies bewegten.
»Ich wusste, ich finde dich hier oben. Du wirst dich jetzt aber nicht für die nächsten Wochen auf dem Dach verschanzen, oder?« Die Frage war als Scherz gemeint, aber ich hörte die Besorgnis in seinen Worten. Mit einem leisen Seufzen ließ Elias sich neben mir nieder und zog ein Bein an, den Blick genauso nach unten gerichtet wie ich.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: