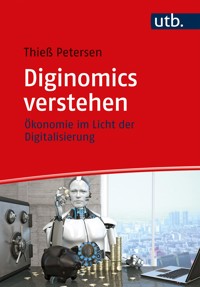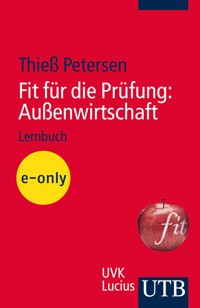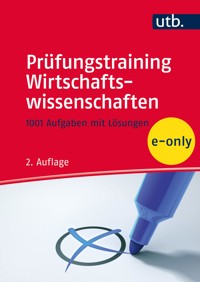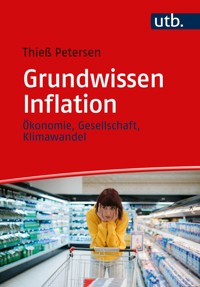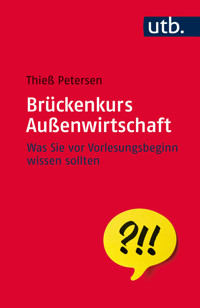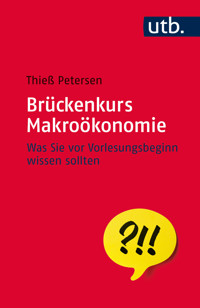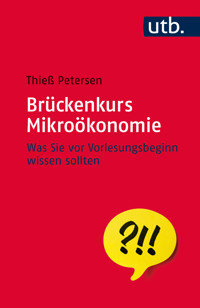21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Sprache: Deutsch
VWL praxisnah und hochaktuell Was tun, wenn der Markt versagt? Genau dann sind staatliche Eingriffe notwendig, aber auch der Staat selbst kann versagen. Thieß Petersen zeigt Formen des Markt- und Staatsversagens auf. Zudem zieht er wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen, die helfen können, die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft zu steigern. Aktuelle Themen lässt er nicht außer Acht, etwa den Klimawandel und die Schuldenbremse. Auch auf die Rolle der Industriepolitik geht der Autor ein. Das Buch ist für Studierende der Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft eine spannende und zugleich aufschlussreiche Lektüre. Es ist zudem für angrenzende Studiengänge geeignet. utb+: Begleitend zum Buch steht den Leser:innen ein E-Learning-Kurs zur Verfügung. Dieser Kurs hilft bei der Vertiefung des Wissens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Thieß Petersen
Markt- und Staatsversagen
Volkswirtschaftslehre einfach erklärt mit eLearning-Kurs
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: © Pham Hung ∙ iStock
Autorenbild: © privat
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563848
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6384
ISBN 978-3-8252-6384-3 (Print)
ISBN 978-3-8463-6384-3 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Im idealtypischen ökonomischen Standardmodell ist die Rolle des Staates in der Wirtschaft weitgehend auf ordnungspolitische Maßnahmen beschränkt – der Staat setzt einen rechtlichen Rahmen, hält sich ansonsten aber aus dem Wirtschaftsgeschehen heraus. In der Realität sind die Annahmen dieses Modells jedoch nicht erfüllt. Die Folge ist ein Versagen des Markts, welches sich in einer Wohlfahrtseinbuße äußert. Das erfordert eine staatliche Intervention. Allerdings ist damit nicht garantiert, dass diese Intervention die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt maximiert, denn auch der Staat kann – rein ökonomisch betrachtet – versagen.
Im → 1. Kapitel werden die erforderlichen theoretischen Grundlagen für die nachfolgenden Erläuterungen gelegt. Es wird gezeigt, dass ein funktionierender Markt die Wohlfahrt einer Volkswirtschaft unter den gegeben Produktionsrestriktionen maximiert. Gleichzeitig aber wird auch deutlich, dass die Voraussetzungen dafür sehr anspruchsvoll sind. Nur wenn zahlreiche Prinzipien erfüllt sind, gelingt es dem Markt, die Wohlfahrt der Gesellschaft tatsächlich zu maximieren.
Schwerpunkt des Buches ist das → 2. Kapitel. Hier werden 10 Arten von Marktversagen beschrieben. Neben den klassischen Beispielen (öffentliche Güter, externe Effekte, die Tragödie der Allmende, natürliche Monopole und unvollständige Informationen) geht es auch um makroökonomische Aspekte (distributives und konjunkturelles Marktversagen) sowie um Wettbewerbsverzerrungen im Ausland, den Verlust der moral-ethischen Basis einer Marktwirtschaft und um meritorische bzw. demeritorische Güter. Erläutert werden die Ursachen und Folgen des jeweiligen Marktversagens sowie wirtschaftspolitische Handlungsoptionen zum Umgang mit ihm.
Das → 3. Kapitel widmet sich dem Umstand, dass eine staatliche Intervention in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie jede Form des Marktversagens heilen kann, dies aber in der praktischen Wirtschaftspolitik keinesfalls garantiert ist. Auch auf Seiten der staatlichen Akteure gibt es Informationsdefizite. Zudem ist zu erwarten, dass die für die Wirtschaftspolitik verantwortlichen Menschen – allen voran politische Entscheider und die in der Bürokratie tätigen Personen – nicht die Maximierung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt als oberstes Ziel verfolgen, sondern eigene Interessen. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Finanzierung staatlicher Aktivitäten durch Steuern ebenfalls zu Wohlfahrtsverlusten führt.
Im → 4. Kapitel werden einige Thesen zur zukünftigen Entwicklung der skizzierten Formen des Marktversagens präsentiert. Kernhypothese ist, dass die für einen funktionsfähigen Markt erforderlichen Voraussetzungen immer häufiger nicht erfüllt sein werden und dass die Wohlfahrtsverluste der daraus resultierenden Marktversagen größer werden. Folglich ist mit einer Zunahme staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsleben zu rechnen. Das abschließende → 5. Kapitel zieht einige wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen aus diesen Thesen.
1Idealtypisches Wirtschaftsmodell
Die Volkswirtschaftslehre beschäftigt sich mit der grundlegenden Frage, wie eine Gesellschaft damit umgeht, dass Menschen über unbegrenzte Bedürfnisse verfügen, für deren Befriedigung es jedoch nur eine begrenzte Menge von Gütern gibt. Die Tatsache, dass die Mittel zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse knapp sind, macht es erforderlich, mit der Knappheit so umzugehen, dass das Spannungsverhältnis zwischen unbegrenzten Bedürfnissen und begrenzten Mitteln zu deren Befriedigung so weit wie möglich reduziert wird. Das Ziel stellt eine Gesellschaft vor zahlreiche Fragen: Welche Produkte sollen hergestellt werden? Wer stellt diese Produkte wie her? Und für wen werden die Produkte hergestellt, d. h. wie werden die knappen Güter unter den Mitgliedern der Gesellschaft verteilt?
Die Beantwortung dieser Fragen kann entweder zentral über Pläne und Zuweisungen erfolgen oder dezentral über Märkte und Preise. Sowohl theoretische Überlegungen als auch praktische Erfahrungen sprechen dafür, dass Märkte und Preise diese Fragen besser beantworten können als zentrale Pläne. Das setzt jedoch eine Reihe von Annahmen voraus, die erfüllt sein müssen, damit das erzielte Marktgleichgewicht auch die gesamtgesellschaftliche WohlfahrtWohlfahrt maximiert.
Wissen | Der MarktMarkt ist der Ort, an dem das Angebot eines bestimmten Gegenstands auf die dazugehörende Nachfrage trifft. Bei dem angebotenen und nachgefragten Gegenstand kann es sich um ein Konsumgut handeln, einen Vermögensgegenstand (z. B. eine Aktie oder Gold), einen Produktionsfaktor, Rohstoffe, Devisen (also ausländische Währungseinheiten) und andere Dinge. Der Preis, bei dem die angebotene mit der nachgefragten Menge übereinstimmt, ist der Gleichgewichtspreis. Der daraus resultierende Zustand ist ein MarktgleichgewichtMarktgleichgewicht.
1.1Voraussetzungen des idealtypischen Wirtschaftsmodells
Volkswirtschaftliche Modelle arbeiten mit drei zentralen Arten von Wirtschaftsakteuren.
Die UnternehmenUnternehmen sind für das gesamtwirtschaftliche Güterangebot zuständig. Sie setzen Arbeitskräfte, Maschinen und andere Produktionsfaktoren ein, um mit ihnen Güter herzustellen, die sie auf Märkten verkaufen. Ziel der Unternehmen ist die Maximierung ihres Gewinns.
Die privatenHaushalte Haushalteprivate Haushalte bieten ihre Arbeitskraft an, um so ein Einkommen zu erzielen, das sie für den Kauf von Konsumgütern benötigen. Die privaten Haushalte sind daher zentraler Akteur der gesamtwirtschaftlichen Güternachfrage. Ihr Ziel ist es, den eigenen Nutzen zu maximieren.
Die Unternehmen und die privaten Haushalte bilden den Privatsektor einer Volkswirtschaft. Ihnen steht der StaatStaat gegenüber. Zum Staat gehören in Deutschland vor allem die drei Gebietskörperschaften – also der Bund, die 16 Bundesländer und die Kommunen bzw. Gemeinden – und die Sozialversicherungen. Zum Staat gehört zudem die Zentralbank, die für die Einhaltung der gesamtwirtschaftlichen Preisniveaustabilität zuständig ist. Die ökonomischen Standardmodelle gehen davon aus, dass es das Ziel des Staates ist, die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt zu maximieren. Letzteres bedeutet im Kern, dass es der Volkswirtschaft gelingt, die innerhalb eines Jahres zur Verfügung stehenden Produktionskapazitäten so zu nutzen, dass die Bedürfnisse der Gesamtheit aller Mitglieder der Gesellschaft bestmöglich befriedigt werden.
Wissen | In den Wirtschaftswissenschaften sind GüterGüter Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Dabei kann es sich um physische bzw. materielle Güter handeln (das sind Waren) oder um nichtmaterielle Güter, also Dienstleistungen.
Im idealtypischen theoretischen Wirtschaftsmodell erreicht der Privatsektor das wohlfahrtsmaximierende Marktgleichgewicht. Benötigt werden dafür Märkte und Preise, die dafür sorgen, dass das gesamtwirtschaftliche Angebot der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage entspricht. Die Realisierung dieses wohlfahrtsmaximierenden Gleichgewichts verlangt jedoch, dass eine Vielzahl von Annahmen erfüllt sind. Zu den wichtigsten gehören die folgenden:
HaftungsprinzipHaftungsprinzip: Die Eigentumsrechte an wirtschaftlichen Gütern sind eindeutig definiert. Das bedeutet vor allem, dass jeder Wirtschaftsakteur alle Kosten seines Handelns trägt, alle Vorteile seiner Entscheidungen erhält und so gesehen alle Konsequenzen seines Handelns trägt.
Verständnis | In der Volkswirtschaftslehre umfassen EigentumsrechteEigentumsrechte eine Reihe von Rechten: das Recht, einen Gegenstand zu nutzen, die Form und das Aussehen dieses Gegenstands zu verändern, Erträge aus der Nutzung des Gegenstands zu ziehen und diesen Gegenstand an andere Personen zu übertragen, also vor allem gegen die Zahlung eines Preises zu verkaufen. So regeln Eigentumsrechte innerhalb einer Gesellschaft den Gebrauch von Gegenständen. Die Durchsetzung von Eigentumsrechten ist in der Realität mit Kosten verbunden. Wer eine landwirtschaftliche Fläche für sich nutzen will, muss andere Personen von der Nutzung ausschließen, z. B. durch den Bau eines Zauns. Der Verkauf dieser Fläche an eine andere Person verlangt in Deutschland eine notarielle Beglaubigung, die mit Kosten verbunden ist. In den volkswirtschaftlichen Standardmodellen wird jedoch angenommen, dass derartige Kosten nicht anfallen, was die ökonomischen Analysen vereinfacht.
AusschlussprinzipAusschlussprinzip: Wirtschaftsakteure können von der Nutzung wirtschaftlicher Güter ausgeschlossen werden, wenn sie nicht bereit sind, einen Preis dafür zu zahlen.
Vollständige InformationenInformation, vollständige: Alle Wirtschaftsakteure verfügen über alle relevanten Informationen, vor allem über das Güterangebot, die Qualität der angebotenen Güter, die Höhe der Preise und die verfügbaren Anbieter. Es gibt daher niemanden, der mehr Informationen als die übrigen Marktteilnehmer hat und dieses Wissen ausnutzen könnte.
RationalitätRationalität bzw. NutzenmaximierungNutzenmaximierung: Alle Wirtschaftsakteure verhalten sich rational in dem Sinne, dass sie unter den gegebenen ökonomischen Restriktionen jeweils die Entscheidung treffen, die ihren individuellen Nutzen maximiert. Die Nutzenvorstellungen bzw. Präferenzen sind dabei von Person zu Person verschieden, aber das grundlegende Ziel der Nutzenmaximierung wird von allen verfolgt.
Vielzahl von Anbietern und Nachfragern ohne MarktmachtMarktmacht: Es gibt eine große Zahl von Anbietern und Nachfragern, sodass kein Wirtschaftsakteur über eine Marktmacht verfügt, die er zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Das heißt u. a., dass kein Marktteilnehmer den Marktpreis durch sein Verhalten selbständig ändern kann – alle Preise sind für alle Marktteilnehmer eine gegebene Größe. Die Wirtschaftsakteure verhalten sich daher als Preisnehmer und Mengenanpasser – sie passen die für sie optimale nachgefragte oder angebotene Menge an den herrschenden Marktpreis an. Die große Zahl von Anbietern ist erforderlich, damit es unter den Unternehmen zu einem Wettbewerb kommt.
MarktoffenheitMarktoffenheit: Der Markteintritt ist ebenso frei wie der Marktaustritt. Jeder, der als Anbieter auf dem Markt für ein bestimmtes Produkt tätig werden will, kann dies machen.
Vollkommene PreisflexibilitätPreisflexibilität: Die Preise für Güter, Vorleistungen, Rohstoffe und Produktionsfaktoren sind nach oben und unten vollkommen flexibel. Wenn beispielsweise das gesamtwirtschaftliche Güterangebot größer ist als die entsprechende Nachfrage, bedeutet das einen Angebotsüberschuss, der zu einem Preisrückgang führt.
Aufgabe des Staates ist es in diesem Kontext, den rechtlichen Rahmen so zu gestalten, dass diese Prinzipien zur Geltung kommen. Der Staat stellt also Regeln auf, die dafür sorgen, dass wettbewerblich organisierte Märkte wie gewünscht funktionieren. Diese Maßnahmen werden als OrdnungspolitikOrdnungspolitik bezeichnet. Zentrale Bereiche der Ordnungspolitik sind die Gesetze zur Sicherung des Privateigentums und zum Schutz des geistigen Eigentums (das erfolgt vor allem über den Patentschutz), das Vertrags- und Mietrecht, Regelungen zum Verbraucherschutz, das Arbeitsrecht zur Regelung von Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie das Wettbewerbsrecht, das einen unfairen Wettbewerb verhindern soll, also z. B. Preisabsprachen unter Anbietern.
Damit Märkte funktionieren und das gesamtwirtschaftliche Güterangebot sich an die Güternachfrage anpasst, braucht es neben einem ordnungspolitischen Rahmen vor allem flexible Preise. Preise sind in der Regel als Geldpreise ausgedrückt, d. h. der PreisPreis eines Guts wird in Geldeinheiten – z. B. Euro – angegeben. Preise haben eine Reihe von Funktionen. Die wichtigsten sind die Allokationsfunktion, die Anreiz- bzw. Sanktionsfunktion, die Innovationsfunktion, die Informationsfunktion, die Koordinierungsfunktion und die Markträumungsfunktion (vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Petersen 2016).
Die AllokationsfunktionAllokationsfunktion des Preises beschreibt den Umstand, dass der Preis die endgültige Verteilung der Güter und der Produktionsfaktoren regelt. Die vorhandenen Produktionsfaktoren und die mit ihnen produzierten Güter werden innerhalb einer Volkswirtschaft so verteilt, dass sie den Konsumenten den größtmöglichen Nutzen stiften. So sind beispielsweise Anbieter von Gütern, die von den Konsumenten hochgeschätzt werden und für die die Konsumenten einen hohen Preis zahlen, in der Lage, höhere Faktorpreise – also z. B. höhere Löhne – zu zahlen. Dadurch werden die Produktionsfaktoren in die Branchen gelenkt, die diese Güter herstellen. So werden die Güter, die von den Konsumenten hochgeschätzt werden, in größerem Umfang hergestellt. Unternehmen bzw. Branchen, die nach Ansicht der Verbraucher weniger attraktive Güter anbieten, verlieren diese Produktionsfaktoren.
Der Preis stellt für die Anbieter oder Eigentümer von Gütern einen Anreiz dar, Mengeneinheiten dieses Guts auf dem Markt anzubieten. Wenn beispielsweise der Preis eines Guts infolge einer größeren Nachfrage steigt, erhöht dies den Anreiz der Anbieter, mehr Einheiten davon zu produzieren und auf dem Markt anzubieten. Zudem erhöht der steigende Preis bei den Eigentümern dieses Guts den Anreiz, sich von ihren Gütern zu trennen und diese zu verkaufen. Im Ergebnis führt die AnreizfunktionAnreizfunktion des Preises also dazu, dass im Fall einer größeren Nachfrage diese durch ein steigendes Angebot befriedigt werden kann. Negativ formuliert nimmt der Preis eine SanktionsfunktionSanktionsfunktion wahr: Produkte, die von den Konsumenten nicht mehr gewollt werden, erleiden einen Preisrückgang. Damit sinken die Gewinne, sodass die Kapitaleigentümer Einkommenseinbußen erleiden. Falls der Preis so weit sinkt, dass er die Produktionskosten nicht mehr deckt, kommt es zu Verlusten. Langfristig müssen diese Anbieter den Markt verlassen, weil sie nicht mehr kostendeckend produzieren können. Der Preis sorgt also dafür, dass Unternehmen, die nicht das anbieten, was die Konsumenten wollen, vom Markt verschwinden.
Eng verbunden mit der Anreiz- bzw. der Sanktionsfunktion ist die InnovationsfunktionInnovationsfunktion. Wenn in einem wettbewerblich organisierten Markt ein einzelnes Unternehmen befürchten muss, dass es von Konkurrenten vom Markt verdrängt werden kann, weil die Konkurrenten günstigere Güter anbieten, hat das einzelne Unternehmen einen Anreiz, durch technologischen Fortschritt die eigenen Produktionskosten zu reduzieren. Sinkende Preise bei den Gütern der Konkurrenz zwingen somit andere Unternehmen, Innovationsanstrengungen durchzuführen, um entweder die Qualität ihres Produkts zu verbessern oder die Kosten – und damit auch den Preis – des eigenen Produkts zu senken. Für die Konsumenten bedeutet dies, dass sie im Fall eines technologischen Fortschritts eine größere Menge von Gütern konsumieren können und dabei gleichzeitig nur noch einen geringeren Preis zahlen müssen. Dies erhöht den materiellen Wohlstand der Bürger.
Die InformationsfunktionInformationsfunktion des Preises beschreibt den Umstand, dass der Preis alle Marktteilnehmer mit den Informationen versorgt, die diese für ihre Entscheidungen benötigen. Hierzu gehört vor allem der Umstand, dass der Preis ein Knappheitsindikator ist. Ein steigender Preis ist ein Indikator dafür, dass es einen Nachfrageüberhang gibt, d. h., dass die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage größer ist als das Angebot. Dies bedeutet, dass nicht alle Konsumenten, die das Gut zu dem am Markt herrschenden Preis kaufen wollen, es in der gewünschten Menge erwerben können. Das Angebot reicht nicht aus, um die Nachfragewünsche zu befriedigen. Der steigende Preis gibt den Anbietern die Information, dass eine Ausweitung des Angebots ökonomisch lohnend ist. Ein sinkender Preis ist hingegen ein Signal dafür, dass das Angebot zu groß ist und eine Reduzierung des Angebots ökonomisch sinnvoll ist. Hohe bzw. steigende Preise signalisieren somit Knappheit, geringe bzw. sinkende Preise sind hingegen ein Indikator für einen Überfluss.
Die KoordinierungsfunktionKoordinierungsfunktion des Preises beschreibt den Umstand, dass der Preis das Angebot und die Nachfrage so koordiniert, dass die Produktionspläne der Unternehmen den Konsumplänen der Verbraucher entsprechen. Wenn die Anbieter z. B. ein Produkt herstellen, das nicht den Wünschen der Konsumenten entspricht, resultiert daraus ein Angebotsüberschuss. Der damit einhergehende Preisrückgang signalisiert den Anbietern, dass sie die Produktion dieses Guts einschränken müssen. Damit werden die Produktions- und die Konsumpläne aufeinander abgestimmt.
Die MarkträumungsfunktionMarkträumungsfunktion des Preises beschreibt schließlich den Umstand, dass der Preis das Angebot und die Nachfrage so koordiniert, dass der Markt geräumt wird. Es kommt zum Ausgleich der angebotenen und der nachgefragten Menge, d. h. es wird ein MarktgleichgewichtMarktgleichgewicht erreicht. Solange das Marktgleichgewicht noch nicht erreicht ist, finden Preisvariationen statt. Im Falle eines Angebotsüberschusses kommt es zu einem Preisrückgang, der zu einem Rückgang der angebotenen Gütermenge und zu einem Anstieg der nachgefragten Gütermenge führt. Die Preisänderungen finden so lange statt, bis der AngebotsüberschussAngebotsüberschuss abgebaut ist und die angebotene Gütermenge mit der nachgefragten übereinstimmt. Dieses Prinzip gilt sowohl für Gütermärkte als auch für Faktormärkte, also z. B. den Arbeitsmarkt, und für Vermögensmärkte wie den Aktienmarkt.
Preise können alle diese Funktion jedoch nur erfüllen, wenn Märkte und Güter die eingangs genannten Eigenschaften besitzen. In diesem Fall führt die Organisation von Angebot und Nachfrage über Preise und Märkte zu einer Maximierung der gesamtgesellschaftlichen WohlfahrtWohlfahrt. Dies lässt sich mit dem Konzept der Konsumenten- und der Produzentenrente verdeutlichen.
1.2Wohlfahrtsmaximierende Gütermenge
Das aus wohlfahrtstheoretischen Überlegungen optimale Niveau eines Produkts lässt sich mit Hilfe des Grenznutzens bestimmen.
Verständnis | Der GrenznutzenGrenznutzen gibt an, wie sich der Gesamtnutzen verändert, wenn eine Person eine zusätzliche Einheit eines Guts konsumiert. Der Grenznutzen kann sowohl für einzelne Wirtschaftsakteure angegeben werden (individueller oder privater Grenznutzen) als auch für die Gesamtheit aller Wirtschaftsakteure (gesellschaftlicher oder sozialer Grenznutzen). In den wirtschaftswissenschaftlichen Analysen wird von einem positiven, aber abnehmendem Grenznutzen ausgegangen. Das bedeutet: Der Konsum einer zusätzlichen Einheit eines Konsumguts erhöht den Nutzen des betreffenden Konsumenten. Der Nutzenzuwachs wird jedoch mit jeder zusätzlichen Gütereinheit immer geringer.
Die Entscheidung, ob eine Person eine weitere Einheit eines Konsumguts erwerben und nutzen sollte, hängt ab von dem in Geldeinheiten ausgedrückten Grenznutzen und dem Marktpreis. Dabei gilt folgende Überlegung:
Wenn der Grenznutzen einer bestimmten Gütereinheit größer ist als der Marktpreis, lohnt sich der Kauf dieses Produkts, weil dessen Konsum einen positiven Nettonutzen stiftet. Eine Konsumgütereinheit mit einem Grenznutzen in Höhe von 8 Euro und einem Preis von 6 Euro stiftet dem Käufer einen Nettonutzen in Höhe von 2 Euro.
Konsumgütereinheiten, deren Grenznutzen geringer ist als der zu zahlende Marktpreis, sollten nicht gekauft werden, weil sie einen negativen Nettonutzen haben.
Der höchste Gesamtnutzen wird erreicht, wenn der Grenznutzen einer Konsumgütereinheit mit dem Marktpreis übereinstimmt.
Das Zahlenbeispiel in → Tab. 1.1 verdeutlicht dieses Prinzip.