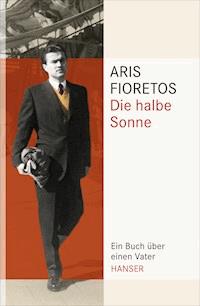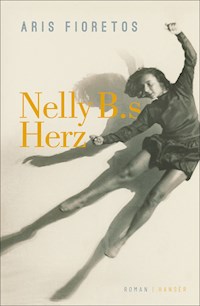Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Es mag seltsam klingen, aber ich bin die einzige, die erzählen kann, wie ich endete.“ Es ist die Zeit der Diktatur des Militärs in Griechenland. Marys Bericht beginnt mit ihrer Liebe zu Dimos, einem Anführer der Studentenbewegung. Im November 1973 wird Mary festgenommen, in den Verliesen des Sicherheitsdiensts ist sie Hunger, Kälte und Folter ausgesetzt. Nur sie weiß von ihrer Schwangerschaft, dem Kind von Dimos. Aber Mary erzählt auch von der Solidarität unter den gefangenen Frauen, wie es ihr gelang zu überleben, ohne Verrat zu begehen. Mit großer literarischer Kraft beschreibt Aris Fioretos, der Autor aus Schweden, die existentielle Krise einer jungen Frau, die vor einem unlösbaren Konflikt steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Es mag seltsam klingen, aber ich bin die einzige, die erzählen kann, wie ich endete.« Mit diesen Worten beginnt Mary, als alles vorüber ist, ihren aufwühlenden Bericht von einer schweren Zeit. Wer ihn gelesen hat, wird Mary nicht mehr vergessen. Im November 1973 hat die Miliz sie vor der Hochschule in Athen festgenommen. In den Verliesen des Sicherheitsdienstes und auf einer Gefängnisinsel war sie Hunger, Kälte und Folter ausgesetzt. Aber sie erzählt auch von der Solidarität unter den gefangenen Frauen und davon, wie es ihr gelang zu überleben, ohne Verrat zu begehen. Von ihrer Herkunft und dem Bruch mit ihrer regimetreuen Familie, von dem verschwundenen Bruder und ihrer Liebe zu Dimos, dessen Kind sie unter dem Herzen trägt. Mit großer literarischer Kraft beschreibt Aris Fioretos die existentielle Krise einer jungen Frau, die mit dreiundzwanzig Jahren vor einem unlösbaren Konflikt steht.
Hanser E-Book
Aris Fioretos
Mary
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Carl Hanser Verlag
Die schwedische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Mary bei Norstedts in Stockholm.
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds in Darmstadt für die großzügige Unterstützung seiner Arbeit.
Der Verlag dankt dem Swedish Arts Council für die großzügige Förderung der vorliegenden Übersetzung.
ISBN 978-3-446-25411-4
2. Ebookversion September 2016
© Aris Fioretos 2015
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag: Birgit Schlegel, gewerkdesign Berlin und Peter-Andreas Hassiepen, München
Bild: © Thomas Florschuetz
Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
INHALT.
DIE ERSTE BUCHT.
DIE GRANATAPFELKERNE.
I. Wer?
II. Warum?
III. Wo?
IV. Was?
V. Wie?
VI. Wann?
VII. …
ALASKA.
Anmerkung.
… eine vage Form
aus Herz und Kranium.
Lorca
DIE ERSTE BUCHT.
WENN ICH MICH auf die Zehenspitzen stelle, reiche ich bis zu dem Fenster hinauf, das hoch und breit ist wie ein Blatt Papier. Unter ihm sieht man feuchte Streifen – als schwitze die Wand. Das Fenster sitzt in der hinteren Ecke, unter der Decke. Vermutlich wegen des Lichteinfalls; weniger gilt hier als besser. Schaue ich hinaus, sehe ich die Gräber, und dahinter Meile für Meile die See. Mal ist sie grau, mal stählern glänzend, meist blau oder grün und ruppig. Schließe ich das Fenster, wird die Brise ausgesperrt, aber der Haken schabt bei Wind. Deshalb habe ich ihn mit etwas Mullbinde umwickelt. Das hilft eine Weile, dann quietscht es wieder. Ansonsten hört man nur die Wellen. Sie donnern so regelmäßig, dass ihr Geräusch in meinen Körper eingezogen ist. Jetzt atmet die Brandung in mir wie eine riesige Lunge.
In der Schlucht kreischen die Vögel, obwohl es Stunden her ist, seit der Müll hinuntergeworfen wurde. Wenn sie alles aufgepickt haben, ziehen und zerren sie an den Resten, balgen sich, fliegen mit einem Fleischfetzen oder Knochen davon. So wüst wie Schulkinder. Sobald die Sonne untergegangen ist, beruhigen sie sich jedoch. Dann hüpfen sie auf den Felsen umher, putzen ihr Gefieder und halten Ausschau, bis die Nacht kommt und mit ihr die Ratten. Lautlos und müßig, ein wenig nutzlos. Nach dem Besuch heute Abend jedoch nicht. Gerade schlagen sie Krach, als ginge es um die richtige Auslegung des Abfalls.
Ich darf die Gerüche nicht vergessen. Es gibt hier auch Gerüche. Von Müll, Tang, faulem Fisch, schimmelndem Putz. Aber vor allem von Salz. Der Wind trägt den Meerschaum überraschend weit. Wenn er sich schließlich legt, klebt er auf Fensterrahmen und Griffen, im Haar und auf den Kleidern. Das Salz ist trocken, fast pudrig, es riecht erstaunlich schlecht, wenn man es zwischen den Fingern verreibt. Im Winter wollte die Feuchtigkeit nie ganz verschwinden. Alles, was ich berührte, war von einer Schicht bedeckt. Dann schlug das Wetter um, und heute, am letzten Apriltag 1974, ist nur das Salz geblieben.
ES IST SCHWIERIG, Papier aufzutreiben, daher schreibe ich auf allem, was mir in die Finger kommt: ein Comicheft, so verblichen, dass die Zeichnungen kaum noch zu erkennen sind, ein paar Konservenetiketten, Zeitungsseiten, die nach Fisch riechen, umgestülpte Zigarettenschachteln … Das Datum habe ich vorhin auf der Verpackung einer Tafel Schokolade notiert. Wir fanden sie, als wir Weihnachten die Küche putzten. Keiner von uns traute seinen Augen. Dann öffneten wir eine Tafel und merkten, wie trocken sie geworden war. Als kaute man Sand. Nicht einmal der Junge wollte die braunen Krümel essen; schon bei ihrem bloßen Anblick bekam man Durst. Ich weiß nicht, wer sie mir vor einer Woche in den Essensbeutel gelegt hat, aber da lag die Tafel – unter dem Strumpf mit Reis. Die Tinte meines Kugelschreibers haftet unerwartet gut auf der Innenseite des Papiers.
Wenn ich die Zettel gefaltet und zerrissen habe, damit sie alle gleich groß sind, fülle ich sie so beharrlich mit Worten, wie die Frauen in der Kirche rußige Gebete murmeln. Solange eins dem anderen folgt, empfinde ich keine Angst, keine Reue. Wenn für weitere kein Platz mehr ist, landet der Zettel bei den anderen in der Zinndose, die ich bei der Beerdigung bekam. Dort liegen sie dichtgedrängt und doch getrennt, als wären sie Granatapfelkerne, obwohl sie diesen nicht im mindesten gleichen. Um den Überblick zu behalten, habe ich sieben Stapel gebildet, einen für jede Frage auf Dimos’ Liste.
Manchmal frage ich mich, was ich hier mache, dann verstehe ich, dass ich keine andere Wahl habe. Es mag seltsam klingen, aber ich bin die Einzige, die erzählen kann, wie ich endete.
DIE GRANATAPFELKERNE.
I.
AUF DEM LETZTEN FOTO aus dem November trage ich eine Jeansjacke, einen Polopullover und eine Hose von der Art, die Stella Slacks nennt. Halbschuhe, über der Schulter eine Filztasche. Wenn meine älteste Freundin das Bild sähe, würde sie annehmen, dass ich das Übliche wiege, ein paar Kilo mehr als fünfzig. Ich selbst fühle mich aufgeschwemmt. Seit ich im letzten Herbst die Tore zum Gelände der Hochschule passierte, ist mein Gesicht voller geworden. Auch der Hals erscheint mir voller, was aber auch an dem Polokragen liegen könnte. Meine Augenbrauen sind zwei breite Pinselstriche, die Lippen geschlossen. Der Mund lässt mich beherrscht aussehen – oder »reserviert«, wie Dimos sagt. Auf dem Foto schreibe ich in ein Heft, das ich auf meinen Oberschenkel presse. Der Körper dreht sich zur Seite, es gibt viele und eigenartige Schatten, weil das Licht aus verschiedenen Quellen kommt – Straßenlaternen und Schaufenster, vielleicht ein Scheinwerfer. Unter der Aufnahme hat jemand notiert: gehbehindert.
Ich wurde Maria getauft. So steht es in dem Ausweis, den ich auf das Regal in Dimos’ Kochnische gelegt habe. Laut Pass bin ich dreiundzwanzig. Vor ein paar Jahren konnte ich mir nicht vorstellen, wie es sein würde, so alt zu sein; jetzt studiere ich bereits im letzten Studienjahr Architektur. Nur die Examensarbeit steht noch aus. In ihr soll es um Mehrfamilienhäuser in urbaner Umgebung gehen, aber ich bin nicht besonders weit gekommen. Ich weiß nicht, ob ich Bauingenieurin, Landschaftsarchitektin oder einfach Architektin werde. Ich vermute, einfach Architektin; zumindest würde ich mir das wünschen. Als ich klein war, wurde ich Tochter oder Marienkäfer genannt, gelegentlich auch Poliomädchen – die Krankheit erklärt mein Hinken. Ich wurde auch mit anderen Namen gerufen, habe aber nicht vor, hier auf sie einzugehen. Dimos nennt mich Mary. Von nun an werde ich so heißen.
Mary. Die Reservierte.
AUF DEM BILD sind die Nieten über der linken Brusttasche der Jacke nicht zu sehen. Ich drückte sie nach dem Arztbesuch fest – manchmal bin ich abergläubisch. Es ist seltsam, aber erfüllt von sanftester Sorge habe ich gleichzeitig das Gefühl, eine Sonne im Unterleib zu tragen, zitternd wie eine geballte Faust Jubel.
ALS ICH AUFWACHE, ist es sieben Uhr abends. Eigentlich hatte ich nicht vor zu schlafen, nachdem ich von der Ärztin zurückkehrte, war mein Körper jedoch schwer wie feuchte Erde, der Kopf leicht wie Äther. Es reichte, mich auf das Bett zu legen, schon war ich weg.
Nun merke ich, dass der Schlaf traumlos gewesen ist, fast erinnerungslos, als hätte sich der Körper von seinem Auftrag ausruhen müssen, ein Mensch zu sein. Dimos’ Seite des Betts ist leer. Seit dem letzten Mittwoch ist mein Freund in der Hochschule. Heute Morgen kam er kurz nach Hause, um zu duschen und ein paar Sachen zu holen. Er wusste, dass ich nach dem Mittagessen zum Arzt wollte, ist aber noch in dem Glauben, der Grund dafür wären meine Gliederschmerzen. Wenn wir uns sehen, werde ich es ihm erzählen. An der Decke dreht sich träge, doch systematisch der Ventilator. Obwohl es Herbst geworden ist, sind die Tage heiß, nicht zuletzt in diesem Backofen von einer Wohnung. Wenn ich lange genug die Luft anhalte, bilden sich am Haaransatz Schweißperlen. Kurz danach formen sie einen Tropfen, der groß genug ist, um über die Schläfe zu rinnen. Er gleitet am Ohr entlang, kitzelt ein wenig und verschwindet in den Nackenhaaren.
Das Rinnsal erinnert mich an das Bild, das ich vor ein paar Tagen in der Zeitung sah, nach meinem ersten Besuch in der Arztpraxis, als ich nur eine Urinprobe abgab. Ein Junge saß darauf mit einer Decke um die Schultern und weit aufgerissenen Augen, Tränen hatten Furchen in sein unfassbar schmutziges Gesicht gegraben. Die Wangen glichen einer verwüsteten Flusslandschaft. In den Armen hielt er einen rußigen Klumpen. Erst als ich die Bildunterschrift las, begriff ich, was das war. Der Sechsjährige mit seinem Teddybär. Er überlebte das Feuer, in dem seine ganze Familie umkam.
Ich weinte wie ein Kind.
Wenn das Haus in der Olympiastraße in Flammen stünde, würde ich mich bedenkenlos in das Inferno stürzen, um seine Bewohner zu retten – obwohl es mir niemand danken würde, jedenfalls Mutter nicht, und obwohl es lange her ist, dass mein Halbbruder Theo das Land verließ. Dabei wäre mir noch vor zwei Jahren nichts lieber gewesen, als keine Eltern zu haben. Was auch immer, wenn es mir nur erspart bliebe, in dieser privaten Version von Kirche, Familie und unserer heiligen Nation, wie das Militär es nennt, erstickt zu werden.
Das Gefühl verschwand erst, als ich mit Stella zusammenzog. Nein, das stimmt nicht. Im Grunde dauerte es bis zu diesem Typen mit dem Pferdeschwanz. Ich hatte ihn bereits mit Freunden in den Fluren oder am Haupteingang gesehen, wo einige Leute gebrauchte Lehrbücher verkaufen. Und gemerkt, dass er zu mir herüberschielte. Aber ehrlich gesagt dachte ich mir nicht viel mehr dabei, und als er Anfang des vorigen Studienjahrs den Boulevard überquerte und direkt auf mich zukam, war ich so perplex, dass ich nicht verstand, was er zu mir sagte. Ich hatte mich gerade erst von Stella verabschiedet und war schon auf dem Weg durch das Eingangstor, als er mich ansprach. Er kam mir doppelt so groß vor wie gewöhnliche Menschen, was die Sache nicht unbedingt leichter machte. Ich entschuldigte mich, ohne richtig hinzuhören. Die Vorlesung habe begonnen, ich sei in Eile, ein anderes Mal – Worte dieser Art.
Möglicherweise gab das schlechte Gewissen den Ausschlag. Jedenfalls drehte ich mich vor dem Betreten des Hauptgebäudes um und sah ihn noch an der Stelle stehen, an der ich ihn verlassen hatte. Als hätte er Wurzeln geschlagen. Das sollte mein erstes Bild von Dimos werden. Und mit der Zeit verblich alles um ihn herum – die schäbigen Palmen, die Mülltonnen, das Gedränge an den Toren. Übrig blieb allein diese zu einem Schattenriss gewordene Gestalt. Konsterniert, unverrückbar, ein Baum von einem Mensch.
Jemand erzählte mir, er engagiere sich in Studentenorganisationen, und gelegentlich übermannte mich bei dem Gedanken, wie selbstvergessen er dort am Eingang gestanden hatte, eine anhängliche Wärme. Trotzdem verwitterte das Bild. Außerdem war ich mit einem Kommilitonen Stellas bei den Anglisten zusammen, was eine Weile für Unordnung in meinem Dasein sorgte. Er heißt Antonis, hat mit dieser Geschichte jedoch kaum etwas zu tun.
Letztes Frühjahr entdeckte ich den Typen erneut, in dem Automatenrestaurant gegenüber vom Nationalmuseum, in dem ich manchmal zu Mittag esse, wenn ich keine Lust habe, heimzugehen. Und plötzlich führte sich der Muskel in meiner Brust auf wie ein Spatz. Dimos saß in der einzigen Sitzecke, in der es noch einen freien Platz gab, war in eine Zeichnung vertieft und aß, ohne an das Essen zu denken. Es erschien wenig wahrscheinlich, dass er seit unserem kurzen Gespräch beim Friseur gewesen war; mittlerweile trug er außerdem einen struppigen Bart, mit dem er einer Kreuzung aus Novize und Rockstar glich. Als ich ihn fragte, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, antwortete er mit einem Grunzen. Zehn Minuten vergingen. In der Jukebox in der Sitzecke nebenan lief ein Hit aus einer amerikanischen Fernsehserie über eine Popgruppe:
This one thing I will vow ya
I’d rather die than to live without ya
Ich aß, während der Baum, auf seine Zeichnung konzentriert, auch dann noch den Löffel zum Mund führte, als nichts mehr auf seinem Teller war. Es sah lustig aus, aber statt zu lachen, studierte ich zum ersten Mal die Hände eines fremden Menschen. Die langen, sehnigen Finger, die erstaunlich gepflegten Nägel, die Adern, die sich wie Würmer zwischen den Knöcheln schlängelten. Und die Sommersprossen, auf die Haut geschüttelt wie feinster Puder. Als er eine Viertelstunde lang nicht aufgeblickt hatte, fand ich jedoch, dass es reichte. Selbstvergessen zu sein, ist eine feine Sache, Höflichkeit eine andere. Ich stand auf, schob den Stuhl an den Tisch, aber statt zu gehen, lehnte ich mich mit dem Tablett in den Händen zu ihm vor.
»Weißt du eigentlich, dass du Luft isst?« Meine Stimme klang schroffer als geplant. Er betrachtete den Löffel und danach mich. Während eines so langgezogenen Augenblicks, dass ich die Erinnerung später im Detail studieren konnte, verfolgte ich die Verwandlung von Verwirrung zu Verblüffung. Als er erkannte, wer ich war, schnappte er nach Luft. Sein Atemholen war so vorbehaltlos, und so unverstellt, dass es mir einen Schock der Verbundenheit versetzte. Lächelnd, aber nervös, gab er vor zu schlucken, und mir wurde klar, dass ich mich besser wieder hinsetzen sollte. »Entschuldige.« Das Tablett klapperte. »Ich war neulich wohl ein bisschen unhöflich.«
Das ist alles. So wurden wir ein Paar. Als der Baum seinen Plan zusammengerollt hatte, nannte er mir seinen Namen. Ich hatte ihn schon gehört – wer nicht? –, allerdings nicht gewusst, wie er aussah. Vielleicht buhlt er um meine Bewunderung, überlegte ich. Vielleicht denkt er, es beeindruckt mich, dass er einer der Freien Studenten ist. Als ich mich ihm vorstellte, entgegnete er jedoch nur: »Die Tochter des Hauptmanns?« Mit vielem hatte ich gerechnet, damit sicher nicht. Der Spatz hörte auf zu flattern und ich versuchte aufzustehen. Was immer ich darauf erwiderte, es würde das Falsche sein. »Man kann anfangen oder aufhören.« Er merkte, dass ich unschlüssig wurde. »Also, ich meine, können wir nicht Leute sein, die anfangen – einander kennenlernen, meine ich?« Ich war mir nicht sicher, ob der Satz grammatikalisch korrekt war, ließ das Tablett aber wieder los. Er steckte eine Münze in die Jukebox und tippte das Lied ein, das gerade gelaufen war. »Darf ich dich Mary nennen?«
DIE WOHNUNG, bevor ich abschließe, ohne zu wissen, dass es das letzte Mal sein wird.
Die Wände sind hellgrün wie unreife Melonen, der Fußboden ist aus Marmor. In einer Ecke stehen zwei Holzböcke mit einer Platte darauf, Kleider verbergen den Stuhl. Die Vase an der Tür hat der Vormieter stehenlassen. Sie ist groß, rund und staubig, in ihr stecken Schilfkolben, die jedes Mal schuppen, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Dimos behauptet, es gefalle ihm, den Flaum durch die Luft wirbeln zu sehen wie trockene Schneeflocken, aber ich hege den Verdacht, dass er einfach nur zu faul ist, die Schilfkolben wegzuschmeißen. An der Toilettentür hängt meine Filztasche, neben dem Wecker liegen die Gefängnisbriefe und ein Buch zur Festigkeitslehre. Ein Schnipsel von einer zerrissenen Ansichtskarte lugt als Lesezeichen heraus; man sieht ein wenig von einer Hand und einer Frucht. Außer dem Lehrbuch und den Kleidern gehört nur eine der Kassetten mir. Ich verbringe zwar mehrere Nächte in der Woche bei Dimos, aber das Durcheinander dort ist so groß, dass man Gefahr läuft, seine Sachen nicht mehr zu finden, wenn man sie bei ihm lässt. Über seinem Schreibtisch hat das Bild eines lachenden, aus der Zeitung ausgeschnittenen Boxers Gesellschaft von dem Jungen mit dem rußigen Kuscheltier bekommen.
Unten auf der Straße gibt ein Motorrad Gas, Autos hupen und bremsen. Der Losverkäufer des Viertels ruft die Gewinne bei der morgigen Ziehung aus, vom Nachbarhaus dringt der Lärm von Frauen herüber, die Wäsche abhängen. Im Inneren des Gebäudes zieht jemand ab, von Zeit zu Zeit setzt sich der Aufzug in Bewegung. Obwohl die Toilettentür geschlossen ist, hört man den Wasserhahn, der mit kurzen, präzisen Meißelschlägen tropft. Als ich ihn zum ersten Mal in seiner Wohnung besuchte, erklärte ich, es sei eigentlich nicht besonders schwierig, den Dichtungsring zu erneuern. Dimos brach in sein helles Lachen aus, das sich anhört, wie sich in meiner Vorstellung Sommersprossen anhören würden, wenn sie ein Geräusch von sich geben könnten. Der Druck in den Leitungen sei so schwach, dass man um jeden Tropfen froh sein müsse. Die Wohnung liegt im obersten Stockwerk. Wenn man in der fünften Etage aus dem Aufzug tritt, muss man noch eine Treppe hinaufsteigen. Am oberen Ende gibt es dann zwei Türen. Die eine führt auf das Dach hinaus, die andere zu seiner Einzimmerwohnung mit Dusche und Kochnische. Eine Zisterne nimmt die Hälfte der Dachfläche ein, der Rest besteht aus dem Fahrstuhlschacht und der zur Wohnung gehörenden Terrasse. Er räumte Kleider und altes Geschirr fort, zog mit ein paar kraftvollen Zügen die Jalousien hoch und erklärte mir, die Wohnung habe er wegen der Terrasse genommen. Fünfzig Quadratmeter unter freiem Himmel, umgeben von Wäscheleinen und Fernsehantennen. Mehr Freiheit gebe es in diesem Land nicht.
Sobald ich auf die Beine gekommen bin, beuge ich mich vor. Das Blut füllt meinen Kopf wie Wasser einen Schwamm. Die Ärztin meint, Schwindelgefühle seien in der Anfangszeit völlig normal. Die nächsten Wochen könnten unruhig werden, danach fühle man sich besser. Als der Schwindel abgeebbt ist, lege ich den Pass fort. Das Gesetz verlangt zwar, dass sich Staatsbürger ausweisen können, aber laut Dimos ist es besser, das Bußgeld zu zahlen. »Ein Mensch hat das Recht, anonym zu sein.« Ich glaube, das hat er bei Gramsci gelesen. Die Polizei lässt einen meistens ohnehin laufen.
Dimos’ Stolz ist ein Kassettenrekorder, den er von Verwandten im Ausland bekommen hat. Ich finde eine Kassette und spule sie zurück. Während das Band flattert und schabt, stelle ich den Herd an. Die Flamme flackert auf, blau wie Eis. Einer der Granatäpfel vom Herbst liegt neben der türkischen Kaffeemühle, die Dimos damals ebenfalls gekauft hat, auf dem Tisch. Die Kurbel sah so graziös orientalisch aus, dass er sie ohne zu feilschen genommen hat. Er behauptet, wenn man sie nur sehe, steige einem schon der Kaffeeduft in die Nase. Nun frage ich mich, wie lange es noch dauern wird, bis wir sie benutzen. Der Apfel ist bereits so eingetrocknet, dass die Kerne darin klappern, wenn man ihn schüttelt.
Auf dem Regal liegt eine Schachtel rote Santé, die Dimos vergessen haben muss. Noch sieben Stück. Ich habe beschlossen, das Rauchen aufzugeben, aber fürs erste gilt dieses Verbot nur für den Kauf eigener Zigaretten. Nachdem ich mir an der Gasflamme eine angezündet habe, rühre ich Zucker in den Kaffee. Der Satz wirbelt auf und legt sich wieder. Der Gedanke daran, wie er reagieren wird, stimmt mich erwartungsvoll, macht mich aber auch nervös. Mein Zwerchfell fühlt sich immer mehr an wie prickelndes Sonnengewebe. Auf dem Weg zur Terrasse drücke ich auf play.
Seit das Haus zehn Jahre zuvor als Teil des Baubooms errichtet wurde, der mit den zementgebundenen Baustoffen einsetzte, haben sich die Abgase in den Marmorfußboden gefressen. Es spielt keine Rolle, wie oft wir putzen, es fühlt sich trotzdem an, als ginge man auf einer dünnen Schicht Asche. Dimos will davon nichts hören – er hält sich die Ohren zu und fängt an, dieses Lied von den Monkees zu singen –, aber ich bin mir sicher, dass der Marmor falsch behandelt wurde. Er muss so geschliffen und poliert werden, dass seine poröse Oberfläche gründlich versiegelt ist. Eigentlich sollte das jedem Handwerker bekannt sein. Ich lehne mich mit dem Rücken an die nachmittagswarme Zisterne. Das Wasser erzittert, gewaltig und dennoch federleicht. Der Kaffee brennt, in den obersten Fenstern gegenüber glitzert die Sonne. Auf dem Dach sind die Frauen fast fertig. Beide pressen das Kinn auf die Wäsche, als sie mit übervollen Körben zum Treppenhaus gehen. Sie grüßen; ich winke zurück. Ich denke, ich werde vorschlagen, die Terrasse instand zu setzen. Der Marmor könnte noch einmal abgeschliffen werden, und wenn man das Geländer mit Bast verkleidet, brauchen hier keine Unfälle zu passieren. Nach der Siesta würden wir sehen, wie die Wäsche trocknet und die Dunkelheit abends kompakter wird, und nachts könnten wir Sternbilder studieren, so kühl wie Diamanten und unfassbar fern.
So make a stand for your man, honey
Try to can the can
Männliche Popgruppen in allen Ehren, aber ich bevorzuge Frauen in Jeansjacken. Der Basslauf donnert krachend durch die Adern, der Teer brennt schwarz und herb in der Lunge. Die Zigarette wippt im Mundwinkel, als ich zusammen mit Suzi Quatro singe. Zum ersten Mal existiere ich in der Welt, die in mir existiert, erbaut um eine Sonne, nicht größer als ein Korn.
Dass ein Leben so leicht sein kann.
ALS ICH AUF DIE STRAßE HINAUSTRETE, singe ich noch immer. Nun bin ich so gekleidet wie auf dem letzten Foto – bis auf die Jacke ganz in Schwarz. Die Füße tragen mich abwärts, als hätten sie ein Eigenleben entwickelt. Vor den Läden stapelt sich der Müll. Offenbar wird er diese Nacht abgeholt. Ein Inhaber unterhält sich mit einem Kunden, während er aus einigen Kartons die Böden schlägt und die steife Pappe umknickt. Ich gehe auf die Straße, an den geparkten Autos entlang. Vor mir spaziert ein Mann, das Hemd über der Hose. Die Hände auf dem Rücken; die Steine der Gebetskette gleiten zwischen seinen Fingern einem verborgenen Ritual folgend hindurch. Auch er bewegt sich schneller als üblich, und noch ehe ich ihn einhole, biegt er ab. Stattdessen kommt federnd ein gelber Oberleitungsbus den Anstieg herauf. Die beiden Kabel, die ihn mit den Leitungen verbinden, lassen ihn aussehen wie eine riesige Heuschrecke. Eine Frau zieht an der Schnur, danach steht sie auf, um auszusteigen.
Ich habe versprochen, mich bei Stella zu melden, gehe aber zunächst zur Apotheke, wo ich neue Tabletten gegen meine Gliederschmerzen abhole. Außerdem kaufe ich die Sachen, um die Dimos mich gebeten hat. Als ich wieder draußen bin, kratze ich das Etikett vom Tablettenröhrchen, überquere die Avenue und gehe in den Park. Die Zypressen ähneln startklaren Raketen, die weiß gekalkten Rinnsteine erinnern an Landebahnen. Auf einer Bank sitzen ein paar ältere Männer, um ihre Füße liegen Sonnenblumenkerne verstreut. Die Schalen gähnen wie Fischmäuler. Eine Mutter schiebt einen Kinderwagen, dabei spricht sie vorgebeugt mit dem kleinen Buddha, der aufrecht und ernst dasitzt, die Hände links und rechts um die Seitenteile geschlossen. Zwei Schulmädchen eilen vom Abendunterricht kommend heim – Strickjacke über der Uniform, Bücher und Hefte an die Brust gepresst.
An dem Kiosk in der Parkmitte tanzen Mücken um die Zeitungen, die unter den Markisen hängen. Hinter den aufgestapelten Zigarettenschachteln und dem kolossalen Telefon zählt eine Frau Münzen. Ich kaufe Double Spearmint. Während ich das Wechselgeld einstecke, lese ich die Schlagzeilen. Das Erdbeben im Oktober hat ein weiteres Todesopfer gefordert. Diesmal ist es eine ältere Frau, die nie mehr zu Bewusstsein kam, nachdem man sie aus den Ruinen gerettet hatte. Die Regierung gibt bekannt, dass die Sechste Flotte in der Bucht vor Anker liegen bleiben wird. Mit der neuen Führung in Chile sind diplomatische Beziehungen aufgenommen worden. Die Studenten des Landes werden ermahnt, weiter fleißig und diszipliniert zu sein. Nach seinem Sieg gegen Norton im September will Ali in einem neuen Titelkampf gegen Frazier antreten.
In der Ferne höre ich, wie in Watte gepackt, Rufe erschallen.
JE NÄHER ICH DER HOCHSCHULE KOMME, desto deutlicher erkenne ich die Ausrufezeichen:
»Eins, und eins – und dann vier! Eins, und eins – und dann vier!«
»Nieder mit der Junta! Nieder mit der Junta! Nieder mit der Junta!«
»Tut etwas, Leute! Sie nehmen sich unser Brot!«
Drei Tage dauern die Proteste jetzt an. Menschen eilen die Straßen hinunter; viele tragen Bretter und Ziegelsteine, andere Lebensmittel. Die Zukunft des Landes entscheidet sich gerade in der Hochschule. Es begann im Winter bei den Wirtschaftswissenschaftlern und ging im Frühjahr bei den Juristen weiter, erste Bewegungen nach Jahren des Stillstands. Im Laufe des Sommers verstärkten sich die Proteste, auch draußen im Land, und nun sind sie zu einer Welle der Unzufriedenheit angeschwollen.
Ich biege auf den Boulevard ein, der an Nationalmuseum und Hochschule vorbeiführt – und sehe auf einmal das Menschenmeer. Es müssen Tausende sein, die sich vor dem Haupteingang drängen. Fahnen wehen, Parolen werden skandiert, Flüstertüten knistern und pfeifen. Die Ladenbesitzer haben ihre Rollläden heruntergelassen; die Kioske sind noch geöffnet. Ein paar Meter vor mir gibt ein Bus auf. Die hydraulischen Pumpen zischen träge. Wer will, kann aussteigen, ehe der Fahrer einen Umweg um das Gelände macht. Zwei, drei Autos versuchen sich vorbeizuschieben, aber Studenten mit Flugblättern in den Händen dirigieren sie um. Bekanntmachungen werden unter Scheibenwischer geschoben und durch Fenster gesteckt. Die Polizei schaut zu, ohne einzugreifen. Vor dem Hotel schräg gegenüber stehen die Männer in Zivil mit ihren Sonnenbrillen. Auch sie schauen zu, ohne etwas zu tun. Anscheinend wird der Abend genauso verlaufen wie der gestrige.
Menschen hängen in dem Zaun entlang des Boulevards. Gelegentlich blitzen die Metallplatten auf, die dort am ersten Tag aufgehängt wurden, um die Kameras des Geheimdienstes in den gegenüberliegenden Häusern zu blenden. Inzwischen ertönen andere Parolen:
»Wir sind die freien Belagerten!«
»Wir sind aus Holz! Die Nacht ist aus Holz! Warum kommt ihr mit Feuer?«
Und unter den Rufen hört man dauernd die große, dumpfe Dünung, die noch immer die anderen Parolen trägt: »Brot – Bildung – Freiheit! Brot – Bildung – Freiheit! Brot – Bildung – Freiheit!«
Vor dem Automatenrestaurant stehen zwei Jungs aus dem dritten Studienjahr. Vor einer Woche hat mich der eine nach meiner Examensarbeit gefragt, jetzt schreibt er etwas in einen Block. Wenn er eine Seite fertig hat, gibt er sie seinem Freund, der das Blatt sofort an einen Passanten weiterreicht. Bevor der Bus zu den Textilvierteln abbiegt, lehnt sich der Fahrer aus dem Fenster. »Was verkündet ihr denn da?« Lachend antworten sie: »114!« Es ist der letzte Paragraph unseres außer Kraft gesetzten Grundgesetzes, der besagt, dass das patriotische Volk die Aufgabe hat, die Verfassung des Landes zu schützen. Während der Bus steht, schreiben andere Studenten mit Filzschreibern Druckbuchstaben auf das Blech. Einer malt mit weißer Deckfarbe ein großes Friedenszeichen auf die Kühlerhaube. Als er fragt, ob er das Fahrtziel über der Windschutzscheibe durch demokratie ersetzen dürfe, schlägt der Fahrer mit der Hand seitlich ins Leere, als hackte er Gemüse. Der Bursche soll es bloß wagen. Zwei junge Frauen laufen vorbei, die eine mit einem Schrubber, die andere mit einer Fahne auf den Schultern. »Endlich passiert es, endlich passiert es!« Vielleicht haben sie recht. Es sieht nicht so aus, als beabsichtige das Militär, einzugreifen.
An dem Kiosk sehe ich zwei Männer in Lederjacken und mit Sonnenbrillen, um den Hals des einen hängt eine Kamera. Ich warte, bis sie in der Menge verschwunden sind, dann kaufe ich Schulhefte. Es sind die gleichen Hefte, die ich sonst immer für Skizzen benutze: dunkelblauer Umschlag, vierundsechzig unlinierte Seiten. Als ich frage, was ich schreiben soll, schlagen meine Kommilitonen Schlagwörter auf Französisch oder Englisch vor, ich bleibe jedoch bei 114. Ohne Ausrufezeichen. Es klingt vielleicht seltsam, aber ich mag das Satzzeichen nicht. Sobald ich eine Seite herausgerissen habe, wird sie mir aus den Händen genommen. Neben uns verteilen andere Menschen Flugblätter. Oder jemand ruft: »Hinsetzen, hinsetzen!« Daraufhin setzen sich auf der Stelle zwanzig Leute und fangen an zu singen. Ein Mann, der mit seinem Auto nicht weiterkommt, kurbelt das Seitenfenster herunter und will wissen, wie ich heiße. Ich schüttele den Kopf. Daraufhin will er mir eine Münze geben, damit ich noch ein Heft kaufen kann. Wieder schüttele ich den Kopf. Nicht von dem Geld anderer.
So geht es weiter. Lange Zeit ist der Himmel rosa wie eine Schürfwunde. Dann senkt sich die Dunkelheit herab.
AB UND ZU sitze auch ich auf der Straße, die Arme um unbekannte Schultern gelegt, und singe aus vollem Hals. Es kommt mir vor, als pochte ein Unwetter aus Blumen in meinem Blut. Oder ich rede mit Freunden und erfahre, was geschehen ist, während ich bei Dimos verschlafen habe. Doch die meiste Zeit schreibe ich, beseelt von Trotz und Jubel. Nach fast sieben Jahren passiert es. Alles, wovon die Menschen träumen, passiert schließlich. Als die Hefte aufgebraucht sind, kaufe ich neue. Am Ende sehe ich kaum noch, was meine Hand schreibt.
Sobald die Straßenlaternen angegangen sind, knistert es in den Lautsprechern, dann ertönt eine mir vertraute Stimme: »Hier spricht die Hochschule, hier spricht die Hochschule! Das ist das Radio der Freien Studenten.« Ruhig erläutert sie, was auf dem Gelände benötigt wird: Brot, Wasser, Vaseline, Kompressen, Desinfektionsmittel … Anschließend werden Versammlungsfreiheit, Presse- und Meinungsfreiheit, Freiheit der Forschung gefordert. Danach verliest die Stimme Namen. Das hat sie seit Beginn der Besetzung am Mittwoch getan, immer sobald die Straßenbeleuchtung anging, aber bevor es Nacht wurde. Es sind die Namen von Menschen, die im Schatten bleiben. Wie die Freien Studenten an sie gekommen sind, ist ein Geheimnis. »Seien Sie gegrüßt, stellvertretender Adjutant Samaritis, 36 Jahre alt und Vater zweier Kinder. Greifen Sie nicht zu Gewalt gegen Ihre Brüder und Schwestern. Seien Sie gegrüßt, Inspektor Lamas, Alter unbekannt, aber unser Bruder. Greifen Sie nicht zu Gewalt. Seien Sie gegrüßt, Leutnant Klendros, 29 Jahre alt und Vater eines Jungen. Greifen auch Sie nicht zu Gewalt gegen Ihre Brüder und Schwestern. Seien Sie gegrüßt, Hauptmann Petr…«
Dimos wird noch eine Stunde lang fortfahren, ihre Namen zu verlesen. Eigentlich hatte ich ihm versprochen zu kommen, bevor er damit anfangen würde, aber jetzt habe ich es nicht eilig. Solange er am Mikrofon sitzt, hat er ohnehin keine Zeit.
DER ABEND VERDICHTET SICH WIE RAUCH. Nach einer Weile zünden die Leute auf den Bürgersteigen Feuer an. Die Flammen flackern und flattern, dennoch lässt sich schwer erkennen, wer sich im Zwielicht bewegt. Erst jetzt spüre ich, dass Unruhe in der Luft liegt, was wahrscheinlich daher kommt, dass es die dritte Nacht ist und die Leute allmählich ihrer Müdigkeit nachgeben möchten, die Stimmung scheint aber auch fiebriger zu sein – als würde die Dunkelheit mit Katzenfell gerieben. Plötzlich knufft mich jemand in die Seite. »Vorsicht, die haben dich gesehen!« Am Kiosk entdecke ich eine der Lederjacken, der Mann senkt seine Kamera. Die Jungs aus dem dritten Studienjahr sind verschwunden, die Menschen stehen dichtgedrängt und schreien. Die meisten drängen in Richtung Eingang, aber immer mehr Leute bewegen sich auch in die entgegengesetzte Richtung. Ich stecke das Heft in die Tasche. Es wird Zeit, zu Dimos hineinzukommen.
Je mehr ich mich dem Haupteingang nähere, desto dichter wird das Gedränge. Die Leute klammern sich nicht nur an den Zaun entlang des Boulevards, sie sitzen auch in den Palmen und Laternen dahinter. Einige wollen wissen, ob ich etwas gesehen habe. Als ich frage was, rufen sie: »Das Militär! Kommt es? Das Militär!« Bisher ist die Hochschule von Polizisten und Männern des Sicherheitsdienstes überwacht worden, aber alle befürchten, dass aus den Kasernen vor der Stadt Soldaten angefordert werden könnten, was hieße, dass die Regierung nicht beabsichtigt, weitere Proteste zu dulden. Keiner weiß, was dann geschieht. Hinter dem Metallzaun skandieren Menschen, die Hochschule sei eine Freistatt, trotzdem sehe ich, dass manche Stuhlbeine in der Hand tragen und einige mit Sand gefüllte Strümpfe halten. Andere rufen mit erhobenen Fäusten.
»Juppi ja ja, juppi juppi ja, juppi ja ja, juppi juppi ja …«
»Wir sind die Freien Studenten!«
Aus dem Lautsprecher ermahnt Dimos die Polizei, keine Gewalt anzuwenden, dann fährt er fort, Namen zu verlesen. Die Bleche blinken in dem elektrischen Licht. Der Lärm ist ohrenbetäubend.
Ich weiß, dass ich vor Mitternacht in das Gebäude gelangen muss, denn danach werden nicht einmal Sanitäter hineingelassen. Am ersten Abend hatten sich die Besetzer vom Sicherheitsdienst überrumpeln lassen. Die Männer hatten weiße Kittel angezogen, einige sogar ein Stethoskop um den Hals gehängt. Kaum waren sie im Gebäude, als sie auch schon mit Schlagstöcken und Bleischlägern losknüppelten. Dutzende Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich. Erst am Morgen konnten sie von einem Krankenwagen abgeholt werden. Nach Protesten des Roten Kreuzes bleibt die Polizei nun draußen, aber niemand weiß, wie lange noch.
KURZ VOR MITTERNACHT wird der Strom abgestellt. Von einer Sekunde zur nächsten liegt das Gelände im Dunkeln. Nur die Scheinwerfer der Polizei am Haupteingang funktionieren noch – sowie der Generator der Hochschule, weshalb das Hauptgebäude in der Nacht wie ein bleiches Kleinod leuchtet.
Seltsamerweise fühle ich mich sicher. Zigaretten glimmen in der Dunkelheit, Leute singen und rufen. Trotz der Dunkelheit scheint keiner ernsthaft damit zu rechnen, dass etwas passieren kann, nicht in diesem Meer aus Hoffnung und Menschen. Die Wärme, der Schweiß, die Nähe von Körpern, die pfeifen und rufen – all das gibt einem Schutz. Trotzdem merke ich widerstrebend, dass ich nicht mehr von wohlwollenden Knüffen ausgehen kann. Mehrere Male umfasse ich instinktiv meinen Bauch. In der Ferne heulen Sirenen; es scheinen Krankenwagen unterwegs zu sein. Dann ertönt ein Megafon, und eine Stimme, dünn wie Metallfolie, erklärt, die Behörden würden keinen weiteren Vandalismus tolerieren. Man verlange Respekt vor dem Gesetz und werde alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Ordnung wiederherzustellen. Personen, die sich in der Hochschule oder den umliegenden Straßen aufhielten, hätten dreißig Minuten Zeit, den Ort zu verlassen, danach werde eingegriffen. Dies sei eine ernst gemeinte Warnung.
In der Dunkelheit erklingen Proteste:
»Wenn ihr bleibt, dann bleiben wir auch!«
»Die Straße gehört allen!«
»Ihr könnt uns das Leben nehmen, aber nicht die Nacht!«
Es ist zu spät, um zurückzuweichen, und wozu sollte das auch gut sein? Die Stadt gehört den Demonstranten ebenso wie den Behörden. Die Polizei kann die Leute zwingen, nach Hause zu gehen, und jeden verhaften, der bleibt. Morgen werden die Proteste trotzdem weitergehen.
Immer mehr skandieren: »Setzen, setzen, setzen!« Und einer nach dem anderen setzen wir uns hin. Einige halten Feuerzeuge hoch, Brillen blitzen im Dunkeln auf, der Trotz wird siegen. Als ich die Silhouetten erkenne, habe ich das Gefühl, die Nacht bekommt Konturen. Auf den Straßen und Bürgersteigen, auf Bänken, in Blumenbeeten und unter erloschenen Straßenlaternen – überall sitzen Gestalten aus Dunkelheit und Widerstand, die sich weigern, sich einschüchtern und zum Schweigen bringen zu lassen, die sich weigern, aufzugeben. Die Polizei kann nicht alle verhaften oder verjagen. Obwohl die Zahl der Demonstranten kleiner ist als gestern, sind es zu viele und außerdem sind sie ein Teil des Dunkels. Jemand beginnt zu singen, andere stimmen ein. Am Ende zittert die Nacht wie eine Baumkrone.
ICH HABE KEINE AHNUNG, wie viel Zeit vergeht, bis am Haupteingang gellende Schreie ertönen. Kurz darauf bricht Tumult aus. Jemand ruft, auf den Dächern befänden sich Heckenschützen, alle müssten in Deckung gehen. Die Leute stehen auf und laufen los – keiner weiß wohin, Hauptsache fort. Ich denke nur: Jetzt geht es los.
Die Tasche unter den Arm geklemmt, bewege ich mich zu den Stichstraßen. Die Menschen, die vom Eingang kommen, halten sich den Bauch oder den Kopf. Eine junge Frau übergibt sich an einer Wand, während ihr Freund an ihr zerrt. Noch ist der Lautsprecher der Studenten zu hören, aber jetzt ist es nicht mehr Dimos, der spricht. Stattdessen ermahnt eine Frau: »Genossen, verlasst die Straßen nicht! Verlasst die Straßen nicht!« Es klingt nach der roten Flora.
Zwischen den Gebäuden knallt es laut, Angst breitet sich aus, wie eine Eisdecke bricht. Jetzt kann ich in der Dunkelheit näher rückende Soldaten sehen. Also ist das Militär gerufen worden. Die Männer gehen Rücken an Rücken, ihre Gewehre an die Schultern gehoben. Die Menschen weichen ihnen aus, pressen sich an Wände oder zwängen sich in Hauseingänge. Dann hört man ein harmloses »popp«. Unmittelbar darauf weitere. »Popp«, »popp«, »popp« … Es dauert einige Sekunden, bis ich begreife, was das ist. Metallhülsen scheppern über die Straße, die Luft ist von beißendem Rauch erfüllt. Und ich gerate in Panik.
DIMOS HAT MIR ERZÄHLT, als erstes seien die Augen betroffen. Sie würden brennen, dann spüre man einen Druck auf der Brust und danach werde einem schlecht. Ich weiß, dass ich nicht reiben darf, kann aber nicht anders. Ich brauche meine Augen, ich brauche meine Augen. Leute schlagen um sich, husten und schreien. Dem Tränengas kann man nicht entkommen, das Atmen wird immer schmerzhafter. Irgendwie gelingt es mir, mich zu einem einige Straßen entfernten Café durchzuschlagen. Vielleicht zieht mich der Mann mit, der mich vorhin gewarnt hat. »Hier, nimm das«, sagt er in dem Lokal und reicht mir sein Taschentuch, aber ich wühle erst in meiner Tasche. Als ich das Tuch mit Vaseline bestrichen habe, verwandelt es sich in ein klebriges Paradies.
Langsam klingt der Schmerz ab, trotzdem ist es ein Gefühl, als hätte ich Katzenkrallen in den Augen. Verwirrt merke ich, dass hier das Licht funktioniert. Durch die Tränen hindurch sehe ich die Kühltheke, in einer Ecke Stapel von Aschenbechern, den Taschentuchklumpen in meiner Hand. Ich schwöre mir, mich an jeden Gegenstand zu erinnern. Auch an die Uhr an der Wand – es ist fast ein Uhr nachts – und die Zahnstocher, die zwischen Gurkenscheiben und Öl auf einem Teller glänzen. Aber vor allem an das Taschentuch. Es ist rot, mit großen schwarzen Punkten wie jenes Kleid, das ich bekam, als ich mit vierzehn Jahren in allen Fächern außer Gymnastik gute Noten nach Hause brachte.
Ich weiß, ich darf hier nicht bleiben. Der Fremde ist mittlerweile verschwunden; die Männer starren mich an. Einige halten Spielkarten in den Händen, andere rauchen. Keiner sagt etwas. Von draußen dringen Schreie und Sirenen, dann ertönt wieder der Lautsprecher – erstaunlich deutlich, obwohl die Hochschule mehrere Häuserblocks entfernt liegt. »Schießt nicht auf eure Brüder und Schwestern, Soldaten! Schießt nicht!« Die Stimme der roten Flora schallt durch die Nacht und Verwirrung. »Soldaten, wir sind Brüder und Schwestern! Wir brauchen Ärzte! Warum schießt ihr? Schießt nicht!«
Hinterher schäme ich mich dafür, dass ich einen Knicks mache, bevor ich gehe.
AUF DER STRAßE ist dumpfes Rasseln zu hören, die Erde bebt wie ein eingesperrtes Gewitter. Es ist schwer zu sagen, was sich abspielt, aber es fallen immer mehr Schüsse und die Luft füllt sich mit Rauch. Überall husten Menschen. Einige bringen noch Proviant, Medikamente und Werkzeug, aber die meisten entfernen sich von der Hochschule. Als ich frage, schütteln alle den Kopf. Keiner weiß, was dort vorgeht. Mit dem Taschentuch vor dem Gesicht haste ich an den Fassaden entlang, schlage einen Bogen um das Gelände. Der Seiteneingang ist ebenfalls abgesperrt, aber wenn ich es bis dorthin schaffe, rechne ich damit, dass man mich hineinlässt. Es gibt immer jemanden, der mich erkennt. Und falls das nicht reichen sollte, müssen sie eben Dimos holen. Den mit den Sommersprossen. Der den Rundfunksender gebaut hat. Diesen Baum von einem Mann.
Im nächsten Häuserblock schließt ein Paar mittleren Alters gerade eine Tür auf. Mir fällt ein, dass ich vergessen habe, Stella anzurufen. So eine Hühnerkacke aber auch. Eigentlich hatte ich mich nach der Siesta bei ihr melden wollen, dann habe ich im Park Kaugummi gekauft und nicht mehr daran gedacht. Als ich die Haustür erreiche, lässt das Paar mich zwar eintreten, macht mir im Aufzug jedoch keinen Platz. Ich bleibe vor der Aufzugtür stehen, sehe auf der Anzeige die Zahlen aufleuchten und erlöschen. Am Ende nehme ich die Treppe. Als ich in die oberste Etage komme, höre ich, wie sich der Schlüssel im Schloss dreht. Ich klopfe an und bitte darum, telefonieren zu dürfen. Niemand öffnet mir, man antwortet mir nicht einmal.
Die Übelkeit nimmt zu. Im Café ist es mir gelungen, sie in Schach zu halten, aber jetzt muss ich würgen. Während ich darauf warte, dass der Anfall vorübergeht, reibe ich mich um Augen und Nasenlöcher mit Vaseline ein. Zähle die Atemzüge. Zähle sie noch einmal. Nach einer Weile bin ich es leid und zähle stattdessen das Ticken, bis das Licht ausgeht und der Schalter erneut gedrückt werden muss. So vergehen die Minuten. Doktor Kolver hat mich gebeten, vorsichtig zu sein, und das erste, was ich tue, ist Tränengas einatmen. Stella würde mich kreuzigen. Ich binde mir die Schuhe mit Doppelknoten zu; ich putze mir die Nase. Vielleicht schaffe ich es ja doch.
Kaum bin ich auf der Straße, als ich mich auch schon übergebe. Es kommt fast nichts hoch, nur Kaffee und Reste von einer Quiche oder einer Piroge – ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe, nach der Untersuchung und nachdem ich die Nieten in dem Eisenwarenladen gekauft hatte. Jedenfalls fühle ich mich befreit. Da stehe ich, die Handflächen auf die Knie gestemmt, der Rotz läuft, und warte darauf, mich zu entleeren. Die Beine zittern, der Magen krampft sich zusammen, ich frage mich, ob Teile von mir Schaden nehmen können. Als die Konvulsionen aufhören, merke ich, dass ich mich an der Lichtgrenze befinde. Hinter mir haben die Häuser Strom, vor mir liegen die Gebäude im Dunkeln. Zwei Schritte weiter und ich stünde mit einem Fuß auf jeder Seite. In manchen Fenstern flackern Kerzen. Wahrscheinlich verbergen sich hinter den Gardinen Menschen, stumme Zeugen des Geschehens. Wollen sie nicht etwas tun?
Ich bleibe auf der dunklen Seite der Straße. An der nächsten Kreuzung erkenne ich Silhouetten. Sie bewegen sich ruhig und systematisch, aber es ist schwer zu sagen, was sie tun. Je länger ich die Gestalten betrachte, desto überzeugter bin ich, dass es sich um Soldaten handelt. Ich vermute, sie riegeln die Gegend ab, was bedeuten würde, dass die Hochschule gestürmt werden soll. Als die Besetzung im Frühherbst geplant wurde, waren sich alle einig, dass keine Waffen verwendet werden dürften. Dimos erzählte, die Mitglieder verbotener Organisationen hätten trotzdem darüber abstimmen wollen. Die Rote Flora meinte, das Militär werde uns nicht verschonen, nur weil wir eine friedliche Lösung der Bildungsfrage anstrebten. Schließlich hatte er sich erhoben. Die Frage laute doch eher, ob es für die Studenten von Vor- oder von Nachteil sei; Gewalt säe Gewalt. Stattdessen könne man die Namen der Männer vom Sicherheitsdienst bekannt machen. Zum Beispiel. Warum sollten sie anonym bleiben dürfen, wenn kein anderer es sein dürfe? Damit war die Sache entschieden.
Während ich darüber nachdenke, wie ich an den Soldaten vorbeikommen soll, kriecht ein Taxi heran. Ausgeschaltete Scheinwerfer, schwaches Quietschen der Karosserie. Später wird mir klar, dass es mir gefolgt sein muss. Der Fahrer kurbelt das Fenster herunter. Zwei Personen sitzen auf der Rückbank, vermutlich Studenten. Die eine, ein pickeliges Mädchen, sieht mich mit unergründlichem Blick an.
»Beeil dich. Sie werden uns jeden Moment entdecken.«
ALS ICH IN DAS AUTO gestiegen bin, setzt es zurück und biegt in Richtung Textilviertel ab. Nach einer Weile schaltet der Fahrer das Licht an. Wir fahren durch verlassene Straßen. Er fragt mich, wie ich heiße. Studiere ich an der Hochschule? Habe ich Freunde auf dem Gelände? Mir ist schlecht und ich sage nur, dass es toll wäre, wenn er mich an dem Platz ein paar Häuserblocks weiter absetzen könne, von dort aus würde ich zu Fuß gehen. Als wir uns der Stelle nähern, tauchen jedoch Militärpolizisten auf. Lastwagen sind auf den Bürgersteig gefahren, Motorräder neben einer Straßensperre geparkt worden. Offenbar dient ihnen der Platz als Stützpunkt. Sogar ein Panzer befindet sich dort. Ein Soldat winkt. Er trägt einen weißen Helm und weiße Handschuhe. Fluchend biegt der Fahrer in eine Seitenstraße ab. Unmöglich, dort zu halten, am besten, er fahre mich nach Hause. Wo hatte ich noch mal gesagt, dass ich wohne?
Auf dieser Seite des Boulevards scheint die Stadt evakuiert worden zu sein. Verwaiste Straßen, Säcke mit Stoffresten auf schlecht beleuchteten Gehwegen, billige Schneidereien und Lagerräume. Wenn wir über ein Schlagloch im Asphalt fahren, schaukelt der Wagen jedes Mal kurz. Dann fühlt es sich an, als gehörten wir zusammen, der Fahrer, die beiden auf der Rückbank und ich – eine verschworene Gemeinschaft, eine endlose Nacht. Keiner sagt etwas, aber der Mann hinten raucht. Auch das verstärkt das Gefühl von Gemeinschaft, obwohl mir wieder schlecht wird. Als wir an einer Kreuzung halten, sehe ich einen zotteligen Hund im Müll wühlen. Er bellt mit aufgestelltem Schwanz und gespitzten Ohren. So muss die Stadt vor knapp sieben Jahren ausgesehen haben, während des Ausnahmezustands aus Anlass dessen, was in den Schulbüchern die nationale Revolution genannt wird. Leer, aber voller Müll.
Wenn mich das Taxi abgesetzt hat, werde ich zurückgehen. Ich weiß nicht, wie ich in die Hochschule gelangen soll, will aber nicht, dass noch eine Stunde ohne Dimos vergeht. Zehn Minuten später fährt das Taxi wieder an dem Hund vorbei. Im ersten Moment begreife ich es nicht, dann wird mir klar, dass hier kein Anhänger der Studenten am Lenkrad sitzt. Im selben Moment legt der Mann auf der Rückbank eine Hand auf meine Schulter und bittet mich um meine Filztasche. Unmittelbar darauf kehren wir zu dem Platz zurück. Diesmal hat der Fahrer keine Angst, zu dem Soldaten zu fahren. Er kurbelt das Seitenfenster herunter und sagt fast heiter, dem Mädchen hinten und danach mir zugewandt: »Noch zwei.«
Ich kann nicht einen würdevollen Gedanken fassen.
II.
ALS DAS FALSCHE TAXI verschwunden ist, werden Zoe und ich auf die Ladefläche eines Lastwagens gescheucht. Zoe, das ist das Mädchen auf der Rückbank. Ich erfahre erst am nächsten Tag, wie sie heißt. Dass sie siebzehn, fast achtzehn ist, und in die Abschlussklasse eines humanistischen Gymnasiums geht. Die Soldaten brüllen, wir sollen still sein. Sie heben die Gewehrkolben und spucken aus, als keiner etwas sagt. Manche riechen nach Alkohol, alle scheinen unter Druck zu stehen. Auf die Ladefläche sind Bänke montiert worden. Vielleicht saßen die Soldaten ein paar Stunden früher selbst darauf; jetzt werden auf ihnen Studenten sowie Personen zwischen fünfunddreißig und sechzig zusammengepfercht. Ein Mann in einem zerrissenen Jackett sieht aus wie ein Anwalt, ein anderer trägt ein Paar Fußballschuhe in einer Stofftüte. Mehrere stöhnen, halten das Hemd an den Kopf gepresst. Ich lande neben einem Mann, dessen einer Arm unbrauchbar im Schoß liegt, Zoe mir gegenüber.
Alles riecht nach Angst und Urin.
EINE HALBE STUNDE SPÄTER sind wir da. Der Motor wird ausgeschaltet, aber wir sollen unter der Plane sitzen bleiben. Es sieht nicht so aus, als hätte man uns zu einer der Kasernen gebracht. Man hört erstickte Rufe; Gefangene werden von anderen Fahrzeugen heruntergezerrt und umhergestoßen. Es herrscht Verwirrung, Befehle werden erteilt und wieder zurückgenommen. Schließlich wird auch unsere Ladefläche geleert.
Es scheint sich um eine Tiefgarage zu handeln. Hier und da flimmern Neonröhren, ansonsten ist es dunkel und riecht nach Diesel. Der Lastwagen setzt zurück und verlässt das Gebäude, die Abgase hängen in der Luft. Die Wärter reihen uns an einer Wand auf. Jeweils eine Armlänge Abstand zum nächsten, das Gesicht zum Beton. Am nächsten Tag erzählt jemand, dies nenne man Strammstehen. Wir stehen da, die Hände auf dem Rücken, die Hacken zusammengeschlagen und die Nase zur Wand. Vorgelehnt, als wären wir kurzsichtig. Nach einer Weile beginnt der Körper zu schmerzen, nach einer Stunde fühlt es sich an, als würde die Wirbelsäule brechen. Lehnt man sich mit der Stirn an die Wand, pressen die Wärter das ganze Gesicht dagegen und reiben es an ihr, bis die Haut aufschürft.
Zwei Soldaten halten Wache, beide sind in meinem Alter. Der eine redet viel, der andere antwortet karg. Der Gesprächigere kontrolliert, dass wir richtig stehen. Geht hinter den Rücken her, lässt die Stiefel knarren. Ab und zu beugt er sich vor, faucht »Bulgarenschwein« oder fragt, ob es vielleicht ein »Polizeijuwel« sein dürfe. Niemand antwortet, aber weiter entfernt jammert jemand. Der Soldat schimpft. Der andere lacht, was ihn zum Weitermachen anspornt. Wenn er noch einen Mucks vom Genossen Bulgarien höre, werde er persönlich dafür sorgen, dass Minus zwei frei werde. Das Jammern geht weiter, dann hört man einen Schlag und einen Aufschrei und jemand fällt hin. Niemand wagt es, sich umzudrehen. Als das Jammern in Wimmern übergeht, schlägt der Gesprächige wiederholt mit dem Schlagstock auf seinen Handteller. Schwülstig und ruhig erklärt er hinter uns: »Genosse Bulgarien darf liegen.«
Aus anderen Teilen des Gebäudes dringt Lärm zu uns heraus, wo wir uns befinden, surren nur die Neonröhren. Ich staune, dass mein Rücken das aushält. Ich tue nur eins, mich vorlehnen. Aber die Glieder sind steif, der Nacken sitzt wie in einem Schraubstock, die Beine zittern und geben sicher bald nach. Nicht eine Minute länger, denke ich. Dann: Nicht noch eine. Ich versuche die Übelkeit in den Griff zu bekommen, ohne über den Zement zu scharren, die Gedanken tanzen umher wie Mücken. Ich weiß nicht, wo Dimos ist, weiß nicht, was in der Hochschule passiert ist, weiß nicht, was geschehen wird.
Atme ruhig und still, rede ich mir ein. Einatmen, die Luft anhalten, und wieder ausatmen. Ein, anhalten – und wieder aus. Ein, anhalten – und wieder aus. Es dauert eine Weile, bis ich erkenne, dass der Rhythmus an den letzten Paragraphen in unserem alten Grundgesetz erinnert. Eins, und eins – und dann vier … Eins, und eins – und dann vier … Trotz meiner Sorgen bringt diese Entdeckung mich fast zum Lachen. Hier stehe ich in einer Tiefgarage, mit Gliedern aus Glas, und atme aus Protest gegen die Regierung des Landes. Wenn Mutter das wüsste. Sollte das Militär den Bürgern weiter die Meinungsfreiheit verweigern, könnten wir so weitermachen. Kein Wort, kein Zugeständnis, nur dieser untrügliche Rhythmus, bis die Luft frei wäre. Jeder Atemzug stärker als ein Ausrufezeichen.
DIMOS MEINT, es gebe viele Gründe dafür, dass Menschen verhaftet würden. So könne es darum gehen, Informationen über illegale Organisationen zu beschaffen, manchmal geschehe es als Strafe, häufig auch, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Die wichtigste Aufgabe sei jedoch religiöser Art. Andersdenkende sollten »bekehrt« werden.
Er hat das Wort heute Morgen benutzt, als er das erste Mal seit Beginn des Aufstands am Mittwoch zu Hause war. Er suchte gerade seine Sachen zusammen. Wie immer, wenn er es eilig hatte, war er von einer Wolke aus Eau de Cologne umgeben. Plötzlich hielt er inne. Ging es bei meinem Arztbesuch auch wirklich um nichts Ernstes? Warum sollte ich sonst schon wieder hingehen; ich war doch erst vor zwei Tagen dort gewesen? Fast hätte ich ihm die Wahrheit gesagt, aber das letzte Prozent Ungewissheit hinderte mich daran. Außerdem hatte ich keine Ahnung, was ich selbst davon halten sollte. Meine Freude war noch zu unförmig, wahrscheinlich fürchtete ich mich auch ein wenig. Also antwortete ich lieber, die Ärztin wolle nur sichergehen, dass die Schmerzen nicht bedeuteten, mein Rücken mache wieder Probleme.
»Aha. Aber du kommst heute Abend?« Laut Dimos geschahen die schlimmsten Misshandlungen in der Medusastraße. Eigentlich heiße die Straße anders, sei im Volksmund jedoch schnell umbenannt worden. Der Name passe perfekt. In dem neuen Hauptquartier, das der Sicherheitsdienst erst kürzlich bezogen habe, sei man auf Gänsehaut spezialisiert. Niemand werde freigelassen, ohne vorher vor Furcht erstarrt zu sein. Nach der Behandlung sei es leicht, die Verhafteten so weit zu bringen, dass sie die Namen von Kameraden verrieten und die Loyalitätserklärung unterschrieben. Die Karteikarten sorgten dafür, dass niemand seine Vergangenheit verleugnen könne.
Ich wollte wissen, warum er das ausgerechnet jetzt erwähnt. Schließlich wusste ich, dass die Dokumente in den alten Räumlichkeiten des Sicherheitsdienstes hinter dem Nationalmuseum verwahrt wurden. Warum über die schwarzen Archive sprechen, das böse Gedächtnis der Junta, wenn die Proteste endlich Wirkung zu zeigen schienen?
Dimos nickte düster, mit Schnürsenkeln in den unentschlossenen Händen. Seine Haare waren nass und ich sah, dass ihm durch den Kopf ging, was ich über die Ärztin gesagt hatte. Wer unterschreibt, schwört falschen Göttern ab, fuhr er schließlich fort. Wenn sie die Loyalitätserklärung erst einmal archiviert hätten, sei nichts mehr zu machen. Dann sei man zu Kirche, Familie und unserer heiligen Nation bekehrt. Zum zweiten Mal getauft.
Aha, verstehe. Ich streifte mir ein Unterhemd über und setzte Kaffee auf. Wollte er auch einen? Ich hatte nicht die Absicht, rührselig zu werden, bevor ich den Befund zu meiner Urinprobe erhalten hatte. »Oder soll ich dir dabei helfen?«
»Was?« Dimos blickte erstaunt auf seine Schnürsenkel. »Nein, nein.« Endlich band er sich die Schuhe zu und suchte nach seiner Lederjacke. Die Ersatzteile für die Rundfunkanlage lagen in der Tasche an der Tür. Er glaubt nicht, dass er es zur Apotheke schafft; wenn ich unterwegs Vaseline und ein paar andere Dinge besorgen könnte, wäre das toll. Der schlimmste Vorwurf, fuhr er fort, betrifft Verstöße gegen Paragraph 509. Dann reicht nicht einmal die Unterschrift aus, um einer Strafe zu entgehen. Bestenfalls erhält man Berufsverbot, schlimmstenfalls wird man deportiert und erhält Berufsverbot, wenn man zurückkommt. Paragraph 509 bezieht sich auf Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates oder Versuche, fremden Mächten zu helfen, Teile des Landes zu erobern. Es reicht schon, wenn der Sicherheitsdienst einem nachweisen kann, dass man »Genossen« hatte. Dimos blieb stehen. »Ich finde meine Jacke nicht. Wo ist meine Jacke?«
»Hier vielleicht?« Ich hob die Slacks und das Hemd vom Stuhl.
Er tastete seine Taschen ab und warf etwas auf das Regal in der Kochnische. Man muss nicht einmal Mitglied einer verbotenen Organisation sein, ergänzte er, als habe das eine etwas mit dem anderen zu tun. Deshalb sei es so wichtig, keine kompromittierenden Papiere bei sich zu tragen. Ich müsse ihm versprechen, so vorsichtig wie möglich zu sein, wenn ich kam. Man habe die Kontrollen ausgeweitet, insbesondere in den Häuserblocks um die Hochschule. Es war zwar strafbar, keine Papiere bei sich zu tragen, aus denen hervorging, dass man Student war. Aber wenn ich erwischt würde, könnte ich es immer auf Vergesslichkeit oder Schludrigkeit schieben. Eine hinkende Dreiundzwanzigjährige erweckt kein Misstrauen. Es sei ohnehin klüger zu schweigen. Je weniger ich sage, wenn die Polizei mich um meine Papiere bittet, desto weniger kann man mir vorwerfen. Außerdem hätte ich immer noch meinen Nachnamen, falls ich ihn denn verwenden wolle.
Dimos sah mich so traurig an, dass ich mit der Hand unter seinem bärtigen Kinn herstrich. »Du vergisst, dass ich längst bekehrt bin. Es wird schon nichts passieren. Wir sehen uns heute Abend.«
AB UND ZU wird jemand geholt; am Morgen ist Wachablösung. Die neuen Wärter sind in Zivil und riechen nach Pulverkaffee sowie Zigaretten. Gereizt teilen sie uns auf. Zuerst werden die Männer abgeführt – außer dem mit dem gebrochenen Arm, er wird in den Aufzug geschleift. Danach zeigen die Wärter in die hintere Ecke. Dort liegt offenbar die Abfahrt zu einem tieferen Parkdeck; nun entdecke ich, dass es an beiden Seiten auch Gittertüren gibt. Hinter einer sind schemenhaft Gestalten erkennbar. Als wir näher kommen, sehe ich, dass es Frauen sind. Sie wirken müde; keine spricht ein Wort. Die Wärter schließen die leere Zelle auf und stoßen uns hinein. Der Raum ist etwa zwanzig Quadratmeter groß, wir sind genauso viele. Jemand behauptet, unsere Nachbarn seien Prostituierte. Nein, Drogensüchtige, murmelt eine andere. Als würde das eine das andere ausschließen, denke ich. Oder als spielte es eine Rolle.
IN DER ZELLE lerne ich Zoe kennen. Besser gesagt: Dort erfahre ich, wie sie heißt.
Zoe hat Locken wie Holzwolle, Augen so rund wie Knöpfe. Wenn sie keine Brille trägt, sieht sie fragend aus, sonst ist ihr pickeliges Gesicht ernst. Wir sitzen an eine feuchte Wand gelehnt, die uns beide husten lässt. Der Platz reicht nicht, um die Beine auszustrecken. Zoe zieht die Knie an und versucht es noch einmal. Wenn sie spricht, bewegt sie nur die Lippen. Ich kenne das von mir selbst; man schämt sich für seine Zähne, lächelt selten, wirkt reservierter, als man in Wahrheit ist.
Stunden vergehen. Manchmal treffen Fahrzeuge ein, die zum nächsten Parkdeck hinunterfahren. Zoe wäscht sich, danach erzählt sie, dass ihre Eltern in der »Partei« seien. Ich erwidere nichts. Wenn jemand dieses Wort benutzt, kann es nur Moskau bedeuten. Nach dem letzten Gefängnisaufenthalt flohen ihre Eltern nach Osten. Sie selbst lebt seit zehn Jahren bei ihrer Tante, aber eines Tages wird sie ihnen nachreisen. Warum, sagt sie nicht. Sie schaut sich um, dann flüstert sie, sie habe gerade »du-weißt-schon-was« bekommen. Ich gebe ihr mein Taschentuch. Es sei zwar klebrig, aber wenn sie wolle, könne sie es haben; ich bräuchte es nicht. Anschließend presse ich die Fingerspitze gegen die Unterlippe. Sie muss aufpassen, mit wem sie spricht. »Was ist, Genossin?« Als Zoe keine Antwort bekommt, fragt sie noch einmal, dazwischen ist es, als litte sie unter Gedächtnisschwund. Sie könne das Taschentuch als Binde benutzen, wiederhole ich, dann lege ich den Kopf auf die Knie. Auch die anderen sind zu ängstlich oder müde, um zu reden. Als Zoe das Taschentuch gefaltet und sich nochmals die Hände gewaschen hat, schaut sie durch die Luke unter der Decke hinaus. Das Einzige, was es dort zu sehen gibt, ist ein asphaltierter Innenhof. Tauben gurren in dem körnigen Licht, und es kommt einem vor, als stehe man mit der Nase knapp über der Wasseroberfläche. Sie wendet sich mir zu. Wenn sie spricht, bewegt sich ihr Gesicht tatsächlich nicht.
Schließlich begreift sie, dass ich nicht vorhabe, ihr zu antworten, und gesellt sich zu einer anderen Frau. Die beiden unterhalten sich lange, fast vertraulich. Plötzlich erklärt die Frau jedoch – ungewöhnlich laut, während sie sich wie nach einem Kellner umschaut –, sie habe keine Zeit für Politik. Zoe solle sie Frau Ikonomou oder einfach gnädige Frau nennen. Sie hält Zoe eine Scheibe Brot hin. »Iss, Mädchen. Und frag nicht so viel.«
AM NACHMITTAG kommt ein Mann mit kupferroten Haaren. Seine Tolle ist gewellt und hängt ihm in die Stirn wie fein gesponnenes Metall. Er unterhält sich mit den Wärtern, als ihn eine Frau in der Zelle auf der anderen Seite der Abfahrt ruft und wissen möchte, wie lange sie noch eingesperrt sein werden. Als sie nicht lockerlässt, geht er zu ihr. »Lass mich erst die Neuen begrüßen, dann sehen wir weiter.« Mit einem Stift in der Hand beginnt er, uns zu zählen.
Die Frau zerrt an dem Gitter. »Die Politischen kommen immer zuerst, was?«
»Fordere mich nicht heraus, Rita.« Der Mann kehrt zum Aufzug zurück, dabei seinen Stift schüttelnd, als wäre er ein Zeigefinger. »Oder möchtest du tauschen?« Das Lachen verstummt, als der Aufzug kommt. »Ihr fahrt in einer Stunde.« Dann schließt sich die Tür.
Eingeschüchtert von diesem Besuch berichtet eine Frau, welche ihrer Freunde wir warnen sollen, falls eine von uns ohne Verhör freigelassen wird. Die meisten sitzen jedoch nur schweigend da oder sind übertrieben höflich, als wollten sie nicht einmal sich selbst gegenüber zugeben, wo sie sich befinden. Und dann ist da noch die Frau, die ununterbrochen weint.
Die Untröstliche ist darauf bedacht, dass keiner Privilegien genießt. Sobald der Verdacht aufkommt, beschwert sie sich bei der gnädigen Frau, die bereits zu der Person geworden ist, an die sich alle wenden. Meistens geht es darum, wo einer sitzen soll oder wer sich als nächster waschen darf. In einer Ecke ist ein Porzellanbecken installiert. Über dem Kaltwasserhahn hängt ein Behälter mit Seifenpulver, das ausgerechnet dann ausgeht, als die Untröstliche sich waschen will. Rasend schlägt sie um sich. Sie hat keine Seife bekommen! Andere haben sich schon zweimal gewaschen. Zweimal! Aber sie hat keine Seife bekommen! Der Speichel in ihren Mundwinkeln wird weiß, aus der Nachbarzelle schallen Rufe herüber. Schließlich bricht sie zusammen, schluchzt hässlich und hilflos mitten im Raum. Die gnädige Frau führt sie zum Waschbecken zurück, wo die beiden mindestens zwanzig Minuten stehenbleiben. Zoe beobachtet sie unablässig, ohne eine Miene zu verziehen. Woher die gnädige Frau das Stück Seife hat, das sie unter den Wasserhahn hält, weiß niemand, aber am Ende hat sie der Untröstlichen Gesicht, Hals, Achselhöhlen und Rücken gewaschen. Endlich versiegen die Tränen.
Dieses Seifenpulver kenne ich aus den Fernzügen, die wir früher nahmen, als Theo noch zu Hause wohnte und die Zeit für unseren alljährlichen Besuch in Tante Notas Heimatdorf gekommen war. Es sind die gleichen papierartigen Krümel, die nie schäumen, sondern sich in eine glatte Schicht verwandeln, die sich mit kaltem Wasser nicht abwaschen lässt. Häufig findet man noch Stunden später Krümel auf der Haut. Sie trocknen in den Haaransatz ein, unter dem Kinn, auf den Wangen. Hebt man die Hände zum Gesicht, riechen diese weiter nach Schmutz. Die gnädige Frau tut mit ihrem Stück Seife, was sie kann, dennoch wissen alle, dass die Untröstliche auch nach vierundzwanzig Stunden Waschen genauso riechen würde wie wir.
Nach Schweiß, Menstruationsblut, Angst.
GEGEN MITTAG
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: