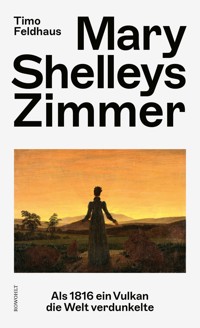
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1815 explodiert auf einer indonesischen Insel der Tambora. Es ist der heftigste Vulkanausbruch der Neuzeit und bewirkt enorme Klimaveränderungen. Kalt und dunkel wird es, auch in Europa kommt es zu einem Jahr ohne Sommer. Timo Feldhaus folgt der riesigen Schwefelwolke, die die Welt verdüstert, und beobachtet, was unter ihr geschieht: Goethe entdeckt die Wolkenwissenschaft und wird nie wieder in den Urlaub fahren. Caspar David Friedrich malt giftgelbe Sonnenuntergänge, Napoleon sitzt einsam auf der Insel St. Helena und hat alles verloren. Ein Mädchen sieht ihre Familie verhungern und irrt durch ein Deutschland, in dem die nationale Idee aufkeimt. In Genf kommt es zu einer künstlerischen Eruption: Die 18-jährige Mary Shelley, gerade mit ihrer Liebe aus London geflohen, versteckt sich vor den Unwettern bei Lord Byron, dem ersten Rockstardichter. Hier kommt dem stillen, hochtalentierten Mädchen die Idee für ihren ersten Roman: die Geschichte von Frankenstein und seinem Monster, die erste Science-Fiction. Timo Feldhaus beschreibt einen Himmel und eine Welt im Umbruch – die der heutigen überraschend ähnlich ist. Es ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte inmitten einer Klimakatastrophe. Und genau so passiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Timo Feldhaus
Mary Shelleys Zimmer
Als 1816 ein Vulkan die Welt verdunkelte
Über dieses Buch
1815 explodiert auf einer indonesischen Insel der Tambora. Es ist der heftigste Vulkanausbruch der Neuzeit und bewirkt enorme Klimaveränderungen. Kalt und dunkel wird es, auch in Europa kommt es zu einem Jahr ohne Sommer.
Timo Feldhaus folgt der riesigen Schwefelwolke, die die Welt verdüstert, und beobachtet, was unter ihr geschieht: Goethe entdeckt die Wolkenwissenschaft und wird nie wieder in den Urlaub fahren. Caspar David Friedrich malt giftgelbe Sonnenuntergänge, Napoleon sitzt einsam auf der Insel St. Helena und hat alles verloren. Ein Mädchen sieht ihre Familie verhungern und irrt durch ein Deutschland, in dem die nationale Idee aufkeimt.
In Genf kommt es zu einer künstlerischen Eruption: Die 18-jährige Mary Shelley, gerade mit ihrer Liebe aus London geflohen, versteckt sich vor den Unwettern bei Lord Byron, dem ersten Rockstardichter. Hier kommt der stillen, hochtalentierten Frau die Idee für ihren ersten Roman: die Geschichte von Frankenstein und seinem Monster, die erste Science-Fiction.
Timo Feldhaus beschreibt einen Himmel und eine Welt im Umbruch – die der heutigen überraschend ähnlich ist. Es ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte inmitten einer Klimakatastrophe. Und genau so passiert.
Vita
Timo Feldhaus, geboren 1980, ist Journalist und Autor. Nach einem Studium der Literaturwissenschaft schreibt er für Monopol, Welt am Sonntag, Zeit Online und Der Freitag über Kunst- und Gesellschaftsthemen. Er arbeitete an der Volksbühne Berlin. Mit seiner Familie lebt er in Berlin und München.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung HelloMe,www.hellome.studio
Coverabbildung «Frau vor der untergehenden Sonne», Caspar David Friedrich, um 1818. Museum Folkwang/akg-images
ISBN 978-3-644-00939-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
1 London
2 Weimar
3 Sumbawa
4 London
5 Paris, Wien
6 London
7 Sumbawa
8 London
9 Sumbawa
10 Waterloo
11 Rügen
12 London
13 Weimar
14 Europa
15 London
16 Dresden
17 London, Genf
18 St. Helena
19 Aargau
20 Diodati
21 Weimar
22 Diodati
23 Berlin
24 Diodati
25 Wien
26 Stuttgart
27 Diodati
28 London
29 Dresden
30 Genfer See
31 Mauretanien
32 Genf, Weimar
33 New Lanark
34 Mont Blanc
35 London
36 Weimar
37 Stuttgart
38 London
Epilog
Frankenstein
Katharina von Württemberg
Thomas Stamford Raffles
Napoleon Bonaparte
John Polidori
Percy Bysshe Shelley
Lord Byron
Johann Wolfgang von Goethe
Louise Seidler
Caspar David Friedrich
Mary Shelley
Ada Lovelace
Friedrich Ludwig Jahn
Claire Clairmont
Tambora
Dank
Quellen
Für Mila und Maurin
1London
Mary Godwin saß an einen Grabstein gelehnt auf dem Friedhof St. Pancras. Es war der 26. Juni 1814, ein Sonntag, und einer dieser unentschiedenen Tage, die noch die Nässe des Frühlings mit dem schon tiefgoldenen Licht des Sommers kombinieren. Vögel sangen ein paar Lieder. Mehrmals die Woche pilgerte die Sechzehnjährige hierher, um zu lesen, zu schreiben oder einfach, um vor der sich rasant zum Mittelpunkt der Welt entwickelnden Stadt ihre Ruhe zu haben. Mary trug ein hochgeschlossenes Kleid von spröder Eleganz. Sie war groß und dünn, ihre blondbraunen Haare flatterten im Wind wie eine Flagge über einem seltsamen schönen Haus.
Nun öffnete sich leise das eisenbeschlagene Friedhofstor, und ein Mann trat ein. Er hieß Percy Bysshe Shelley und warf eine Nuss in die Luft, die einer eleganten Kurve folgend in seinem Mund landete. Percy war überzeugter Vegetarier. Begleitet wurde er von Marys Halbschwester Jane, die ihn als geheimer Kurier herbringen sollte und sich nun losmachte, um Räder schlagend im Grün zu verschwinden. Marys Herz klopfte, als sie sich aufrichtete. Percy sah sie, hüpfte kurz etwas auf und beschleunigte seinen Gang. Der hochintelligente Student hatte die Eliteschulen Eton und Oxford besucht und erst vor Kurzem öffentlich der Religion abgeschworen, dadurch die Institution der Universität hinter sich gelassen, beziehungsweise sie ihn, und so durchaus mutwillig den Bruch mit der eigenen Familie vollzogen. In diesem Moment hatte der 20 Jahre alte Percy das flirrende Gefühl im Körper, wenn ein in der eigenen Epoche noch nie gedachter, also völlig neuer Gedanke einen Menschen überfällt. Nämlich, dass er sich nach Religion, Familie und Staat nun auch von dem die marode Gesellschaft zusammenhaltenden verbliebenen Ideal der Zweierbeziehung frei machen würde. Die Liebe würde nur größer, weil wahrer, dachte er euphorisch und noch mehrmals aufhüpfend. Percy stand beinahe vor Mary, er wollte ihr schnell und viel erzählen von dem, was ihm flammend im Schädel herumwirbelte. Doch Mary Godwin nahm seinen Kopf in beide Hände und küsste ihn auf den Mund. Sie hatte sich das gut überlegt und war jetzt dennoch unglaublich erschrocken. Es war der erste Kuss ihres Lebens. «Ich will dich», flüsterte sie heiser, und ihr Kopf zersprang.
Der ungestüme und sehr zärtliche Kuss, der genau eine Minute und 24 Sekunden dauerte, fühlte sich spektakulär an. Kurz darauf schrieb Percy einem Freund über Mary: «Ich glaube nicht, dass es größere Vollkommenheit gibt, zu der die menschliche Natur gelangen könnte. Wie tief empfand ich meine Unterlegenheit, wie bereitwillig gab ich zu, dass sie mich an Originalität, echter Erhabenheit und Brillanz weit übertraf, ehe sie einwilligte, ihre geistigen Fähigkeiten mit mir zu teilen.»
Mary lachte ihm ins Gesicht, er konnte nichts sagen. P.B. Shelley, der übrigens Schriftsteller werden wollte, waren die Worte abhandengekommen. Sie umarmten sich und fielen vor dem Grabstein ins Gras.
Es begann wie die älteste Geschichte der Welt, eine junge Frau und ein junger Mann. Seine Eltern waren reich und langweilig, Barone aus Sussex. Ihre waren Londoner, häufig knapp bei Kasse, dafür extrem interessant. Percy bewunderte sie abgöttisch, vor allem Marys Mutter. Sie gehörte zu den ersten Feministinnen der Welt, eine europabekannte Intellektuelle. Von vielen geachtet, von vielen geächtet. Ihre Mutter war daran gestorben, Mary auf die Welt zu bringen, und die Tochter konnte sich das nicht verzeihen. Ihre Mutter hieß wie sie, Mary. Aber an ihrer Stelle waberte nun die eigene ungenügende Existenz. Mary trauerte jeden Tag, und bei allem, was die Sechzehnjährige über ihre Mutter herausfand, wusste sie genau, dass das das Letzte war, was diese gewollt hätte.
Es blieb ihr Vater, Sozialphilosoph und Schriftsteller. ‹Alles gehört allen›, diese Idee hatte William Godwin praktisch erfunden. Jetzt war er sauer auf seine Tochter, wegen Percy. Sie verbrachten zu viel Zeit miteinander. Mary konnte nicht sauer auf ihren Vater sein, noch nicht. Wie so vieles war auch Percy durch ihn in ihr Leben gekommen. Mary und er kannten sich seit acht Wochen.
Sie roch seinen Schweiß und das Gras unter ihnen. Es hatte wehgetan, nun war sie stolz. Sie sah in die Blätter, ihr Vater hatte ihr hier das Lesen beigebracht, indem er ihre kleinen Finger über den Grabstein und die dort hineingemeißelten Buchstaben geführt hatte: M A R Y. Sie war in sich gekehrt, ein bisschen nerdy, manchmal war Percy fast unheimlich zumute mit Mary, als käme sie aus der Zukunft. Sie war überzeugt, in ihm einen Gefährten gefunden zu haben. Menschen empfand sie als seltsam, langweilig, zu, immer gleich, dumm. Aber das sagte sie niemandem, denn es war hochmütig. Also schwieg sie oft und ließ ihre Augen leuchten. Die Leute fanden das niedlich, die Leute hatten eben auf die schrecklichste Art keine Ahnung von nichts.
«Wow», sagte Percy, nachdem sie lange geschwiegen hatten.
«Weißt du», sagte Mary, «ich habe darüber nachgedacht, was wir gestern besprochen haben, als wir durch die Stadt gelaufen sind.»
«Was meinst du?», seufzte Percy träumend. Die Dämmerung setzte ein, er war in das Streicheln der Härchen auf ihrem Arm vertieft.
«Wie wir leben. Der Rauch aus den Schloten der Fabriken.»
«Ah ja, die neuen Maschinen.»
«Ja, genau.»
Die beiden hatten gesehen, wofür die Arbeiter keine Worte hatten, doch was sie in jeder müden Faser viel größer spürten. Die Maschinen waren ihnen überlegen, brauchten keinen Schlaf und machten sie bald überflüssig. Eine Revolution walzte durch die Straßen, doch sie war nicht von Menschen gemacht.
«Ich glaube, wir haben uns geirrt. Wir Menschen sind größer und stärker als jemals zuvor. Obwohl jeder Einzelne sich schwach fühlt. Das ist das Seltsame daran. Wir treiben gewaltige Dinge gegeneinander. Wir haben es selbst in der Hand.»
Mit leicht geöffnetem Mund hörte Percy zu, während Mary sich langsam aufrichtete und ein Buch aus ihrem Rucksack kramte. «Das habe ich gestern Abend in Vaters Bibliothek gefunden, es ist von Herder, diesem deutschen Philosophen. Es muss falsch einsortiert gewesen sein, ich hatte nach Schauergeschichten für uns gesucht.» Mary blätterte durch das Buch. «Es steht ein komisches Wort darin, es heißt ‹Klima›.»
«Klima?», fragte Percy.
Mary hatte die Stelle gefunden. «Warte mal, ich lese es dir vor: ‹Seitdem er das Feuer vom Himmel stahl und seine Faust das Eisen lenkte, seitdem er Tiere und seine Mitbrüder selbst zusammenzwang und sie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog, hat der Mensch auf mancherlei Weise zur Veränderung desselben mitgewirket. Europa war vormals ein feuchter Wald, und andre jetzt kultivierte Gegenden waren’s nicht minder: es ist gelichtet, und mit dem Klima haben sich die Einwohner selbst geändert. Wir können also das Menschengeschlecht als eine Schar kühner, obwohl kleiner Riesen betrachten, die allmählich von den Bergen herabstiegen, die Erde zu unterjochen und das Klima mit ihrer schwachen Faust zu verändern. Wie weit sie es darin gebracht haben mögen, wird uns die Zukunft lehren.›»
Die Wörter drehten sich in Percys Kopf und knisterten sachte an den Neuronen. Was er ganz genau verstand, und das spürte er auch in seinem Bauch: dass Mary für ihn so ein Klima war. Sie würde alles ändern können.
2Weimar
Einige Monate lang hatte sich Johann Wolfgang von Goethe steinalt gefühlt. Morgens beim Aufstehen konnte er sich öfter nicht mehr riechen. Nicht im Negativen oder Positiven, nein, er schien sich selbst völlig geruchlos. Das war nun vorbei. Das allseits anerkannte Originalgenie zählte 65 Jahre und lief aufgeregt durch seinen großen Garten am Frauenplan, in den ein kurzer Weg von seinem Arbeitszimmer führte und der in diesem Frühsommer bereits in allerhöchster Pracht stand. Die Apfelbäume schlugen aus, die Tulpen, die Kaiserkrone daneben, alles sang und duftete. Und er selbst stank wieder salzig und lebendig. Vorbei lief er an seiner Sammlung botanischer Pflanzen, die der Geheimrat sich zwecks metamorphischer Beobachtung im Kleingarten hielt. Vorbei lief er, denn er hatte plötzlich Anderes, Größeres, Neueres und noch Fremderes im Kopf. ‹Als wäre ich in der Pubertät›, schrie es in ihm. Er sah nach oben und lächelte dem Himmel zu.
Seine Drüsen und Sinne waren wieder aufgesperrt. Goethe las und schrieb, wie er es schon lange nicht mehr richtig getan hatte. Von Schreibtisch zu Schreibtisch rauschte er in seinem Arbeitszimmer, an dessen Wänden insgesamt drei geräumige Tische standen, voll von Material für jede seiner vielen Tätigkeiten. In diesen Tagen war das Material ein einziges Buch. Durch dessen Inhalt verwandelte sich der deutsche Dichter in einen Perser aus Tausendundeiner Nacht.
Denn die Lebenskraft, die Goethe seit ein paar Tagen umspülte, verdankte er einer schlecht ins Deutsche übersetzten Sammlung persischer Lyrik. Ihr Autor war Hafis, ein Dichter und Mystiker, der den Koran auswendig kannte und vor 300 Jahren gestorben war. Sie trafen Goethe mitten ins Herz. Höchst inspiriert schritt er das Morgenland seiner Fantasie ab und verließ dafür sogar sein so lange schon gelebtes Ideal einer Antike, in der die Rahmungen der Welt stets fest und klar, streng und gut sichtbar erschienen. Er überlegte, wie es wäre, in einem Zelt zu leben. Träumte sich mit Kameltreibern und alten Patriarchen unterwegs, wandernd von einem Ort zum nächsten, über einem nur die Sterne. Ganz allein auf der Welt, aber mit allem verbunden. Unter Hirten würde er sich fortan vielleicht mischen. In Hafis’ Lyrik fand er ein Spiegelbild des Weltreichs, das untergegangen war wie gerade eben das Napoleons. Er fand Glauben, an den er womöglich wieder glauben wollte. Und vor allem fand er darin: sich selbst.
Diesem Ich war Goethe jahrzehntelang aus dem Weg gegangen. Um sich zu kreisen, hatte er stets für infantile Zeitverschwendung gehalten. Jetzt war es eben geschehen, er schrieb und sprach seit einiger Zeit ständig von dem Gefühl, «sich historisch zu werden». Der dritte Band seiner Autobiografie Dichtung und Wahrheit war erschienen und Goethe überzeugt, dass es das eine nicht ohne das andere geben konnte. Weil Fakten existieren und Fiktionen und beide sich, sobald die Sonne aufgeht, in der Atmosphäre mischen wie die Farben des Lichts. Jede Biografie war ein lebendiges Wesen, das sich verwandelte, sobald man es ansah. Die Stimmen waren beteiligt, die Geister waren beteiligt. Goethe mochte keine Geister. Es erschien ihm zwangsläufig, dass sich die Menschen der Zukunft für ihn interessieren würden. Dieses Geschöpf wollte er ihnen nicht allein überlassen. Goethe wollte eine Anleitung geben, eine Gebrauchsanweisung für sich selbst.
3Sumbawa
Auf der anderen Seite der Welt segelte in diesem Sommer ein schottischer Forschungsreisender und späterer Diplomat durch das durchsichtige Wasser des weit verzweigten Indonesischen Archipels. Er war knapp 30 Jahre alt, hieß John Crawfurd und wurde von einem Matrosen auf die Wolke aufmerksam gemacht, die sich vor dem Expeditionsschiff auftürmte und den Himmel schwärzte. Ein Sturm, dachte der Forscher. Auch der Kapitän rief die Mannschaft auf, sich entsprechend zu rüsten. Als sie näher kamen, realisierte Crawfurd allerdings, dass die Wolke gar nicht als Vorbote zu einem Unwetter, sondern in ihrer monolithischen Erhabenheit zum Vulkan Tambora gehörte, dem sie sich näherten. Der Tambora war der größte Berg im Archipel. Seit Schiffe fuhren, orientierten sie sich an ihm. Nun war er offenbar erwacht. Wie ein Beweis fiel in diesem Augenblick leiser, trockener Regen auf das Deck. Crawfurd schlierte mit der Hand durch das feinkörnige Material, probierte etwas und hielt seinen Finger dem Matrosen hin: Ja, es war Asche, Vulkanasche.
Unsichtbare Vögel kreischten aus dem Dschungel in die beunruhigende Stille hinein, das Schiff bewegte sich sanft durch die Gewässer. Der Ethnologe ließ sich sein Fernrohr geben, stierte hindurch und schwang es mit großer Geste hin und her. Mit seinem Glas flog er durch den schwarzen Rauch und über die Inseln, die an den Flanken des riesigen Vulkanbergs lagen. Auf der Halbinsel Sumbawa konnte er, als das Schiff sich schon am Rande des Strandes bewegte, einen Mann anvisieren, der mit hinter dem Rücken gekreuzten Armen am Fenster eines Hauses stand und wie ein Häuptling aussah. Der Mann, den Crawfurd etwas verschwommen erkennen konnte, sah besorgt aus. Der Forscher hatte die Erfahrung gemacht, dass er, auch wenn er keiner einzigen asiatischen Sprache mächtig war, die hiesigen Menschen sehr gut verstand. Er wusste Charakterzüge anhand weniger Bewegungen zu deuten, das war seine Stärke. In diesem Augenblick sah der Schotte den Radscha von Sanggar, dessen Hoheitsgebiet am südöstlichen Hang des Vulkans lag und der nicht nur besorgt, sondern geradezu vorwurfsvoll auf den Vulkan blickte. Während dieser leise Qualm in den Himmel atmete, gelegentlich begleitet von einem kaum merklichen Beben der Erde, begriff der Engländer auf seinem Schiff stehend sofort alles. Er sah einen Teil, und der Rest des riesigen Puzzles setzte sich in seinem Kopf zusammen: Der Mann am Fenster hatte ein Problem, denn er musste den schwelenden Vulkan interpretieren.
Natürlich würden auch die Stammesmitglieder des Radschas jeden Tag in großer Angst überlegen, was die Rauchzeichen zu bedeuten hatten. In seinem Rücken, fantasierte Crawfurd, hatte sich bereits eine freche Bande Einlass verschafft. Es blieb dem Herrscher keine Wahl, er musste sie anhören. Der Radscha war im Volk geachtet, weil er Ordnung sicherte. Er schickte regelmäßig Kinder seines Stammes als Geschenke zu den Weißen, die sie schon lange beherrschten. Das tat ihm im Herzen weh, aber er konnte damit leben. Der erwachte Vulkan jedoch brachte Unordnung. «Die Götter werden uns bestrafen, ihr Zorn ist unendlich!», riefen die Menschen auf den Straßen. Sein Königreich war ein Paradies, die letzte Zeit hatte eine hervorragende Entwicklung in Gang gebracht. Die Reisernte fuhren sie zwei Mal jährlich ein. Kaffee, Edelsteine, Honig und Baumwolle konnten für gutes Geld an alle verkauft werden, die es ausgeben wollten. Es gab Vögel so groß wie Ziegen und so bunt wie überhaupt gar nichts in England. Ihre Pferdezucht war weit über die Grenzen der Insel bekannt. Durch den elysischen Überfluss angezogen, in dem die Bewohner lebten, waren unzählige Sprachen und Ethnien hier heimisch geworden. Die überwältigende Potenz der Natur gebar sich in einem permanenten rauschhaften Ausnahmezustand, sie gab und gab und gab. Das ganze Jahr schien die Sonne. Der Radscha hatte allerdings zwei Probleme, eigentlich sogar drei. Zum einen hatte er ständig diese irrationale Angst, dass seiner jüngsten Tochter etwas zustoßen könnte. Dann die Piraten, die mit Messern zwischen den dreckigen Zähnen auf ihren Schnellbooten um die Insel fuhren, um seine Untertanen zu kidnappen und auf den riesigen Sklavenmärkten Ostindiens feilzubieten. Und nun eben der Vulkan.
Die vier jungen Leute in seinem Rücken, allesamt von progressiven Ansichten getrieben, wollten die Erlaubnis einholen, nach einem Mann zu schicken, der in den Vulkan schauen sollte.
«Warum?», fragte der Radscha, drehte sich vom Fenster weg und versuchte dabei, seine Wut zu verbergen. «Warum, verdammt noch mal, überhaupt jemand von außen hierherholen?»
«Nun», antwortete einer der vier, «es war doch schon einmal einer da mit eisernen Instrumenten. Eine weiche Stimme hatte er gehabt. Ein Verrückter, natürlich. Aber wer sollte denn sonst hinaufklettern?»
Diese Männer wollten ihm seit Langem gefährlich werden, und sie machten das auf kluge Art. Beim letzten Punkt musste der Radscha ihnen recht geben. Wer sollte sich das trauen? Eine Unverschämtheit blieb es dennoch. Immer wollten sie etwas genau wissen, was seit Jahrhunderten niemand genau wissen konnte und im Dunkeln auch besser aufgehoben war.
Der riesige Tambora war seit ewigen Zeiten nicht mehr ausgebrochen. Er war ein friedlich schlafender Riese, der das Land fruchtbar gemacht hatte und die Menschen demütig. Der Radscha mochte seinen Vulkan. Natürlich war der Berg lebendig, was sollte er sonst sein. Die Geister der Toten schliefen unter ihm. Der Radscha wusste genau, dass sie alle viel falsch gemacht hatten in den letzten Jahren. Aber wie sollte man Dinge auch nicht falsch machen, wenn man einigermaßen anständig leben wollte. Nun schwieg er. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass die meisten Probleme gingen, wie sie kamen, und wenn man herrisch über sie hinwegsah, gingen sie umso schneller. Das Rauchen würde bald aufhören. Es war Rauch. Er war grau, machte seltsame Formen und löste sich wieder auf. Die Wolken würden weiterziehen und der Himmel wieder lichter werden. Man würde wieder die Sterne sehen, und seine Leute würden sich keine Sorgen mehr machen. Sie würden ihn wieder lieben. Vielleicht, dachte er, hätte es auch sein Gutes, wenn einer von außen käme. Vielleicht könnte er ihm die Sache mit dem Vulkan anhängen. Er nickte dem Ratsvorsitzenden zu: «Dann soll er eben kommen», und kratzte sich mit seinem langen, türkis lackierten Fingernagel einen Krümel der vergangenen Nacht aus dem schwarz geschminkten Auge.
Der Radscha drehte sich wieder dem Fenster zu, und in diesem Moment schaute er Crawfurd durch das Fernrohr praktisch in die Augen. Dieser riss das Gerät herunter und befahl, obwohl er auf dem Schiff wirklich nichts zu befehlen hatte: «Weiterfahren.»
4London
«Stopp!», rief Percy. Nachdem er Marys Vater ihre Liebe erklärt hatte, hatte der erst lange geschwiegen, dann rumgeschrien, und schließlich waren die Dinge außer Kontrolle geraten. Irgendwann war Percy im Arbeitszimmer auf den Schreibtisch ihres Vaters gesprungen und stand nun zentral vor dem Portrait von Marys Mutter an der Wand. Das kleine Fläschchen Gift, das er stets bei sich trug, reckte er kurz in die Höhe und löste den Korken vom Gefäß, sein Haar stand noch weiter vom Kopf ab als sonst, als hätte der Blitz geradewegs in ihn eingeschlagen.
Es begann der Showdown, auf den die fiebrigen letzten Wochen zugelaufen waren, der Raum surrte vor Energie. Einen Augenblick erschien Mary, die sich außer Atem in einen Sessel hatte fallen lassen, die Familienszene vor ihr wie eingefroren. Sie sah in Percys riesige Augen, die immer ein wenig unter Wasser standen. Er trug auch heute lange Hosen, die unten am Saum verwegen breit geschnitten waren. Sein weißer Kopf schaute aus den Kleidern heraus wie ein Schwan aus dem nächtlichen Wasser. Mein Elf, dachte Mary.
Nur einen Menschen kannte sie, dessen Worte so in sie einschlugen, und das war ihr Vater. Ihn hatte sie ihr Leben lang am hingebungsvollsten und unwillkürlichsten geliebt, und nun traute sie sich nicht, zu ihm zu sehen. Vater Godwin, der alte Anarchist, wirkte abgekämpft. Der Rock hing halb über dem Gürtel, er war dick geworden und hatte die Hälfte der Haare auf dem Weg verloren. Neben ihm räkelte sich Marys Halbschwester Jane Clairmont auf der abgewetzten roten Chaiselongue. Sie war die Tochter von Marys Vaters neuer Frau, ihr leiblicher Vater soll Spanier gewesen sein. An ihren Lippen konnte Mary erkennen, dass sie sich freute, weil etwas passierte, und zugleich demonstrativ schmollte, da sie in dem hier aufgeführten Drama nur eine Nebenrolle spielte. Jane sah sehr zeitgenössisch aus. Es war nicht nur das blassblaue Kleid, das ohne Korsett auskam und von dem weder Mary noch irgendwer sonst eine Ahnung hatte, wie und mit welchem Geld sie es aufgetrieben hatte. Ihre Stiefschwester umgab eine unerklärliche Leichtigkeit, die alle verrückt machte. Sie besaß die magische Gabe, immer etwas nachlässig auszusehen, zu jeder Situation das passende Gesicht zu tragen und den perfekten kurzen Satz zu sagen. Obwohl sie nie ein Buch las. Jedenfalls nicht oft. Jedenfalls nicht halb so gebildet war wie Mary. Die Beziehung der beiden fast gleichaltrigen Halbschwestern bestand aus großer Bewunderung, rasender Eifersucht und inniger Liebe. Sie beide wussten, dass Mary einmal Schriftstellerin werden sollte. Was aus Jane einmal würde, wusste niemand.
Godwin war sicher, dass Percy es nicht tun würde. Dieser aristokratische Aufschneider und Salonradikale war viel zu egozentrisch, um sich umzubringen. Vor einem Jahr war er hier als größter Fan angetanzt mit seinem Atheismus, seiner Godwin-Manie und seinem Geld. In der Weichzeichnung, die der Baronensohn seitdem täglich vornahm, waren er und seine verstorbene Frau noch einmal als großes Paar auferstanden. Natürlich hatte Godwin das geschmeichelt. Er brauchte Unterstützer. Als Autor war er nicht mehr gefragt, seine Buchhandlung und der neu gegründete Kinderbuchverlag, für den er nun auch selbst Geschichten beisteuerte, liefen nicht gut. Anders als Percy hatte Godwin sich alles selbst erarbeiten müssen. Sein bekanntester Roman war ein Hit gewesen, seine große theoretische Schrift Politische Gerechtigkeit hatte dafür nachhaltiger gewirkt. Ganz London hatte sie gelesen. Es waren gute Zeiten gewesen, nun waren sie wohl um. Godwin wollte es nicht wahrhaben und hatte Percys Lobeshymnen irgendwann geglaubt, denn am Ende war er noch eitler und kindischer als der junge Dichter. Er liebte Mary wie nichts anderes auf der Welt. Wie keines seiner anderen Kinder, wie keine Frau. Er schnaufte tief. Es klang wie ein Startschuss. Das lodernde Feuer aller Beteiligten hatte genügt, die eingefrorene Szene abzuschmelzen. Sie waren nun gezwungen, das ganz große Drama ein für alle Mal durchzuexerzieren. Zwei Dinge standen im Raum. Eins davon wollte Godwin auf keinen Fall ansprechen, das andere unbedingt als Erstes. Er donnerte: «Was ist mit Harriet?»
Harriet war Percys Ehefrau und die Mutter seines Kindes. Er hatte die damals Sechszehnjährige vor drei Jahren gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet. Sie war eine Freundin seiner Schwester. Die Liebe war für ihn der perfekte Kampfplatz, um die patriarchale Ordnung, die die Menschen in Passivität und Depression zwang, zu zerstören. Es galt, die jungen Frauen zu befreien, also auch möglichst viele von ihnen. Auf Godwins Frage hin ließ er allerdings seinen Giftarm sinken. Er hatte nichts gegen Harriet, war sich sogar sicher, dass er sie noch liebte. Aber er konnte das Zeug in sich, das Leben hieß und das so wütend voranschritt, nicht im Zaum halten. Zuletzt hatte sie sowieso nur noch gemeckert und Ansprüche gestellt. Gar nicht das Bild einer selbstständigen Frau. Und die wollte er. In drei Jahren war er berühmt, oder tot. Sein Arm stand wieder grade in der Luft. Percy schrie:
«Wie können Sie das fragen? Bin ich nicht hierhergekommen, weil in Ihren Worten die Freiheit liegt? Die Unbedingtheit? Die Größe!? ‹Der vernunftbegabte Mensch braucht weder Gesetze noch Institutionen› – Ihre Worte.»
«Harriet ist nun einmal Ihre Ehefrau», knurrte Godwin.
«Was ist die Ehe? Ein Blatt Papier! Sie wollten sie doch selbst abschaffen!»
Godwin schaute genervt.
Percy weiter: «Marys Mutter nannte die Ehe Haussklaverei und legale Prostitution. Warum sollen Frauen weniger wert sein als Männer?» Er machte dazu auf dem Schreibtisch plötzlich leichte Tanzbewegungen.
Godwin irritierte das Gewackel. Wie hatte er seine Frau damals angefleht: Die Gerechtigkeit der Völker, natürlich, das ist unser Kampf, aber wenn sie das mit dem Feminismus, an den sie beide glaubten und den sie gemeinsam lebten, auch öffentlich durchziehen wollte, würden die Leute ihr das nicht verzeihen. Natürlich hatte sie nicht auf ihn gehört.
«Hören Sie mir überhaupt zu?», rief Percy vom Tisch.
Marys Vater versuchte mit aller Kraft, ihm nicht zuzuhören. Wie dieser Shelley dastand, in seinem abgerissenen Aufzug, vollkommen albern. Gottlob war seine Frau nicht hier, um den Schlamassel mit anzusehen. Was könnte er gegen eine Entführung ausrichten? Er würde sich seine Tochter nicht rauben lassen. Mary war sein begabtestes Kind. Wenn er hinter der Stirn dieses verschlossenen Mädchens die Gedanken rattern hörte, sah er das Ebenbild seiner verstorbenen Frau. Er würde sie zur größten Autorin Londons machen. Vor allem würde er sie nicht auf die andere Seite der Gesellschaft ziehen lassen. Er selbst balancierte seit jeher auf einer seidenen Linie zwischen umstürzlerischer Avantgarde und sicherem Hafen, Kunst und Gefängnis. Er wusste, wie schwer diese Membran rückwärts zu überschreiten war. Shelley wusste einen Scheißdreck. Am Ende würde seine schwerreiche Familie ihn wieder aufnehmen und den verlorenen Sohn in einem Schloss auf dem Land versauern lassen. Er würde dort depressiv und Alkoholiker werden, aber mehr auch nicht. Die Reise von einer Klasse in die andere, von einer gesellschaftlichen Sphäre und zurück, den machten in dieser Zeit nur eisenharte und zugleich fast durchsichtige, flexible Gestalten, deren Seelen und Wörter zugleich hell und antik waren. Die Jahre hatten den aufsässigen Humanisten zu einem Pragmatiker werden lassen. Hehre Ziele und große Ideale, natürlich, immer. Das alltägliche Leben und Leiden stand allerdings auf dem gleich daneben liegenden Blatt. Und anders als für das Gemeinwohl war dafür alleine er verantwortlich. Er musste die große Familie aus ganzen und halben Töchtern, Dreiviertel-Söhnen und im Grunde völlig fremden Kindern, die unter seinem Dach wohnten, am Laufen halten. Er brauchte Geld. Und das war eben das Zweite, worüber er ständig nachdachte, aber sicher nicht hier vor seinen beiden Töchtern sprechen wollte: das viele Geld, das Shelley ihm geliehen hatte, und vor allem das Geld, das er ihm noch leihen sollte. Ohne diesen aristokratischen Hurensohn ging es einfach nicht mehr. Godwin schaute in die Runde und schloss angeekelt die Augen. Percy sprach nun etwas ruhiger:
«In diesem Haus, vor allem durch Sie, Godwin, wurde der Grundstein gelegt, hier habe ich Mary getroffen …»
Mary wollte etwas sagen, es kam nichts aus ihrem Mund. Godwin brüllte: «Vor sechs, sieben Wochen, Shelley. Vor sechs, sieben Wochen!»
«Schon richtig», gab Percy zu, «doch nur hier konnten wir die Idee einer Welt weiterentwickeln, in der alle politischen und sozialen Hierarchien überwunden werden. Ich will nicht abergläubisch wirken, aber sollte es nicht vielleicht genau so sein? Doch wir müssen hier raus, wir bilden die Gemeinschaft der kommenden Gesellschaft.»
Mary saß, ja, lag eigentlich in ihrem Sessel, die Augen halb geschlossen. Oft, wenn die Welt zu aggressiv auf sie eindrang, reagierte ihr Körper darauf mit Schlaf. Sie konnte nichts tun, als sich der bodenlosen Träumerei zu ergeben. Kurz bevor dieser Zustand eingetreten war, hatte Mary eine schreckliche Vision gehabt. Die Bücherberge, die rings um ihren Geliebten bis an die Decke gestapelt standen – ihr Vater verfügte über eine der größten privaten Bibliotheken des Landes – sie hatten sich plötzlich in den Raum hineingewölbt wie Wellen, und die Bücher, zu Tausenden herabgestürzt, hatten Shelley unter sich begraben.
«Wir waren gegen die Ehe», dröhnte ihr Vater in diesem Moment, «das wisst ihr beide. Aber wir haben nichtsdestotrotz geheiratet, weil ich nicht wollte, dass deine Mutter allein vor der Gesellschaft steht, denn das wird auch Harriet als Frau mit Kind, aber ohne Mann. Deine Mutter und ich lebten zusammen, aber wir haben uns jeder ein Zimmer gemietet, um dort zu schreiben. An wen denkt ihr, außer an euch?»
«Wir denken an eine Kommune», antwortete Percy sofort, «in der es keine Grenzen zwischen Freundschaft und Leidenschaft gibt. Ich habe erst kürzlich ein Buch gelesen. Es ging darin um die Zeit vor unserer Zeit, die alte Zeit. Damals begann der Mensch Werkzeuge herzustellen, und er begann sich zu unterscheiden. Damals gingen Frauen mit mehreren Männern, und auch Frauen. Niemand wusste, welches Kind zu wem gehörte, und alle gemeinsam fühlten sich für alle verantwortlich. Wir werden das Modell der patriarchalen Kleinfamilie überwinden», verkündete Percy euphorisch. «Ich will, dass Harriet mitkommt, die Kleine auch. Jane soll nachkommen.»
Marys Schwester entfuhr ein begeistertes «Yes». Mary tat etwas in ihrer Brust weh.
Ohne Percy eines Blickes zu würdigen, fragte der alte Anarchist ruhig, aber so bebend, dass alle sofort still waren: «Wie kannst du dich nur gegen mich wenden, Mary?»
Mit letzter Kraft warf er die Worte in die Weite des Raums: «Ihr schmeißt doch alles kaputt! Ihr stürzt euch und uns ins Elend. Vernunft! Das wollte deine Mutter. Sie hat ihre Theorie gelebt. Ihr redet von Träumen …»
«Siehst du denn nicht, dass in Percy all eure Ideen erneut versammelt sind?», fragte Mary. «Siehst du nicht Mutter in ihm? Wir verbringen die Tage damit, eure Schriften zu lesen. Wir werden Sie wieder zum Leben erwecken.»
Godwin überlegte, wie er seiner Tochter nur erklären sollte, auf wie vielen Ebenen das Unsinn war.
Doch da fragte plötzlich Mary: «Wie hast du mich genannt, Papa? Wie habt ihr mich genannt, als ich noch nicht geboren war?»
Godwin schaute auf den Boden.
«Wie?», fragte Mary erneut.
Godwin wusste, dass es jetzt aus und verloren war. Er fühlte sich wie eine schwere Tonne, die sich immer eingebildet hatte, etwas ganz Besonderes zu sein, aber nun schlagartig realisierte, dass sie ein Behälter war, der nur dann Fahrt aufnahm, wenn er von Kindern umgekippt und angestoßen den Hang runterkullerte.
«Sag es bitte», sagte Mary.
Die Tochter und der Vater, die sich so sehr liebten, schauten sich an. Dem alten Godwin war klar, dass die jungen Leute über ein Wissen verfügten, von dem er keine Ahnung hatte, weil es eben in der Jugend ihrer Körper und ihres Geistes und der drängenden, weit offenen Gegenwart lag, in der dies alles gemeinsam existierte. Er hatte es immer gewusst. Wenn er die revolutionäre Idee in die Kleinen injizierte, dann würden sie davon Gebrauch machen, und es lag auf der Hand, dass sie dies auch gegen ihn verwenden würden. Aber er war auch zu alt, um ihnen das hier jemals zu verzeihen. Godwin spürte in diesem Moment sein Herz aus seinem Körper entweichen. Das tat unbeschreiblich weh. Und dann flüsterte er niedergeschlagen:
«Das Kind der Liebe und des Lichts.»
Mary nickte. Bis jetzt war ihr nicht bewusst gewesen, dass sie sich gegen ihren Vater entschied, wenn sie sich für Percy entscheiden würde. Nun war klar: Die beiden Männer ihres Lebens brüllten sich an, lieferten sich diesen Kampf, in dem es um alles ging. Aber sie trugen nicht die Verantwortung. Sie allein hatte die Macht, den Ausgang zu beeinflussen. Sie sah die Entscheidung deutlich vor sich wie einen Unfall, den sie selbst verursacht hatte und dessen verheerenden Ausgang sie bis jetzt nicht hatte kommen sehen, obwohl sie doch immer alles kommen sah. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Aber Mary hatte keine Wahl. Denn sie hatte sie längst getroffen.
Wenige Tage später durfte Percy Godwins Haus nicht mehr betreten. Noch etwas später unternahm er einen noch immer halbherzigen und dennoch Aufsehen erregenden Selbstmordversuch. Dann durfte er wiederkommen, aber Mary nicht sehen. Dann konnte Percy erneut Geld für Godwin besorgen. Und einen Monat nach ihrem ersten Kuss flohen Mary, Percy und Jane um vier Uhr in der Früh in einer geliehenen Kutsche aus London.
5Paris, Wien
Napoleon trank ein Glas Champagner, wie immer zur Hälfte mit Wasser aufgefüllt. Er saß auf seinem alten Thron, genau wie vor einem Jahr. Vor dem Palast hörte er seine Anhänger, sie sangen die Marseillaise, sein Siegeslied. Auf ihren breiten Bauernschultern hatten sie ihn hineingetragen, von ihren Dörfern bis auf die Champs-Élysées waren sie ihm gefolgt wie ein Fluss.
Es war Frühling, der klare, silberne Pariser Frühling, aber die Blumen stanken nach Verrat. Napoleon wusste, dass die jubelnde Menge nicht für alle stand, er hatte dem Volk noch nie getraut. Fast ein Jahr war er weg gewesen. Neue Kräfte gab es, so war Paris nun einmal. Zwischen dem Volk und seinem Oberhaupt lag der Staat, er selbst hatte ihn dort gedeihen lassen. Dann die Feinde aus dem Ausland, in Wien hatten sie ihn für vogelfrei erklärt. Bonaparte war erst 45 Jahre alt und wieder der Kaiser, doch sein Land hatte sich verändert, so wie er selbst. Seine Handflächen waren feucht, das war früher nicht so gewesen, der kleine Mann war immer die Ausgeburt nüchterner Trockenheit. Jeder Gedanke ein neuer Befehl, jede Idee eine Tat. Heute fühlte er sich weich und beklommen, einem Diener hatte er am Morgen minutenlang irgendein Zeug erzählt, dieser hatte ihn zu Tode erschrocken angesehen und natürlich nicht geantwortet. Nun stach er sich in nachdenklicher Pose mit den Fingern in die grimmig geschlossenen Augenhöhlen.
Er, der Soldat aus Korsika, der aus den Trümmern der untergegangenen Revolution aufgestiegen war wie ein Engel. Ein Emporkömmling, der zum mächtigsten Eroberer der Welt geworden war und sich selbst zum Kaiser gekrönt hatte. Er war das nicht durch sein Blut, nicht durch Gott, sondern durch seine außergewöhnliche Begabung und Bereitschaft geworden. Niemand hatte seine Familie gekannt. Wenn das eigene Blut oder Gott einen auf den Thron hievte, musste man sich nicht anstrengen. Napoleon hatte sich immer enorm angestrengt. Das alles war schon furchtbar kompliziert und für die Leute schwer zu verstehen. Doch die Menschen hatten ihn und seine Idee nicht nur akzeptiert. Die Revolution, sagten sie, hatte sich in Napoleon Bonaparte ihren Korpus erschaffen. Er hatte ihr zu Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zudem Ordnung, moderne Gesetze und Schneid gegeben.
Napoleon erinnerte sich. Wie die Feinde ihn vor einem Jahr auf die Insel Elba verbannt hatten. Es war eine schreckliche Zeit gewesen. Doch seine Agenten ließen alsbald durchsickern, dass die Dinge schlecht standen für den nach seiner Niederlage wieder eingesetzten König. Und dass die europäischen Fürsten, die ihn in der kolossalen Schlacht bei Leipzig besiegt hatten, sich in Wien dabei verzankten, das Europa, das sie ihm abgeknöpft hatten, unter sich aufzuteilen.
Kurzerhand hatte er mit seinen verbliebenen 1000 Offizieren und Elitesoldaten einige Schiffe gekapert, war unbemerkt durch das plätschernde Mittelmeer gefahren und in Cannes gelandet. Noch einmal war er zu schnell für alle anderen. Und dann erinnerte er sich an seine Lieblingsszene. Eine Woche nach seinem Aufbruch trafen sie auf eine Brigade, die mit dem Auftrag losgeschickt worden war, Napoleon tot oder lebendig nach Paris zu bringen. Er dachte daran, wie der Nebel des Morgens die wunderschöne Landstraße eingehüllt hatte, in der Luft lag kühle, stille Ehre. Das hätte das Ende sein können, das Ende sein sollen. Aber es war nicht das Ende. Das französische Regiment stand Napoleon und seinen Offizieren gegenüber. Sein schwarzer Hut, leicht in den Nacken gerutscht, der steife Soldatenmantel, seine mächtige Nase. Napoleons kleine Schar, hoffnungslos unterlegen, hob die Gewehre, so wie, nur zehn Meter entfernt, die vom König gesandten Männer. Nur eine einzige Kugel, und der kleine unerschrockene Mann mit den funkelnden Augen wäre tot gewesen. Doch Bonaparte ging auf die Wand aus Waffen zu, verschränkte dabei langsam die Arme hinter seinem Rücken, zeigte ihnen seinen dicken Bauch.
Er hatte keine Angst: «Kameraden, wer führte euch so oft zum Sieg? Ihr kennt mich!», sprach er. Und er breitete die Arme aus wie ein Vater, man sah seine Orden unter dem grauen Mantel. Die Flintenhälse neigten sich herab. Er hatte sie wieder eingefangen. Der Kaiser der Soldaten und des Volkes, das er so sehr geschunden hatte und das ihn trotzdem liebte. Ab diesem Zeitpunkt wurde seine Rückkehr ein Triumphzug. Wie ein Adler flog er über sein Land, immer größer wuchsen seine Schwingen. Kurz darauf floh Ludwig XVIII. aus den Tuilerien. Also warum, um Himmels willen, tat jetzt nur sein Kopf so weh?
Weit weg in Wien war das Wetter herrlich, das Thermometer zeigte vierzehn Grad. Sieben Monate zogen sich die Beratungen des Wiener Kongresses bereits hin, der Frühling erfüllte die Teilnehmer mit neuer Kraft. Die Fürsten Europas suchten nach den endlosen Jahren des Krieges und sich epidemisch über den Kontinent ausbreitenden revolutionären Ideen, die alte Ordnung herzustellen. Wie eine Kanonenkugel war die Neuigkeit in Wien eingeschlagen: Der Gewaltige war entkommen, wieder da, schon in Paris. Schneller musste man beraten, zum Schlusse kommen, riefen die Zeitungen, und die Taktzahl diplomatischer Gespräche drehte auf.
In der wie eine Schmuckschatulle glitzernden österreichischen Hauptstadt vollzog sich unter dem Vorsitz des Außenministers Metternich ein perfekt orchestriertes Spiel. Während die 200 Fürsten fast sämtlicher Staaten Europas sich tagsüber mit Jagden und am Abend bei rauschenden Bällen und Konzerten vergnügten, rangen ihre Diplomaten und Politiker um die Territorien Europas. «Es wird gestritten, aber es wird nicht weniger getanzt», erklärte die Frau eines Abgesandten des Königs von Sachsen ihrem jungen, recht dummen Mann die Lage und führte ihn, ohne dass man merkte, dass sie ihn führte, unter dem silbernen Kristallkandelaber entlang in den prächtigen Salon, wo an diesem Abend die preußische Delegation ein Stelldichein ausrichtete.
«Und dabei gibt es konzentrische Kreise der Erlauchten», so nannte es die schöne Frau des Abgesandten. «Sie müssen es sich so vorstellen, dass ganz oben Talleyrand für die Franzosen sitzt mit den Preußen Hardenberg und Humboldt, sowie dem russischen Zaren, ein paar Engländern und Österreichs Außenminister. Die Auseinandersetzung dieser fünf Mächte ist der Mittelpunkt. Und von dort zieht es immer weitere Kreise, und nun sind auch wir vom Strudel erfasst! Sie denken, der größte Ball wäre der schönste. Doch Sie irren. Je kleiner der Kreis, desto interessanter. Sie denken, die Menschen amüsieren sich hier, aber schauen Sie genau hin: Hier wird Politik gemacht.»
Der Abgesandte nickte, obwohl er wenig begriff, doch Rangfolgen attraktiv fand und, was seine Frau redete, wie so oft, sehr feinsinnig klang. Er nahm ein Glas Wein vom hingehaltenen Tablett.
«Und wo stehen wir?», fragte er.
«Wir sind schon nicht ganz unten, Erlauchter», antwortete sie stolz.
«Sehen Sie doch», und die Dame machte einen kaum sichtbaren, eleganten Wink zur Tür. «Sehen Sie, wie die Abgesandten des Großherzogs von Mecklenburg versuchen Eintritt zu nehmen. Er wird ihnen verwehrt. Sie schaffen es nicht hinein.»
«Grandios!», freute sich ihr Mann und ließ den Blick über die goldverzierten Stuckwände schweifen. Bis er an einer Erscheinung hängenblieb.
«Wer ist denn dieser Herr?» Er zeigte mit dem Finger auf einen Mann, der sich durch seine struppigen Haare und den bestürzend wilden Bart von allen anderen abhob. Die Frau des Abgesandten bog schnell den Arm ihres Mannes nach unten und antwortete:
«Das ist Friedrich Ludwig Jahn.»
Der Abgesandte war fassungslos. «Was macht so einer hier?»
«Nun ja», räusperte sich seine Frau und führte sie beide dabei langsam einem Tische zu. «Er ist mit Minister Hardenberg hier. Viele der Diplomaten verfügen in ihrem Gefolge über zahlreiche Experten, die über bestimmte Dinge genauer Bescheid wissen und die Temperaturen in den Räumen entsprechend zu verändern vermögen. Jahn ist ein Berater in historischen Fragen, so hat Hardenberg ihn jedenfalls vorgestellt.»
«Wie meinen Sie?»
«Nun, der Turnvater hat eine neue Idee von Deutschland.»
Der Abgesandte des Fürsten hörte die einzelnen Worte, doch der Sinn verwehrte sich ihm wie durch eine Schutzmauer. Deutschland, wusste er wohl, war ein gefährliches Wort. Als sie nähertraten, merkten beide, wie der Mann die um ihn Stehenden in den Bann schlug. Dieser Jahn sprach nicht, sondern bellte wie ein großer Hund. Er hatte den Körper eines athletischen jungen Mannes und das weise Gesicht eines Priesters. Er war Mitte dreißig, aber er hätte jedes Alters sein können. Eine Traube von Menschen hatte sich um ihn gebildet. Von links kam ein schmucker junger Mann mit schlauen Augen und grüßte formvollendet die Frau des Abgesandten.
«Er fällt auf unter den Herrschaften mit ihren schneeweißen Strümpfen, nicht wahr?», bemerkte der schöne Mann. «Unser berühmter Deutschtümler in seiner altdeutschen Tracht.»
«Herr Varnhagen, wie schön, Sie zu treffen», freute sich die Frau des Abgesandten. «Wo haben Sie Ihre Frau gelassen?»
«Sie ist noch in Berlin.»
Elegisch dachte die Frau des Abgesandten an den berühmten Salon Rahel von Varnhagens, in den sie wohl niemals eingeladen würde.
«Rahel», sagte Varnhagen, «kommt in ein paar Tagen. Natürlich kann sie sich das hier nicht entgehen lassen.»
«Was spricht dieser Jahn so laut und rücksichtslos?», mischte sich der Abgesandte brüsk ins Gespräch, weil er entschieden fand, dass seine Frau dem Schnösel zu schmeichlerisch zugetan war.
«Nun, Jahn ist eben ein patriotischer Turner», versuchte seine Frau zu erklären.
«Ein Turner?!» Der Abgesandte schwieg. Er verstand erneut nicht, wovon seine Frau sprach. Aber hier wurde die Zukunft besprochen, und so nickte er feierlich und ratlos.
«Haben Sie nicht gehört, was er in Berlin treibt?», fragte sie.
«Berlin?», erwiderte er. «Was reden Sie jetzt ständig von Berlin?»
«Nun, auf den sandigen Hügeln vor Neukölln hat dieser Jahn allerlei Holzgerät aufgestellt, Pferdeböcke, Balken, um darauf zu balancieren, und Kletterseile, die vom Boden bis zum Himmel reichen. Der erste Turnplatz der Welt und dort der letzte Schrei. Eine große Zahl Jugend versammelt sich täglich. Sie machen sich fit.»
«Was, fit machen? Was reden Sie denn da? Sehen Sie sich mal die Stiefel von dem Kerl an!»
«Amüsant, nicht?», warf Varnhagen ein. «Diese Lässigkeit des Anzugs, der Einzige in Stiefeln, und bei dem trockensten Wetter in kotigen, sodass man glauben muss, er halte das zum Kostüm gehörig und habe sie mühsam eigens beschmiert. Ist es sein Markenzeichen? Man weiß es nicht genau bei diesem Jahn.»
Sie reckten ihre Köpfe zu dem Kraftmann. Jahns vorgetragener Franzosenhass wurde dabei goutiert, die Geißel der napoleonischen Fremdherrschaft steckte tief und voller pechschwarzer Kränkung in den Knochen. Bei seinen heftigen nationalistischen Reden für ein einiges Vaterland schaute man sich allerdings um, bevor man, wenn die Luft rein war, umso euphorischer lachte. Jahn erklärte nun, man müsse zum Schutz der deutschen Grenzen künstliche Wüsten installieren und hungrige Bären und andere wilde Tiere ansiedeln: «Schon in Altdeutschland», hörten ihn alle rufen, «ist ein Stamm und Ort umso berühmter gewesen, je größer und undurchdringlicher der Wald sein Gebiet ummarkt habe. Aus alten Klöstern entstehen dann Eulenschläge, Adlerhorste aus ausgebrannten Turmzinnen, unterirdisch aufgebaute Irrgebäude dienen gleich Schneckenbergen zu Werken für Giftschlangen. Die mit einer Doppelreihe von Verwallungen und Dornenhecken eingezäunte Wüste ist wenigstens ein Grad breit, kein Leichtfuß kann sie ohne Rast durchhüpfen.»





























