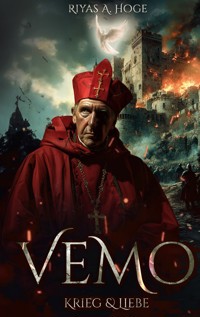Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich einen gutaussehenden (Mal mehr, mal weniger) jungen Mann. Nicht perfekt. Narben überall am Körper, ein kleines Bäuchlein, Lovehandles, nicht sehr groß oder gar muskulös. Aber ein Anblick der mir gefällt. Das war nicht immer so und der Weg dahin war gepflastert mit Ängsten, Schmerzen, Abscheu, Komplikationen, Depressionen und Hoffnung. Mein Name ist Riyas Alexander Hoge und in I did it my way - Maskenball nehme ich euch mit auf meinen Weg in ein freies Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maskenball I did it my way Riyas A. Hoge
Das Buch:
Anders zu sein und nicht zu wissen, was genau diese Andersartigkeit bedeutet, ist nicht einfach. In diesem Buch erzählt der Transmann Riyas A. Hoge, wie er zu sich gefunden hat und welche Hürden und Schwierigkeiten er zu überstehen hatte, bevor er endlich ein Leben in seinem Sinne führen konnte.
Der Autor:
Riyas A. Hoge (*5.10.1980 Meppen) schreibt seit 2015 hauptsächlich im Dark-Fantasy Bereich und teilt hier erstmalig sehr private und intime Einblicke über seinen
Transweg.
Maskenball
I did it my way von
Riyas A. Hoge
2. Edition, 2024
© 2023-2024 all rights reserved.
Riyas A. Hoge
Postach 1162 49723 Haren
[email protected]://www.riyashoge.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort9
Kapitel 1 – es war einmal13
Kapitel 2 – das Outing25
Kapitel 3 – nach dem Outing33
Kapitel 4 – Warten & Angst43
Kapitel 5 - Und weiter gehts49
Kapitel 6 – Gericht & Folgen57
Kapitel 7 – Krankenkasse & Klinik67
Kapitel 8 – Mastektomie73
Kapitel 9 – Hysterektomie81
Kapitel 10 – der Aufbau89
Kapitel 11 – Zwischen den Operationen99
Kapitel 12 – Fistelverschluss103
Kapitel 13 – Zwischenspiel113
Kapitel 14 – Erektionsprothese117
Kapitel 15 – Komplikationen I123
Kapitel 16 – Erektionsprothese 2131
Kapitel 17 – Aufbau 2137
Kapitel 18 – noch mehr Komplikationen141
Kapitel 19 – Harnweg und Hoden151
Kapitel 20 – Zuhause157
Kapitel 21 – Nachgedacht161
Kapitel 22 – Glansplastik177
Kapitel 23 - Home again185
Kapitel 24 - This is the end?189
Kapitel 26 Fragen & Antworten197
Kapitel 27 – Danksagung203
Vorwort
Wenn ich heute in den Spiegel schaue, sehe ich einen gutaussehenden (mehr oder weniger) jungen Mann.
Okay er ist ziemlich schmächtig, seine Haare gehen zurück, seine Nase ist zu groß und der kleine Bauch und der Hüftspeck sprechen davon, dass er gerne gutes Essen mag und für Sport nur sporadisch zu haben ist.
Wenn er eine anstrengende Woche hinter sich hat, dann ist das ‚jung‘ auch nicht mehr sehr aktuell. Er ist kein Model, das die Cover diverser Zeitschriften ziert. Es ist ein anderes gutaussehend. Die Art gutaussehend, die entsteht, wenn man mit sich selbst im Reinen und glücklich ist.
Ich liebe dieses Spiegelbild. Ich liebe jede Narbe - von denen es einige gibt- , den Drei-Tage-Bart, wenn ich mal wieder zu faul war, um mich zu rasieren. Mein Bäuchlein, mein Hüftspeck. Dass ich mich selbst so zufrieden im Spiegel ansehen kann, war nicht immer so. Aber das ist für die meisten nichts Ungewöhnliches, nicht wahr? Wer findet nicht den ein oder anderen kleinen Ansatz, den man an sich verändern würde?
Früher einmal habe ich geglaubt, meine Riesennase wäre mein größtes Problem, nicht zuletzt, weil ich deswegen unter anderem in der Schulzeit immer wieder gehänselt wurde. Zu erkennen, dass nicht meine Nase das Problem war, sondern ich selbst und die Zugehörigkeit zu meinem Geburtsgeschlecht, dauerte lang.
Der Weg von dem dürren Mädchen, der sehr dünnen, stillen Frau zu dem Mann, der mir heute im Spiegel schelmisch entgegen lächelt, war lang und nicht immer leicht. Aber wie die Geburt meines Sohnes war diesen Weg zu beschreiten, dass Beste, was ich machen konnte. Und trotz aller Widrigkeiten und Probleme bereue ich nicht einen Tag, das ich mich entschied, frei zu sein.
Ich zu sein.
Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich dieses Buch schreiben soll. Nicht, weil ich nicht glauben würde, dass es jemanden interessiert, sondern, weil es bedeutet, noch einmal alles aufzurollen. Mich noch einmal mir selbst stellen müssen, wie ich es im Laufe meines Weges sehr oft tun musste.
Würde ich stark genug sein, um mich der Angst, der Verzweiflung, den Depressionen noch einmal zu stellen?
Face to Face?
Ausschlaggebend waren die Fragen. Sobald jemand wusste, dass ich ein Transgender bin, wurden mir immer wieder Fragen gestellt. Zum Weg, zu den Operationen, zu meinem Deadname ... also entschied ich, diese Fragen im Laufe meiner Geschichte für euch zu beantworten.
Gnadenlos ehrlich.
Also kommt und begleitet mich ein stückweit auf meinem Weg und nehmt Anteil, an meinem Schmerz und meiner Freude.
Dein ganzes, armes Leben warst du auf einem Maskenball!
Dein Lächeln war gefroren, es glänzte wie Kristall!
Niemand durchschaute dich, doch schauen sie auf dich herab!
Wenn du nicht lebend sterben willst, dann nimm die Masken einfach ab!
(Letzte Instanz- Maskenball)
»Dies über alles: Sei dir selber treu.« - Shakespeare
Kapitel 1 – es war einmal
Es war einmal, vor langer Zeit ...
So beginnen Märchen und auch wenn diese Geschichte vielleicht ein Happy End hat, ist es kein Märchen.
Es gibt keine Magie.
Es kommt keine gute Fee die Wünsche erfüllt.
Keine Zauberer wirken jedwede geheime Mächte.
Leider.
Nur ich.
Nur meine Geschichte.
Geboren wurde ich am 5. Oktober 1980 als ein gesundes kleines Mädchen. Das erste von drei Kindern. Meine erste Schwester kam zwei Jahre später und das Küken ganze sieben Jahre nach mir.
Ich wuchs in einer Zeit auf, in der man sich keine großen Gedanken darüber gemacht hat, ob man dem Geschlecht angehört mit dem man geboren wurde oder nicht.
Natürlich gab es gewisse Klischees. Mädchen spielten mit Bar- bies, tauschten Sticker und knüpften Freundschaftsbändchen und Jungs spielten mit Lego und Autos, waren wild und hatten nichts als Unfug im Kopf.
Ich selbst jedoch wuchs ohne diese Rollenklischees auf. Ich war frei. Ich tobte stundenlang im Wald und in ‚Sandkuhlen‘. Ich spielte Fußball, lief Rollschuh und trug höchsten zwei Mal in meinem Leben Kleider.
Im Sommer, wenn es heiß war, sprang man in Shorts in den See oder spielte mit bloßem Oberkörper auf der Straße Fußball und niemanden hat es gekümmert.
Egal ob Junge oder Mädchen.
Ich wuchs in einem kleinen Dorf auf. Jeder kannte jeden. Versucht das heute Mal. Das daraus entstehende Drama, währe oscarwürdig. Gedanken darüber, dass es meinem Geschlecht nicht entsprechen würde, habe ich mir nie gemacht. Für mich war es normal, was ich tat oder wie ich war. Ich war einfach ich.
Mein Onkel sagte früher immer, an mir wäre ein Junge verloren gegangen. Aber nicht einmal das, gab mir Anlass, darüber nachzudenken, ob mein Verhalten meinem Geschlecht angemessen war oder ob ich mich meinem geborenen Geschlecht zugehörig fühlte. Er tobte oder spielte Fußball mit mir und zeigte mir, wie man sich prügelt. Er animierte mich immer wieder dazu, noch höher auf den Baum zu steigen – hoch war nie das Problem, erst beim Abstieg kamen die Probleme.
Mit meinem Vater bin ich immer angeln gegangen. Ich habe besonders das Nachtangeln geliebt. Weniger wegen den Fischen, sondern vielmehr wegen der Nachtwanderungen und der Fledermäuse und der Zeit die wir zusammen verbracht haben. In der schützenden Dunkelheit fühlte ich mich immer wohl. Während andere sich gruselten, kamen mir die lustigsten Ideen, auf die ich hier jedoch nicht eingehen werde.
Zusammengefasst kann man sagen, dass ich sehr wild, sehr frei und ebenso glücklich war. Auch wenn ich mich immer schon von anderen unterschied und das tatsächlich wahr nahm, konnte ich es nicht erklären oder gar Gründe dafür benennen. Während die Mädchen im Kindergarten in der Puppenküche zu finden waren, malten oder bastelten, prügelte ich mich mit Jungs, stritt um Autos und kletterte auf den Spielgeräten herum. Mädchen waren langweilig – oder zumindest ihre Spiele. Den Jungen war ich suspekt. Ich ging davon aus, dass man mich nicht mochte, weil ich es nicht schaffte, einen Zugang zu den anderen Kindern zu bekommen.
Also war ich meistens allein.
Ich liebte es, im Wald herumzutollen, neue Pfade zu entdecken und dem Vertrauten etwas Neues abzugewinnen. Abseits der Wege suchte ich nach Abenteuern, kletterte auf Bäume oder focht Schwertkämpfe gegen unsichtbare Gegner. Ich hatte, wie man sich vorstellen kann, einen sehr hohen Verschleiß an Hosen, aber das störte mich nicht. Genauso wenig wie es mich störte, in verschlissenen Jeans mit Löchern an den Knien rumzulaufen, was heute ja immer mal wieder Mode ist.
Ab und zu wurde mir direkt und knallhart vor Augen geführt, dass ich anders war. Und dieses anders war nichts Gutes. Individualismus gern, aber andersartig ... nein so viel Individualität lieber nicht.
Wenn die anderen Kinder sich über Geburtstage unterhielten (zu denen ich nicht eingeladen war) oder über diverse Nachmittagsaktivitäten, an denen ich ebenfalls nicht teilgenommen hatte, fiel mir mehr auf als sonst, dass ich nicht zu den anderen passte.
Dass ich ruhig und schüchtern war, machte es für mich nicht einfacher, Freunde zu finden. Ab und zu ‚adoptierte‘ mich ein extrovertiertes Mädchen für eine Weile, aber das währte in der Regel nicht lang, weil ich eben nichts mit den Aktivitäten anfangen konnte, an der andere Mädchen Interesse zeigten.
Ich war nicht einsam oder zumindest war ich mir dessen nicht bewusst. Ich kam gut mit mir zurecht. Mein Großvater hatte in seinem Zimmer eine kleine Bibliothek und ich tauchte früh in alle möglichen Geschichten ein. Romane, die für mein Alter nicht geeignet waren, aber die ich dennoch begierig las. Das Dschungelbuch von R. Kipling oder Michael Endes ‚Die unendliche Geschichte‘ waren vielleicht nicht unbedingt Bücher, die von Kindern gelesen werden, ebenso wenig wie Readers Digests Romansammlungen, aber ich fand es spannend.
Auch wenn mir viele Einzelheiten nicht auffielen, die Kinder nicht verstehen können, tauchte ich in spannende, fantastische oder beängstigende Welten ein. Was kümmerte mich da, das ich keine Freunde hatte?
Was kümmerte mich, dass ich nicht zu Nachmittagsaktivitäten eingeladen wurde?
Nichts!
Außerdem hatte ich neben den Büchern meines Großvaters ja auch noch meine Schwestern, die man herrlich ärgern konnte. Manche Dinge halten wir uns auch heute noch scherzhaft vor über andere lachen wir Tränen. Ich spielte abends mit meinem Onkel zehn Tore oder er zeigte mir, wie man kämpft und sich wehren kann.
Wenn wir im Herbst die Bäume beschnitten, fuhr ich auf dem Anhänger auf den Ästen und dem Laub mit – theoretisch um auf zupassen, dass nichts verloren ging. Praktisch konnte man dem Weg den wir genommen haben sehr einfach verfolgen. Ich hatte einfach Spaß daran oben auf dem Schnittgut mitzufahren.
Der kleine Nervenkitzel reizte mich. Vermutlich war es auch dieser Reiz, der mich auf das Dach der Nachbarfirma trieb. Immer ein kleines bisschen höher, ein kleines bisschen weiter. Auf den ersten Palettenstapel, auf den nächst höheren, auf das erste Dach, aufs nächsthöhere- und oh wie cool, auf der anderen Seite ist ja schon unser Hof, also runter aufs niedrigere Dach, und schwupp ab in den Misthaufen gesprungen.
Hätte meine jüngste Schwester nicht ihre Jacke dort vergessen, wäre unser kleines Abenteuer nie herausgekommen. Mir war kein Baum hoch genug – bis ich oben war und mich daran erinnerte, dass ich unter Höhenangst litt und nicht mehr wusste, wie ich herunter komme.
Ich hatte trotz einiger Widrigkeiten (die es in meinem Leben natürlich gab, aber auf die ich hier nicht eingehen werde) eine schöne Kindheit.
Eine einfache Kindheit.
Einfacher als es heute der Fall ist.
Ich war freier als die Kinder es heute sein können.
Ich habe darüber nachgedacht, wie ich den Nachmittag verbringe, welches Buch ich lese, wohin ich gehen will – aber nicht einmal habe ich über mein eigenes Geschlecht nachgedacht. Es gab schließlich viel Spannenderes zum Nachdenken. Um halb eins war die Schule aus (spätestens) und danach hieß es Essen, Hausaufgaben, spielen bis zum Abendessen oder bis die Straßenlaternen angingen.
Ich höre und lese oft, dass mancher Transsexueller sagt, schon als kleines Kind gewusst zu haben, das er/sie/es im falschen Körper gesteckt hat. Vor allem von Jüngeren höre ich das oft. Mir ging es nicht so. Vielleicht liegt es daran, dass ich nie in ein Klischee gedrängt wurde und mich frei ausleben und entwickeln konnte. Vielleicht liegt es daran, dass das Geschlecht heute mehr als zu meiner Zeit thematisiert wird. Vielleicht von allem etwas.
Mir selbst wurde erst mit Einsetzen der Pubertät bewusst, das mein Körper nicht zu mir passte. Als meine Brust zu wachsen begann, trug ich oft weite Hemden von meinem Vater oder Onkel, um die Rundungen meines Körpers zu verstecken. Nicht das diese besonders groß oder auffällig gewesen wären, aber mir reichte es aus, um mich unwohl zu fühlen.
Meine erste Periode war die Hölle. Es widerte mich an, schlimmer noch: Ich widerte mich an. Ich hatte Klassenkameradinnen darüber sprechen hören, mit einem gewissen kleinen Stolz vermischt mit leichter Scham, waren sie doch jetzt keine Mädchen mehr, sondern junge Frauen.
Bäh!
Ich empfand diesen Stolz nicht. Es passte nicht zu mir. Krämpfe und bluten, tolle Scheiße! Das war doch nicht ich?! Ich wollte das alles nicht und empfand es als Verrat meines Körpers an mir. Das Bluten genauso wie die voranschreitende Entwicklung meines Körpers.
Als ich vierzehn Jahre alt wurde, durfte ich mir erstmals die Haare kurz schneiden. Auch damit stach ich aus der Menge heraus, ohne das ich es beabsichtigt hätte. In der Regel hatten Mädchen lange Haare. Meine Haare waren immer schon sehr dünn und außerdem nervte es mich, dass kaum das ein Lüftchen wehte, ich aussah wie ein Zottelmonster. Also kamen sie ab. Kurze Haare waren doch ohnehin viel praktischer und Pflegeleichter.
Kaum jemand schnitt sie so kurz, wie ich es tat und wenn wurden sie gleich als Kampflesben betitelt. Ob ich insgeheim so genannt wurde, weiß ich nicht und es ist wohl auch nicht mehr wichtig. Manche Mädchen trugen vielleicht einen Bob, aber das war schon sehr kurz für die meisten Mädchen.
Das ich mit dem Haarschnitt und meiner Kleidungswahl, meistens wie ein Junge aussah, störte mich auch nicht. Jeans, Shirt und Hemd, Turnschuhe. Passt immer und war mein Standartoutfit. Die aktuelle Mode ging vollkommen an mir vorbei, und um der Wahrheit die Ehre zu geben: Auch das scherte mich nicht im Geringsten.
Während andere Mädchen in meinem Alter sich schminkten, Take That anhimmelten und GZSZ geschaut haben, konnte ich damit nichts anfangen.
Ich habe es versucht.
Wirklich.
Aber Take That interessierte mich nicht. Ich war froh, wenn ich wusste, dass irgendein Lied das grade im Radio lief, von denen kam. Der Hype ging vollkommen an mir vorbei. Ich konnte den ganzen Boybands oder Girlgroups nichts abgewinnen. GZSZ fand ich sterbenslangweilig und mega überdramatisiert und zum Fernsehen hatte ich eh keine Zeit, schließlich gab es bestimmt noch unentdeckte Winkel im Wald.
Und das Schminken ?... Nun ich hatte weder Talent dafür, noch wusste ich, wozu das gut sein sollte.
Ich tat es, ab und an. Weil es alle taten.
Weil ein kleiner Teil von mir dazu gehören wollte.
Wie mein scheinbares Selbstvertrauen wurde das Schminken zum Teil einer Maske, die ich zu tragen lernte, um nicht zu sehr aus dem Rahmen zu fallen.
Irgendwo tief im Inneren, sehnt sich vermutlich jeder von uns nach Anschluss. Egal wie hart und stark wir tun. Egal wie sehr wir behaupten, dass es uns egal ist, wir wollen eine soziale Gruppe um uns, in der wir uns sicher und gewollt fühlen. Eine Gruppe, in der man uns sieht und hört. Zumindest ging es mir so, vielleicht gibt es ja da, auch Ausnahmen.
Wusste oder ahnte ich damals bereits, dass ich im falschen Körper stecke?
Jain.
Ich wünschte mir oft, ein Junge zu sein. Ich stellte es mir bildhaft vor, aber sprach mit niemandem darüber. Ich wusste nicht, dass ich im falschen Körper stecke, wusste nichts von diesem Krankheitsbild, geschweige denn das es eine Krankheit wie diese geben könnte. Ich dachte, es wäre einfach nur der Wunsch, das zu sein, was ich offensichtlich nicht war.
Dass es Möglichkeiten gäbe oder geben würde, mein Äußeres meinem Inneren anzugleichen, ahnte ich nicht. Mir standen keine der Informationen zur Verfügung, die heute zugänglich sind. Die Bücherei war klein und nur sonntags und mittwochs für ein paar Stunden geöffnet. Die Auswahl kam unserer Schulbücherei gleich, was heißt, das sie kaum nennenswert war. Geschweige denn, dass man dort Informationen über Transsexualität finden würde. Bis zum Internet dauerte es noch sehr lang.
Die Zeiten waren andere.
Homosexualität war ein Grund gemieden zu werden. Zumindest, wenn derjenige Glück hatte und es nur beim Meiden blieb. Gewalt gegen einen bekennenden Homosexuellen war die häufigere Reaktion.
Den Begriff Transsexualität habe ich zum ersten Mal zwischen meinem siebzehnten und neunzehnten Lebensjahr gehört. Selbst da war mir noch nicht klar, was genau damit gemeint war.
Ich habe eines Nachts einen kurzen Teil einer Reportage gesehen, in der es um Sexualität ging. Homosexualität und Transsexualität wurden dort unter anderem behandelt. Ich erkannte mich in vielen Aspekten wieder, aber was ich mit diesen Informationen anfangen sollte, war mir unklar.
Ich glaube, damals habe ich es nicht wirklich mit Verstand geschaut. Ich konnte nicht schlafen und suchte nach einer Ablenkung, die mich ermüden würde. Was eignet sich da für einen Heranwachsenden besser als Reportagen?
Heute schaue ich die ein oder andere Doku oder Reportage ganz gerne, aber früher nutzte ich sie, um müde genug zum Schlafen zu werden. Und so vergaß ich diese Reportage auch bald wieder.
Mit dem Internet steht uns heute so ziemlich jede Information zur Verfügung, die wir uns wünschen. Wenn wir denn wissen, wonach wir suchen sollen. Als ich das erste Mal Internet hatte, war mein Sohn grade geboren, und es gab noch Gratisstunden von AOL.
MSN hatte Gruppen und Chats, in denen sich allerlei eigenartige Leute tummelten – inklusive mir.
Aber zur Informationsbeschaffung nutzte ich das Internet dabei eher selten. Ich chattete, machte Schrift-Rp und vertrieb mir anderweitig die Zeit. Ich lernte in dieser Zeit viele interessante Leute kennen, erlebte viele Dinge, die hier jetzt nicht von Bedeutung sind und auch nichts mit meinem Weg zu tun haben.
Was jedoch von Bedeutung ist, ist das ich mehr und mehr unzufrieden war. Eine Art Schatten schien sich mit dieser Unzufriedenheit mehr und mehr über mich zu schieben. Unzufriedenheit über meinen Körper und mit mir selbst.
Jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich hatte einen guten Job, ein tolles Kind, einen Partner und Freunde. Aber etwas fehlte mir und ich konnte nicht sagen, was genau es war.
Vom Wesen her galt ich immer als sehr burschikos. Meistens trug ich mein Haar kurz geschnitten und wo ich mich Monat für Monat von meinem Körper verraten fühlte, war die Schwangerschaft, das eigenartigste (aber großartigste) das mir je passiert ist. Und das, obwohl mir nicht klar war, was genau mit mir nicht stimmte. Am 23.11.2000 um 1:29 Uhr schenkte ich meinem Sohn das Leben und egal, was noch geschehen mag, er ist und war das Beste, das mir je passiert ist.
Sexualität war nie ein vorrangiges Thema in meinem Leben und ist es auch heute nicht. Andere machten es oft mehr zum Thema, als ich es tat. Ich hörte in meiner Schulzeit oft, wenn sich Klassenkameradinnen über ‚Frauenprobleme‘ unterhielten und erste Erfahrungen mit Jungen austauschten.
Und ich?
Ich hatte mit all dem nichts am Hut. Es behagte mir nicht, über meine Periode oder Krämpfe oder Erfahrungen mit Jungen (die nicht vorhanden waren) zu sprechen. Vielleicht war ich ein kleiner Spätzünder, na und?
Ich tobte im Wald, mein kleiner Freundeskreis bestand in der Regel aus männlichen Freunden, auch wenn ein, zwei Mädchen dabei waren. Da blieb für Jungen oder Sex gar keine Zeit.
Im Erwachsenenalter oder beim Heranwachsen änderte sich daran nicht viel. Nur das meine geringe Freundeszahl noch ein wenig mehr abnahm. Außer ich war aus zum Feiern. Dann konnte ich tatsächlich kontaktfreudig sein. Auch wenn ich mich dann und wann schminkte, war ich immer noch sehr burschikos. Das Schminken beschränkte sich in der Regel auf Puder und Mascara, heute ist das nicht mal das Basement für den Großteil der Damen und einen Teil der Männerwelt.
Wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert.
Durch das Gefühl, das etwas nicht stimmt, das mir etwas fehlt, obwohl ich doch augenscheinlich alles hatte, verfiel ich in Depressionen. Ich konnte meinem Arzt nicht sagen, was es war das mich belastete, weil ich es selbst nicht greifen konnte. Aber ich suchte mir Hilfe und ich rate jedem, das zu tun. Ich hatte und habe das Glück, das mein Hausarzt immer ein offenes Ohr hat und als ich um Antidepressiva bat, bekam ich sie auch.
Die Trennung von meinem Partner war abzusehen. Er verließ mich nach fast acht Jahren Beziehung, aber ich trage es ihm nicht nach. Ich war kein einfacher Mensch und wie viele andere suchte ich im Internet nach Ablenkung vor der Leere, die mich erfüllte, und er blieb außen vor.
Im Second Life konnte ich sein, wer ich wollte und was ich wollte. Ich fand Rollenspielsims und diese lösten bald das andere Schrift-RP ab das ich bis dahin aufrechterhalten hatte. Auf einer
‚Sim‘ (einem Land das bebaut und bespielt werden kann) musste ich mich mittels Voice - Check verifizieren.
Die Verantwortlichen wollten sicherstellen, dass ich kein Kind bin, da es dort Rollenspiel gab, das bisweilen durchaus gewalttätig sein konnte. Einer der Admins sagte »Ja der ist auf jeden Fall erwachsen.«
Ich verbesserte ihn nicht. Stellte nicht klar, dass ich kein ‚er‘ bin.
Das hatte zwei Gründe:
Als Frau im Internet zieht man sehr eigenartige Menschen an. Als Mann hat man seine Ruhe. Dachte ich – war ich nicht herrlich naiv?
Es gefiel mir als Mann erkannt zu werden. Warum es mir so gefiel, konnte ich nicht sagen, aber um ehrlich zu sein, dachte ich auch nicht sehr ausgiebig darüber nach, dass es mir zusagte. Vielleicht war dieses Gefallen, noch ein Ausdruck eines vergessenen Wunsches? Der Wunsch, ein Junge zu sein?
Doch andererseits ... sagte ich nicht immer wieder – nur zum Teil - im Scherz, dass ich ein toller Schwuler wäre? Denn das dem so war, war mir vollkommen klar.
Mit dem weiblichen Körper konnte ich nichts anfangen, nicht einmal meinen mochte ich sonderlich.
Ich lernte durch Second Life neue faszinierende Menschen kennen, und auch wenn ich versuchte, Second Life und Real Life strikt voneinander zu trennen, gelang mir das nicht immer. Ich fand eine neue Freundin und über die Zeit wurden wir zu besten Freunden.
Sah man von einer Kleinigkeit ab, dass ich theoretisch nicht der Mann war, für den ich mich ausgab, teilten wir alles miteinander. Wir skypten täglich und wenn es nicht Skype war, dann Whatsapp oder Facebook-Messenger, über die wir über den Tag verteilt Kontakt hielten.
Vielleicht war es tatsächlich zum Teil diese virtuelle Welt, die mir den Mut gab – wenn auch erst Jahre später – das ich den Schritt wagte, mein Leben neu zu gestalten. In dieser virtuellen Welt, in der ich versuchte, die Leere zu füllen, die ich nicht erklären konnte, konnte man sein, was man wollte.
Selten nur begegnete einem Hass oder Ablehnung. Und was in dieser virtuellen Welt möglich war, sollte doch auch im wirklichen Leben möglich sein, oder?
Vielleicht.
Kapitel 2 – das Outing
Mein Outing selbst vollzog ich in zwei Teilen. Ein tatsächliches und ein halbes. 2015, als ich mit meinem inzwischen 15-jährigen Sohn spazieren ging, erkundigte ich mich bei ihm, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich fortan als Mann leben würde. Nicht das ich vorhatte seine Erlaubnis einzuholen, aber Kinder können grausam sein, wie ich das ein oder andere Mal aus eigener Hand erfahren durfte. Und in Zeiten, in denen Technologien eine zunehmende Rolle spielten, wurde es für Kinder und Jugendliche nicht einfacher.
Das Letzte, das ich wollte, war, dass er unter Repressalien zu leiden hatte, weil ich alles auf den Kopf stellte. Mein Leben war in diesen Jahren sehr turbulent und ich war mir nicht sicher, ob ich mit eventuellen Anfeindungen zurechtkommen würde. Ich beschloss, vorerst zu schweigen und abzuwarten, auch wenn mein Sohn kein Problem damit hätte, wenn ich mich outen würde und mein Leben lebte.
Zitat: Das ist wie Kaugummi kauen (Anspielung auf ein Lied der Ärzte).
Ich hatte es irgendwie bis hierher geschafft, was sollte da ein bisschen mehr Zeit ausmachen? Ich wusste nicht, womit ich rechnen müsste, wenn ich mich outete.
Hass? Gewalt? Mobbing? Ausgrenzung?
Gut ich bin und war nie der Geselligste, aber aus freien Stücken allein zu sein, oder gemieden zu werden, ist ein himmelweiter Unterschied. Alles, was ich wusste, war, dass ich nichts von alle dem zum jetzigen Zeitpunkt gewachsen war. Es dauerte noch zwei Jahre, bis ich den Mut fasste, mich der Masken, mit denen ich zu leben - oder zu überleben – versuchte, entledigte.
Masken aus Selbstbewusstsein. Lachende Masken.
Geschminkte Masken.
Wer oder was hinter diesen Masken steckte ... nicht einmal ich konnte es sagen. Aber ich würde und wollte es herausfinden. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich nicht länger jemand sein wollte, der ich nicht bin.
Ich hatte mein tatsächliches Outing nicht geplant und mir keine Gedanken darüber gemacht wie ich es am besten anstellen sollte oder könnte. Ich hatte nicht einmal beschlossen, das es an der Zeit wäre mich zu outen.
Es kam ganz spontan.
Ich war mit meiner Mutter einkaufen. Auf dem Parkplatz, nachdem wir das Auto eingeräumt haben, saßen wir noch einen Moment da und tranken unseren Kaffee 2 Go, als ich auf irgendein Herumgealber einen Satz sagte, den ich schon oft gesagt hatte:
»Ich bin ein toller Schwuler. Gut, der Einzige der nicht ein Fünk- chen modischen Geschmack oder Style hat, aber toll.«
Mama lachte. Nach ein paar weiteren Minuten, des Lachens und Alberns wurde ich ernst.
»Wäre es in Ordnung für dich, wenn ich als Mann weiterlebe?« Was genau das bedeutete, konnte ich nicht einmal sagen.
Woher sollte ich das auch wissen? Was nötig wäre, welcher Weg vor mir liegen würde, ahnte ich nicht. Aber das war auch nicht wichtig. Wichtig war, dass ich eine Entscheidung getroffen hatte und diese Entscheidung mit meiner Mutter und meinem Umfeld teilen wollte. Mamas Antwort war kurz, aber deshalb nicht weniger intensiv oder wichtig:
»Natürlich«
Mir fiel ein Stein vom Herzen und ich atmete erleichtert aus. Wir tranken unseren Kaffee schweigend. Dann grinste sie mich an und mir schwante Böses. Na ja mehr oder weniger. Was sollte jetzt schon noch passieren, nicht wahr?
»Aber du sagst es Papa selber.«
Wir lachten. In dem Moment wurde mir klar, dass ich tun könnte, was ich wollte, und meine Familie trotzdem hinter mir stünde.
Wie ich das Ganze meinem Vater erklären wollte, wusste ich noch nicht. Mein Vater ist ein sehr ruhiger Mensch. Ich konnte und kann immer mit ihm sprechen, aber seine Meinung behielt er in der Regel für sich, wenn man nicht direkt danach fragte. Erst im Laufe der vergangenen Jahre nahm das ab und er wurde offener und gesprächiger.
Es bereitete mir weit mehr Sorgen, meinem Vater zu erklären, dass seine erstgeborene Tochter sein Sohn war, als bei jedem anderen. Ich erwartete keinen Widerstand, schließlich unterstützten meine Eltern mich von jeher bei allem, was ich tat.
Und doch ...
Ist es nicht eigenartig?
Egal wie alt man auch sein mag, in Gegenwart der Eltern, ist man das kleine Kind, das vielleicht eine Dummheit beichtet (und davon gab es einige) oder um Erlaubnis bitten will, die Nacht bei der besten Freundin zu verbringen. Und genauso fühlte ich mich, als ich neben meinem Vater im Auto saß.
Der perfekte Zeitpunkt.
Er hatte sein Motorrad in die Werkstatt gebracht und ich holte ihn ab. Ich hatte schon auf dem Hinweg überlegt, welche Worte ich wählen sollte, legte mir Argumente zurecht und malte mir gedanklich aus, wie mein Vater reagieren würde. Auf seine tatsächliche Reaktion war ich nicht vorbereitet: Ich nutzte keine bereitgelegten, vorbereiteten Worte – wer tut das schon? – sondern sagte ihm schlicht: »Du Papa, ich habe beschlossen, das ich den Rest meines Lebens als Mann leben werde.«
Stille.
Fünfzig Meter. Hundert Meter. Zweihundert.
Ich spürte den Blick meines Vaters auf mir, während ich versuchte, auf den Verkehr zu achten und auf eine Reaktion wartete. Irgendein dummer Kommentar, ein dummer Spruch, ein Scherz – irgendwas.