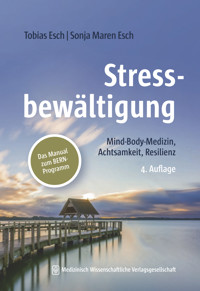9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unsere Gesellschaft steckt in einer Krise des Überangebots und der permanenten Beschleunigung. Für Bestsellerautor, Neurowissenschaftler, Mediziner und Glücksforscher Tobias Esch ist es spätestens nach Corona an der Zeit, das sinnentleerte Streben nach Mehr infrage zu stellen – wir müssen von der sich unablässig steigernden Dichte, von haltlosem Konsum und damit einhergehender (Selbst-)Ausbeutung wegkommen, müssen zurückfinden zu der Reduktion auf das Minimale und einer so wohltuenden wie befreienden »Leere«. Mehr Nichts, weniger Mehr, nach diesem Leitmotiv sollten wir unsere Leben ausrichten! Im Mittelpunkt der von Esch aufgerufenen Debatte steht die Medizin und eine selbstgefällige Suche nach strahlender Gesundheit oder »ewigem Leben« – mit Corona als alarmierendem Stachel im Fleisch. Darüber hinaus wendet sich der Autor allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens zu: Glauben und Achtsamkeit, Politik, Klima, Ökologie und Wirtschaftsstrukturen. Hier attestiert er eine paradox erscheinende Gleichzeitigkeit von ungehemmtem Wachstum einerseits und einer parallel anwachsenden Zahl von Menschen andererseits, die nicht mehr willens sind, so wie bisher mitzumachen, sich das Drama einer aus den Fugen geratenen Welt noch länger anzuschauen.
Nur wenn wir uns in sämtlichen Belangen – und nicht nur mit Blick auf individuelle Selfcare-Maßnahmen – wieder auf die Essenz reduzieren, können wir den Weg zurück zu sinnhaftem Lebensglück und Nachhaltigkeit finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
»Es ist an der Zeit, das verhängnisvolle Lebensmodell des ewigen Mehr infrage zu stellen.« Tobias Esch
Unsere Gesellschaft steckt in einer Krise des Überangebots und der permanenten Beschleunigung. Für Bestsellerautor, Neurowissenschaftler und Glücksforscher Tobias Esch ist es spätestens nach Corona an der Zeit, das sinnentleerte Streben nach Mehr infrage zu stellen – wir müssen von haltlosem Konsum und damit einhergehender (Selbst-)Ausbeutung wegkommen, müssen zurückfinden zur Reduktion auf das Minimale und einer so wohltuenden wie befreienden »Leere«. Im Mittelpunkt der von Esch aufgerufenen Debatte steht die Medizin und eine selbstgefällige Suche nach strahlender Gesundheit oder »ewigem Leben« – mit Corona als alarmierendem Stachel im Fleisch. Darüber hinaus wendet sich der Autor allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens zu: Glauben und Achtsamkeit, Politik, Klima, Ökologie und Wirtschaftsstrukturen. Nur wenn wir uns in sämtlichen Belangen wieder auf die Essenz reduzieren und zur BESINNUNG kommen, können wir den Weg zurück zu Lebensglück und Nachhaltigkeit finden.
Zum Autor
Univ.-Prof. Dr. med. Tobias Esch ist Neurowissenschaftler, Gesundheitsforscher und Allgemeinmediziner. Seit vielen Jahren untersucht er, u. a. an der Harvard Medical School und an der Berliner Charité, wie Selbstheilung funktioniert und wie ihre Potenziale innerhalb und außerhalb der etablierten Medizin nachweisbar für die Gesundheit genutzt werden können. Seit 2016 ist er Institutsleiter und Professor für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke, wo er auch die dortige Universitätsambulanz als Aushängeschild und Blaupause einer »Medizin von morgen« gründete. Seine Sachbücher (u. a. »Der Selbstheilungscode« oder »Die Bessere Hälfte« zusammen mit Dr. med. Eckart von Hirschhausen) wurden mehrfach ausgezeichnet und erreichten Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten.
TOBIASESCH
MEHRNICHTS!
Warum wir weniger vom Mehr brauchen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2021 Copyright © 2021 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung von Motiven von © FinePic®, München
Redaktion: Regina Carstensen
DF | Herstellung: kw
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-27031-5 V002
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Inhalt
Statt eines Vorworts Ein Gespräch mit Eckart von Hirschhausen
Die Idee
Oh, Corona – Das Paradoxon
Teil I Mehr oder weniger Medizin
Immer mehr Medizin
Ein wachsender Markt – Deutschland ist Weltmeister – Gesundheit in allen Ecken? – Erfolgsgeschichten – Die Antreiber – Der wahre Feind – Wie wollen wir leben? – Voll der Stress – Die Menschen hinter den Masken – Reicht es für alle? – Was ist das Ziel? – Darf’s ein bisschen weniger sein?
Weniger Medizin?
Das Haus Gottes – Was ist Gesundheit? – Ihre Gesundheit braucht Sie! – Was wir von den Alten lernen können – Ananda – Aristoteles meets Dr. House – Heil-Sein oder: Du musst nicht funktionieren – Weniger Medizin durch Digitalisierung? – Die Medizin neu denken
Teil IIMehr oder weniger Glaube (oder Achtsamkeit)
Die Ökonomisierung des Bewusstseins
Volles Bewusstsein – Zur Mitte finden – Achtsamkeit – Meditation wirkt! – Mit der Welt im Einklang? – Religion (und Achtsamkeit) als Ware – McMindfulness – Gewissenlose Achtsamkeit? – Seelenstyling – Fake-Spiritualität – Wer hat das Problem?
Die reine Leere
Nada Brahma – Nichts ist nicht nichts – Form ist Leere – Nach Hause kommen – Heiligt der Zweck die Mittel? – Keine Angst – Freiheit (Lass los!)
Teil IIIMehr Wirtschaft, weniger Ökologie? Oder umgekehrt? Oder beides?
Wie im Kleinen, so im Großen
Das Problem des ungezügelten Wachstums – Spannungsverhältnis Ökonomie und Ökologie – Heiße Zeiten! – Planetary Health: Die Beziehung zwischen Mensch und Natur neu denken
Weniger ist das neue Mehr
Wachstum und Entschleunigung: Wie geht das zusammen? – Weniger in der Politik – Joy of Missing Out – Ein neues Paradigma – Der leere Spiegel
Mehr Nichts
Danksagung
Anmerkungen
Statt eines Vorworts Ein Gespräch mit Eckart von Hirschhausen
Eckart von Hirschhausen:Mensch Tobias, seit unserem Buch Die bessere Hälfte sind wir beide ja nicht jünger geworden. Die kühne These war ja, dass die zweite Lebenshälfte die zufriedenere ist. Wie hast du deinen fünfzigsten Geburtstag erlebt?
Tobias Esch: Na, ich hatte es ja schon geahnt. Statistik ist das eine, das eigene Erleben das andere. Und zur besseren Hälfte gehört eben auch, dass man sich erst von »da unten« nach »da oben«, zur Zufriedenheit, hocharbeiten muss. Kurzum: Es war eher durchwachsen.
Kann man am Durchwachsen persönlich wachsen? Was war denn mühselig?
Zu deiner ersten Frage: Ja, das Wachsen ist ein Tun. Das fällt einem nicht so in den Schoß. Meine Arbeit hieß beispielsweise Corona: Geburtstagsfeier abgesagt, in der Ambulanz in Schutzmontur Abstriche nehmen! Sehr viele Prozesse, das zu deiner zweiten Frage, mussten neu definiert werden. Man musste sich irgendwie neu erfinden.
Aber eigentlich hätte doch der Lockdown bei jemandem, der ständig über Achtsamkeit und Entschleunigung redet, offene Türen vorfinden können?
Alles hat bekanntlich mehrere Seiten. Bei mir war es eher so, dass sämtliche Routinen, die die Achtsamkeit und das Miteinander einbeziehen, über den Haufen geworfen wurden. Fraglos und ganz im Sinne der »besseren Hälfte« war jedoch, dass unser aller Leben auf das Wesentliche fokussiert wurde. Im Sinne von: »Weniger ist mehr«. Wir brauchten viel weniger, um zufrieden zu sein. Es gab ja auch nichts anderes.
Aber wie hast du in dem Chaos die Struktur behalten?
Meine Frau und ich hatten über Monate hinweg ein Ritual entwickelt: Jeden Abend lauschten wir online einem Gespräch mit unserem Achtsamkeitslehrer Jon Kabat-Zinn. Das war sehr tief.
Das Irre ist doch, dass es bei dieser globalen Pandemie zum ersten Mal ein globales Bewusstsein einer Bedrohung gab – und damit gemeinsame Anstrengungen, die seelische Gesundheit hochzuhalten. Wie war das, sich übers Internet »verbunden« zu fühlen, synchron mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt?
Sehr berührend und überraschend: Exakt tausend Leute kamen über vier Monate zur selben Zeit zusammen. Jeder trug etwas bei, sodass man zu den Gesichtern über die Zeit auch persönliche Geschichten und Eigenschaften kennenlernte. Die »Community« hat dann spontan eine »Weltkarte der Liebe« erstellt, wo sich jeder online eintragen konnte mit einem Fähnchen und einem kleinen Spruch oder so. Wir saßen alle im selben Boot und hatten dieselben Themen und Fragen. Ein wahnsinniges Gefühl von Gemeinschaft. Und wie war es bei dir?
Ich habe ebenfalls die Online-Welt neu entdeckt, nur ein wenig anders. Durch den Aufbau eines wöchentlichen YouTube-Kanals, »Hirschhausen zu Hause«, versuchte ich einen Beitrag zu leisten. Aber erst wenn das Analoge wegfällt, erkennt man den Wert echter Begegnungen.
Stimmt – auf der Bühne und bei Vorträgen erlebe ich dich immer besonders intensiv und lebendig. Du bist ein echter Begegnungsmensch. Ein zentraler Teil deines Wirkens brach bei dir ein …
Genau. Von einem auf den anderen Tag wurde die ausverkaufte Tour abgesagt, mein Lebenselixier, da hast du schon recht, da bin ich voll in meinem Element. Das war sehr hart, aber nicht nur für mich, vor allem für die gesamte Crew, die Licht- und Tonleute, die Veranstalter, die Agentur, das Management und jene, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig waren. Kultur wurde über Nacht als entbehrlich eingestuft, kann als Erstes wegfallen, wird nicht unterstützt, hat keine Lobby und keinen Wert. Das führte zu einem tiefen Riss in der Gesellschaft. Bislang ist nicht klar, ob sich diese Branche mit über einer Million (Nicht-)Beschäftigten davon wieder erholt.
Ich litt mit euch. Es war traurig, all die Bühnen und Plätze leer und verwaist zu sehen. Aber wie ist es dir persönlich ergangen? Irgendwelche Aha-Erkenntnisse?
Durch das »Not-Aus«, den Lockdown und das Zurückgeworfen-Sein auf das Wesentliche ist mir die Zerbrechlichkeit all unserer Gewissheiten sehr bewusst geworden. Wir denken gerne, dass wir ein Anrecht darauf haben, dass alles so weitergeht, wie wir uns das wünschen, wie wir das kennen. Und das ist ganz offensichtlich Quatsch. Ein kleiner Schnipsel Erbsubstanz, mehr ist ja ein Virus nicht, wirft die gesamte Erde aus der Bahn. Ich verfolgte in dieser Zeit weiter die Idee einer Planetary Health, also jenes Konzept, das einen Zusammenhang von globaler und persönlicher Gesundheit herstellt.
Das große Ganze und das kleine Persönliche stehen also nicht im Gegensatz? Tatsächlich habe ich dich in letzter Zeit ziemlich betroffen und auch nachdenklicher erlebt – trügt mein Eindruck?
Nein. Je mehr ich mich mit der Klimakrise beschäftige, desto mehr wundere ich mich, wie ich die Berichte der letzten dreißig Jahre darüber so lange habe ausblenden können. Denn das ist eine Katastrophe mit Ansage. Da stelle ich mir die Frage, welche Rolle Ärzte und öffentliche Personen hier übernehmen können und müssen.
Wir sind beide Ärzte. Ich beschäftige mich insbesondere mit den persönlichen Anteilen – etwa der Ärzte und des Pflegepersonals. Und so wie du verstärkt auf die globalen Zusammenhänge geschaut hast, so habe ich mich intensiver mit den Konsequenzen auf der Ebene der Individuen auseinandergesetzt. Und auch hier sieht man eine Katastrophe mit Ansage. Mehr und mehr werden persönliche Ressourcen verbrannt, ohne dass es die Menschen glücklicher oder zufriedener macht. Aus der Sicht des Einzelnen scheint es sogar so zu sein, dass wir unser Gesundheitssystem an die Wand fahren.
Ich erinnere mich an einen großartigen Satz aus dem Roman House of God über das Leben der Nachwuchsmediziner: »Die Kunst der Medizin besteht darin, so viel NICHTS zu tun wie möglich.« Stattdessen herrscht in ihr der gleiche Wachstums- und Effizienzglaube wie überall in der Wirtschaft. Was hast du denn für ein Gegengift?
Wir haben ein umfangreiches Forschungsprojekt initiiert, wo es um Glück und Achtsamkeit, um Belastungen und Ressourcen in der Medizin und in der Pflege geht. Im Gesundheitswesen insgesamt. Immer wieder sehen wir Menschen hinter den Masken, denen es gerade nicht gut geht. Und das, obwohl das Wissen über Glück uralt ist und alle sagen, dass die Gesundheitsberufe so wichtig sind, dass allein schon deswegen Zufriedenheit herrschen müsste. Was läuft da schief, Eckart?
Corona hat uns durch die Unmittelbarkeit der Gefahr in einen Stresszustand versetzt und uns zum Handeln gezwungen. Wir akzeptieren sogar drastische Maßnahmen, wenn wir sie für nötig halten. Das Dumme ist nur, dass wir aus dem Reagieren nicht mehr herauskommen, um auf übergeordneter Ebene darüber nachzudenken, wie gut es uns mit weniger Stress gehen könnte. Wie bekommen wir denn die Idee von »Weniger ist mehr« in die Köpfe und Herzen?
Am Ende ist es immer ein Gefühl. Unsere Motivation kommt schließlich von innen, sie »wohnt« im Kopf. Unser inneres Belohnungssystem lässt uns fühlen, was wir wollen oder was wir nicht wollen. Was vermeintlich gut oder weniger gut für uns ist. Es muss uns gelingen, das, was uns wirklich wichtig ist und weiterbringt, auch als globale Community, in diesem Sinne als lohnenswert erscheinen zu lassen. Wir müssen aus der Defensive, aus dem Stress heraus und die Zukunft aktiv gestalten – und zwar mit Freude und Lust. Nicht mit Verboten allein.
Darin sehe ich ebenso den Wert von Musik, Kabarett, Lesungen und allem, was Menschen kreativ miteinander verbindet. Eigentlich ist es doch toll: Wir müssen nicht mehr wie unzählige Generationen vor uns unentwegt schuften, um uns etwas zu essen kaufen zu können. Aber wir ignorieren das. Stattdessen drehen wir immer schneller am Rad, bis die Erde in die Knie geht und wir tatsächlich nichts mehr zum Essen haben. Das ist sehr komisch, unfreiwillig.
Als Komiker lebst du von Widersprüchen, die in der Gesellschaft und in jedem Einzelnen von uns existieren.
Und du ebenso, wenn auch anders! Alle wollen gesund sein, aber keiner will dafür in »Vorleistung« gehen, sprich: gesünder essen, sich mehr bewegen und sich weniger stressen lassen.
Dabei wäre das, was der Einzelne tun kann, so wirksam. Aber es ist anstrengender, als eine Pille einzuwerfen. Und das Paradoxe dabei ist: Der Gesundheits- und Pharmamarkt wächst und wächst, aber die Menschen sterben verstärkt an lebensstilbedingten und prinzipiell vermeidbaren Krankheiten. 80 Prozent machen die aus! Corona hin oder her.
Nicht minder absurd ist dabei: Dieser Lebensstil tut weder dem Menschen noch der Erde gut. Körperlich bewegen wir uns immer weniger, dafür räumlich ständig mehr, noch dazu mit einem hohen Verbrauch fossiler Energie, was die Umwelt massiv belastet. Sollten wir doch besser mal unser überschüssiges Körperfett verbrennen. Und ironischerweise atmen wir dann auch noch die dreckige Luft ein.
Wir alle spüren aber, dass da etwas nicht stimmt. Wir haben ein schlechtes Gewissen, weil wir ahnen, dass wir selbst mitverantwortlich sind. Und dieses schlechte Gefühl ertränken wir dann in vermehrtem Konsum, statt an den Ursachen zu arbeiten.
Glaubst du nicht auch, dass die Klimakrise eine spirituelle ist? Wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir brauchen.
Ja, und ist das nicht schräg? Während die Fridays-for-Future-Demonstrationen ihren bisherigen Höhepunkt kurz vor der Pandemie hatten, war global der höchste Energie- und CO2-Verbrauch zu messen. Und während im letzten Jahr die meisten Austritte aus den christlichen Kirchen hierzulande verzeichnet wurden, schwemmten Sinnsuchende einen stark anwachsenden Spiritualitäts- und Achtsamkeitsmarkt! Eine ganz neue Industrie ist da im Entstehen – nach den bekannten Regeln von Angebot und Nachfrage. Viele Ersatzhandlungen sind zu beobachten, die alle von wichtigen Fragen ablenken: Kannst du mit dem zufrieden sein, was da ist? Muss es wirklich immer mehr sein? Geht auch mal weniger – oder gar nichts? Was brauchst du wirklich?
Na, dann lass mal hören.
Die Idee
Oh, Corona – Das Paradoxon
Dieses Buch schrieb ich mitten in der Corona-Pandemie – Ausgang ungewiss. Man sucht es sich nicht aus.
Die Idee dafür ist über mehrere Jahre entstanden, die Beobachtungen und zentralen Thesen, die ich darlegen werde, stammen aus der Phase »vor Corona«. Und nun drängt sich die Frage auf: Gibt es noch etwas, das ohne Corona gedacht und beschrieben werden kann?
Kritisch werde ich jedenfalls die Rolle der Medizin in heutiger Zeit hinterfragen. Hat nicht Corona, hat nicht die Krise, die wir im Zuge der Ausbreitung des Virus gegenwärtig erleben sowie der massiven Bemühungen, es unter Verzicht auch auf persönliche Freiheiten und lang erkämpfte und für gegeben geglaubte Individualrechte einzudämmen, mehr als deutlich gemacht, wie wichtig und alternativlos die moderne Medizin ist? Und wie wichtig es ist, dass sie jederzeit gerüstet, ja, hochgerüstet ist? Immer einen Schritt voraus und keinesfalls mit veralteten Waffen und mangelhafter Ausrüstung ausgestattet? Oder würde man das Gegenteil von »mehr Medizin« nicht als zynisch abtun müssen, könnte es nicht fatale Folgen haben, tatsächlich und messbar?
Weniger Medizin – kann das zuweilen nicht doch »besser« sein? Obwohl: Sich pandemisch ausbreitende Seuchen und Erkrankungen, sind sie nicht der unmittelbare Beweis dafür, dass dies nicht stimmen kann? Wäre nicht allein eine solche Behauptung ein Spiel mit dem Feuer? Geben uns nicht die Medien tagtäglich zu verstehen, dass wir mehr Medizin, mehr Forschung, mehr Effektivität und letztlich mehr Geld und Personal für diesen Wirtschaftssektor brauchen? Wie kann man da ernsthaft von »weniger« sprechen?
Sollte man dieses Buch also nicht gleich zur Seite legen, weil allein die Frage offensichtlich falsch gestellt ist und damit nicht stimmt, nicht stimmen kann? Man kann es aber auch anders sehen: Die gegenwärtige Aufruhr- und Aufbruchsphase ist ein weiterer Indikator dafür, dass etwas in unserem System grundsätzlich nicht stimmt. Meine Überlegungen könnten durch die Krise noch in ihrer Brisanz unterstrichen werden.
Sie* werden aufgefordert, sich ein eigenes Bild zu machen. Wie gesagt: Der Ausgang ist ungewiss, nicht weniger für mich. Vielleicht habe ich unrecht. Aber vielleicht ist es gerade jetzt an der Zeit, meine Ideen in den Raum zu stellen, um Entwicklungen in anderen Bereichen mit in Betracht zu ziehen. Als Denkanstöße. Mehr habe ich gerade nicht zur Hand.
Zweifellos: Schon jetzt ist absehbar, dass wir uns in Zukunft stärker Gedanken darüber machen werden, ob jenseits der Medizin nicht auch Aspekte wie ein globales Vernetzen aller Tätigkeiten und damit bedingungslos Voneinander-abhängig-Machen, das Fehlen von Autonomie und Autarkie, die Tatsache, keine Ressourcen mehr in Reserve zu haben, alles »just in time« erledigen und bekommen zu können, die Vorstellung einer völligen Entgrenzung jeglichen wirtschaftlichen Handelns und damit unserer All-Verbundenheit selbst im sozialen Austausch doch sehr deutliche Risse bekommen haben. Und so mehren sich inmitten der Krise jene Stimmen, die die Geschichte vom »Weniger ist das neue Mehr« in unterschiedlicher Weise, aber letztlich ähnlich klingend erzählen.
Was ist dann hier neu? Oder ist das Buch nur ein weiteres Echo, ein Widerhall, vielleicht geschrieben von einem »Trittbrettfahrer«? Nun, das kann ich nicht entscheiden. Da sind Sie gefragt. Ich hoffe jedoch, Überlegungen und Beobachtungen zu vertiefen, die eine aktuelle Aufgeregtheit und jedweden Aktionismus überdauern. Insofern geht es nicht nur um mehr oder weniger Medizin, sondern auch um Verzicht und Solidarität, um soziale Nähe und soziale Distanz. Das führt weiter zu spirituellen Fragen, zum Glauben, zur Sinnhaftigkeit sowie einer möglicherweise existierenden »tieferen Quelle«.
Lassen Sie sich überraschen.
Das Paradoxon
Schaut man sich die Kosten und Ausgaben im Gesundheitswesen an, deren Entwicklung sowie die Erfolge und Möglichkeiten, die uns die moderne Heilkunde zu bieten scheint, könnte man meinen, dass hier ein geradezu unendliches Wachstum möglich ist. Es scheint denkbar, die Grenze des Lebens noch weiter nach hinten hinauszuschieben, bis schließlich – manch ein Mediziner oder Gesundheitswissenschaftler mag davon träumen – ein Schlüssel zur Unsterblichkeit gefunden wird.
Gleichzeitig ist es jedoch so, dass der Mensch, gerade wenn er älter wird, sich mehr und mehr von der Vorstellung einer ewigen Jugend, einer ewigen Gesundheit und Unversehrtheit emanzipiert. Seine Zufriedenheit und sein Lebensglück hängen immer weniger, folgt man entsprechenden Statistiken, vom Erhalt oder dem Wiedererreichen des ursprünglich gesunden – vermeintlich idealen – Zustands ab. Mehr noch: Gerade das Akzeptieren von Vergänglichkeit und ein Sich-Arrangieren mit dem oft als schicksalhaft erlebten körperlichen Abbau, gekoppelt jedoch an die Fähigkeit, »loslassen« zu können (ohne die Lebensfreude dabei zu verlieren!), wozu auch das Zurücklassen einer naiven Vorstellung vom »ewigen Leben« gehört, scheinen für viele Ältere eine ganz eigene Schönheit und Zufriedenheit in sich zu begründen. Hier mag es um innere Reifungsprozesse, um eine Art innere Freiheit und, vielleicht, Weisheit gehen – trotz nicht zu leugnender äußerer und körperlicher Einschränkungen. Manche Ältere nennen das Lebenserfahrung – und sind dankbar dafür. Die Medizin tritt hier stellenweise in den Hintergrund, Ärzte sind jetzt mehr Begleiter, weniger als Heiler gefragt.
Offensichtlich haben wir es hier mit zwei unterschiedlichen Polen zu tun, man könnte sagen, mit einem Paradoxon: das Dilemma in der Medizin, einerseits mit aller Kraft und allem, was möglich ist, Heilung und Wiederherstellung anzustreben, anstreben zu müssen, während andererseits das Objekt dieser Bemühungen, der individuelle, reifende Mensch, immer weniger – in Bezug auf sein persönliches, subjektives Glück und seine Lebenszufriedenheit – an tatsächliche Heilung und den Erhalt dieses Urzustands glaubt oder sich von ihm gänzlich abhängig macht.
Spannen wir den Bogen noch größer.
Wir erleben in unserer Gesellschaft nicht nur in der Medizin ein Dilemma, wo eine generelle Ausgabenexplosion – beschleunigt etwa durch moderne Krebstherapien und ihre immensen Kosten, begleitet von einem ständig bedrohlicher werdenden Fachkräftemangel – Zeichen einer Überhitzung, eines möglichen »Aus-dem-Ruder-Laufens« ist. Vor allem zeigt es aber die Tatsache an, dass das theoretisch und individuell Machbare nicht immer mit dem praktisch Durchsetzbaren (und Bezahlbaren) sowie dem »allgemein« Gewollten deckungsgleich erscheint.
Das Dilemma finden wir heute vielerorts, fast scheint es, als hätten sich möglichst viele gesellschaftlich und »systemrelevante« Bereiche verabredet, um nahezu gleichzeitig am gleichen Problem zu erkranken: Eine Polarität zwischen dem Möglichen und dem Machbaren, auch zwischen einem objektivierbaren (notwendigen?) Wachstum im Außen und der subjektiven Freiheit des Einzelnen darin – inklusive einer Emanzipation oder bewussten Abkehr von genau jenem Wachstumsdiktat – , sehen wir (neben der Medizin) in zahlreichen volkswirtschaftlichen Entwicklungen, ebenso im Konsumverhalten einer immer größer werdenden Zahl von Menschen: Entschleunigung und Rückzug anstelle von ungebremstem und mechanischem Wachstum, Slow Food statt Fast Food, Regionalität statt globale Märkte, Konsumbegrenzung statt XXL, Wiederverwertung statt Wegwerfmentalität, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit statt Ressourcenverschwendung, Gemeinwohlökonomie statt Raubtierkapitalismus.
Zugleich und in Analogie erkennen wir ähnliche Trends im religiösen Kontext, wo die Zahl der Konfessionslosen steigt, gerade in den urbanen Räumen und Ballungsgebieten. Eine große »Abkehr« setzt derzeit ein: Die Zahl der bekennend Gläubigen nimmt ab. Parallel dazu wächst die Gruppe der »spirituellen Atheisten«, also derer, die kein formales Glaubensbekenntnis unterschreiben, jedoch nach Sinn und etwas »Höherem« suchen – etwas, das über sie hinausweist und transzendent oder größer erscheint.
Und auch hier, teilt man diese Gruppe weiter auf, ist erneut eine Polarität erkennbar: Da gibt es Menschen, die sich auf einem inneren Erkenntnisweg, einem tiefen Einsichtsprozess befinden, der aufwendig ist, anstrengend, und sich ergebnisoffen gestaltet, der sich stark disruptiv auf den individuellen Lebensweg und die Beziehungen zur Außenwelt auswirken kann. Und dann ist da die zunehmende Schar derer, die Meditation und Achtsamkeit (Mindfulness) als Mittel zur Stressbewältigung betreiben, als schnelle Hilfe in schwierigen Zeiten oder zur Verbesserung der eigenen Konzentration und Leistungsfähigkeit. Bestimmte Nuancen und Übergänge nicht ausgeschlossen, auch die verschiedenen Motive schließen sich nicht gänzlich aus. Wenn aber bei der Achtsamkeit primär die Performance im Fokus steht, das optimale Erfüllen einer erwarteten Funktion und Leistung, dann ist das etwas anderes als der eher gegenteilig ausgerichtete Prozess einer inneren Einkehr und – womöglich – Emanzipation von jener äußerlichen Funktionalität und Ergebnisorientierung.
Phänomene von »McMindfulness« oder »Mindfulness-to-go«, wie man sie provokativ bezeichnen könnte, finden wir ebenso in neuen geisteswissenschaftlichen Strömungen oder mancher Gegenwartsphilosophie, in Teilen der Psychologie, wo nicht selten unter Verwendung von Begriffen wie »Bewusstsein« oder »Integralität« oder im Versprechen eines »Transhumanismus« die Optimierung, letztlich die Ökonomisierung von Geist und Bewusstsein in Aussicht gestellt werden. Die schöne neue Welt von morgen?
Auch die Digitalisierung reiht sich hier problemlos ein, wo einerseits Informationsdemokratie, Transparenz, Grenzenlosigkeit und Vernetzung alles möglich erscheinen lassen, nicht weniger als einen vermeintlich »besseren« Menschen oder offenere Gesellschaften. Andererseits sind Überforderung durch fehlende Informationshygiene, eine Einschränkung von Intimität und Privatheit oder die Erosion ganzer Demokratien (etwa durch ständige Falschmeldungen im Netz) zu einem manifesten Problem und zu einer Bedrohung unserer Zukunft geworden. Corona und damit verbundene digitale Auswüchse haben das vor Augen geführt. Nicht zu vergessen: Internetsucht und Burn-out, verbunden mit einem Sich-Verlieren im digitalen Raum, sind neue Krankheiten in einer globalisierten Welt.
Nicht alles, was digital »kann«, ist gut. Doch wer vermag und will den Zug noch lenken, ihn verlangsamen oder gar stoppen? Genau das Gegenteil findet gerade statt.
Ähnliches gilt für die gegenwärtige Klimadebatte, die uns dringend zur Entschleunigung mahnt, dabei das Problem durch technischen Fortschritt, ein schnelleres Aufrüsten sowie mehr Nachhaltigkeitsindustrien in den Griff bekommen möchte. Ist das nicht irgendwie paradox? Gerade in diesem Sektor ist eine atemberaubende Beschleunigung auszumachen, eine Tendenz zum »Höher, Schneller, Weiter« mit großer Anziehungskraft und enormen Zuwachsraten. Umweltschutz ist hip. Zeitgleich werden beim CO2-Ausstoß weltweit die höchsten Werte seit Aufzeichnungsbeginn registriert. Mit einem kurzen Durchatmen durch Covid-19. Wie passt das zusammen?
Ökologie ist wieder in Mode. Mehr als je zuvor scheint grün gefragt. Auch philosophische Betrachtungen zu vermeintlich grünen Alltagsthemen erreichen die Mitte, den Mainstream. Philosophen wie Richard David Precht, Ariadne von Schirach, Markus Gabriel oder Wilhelm Schmid (und Robert Habeck!) erzielen mit ihren Büchern und Wortmeldungen zuweilen Kultstatus. Sogar unter Hipstern.
Immer wieder treffen wir auf das gleiche Muster, auf sich scheinbar polar gegenüberstehende Bewegungen: Messbare Größen zeigen an, dass sich »alles« zu beschleunigen scheint. Menschen wünschen sich jedoch das genaue Gegenteil vom vermeintlich Gegenwärtigen, träumen mehr von einer alternativen, einer ganz anderen Welt. Entschleunigung wird gesucht und auch gebraucht. Selbst ohne Corona.
Dieser Ruf nach einem »Weniger« verbindet wie ein roter Faden viele gesellschaftliche Aspekte: Ein Trend demaskiert sich als gemeinsamer Nenner in unterschiedlichen Lebensbereichen und im öffentlichen Diskurs. So ist es nur konsequent, eine primär auf Verwertung abzielende Logik der Ausnutzung von Ressourcen (das Dogma des fortwährenden Wachstums und der reinen Nutzenorientierung) verstärkt mit dem Thema Leere (statt Fülle) zu kontrastieren. Mit Innenraum anstelle von Außenraum. Dieses Denken ist heute alles andere als politisch links. Das ist die neue Mitte.
Ich verfolge die Idee, die beschriebenen Polaritäten in einigen Bereichen exemplarisch genauer zu untersuchen. Und vielleicht punktuell zusammenzuführen. Den Schwerpunkt werde ich als Mediziner dabei – kaum verwunderlich – auf die Medizin und den Glauben legen (Spiritualität, Achtsamkeit, Buddhismus), werde aber ebenso einige ökonomische und ökologische Aspekte näher betrachten sowie die eine oder andere philosophische Stimme zu Wort kommen lassen.
Letztlich geht es um das Aufdecken von möglichen Schnittmengen und gemeinsamen Mustern, die ein größeres Bild erkennen lassen, eine offensichtliche Bewegung hin zu weniger statt mehr.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwende ich in diesem Buch bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form. Es sind jedoch immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung gemeint. Die verkürzte Sprachform ist wertfrei.
Teil I Mehr oder weniger Medizin
Immer mehr Medizin
Ein wachsender Markt – Deutschland ist Weltmeister – Gesundheit in allen Ecken? – Erfolgsgeschichten – Die Antreiber – Der wahre Feind – Wie wollen wir leben? – Voll der Stress – Die Menschen hinter den Masken – Reicht es für alle? – Was ist das Ziel? – Darf’s ein bisschen weniger sein?
Die Gesundheit ist uns etwas wert. Dem Staat und dem Einzelnen. Die Pandemie machte das wieder überdeutlich. Jedoch gilt diese Feststellung generell und über die aktuelle Lage und den Tag weit hinaus.
Ein wachsender Markt
Das Coronavirus kennt keine Grenzen. Das zeigt sich auch bei den Gesundheitsausgaben. Und in den Staatshaushalten: Lange gehegte Grenzlinien, verteidigte Bastionen und Dämme fallen schnell im Zuge einer anrollenden Pandemie. Die schwarze Null im deutschen Bundeshaushalt, einst wie eine Monstranz von der Regierung zur Schau gestellt, gefeiert und verteidigt, ist plötzlich passé. Ende März 2020 wird ein gigantischer Nachtragshaushalt verabschiedet – 160 Milliarden Euro; dazu ein erster Schutzschirm in Höhe von über einer halben Billion Euro. Im Juni 2020 kam ein Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro dazu, direkt danach ein zweiter Nachtragshaushalt von 62,5 Milliarden Euro. Das Ende ist noch nicht in Sicht. Auf fast zwei Billionen Euro summierte sich das staatliche Hilfspaket, das die wirtschaftlichen Folgen abfedern sollte. Ein Volumen, vergleichbar den Gesamtkosten der deutschen Wiedervereinigung. Die zusätzlichen Belastungen durch Transferzahlungen innerhalb der Europäischen Union waren da noch nicht eingerechnet. Und wer weiß, was in der Gesamtbilanz noch alles zu berücksichtigen sein wird. Von solchen Größenordnungen jedenfalls hat man seit mindestens dreißig Jahren nicht gehört. Deutschland, so heißt es, sei stark genug, eine Krise solch ungeahnten Ausmaßes zu überstehen – »Wir schaffen das« hat wieder Hochkonjunktur.
Während der Staat im Jahr 2020 seine Ausgaben im Gesundheitsbereich raketenhaft nach oben fuhr – im Versuch, mit dem Virus Schritt zu halten – , gingen die Bürger hamstern. Und igelten sich ein mit dem, was sie gebunkert hatten, gingen auf soziale Distanz, ganz so, wie es von ihnen verlangt wurde, damit der Feind sie nicht fand. Gleich zu Beginn der Krise kletterte der Verkauf von Toilettenpapier innerhalb kürzester Zeit in astronomische Höhen, Mehl und Nudeln wurden als überlebenswichtige Konsumgüter knapp, neben Schutzkleidung, Mundschutzmasken und Desinfektionsmitteln. Desinfektionsspender im öffentlichen Raum wurden heimlich abgebaut und entwendet, Schutzmasken geklaut, selbst in Kliniken und Ambulanzen wurde eingebrochen und entsprechendes Material entwendet. In solchen Momenten ging es offensichtlich ums nackte Überleben. Während in Frankreich und Italien, so kolportiert, Rotwein und Kondome knapp wurden, in den Niederlanden Cannabis, gab es in Deutschland eine massive Nachfrage nach Hygieneartikeln. US-Amerikaner kauften dagegen vermehrt Waffen. Auch das eine interessante Variante.
Schaut man mit etwas mehr Distanz auf das Geschehen, so ist, bei aller feststellbaren Aufregung, das alte Prinzip von Angebot und Nachfrage nicht außer Kraft gesetzt. Selbst die Entwicklung bei den Gesundheitsausgaben entlarvt nur wieder die Tatsache, dass das Gesundheitswesen letztlich ein gewöhnlicher Wirtschaftszweig ist. Und dieser folgt, bei aller Krisenhaftigkeit, eher simplen marktwirtschaftlichen Prinzipien. So irrational das Horten von Klopapier zunächst erscheint (es ist kaum anzunehmen, dass die Menschen mit oder nach Corona siebenmal so häufig Stuhlgang haben werden wie vor Corona; Covid-19 ist primär keine Magen-Darm-Erkrankung), so sehr ist das Anlegen von Vorräten bei einer zu erwartenden Verknappung von Gütern, abbrechenden Lieferketten und eingeschränktem Freihandel ein Vorgang, den Verhaltensökonomen stets vorhersagen und berechnen konnten.
Und so gilt: Gesundheit ist eine Ware, der Austausch von Gütern, Produkten und Dienstleistungen folgt den Kriterien des Marktes.
Die Gesundheitswirtschaft setzt sich aus vielen Akteuren zusammen. Dabei unterscheidet man klassischerweise den ersten vom zweiten Gesundheitsmarkt. Den ersten Gesundheitsmarkt bezeichnet man häufig als den eigentlichen Kernbereich, denn er umfasst das, was wir normalerweise unter der Gesundheitsversorgung, generell unter »der Medizin« verstehen. Gemeint sind hier Leistungen, die von den Krankenversicherungen – gesetzlich wie privat – einschließlich der Pflegeversicherung finanziert werden. Im allgemeinen Verständnis sind dies die ärztlichen, therapeutischen und auch pflegerischen Maßnahmen, dazu die verschriebenen Medikamente und Hilfsmittel. Demgegenüber steht der zweite Gesundheitsmarkt, wo vor allem die privat finanzierten Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit gehandelt werden. Dabei ist die Zuordnung, welche Waren und Dienstleistungen einen Bezug zur Gesundheit aufweisen, nicht immer klar, teilweise auch umstritten.1 Nach gängiger Auffassung finden wir in diesem zweiten Gesundheitsmarkt frei verkäufliche Arzneimittel und individuelle Gesundheitsleistungen, Fitness und Wellness, Gesundheitstourismus sowie Teile aus Sport, Freizeit, Ernährung oder dem Wohnen. Erweiterte Therapieverfahren gehören ebenfalls dazu. Dieses sind unter anderem Heilpraktiker- sowie sonstige Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen, die regelhaft nicht von den Krankenkassen erstattet werden. Hinzu kommen, zuletzt massiv im Aufwind: Wearables, Gadgets und Apps. Letztere »diffundieren« gerade als Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), staatlich stark erwünscht und gefördert, in den ersten Gesundheitsmarkt hinein und werden dort nun häufig auch als Medizinprodukte klassifiziert.
Man merkt – es wird schwammig. Halten wir fest: Der erste Gesundheitsmarkt umfasst im Wesentlichen das, was vom Staat reguliert und nicht individuell finanziert wird. Und der zweite alles andere.
Und wie verhält es sich nun mit den Ausgaben in vermeintlich normalen Zeiten, das heißt ohne beziehungsweise vor Corona? Der Gesundheitsmarkt, ganz generell, wächst und wächst. Im aufstrebenden zweiten Gesundheitsmarkt, der mit 130 Milliarden Euro inzwischen etwa ein Drittel des ersten ausmacht, erleben wir schon seit über zwei Jahrzehnten unter anderem einen Boom der Freizeit- und Wellnessindustrie. Und der digitale Gesundheitsmarkt hat in den letzten fünf Jahren sein Volumen fast verdreifacht. Tendenz: exponentielles Wachstum. Die offensichtlich steigenden individuellen Bedürfnisse der Menschen nach stärkerer Selbstregulation und Selbstoptimierung, abzulesen etwa an der rasant zunehmenden Nachfrage nach Angeboten zu Stressabbau, Performance-Verbesserung, Bodyshaping usw., auch mithilfe von digitalen Apps & Co., sowie das selbstgesteuerte Verfolgen (Tracking) von Gesundheitsdaten etwa über das Smartphone oder die Smartwatch spielen hier hinein: Digitale Anwendungen ermöglichen uns als Konsumenten, Therapeuten unserer selbst zu werden. Das mag sich bis zu einem »Gesundheitswahn« steigern – ich werde darauf noch zurückkommen.
Und wie sieht es im ersten Gesundheitsmarkt aus? Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen steigen kontinuierlich an, über die letzten zehn Jahre gemäß Spitzenverband Bund der Krankenkassen und Bundesamt für Soziale Sicherung um fast 100 Milliarden Euro, auf rund 260 Milliarden Euro jährlich. Die Unternehmensberatung Roland Berger prognostiziert dann auch ein Ansteigen der allgemeinen Beitragssätze zur Krankenversicherung bis zum Jahr 2050 auf bis zu 30 Prozent der Bruttoeinkommen. Natürlich spielen der medizinische Fortschritt und die demografische Entwicklung dabei eine entscheidende Rolle, aber ebenso unser individuelles Konsumverhalten, die Preisgestaltung am Markt oder Angebot und Nachfrage: Gesundheit ist teuer geworden. Und sie wird noch teurer. Weil sie es uns wert ist.
Und was bekommen wir dafür? Ohne Frage, das deutsche Gesundheitssystem gehört zu den besten und leistungsfähigsten weltweit. Keiner will das bestreiten. Jedoch ist nicht alles Gold, was glänzt, insbesondere wenn man näher hinschaut. Im internationalen Vergleich sind große Unterschiede erkennbar. Einige Teile des Gesundheitssystems stehen besonders gut da, aber es gibt auch solche, bei denen die Deutschen von anderen Ländern und Systemen etwas lernen können. Ist das ein Klagen auf hohem Niveau? Das mag sein, doch wenn man das Wort »Klage« durch das generelle Ziel einer Verbesserung und Optimierung der Leistungsfähigkeit ersetzt, der messbaren Ergebnisse, so ist es möglich, nüchtern relevante Benchmarks und Outcomes zu betrachten und eben zu vergleichen. Schauen wir auf die relativen Gesamtausgaben im Versorgungssystem, also den Anteil der gesamten Gesundheitskosten am Bruttoinlandsprodukt, so stellen wir fest, dass Deutschland gemäß der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in der Spitzengruppe gelistet ist: Mehr wurde nur in der Schweiz und – mit erheblichem Abstand auf Platz eins – in den USA für die Gesundheit ausgegeben.2
Und die Outcomes? Um die Effektivität eines Gesundheitssystems schnell zu erfassen, kann man sich die durchschnittliche Lebenserwartung anschauen – zugegeben, ein sehr grober, aber dennoch bedeutsamer Parameter in diesem Zusammenhang. Hier belegt Japan mit einer mittleren Lebenserwartung bei Geburt von vierundachtzig Jahren den Spitzenplatz. Die Schweiz befindet sich noch unter den Top Ten. Und Deutschland? Bei gewissen Schwankungen, je nach Jahr und Darstellung, rangiert es auf den Plätzen 30 bis 35. Mehr oder weniger der letzte Platz in Westeuropa.3 Die USA liegen im Übrigen auf Platz 40 bis 45. Der Unterschied zwischen Japan und Deutschland beträgt etwa drei Jahre, zwischen Deutschland und den USA zwei. Natürlich ist das ein bisschen wie Kaffeesatzlesen, wie der Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen. Auch kann man am Beispiel von Japan, mit der weltweit ältesten Bevölkerung (gefolgt von Deutschland), darüber streiten, was eigentlich Henne und was Ei ist: Japan leistet sich ein teures Gesundheitssystem, hat aber eine hohe Lebenserwartung vorzuweisen – und viele alte Leute. Werden die so alt, weil das Gesundheitssystem so gut ist? Oder ist das System teuer, weil die Älteren und Langlebigen mehr medizinische Betreuung benötigen und tatsächlich auch bekommen? Weitere Begründungen sind ebenfalls denkbar …
Länder wie Italien (vor Corona) oder Stadtstaaten wie Singapur geben jedoch zum Teil erheblich weniger Geld anteilig für die Gesundheit aus und landen dennoch weit vor Deutschland bei der Lebenserwartung. Das hat viele Gründe, sicher aber nicht den, dass die Deutschen zu wenige Gesundheitsdienstleister am Markt haben oder insgesamt zu wenig Geld für die Gesundheit ausgeben – oder zu selten zum Arzt gehen.
Deutschland ist Weltmeister
Die Deutschen schätzen ihr Gesundheitssystem. Und sie nutzen es rege. 2008 gingen sie so oft zum Arzt wie in keinem anderen Land der Welt.4 Der damalige Höhepunkt mit durchschnittlich achtzehn Arztbesuchen pro gesetzlich Versichertem und Jahr ergab eine Behandlungsfrequenz deutscher Ärzte, die im internationalen Vergleich fast doppelt so hoch lag wie anderswo. Lediglich die Japaner kamen damals mit vierzehn Arztkontakten in die Nähe der deutschen Größenordnung. Schweden suchten dagegen nur dreimal jährlich einen Arzt auf, US-Amerikaner viermal. In den nachfolgenden Jahren konnten Schweizer und Franzosen zu Deutschland aufschließen, 2017 liefen Korea und Japan diesem Trio sogar den Spitzenrang ab.5
Ein Arztbesuch in Deutschland dauert im Schnitt weniger als acht Minuten.6 Auch da belegen die Deutschen Spitzenplätze. Schnell und effektiv? Zweifel sind erlaubt. Immerhin sind die in Deutschland lebenden Menschen umfassend versorgt. Die ambulante ärztliche Versorgung erreicht hier fast die gesamte Bevölkerung: 93 Prozent aller Menschen gingen 2015 mindestens einmal in die Praxis eines niedergelassenen Haus- oder Facharztes.7 Diese ohnehin schon hohen Zahlen steigen von Jahr zu Jahr weiter an, wenngleich zuletzt etwas gebremst. Dabei hat die Zahl der Behandlungsfälle – das sind die jeweiligen Anlässe, wegen derer Patienten ihre Ärzte aufsuchen – ein Rekordniveau erreicht. Statistisch fasst die Größe des Behandlungsfalls jeweils alle Arztkontakte einer Person pro Quartal (bei einem bestimmten Arzt, in der Regel zu einer bestimmten Hauptdiagnose) zusammen. Allein aus diesen Angaben lässt sich ableiten, dass es bei hohen Fall- und Kontaktzahlen auch sogenannte Drehtüreffekte geben muss. Gemeint sind Patienten, die bei ihren Ärzten ein und aus gehen. Oder Ärzte, die Doppel- und Mehrfachuntersuchungen veranlassen, die nicht gut abgestimmt mit anderen Fachkollegen arbeiten, das heißt, schlecht koordinierte Maßnahmen und Ausgaben zu verantworten haben. Sie arbeiten nicht effizient.
Die schlechte Koordination und damit eingeschränkte Effizienz der Gesundheitsversorgung konnte unlängst eindrucksvoll bestätigt werden, insbesondere im Bereich der hausärztlichen Versorgung.8 Das Problem existiert in vielen Ländern, Deutschland fällt jedoch im internationalen Vergleich besonders negativ bei der mangelhaften Abstimmung zwischen Fach- und Hausärzten auf, in beide Richtungen. Auch die Kommunikation zwischen den genannten Berufsgruppen scheint eklatant begrenzt zu sein – die zwischen Krankenhäusern und Hausärzten, etwa bei Entlassungen von Patienten aus der stationären Versorgung, schneidet dagegen deutlich besser ab. Geradezu katastrophal sieht es beim Gebrauch von Online-Optionen zur Kommunikation zwischen Fachkollegen oder beim Einsatz von Patientenportalen oder sonstigen digitalen Instrumenten zum Austausch mit Patienten aus. Deutschland ist hier 2019 im internationalen Vergleich noch einsames Schlusslicht. Ein Online-Austausch findet praktisch nicht statt.
Ideen zur Verbesserung der Patientenkompetenz durch den Einsatz digitaler Plattformen, beispielsweise durch das Bereitstellen der medizinischen und ärztlichen Dokumentation auf elektronischen Patientenportalen, sind hier noch Zukunftsmusik.9 Studien zeigen jedoch, dass solche Angebote, also wenn persönliche Gesundheitsinformationen für den Patienten online leicht zugänglich gemacht und dadurch für ihn und seine Angehörigen barrierefrei nutzbar werden, nicht nur reine Serviceleistungen sind, quasi »nice to have«, sondern dass sie ebenso das Potenzial haben, die Qualität der Versorgung insgesamt deutlich zu verbessern.10 Patienten verstehen über solcherart bereitgestellte Informationen nachweislich mehr über ihre Gesundheit und Behandlung, ihr Gesundheitswissen steigt, und auch die Beziehung und das Vertrauen in die Ärzteschaft und das Gesundheitssystem generell nehmen zu. Genauso steigt ihre Selbsthilfekompetenz: Patienten sind mit diesen Informationen an der Hand besser in der Lage, ihre Gesundheitsthemen selbstständig ein- und zuzuordnen, ihre Belange zu koordinieren. Und sie nehmen ihre Medikamente zuverlässiger ein – die Therapietreue steigt nachweislich an. Keine Frage: Digitale Transparenz ist gesund. Um Risiken und Nebenwirkungen geht es später.
Wird die digitale Welt bald das analoge, herkömmliche Arbeiten und Zusammenkommen in der Medizin überholen, es vielleicht sogar ablösen? Oder kommt das virtuelle Geschehen einfach noch hinzu, on top, und erhöht dadurch zusätzlich den »Traffic«, das heißt die individuellen Kontaktzahlen und den Druck im System insgesamt? Vieles spricht für Letzteres. Nicht nur steigen die Behandlungsfrequenzen in den Arztpraxen, sondern es gibt zudem Ungleichheiten bei der Verteilung dieses Geschehens, so bei den gestellten Diagnosen oder der Geschlechterspezifität. Frauen suchen demnach ihre Ärzte im Vergleich zu den Männern im Verhältnis von sieben zu fünf auf. Sie werden allerdings statistisch gesehen auch älter. Und bei den Diagnosen sind die chronischen und lebensstilassoziierten Erkrankungen klar auf dem Vormarsch. Das nehme ich gleich noch genauer unter die Lupe, hier will ich jedoch schon festhalten: Die meisten Patienten belassen es nicht beim einmaligen Arztbesuch, sie verlassen die Praxis in der Regel auch nicht wieder gesund und kommen zuverlässig wieder. Hauptanlaufstellen sind dabei die Hausärzte und hausärztlichen Internisten (diese verantworten knapp die Hälfte der Arztbesuche), weit vor den Frauenärzten, fachärztlichen Internisten sowie den Kinder- und Jugendärzten (jeweils einstellige Prozentränge). Übrigens: Am günstigsten sind die zwanzig- bis vierundzwanzigjährigen Männer, sie verursachen die geringsten Behandlungskosten. Am anderen Ende: Männer über fünfundachtzig sind die teuersten Patienten.
Gesundheit in allen Ecken?
Gesundheit ist ein Megathema. Die Menschen gehen häufiger zum Arzt, und sie werden immer stärker zu Teilhabern und Multiplikatoren von Gesundheitsdienstleistungen. Zeitschriften zu Medizinthemen sprießen wie Pilze aus dem Boden, individualisierte Gesundheitsmagazine oder Apotheken-Informationsblätter haben höchste Auflagen. Das Interesse ist riesig. Es ist nicht von der Hand zu weisen: Die Gesundheitswirtschaft und gerade der zweite Gesundheitsmarkt zeigen enorme Wachstumsraten, aber selbst der staatlich regulierte erste Markt bläht sich spürbar auf. Dies geschieht im internationalen Vergleich fast überall. Kaum ein anderes Thema scheint die Menschen so sehr zu emotionalisieren wie die Gesundheit, sie in den Bann zu ziehen, sogar Verhaltensänderungen im Kollektiv zu ermöglichen, die in anderen Zusammenhängen unvorstellbar wären: Unter Corona schweigen in manch gewalttätigem Konflikt die Waffen, die Flugzeuge stehen am Boden, der Verkehr auf den Straßen und die Feinstaubbelastung in den Innenstädten gehen zurück, die täglichen Staus auf dem Weg zur Arbeit, das hektische Treiben allerorten nimmt ab, genauso verringern sich die endlosen und oft ineffektiven Konferenzen in der Politik und am eigenen Arbeitsplatz – überall kehrt Besinnung und Entschleunigung ein. Plötzlich scheint »weniger« möglich, ja sogar erwünscht zu sein. Außer im Gesundheitswesen, da herrscht verständlicherweise in vielen Bereichen Hochbetrieb. Kein Protest, keine Demonstration konnte bisher bewirken, was ein Virus oder eine kollektive Sorge um die Gesundheit innerhalb kürzester Zeit zu erzielen vermochten: Das Gesundheitsthema, jetzt sichtbar für alle, ist in jede Ecke unseres täglichen Lebens vorgedrungen.
Der Befund einer ubiquitären, allgegenwärtigen Gesundheitsüberempfindlichkeit kann nahezu in jedem Land der Welt erhoben werden. Kein Thema scheint wichtiger – außer vielleicht das der wirtschaftlichen Folgen im Fahrwasser des medizinischen GAU, des vermeintlich größten anzunehmenden »Unfalls«, den wir im Zuge von Corona erleben. Kaum zu glauben, aber es sieht so aus, als schwinge die gesamte Erde gerade in einem Gleichklang, einem simultanen Krisen-Rhythmus. Alle schauen auf das gleiche Ziel, haben den gleichen Gegner. Zumindest gilt das für die Bevölkerung, für die Menschen – getrost können wir davon ausgehen, dass der »Rest« der Welt weiterhin und nahezu unbeeindruckt sein Tagwerk verrichtet. Oder glauben Sie, dass es den Quastenflosser im Indischen Ozean kümmert, was den Menschen im Frühjahr 2020 kollektiv den Atem raubte? Da hat er schon ganz andere Zeiten überlebt.
Der augenscheinliche Gleichklang von Interessen und universellen Verhaltensweisen der Weltbevölkerung im Zuge krisenhafter Zustände im öffentlichen Gesundheitswesen sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es bei den einzelnen Ländern große Unterschiede gibt, wenn es um die Präsenz von Gesundheitsthemen geht: Angebot, Zugang und Nutzung von Dienstleistungen im Medizinsektor sind in ihrer Verbreitung regional häufig stark verzerrt. Das betrifft nicht nur die Seuchenaktivitäten und die Reaktionen angesichts konkreter gesundheitlicher Bedrohungen, ebenso sind Ungleichheiten zwischen Angebot und Nachfrage in der alltäglichen medizinischen Praxis vorhanden. Auch die medizinischen und individuellen Ressourcen sind in einzelnen Ländern ungleich verteilt.
Wie gesagt: Es geht hier um einen Markt. Das Angebot folgt der Nachfrage, die Nachfrage schafft sich ihren Markt. Und manchmal verhält es sich genau andersherum: Die Arztbesuche in Deutschland haben sich, wie erwähnt, in den vergangenen fünfzehn Jahren nahezu verdoppelt. Jedoch kommt nun ein weiterer Aspekt hinzu: Die Zunahme der Konsultationen in den Arztpraxen korrespondierte im selben Beobachtungszeitraum mit einem vergleichbaren Anstieg der Arztdichte in Deutschland. Hinsichtlich dieser zweiten Größe belegt Deutschland abermals einen Spitzenplatz: Kaum anderswo finden sich in einer solchen Dichte (bezogen auf die Einwohner) so viele Ärzte – wobei in urbanen oder ländlichen Regionen zum Teil extreme Unterschiede existieren. In manchen Gegenden gibt es hundert Hausärzte für 100 000 Einwohner, in anderen Landkreisen nur halb so viele.11
All diese Ärzte sind nicht untätig. Allein 2019 erhöhte sich die Zahl der Praxisärzte – gemeint sind die rund 150 000 Mediziner und Psychotherapeuten, die ihre Dienste den gesetzlich Krankenversicherten anbieten – gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent.12 Nicht ohne Konsequenzen: Im ersten Quartal 2020 (im Wesentlichen also noch vor Corona) gab es einen steilen Anstieg bei den Ausgaben für Arzneimittel von über zehn Milliarden Euro.13 Die vielen Ärzte verschrieben viel mehr Medikamente. Das Entscheidende ist hier, dass die Dienstleistungen oft den Ärzten folgen. Nicht umgekehrt.
Beispiel Herzkatheter: Laut Daten der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) gibt es in diesem Bereich große regionale Unterschiede.14 Die Herzkatheteruntersuchungen haben über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zugenommen, wobei die Verteilung der erbrachten Katheterleistungen nicht der Verteilung der Risiken in der Bevölkerung entspricht. Die durchgeführten Katheterleistungen folgen also auch dem vorhandenen Angebot vor Ort. Mit anderen Worten: Wo die Kapazitäten für derartige Untersuchungen und die entsprechenden Expertisen vorliegen, werden auch mehr Interventionen, mehr diagnostische Eingriffe veranlasst. Das allein mag noch nicht verwundern. Die Top-Five-Regionen mit den häufigsten Herzkatheteruntersuchungen im Jahr 2010 waren laut AOK-Daten Oberfranken, das Rhein-Main-Gebiet, Hamburg, die Rhön und Göttingen. Die geringste Anzahl dagegen wiesen Bremen und Bremerhaven auf. Vergleichen wir die beiden norddeutschen Hansestädte Hamburg und Bremen, die trotz unterschiedlicher Größe nicht ganz unähnlich sind hinsichtlich der Bevölkerungsstruktur, so fanden pro 10 000 Versicherten zirka vierzig solcher Untersuchungen in Bremen und 180 in Hamburg statt. Schnell wird deutlich, dass hier nicht nur rein medizinische beziehungsweise bedarfsorientierte Faktoren eine Rolle spielen können.
Anhand solcher Daten ist jedoch kaum feststellbar, ob in Regionen mit großer Herzkatheterhäufigkeit und Untersuchungsdichte eine Überversorgung und in Regionen mit geringer Häufigkeit und Dichte eine Unterversorgung vorliegt. Der konkrete Bedarf vor Ort, beim einzelnen Arzt oder in der einzelnen Klinik, ist nur schwer abzuschätzen. Auch spielt die Mobilität eine wichtige Rolle – manch ein Patient reist von weit entfernt für eine Untersuchung zum empfohlenen Spezialisten an. Die eine oder andere Entwicklung könnte zusätzlich durch den medizinischen Fortschritt entstanden sein, der unterschiedlich schnell in der Praxis ankommt, was wiederum Einfluss auf die Inanspruchnahme vor Ort hat, ohne dass sich der eigentliche Krankenstand und damit der Bedarf grundsätzlich verändert hätte. Sicher ist aber, dass die beobachtete Verteilung keiner regionalen Kapazitätsplanung entspricht und so in jedem Fall eine Verzerrung vorliegt. Auch gilt: Die regionalen Häufigkeiten der Herzkatheteruntersuchungen einerseits und der tatsächlichen Fälle mit akutem Herzinfarkt andererseits stehen in keinem statistisch signifikanten Zusammenhang.15 Dabei sollte man doch eigentlich annehmen, dass besonders häufig invasive Herzuntersuchungen dort stattfinden, wo besonders viele »kranke Herzen« existieren, diese Untersuchungen also besonders nötig sind. Dem scheint nicht so zu sein. Und all das vor dem Hintergrund, dass Deutschland im europäischen Vergleich eine der höchsten Herzkatheterraten aufweist.16 Nicht zu vergessen: Solche Untersuchungen sind Teil eines Gesundheitsmarktes und zugleich eine nicht unerhebliche Erlösquelle – wenn man die Menschen und das System dazu hat, die solche Verfahren durchführen können, und Geld für ihre Bezahlung vorhanden ist.
Bei den künstlichen Knie- und Hüftgelenken sieht es ähnlich aus. Die absolute Anzahl endoprothetischer Hüft- und Kniegelenkeingriffe steigt kontinuierlich, entsprechend der Zunahme von Personen im höheren Alter in der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung. Nach Daten der KKH Kaufmännischen Krankenkasse von 2020 nahm die Zahl der Operationen, bei denen Patienten ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk eingesetzt wurde, zwischen 2008 und 2018 um 31 Prozent zu.17 Auffallend ist auch, dass die Patienten immer jünger werden. Allein unter den Versicherten im Alter zwischen fünfundvierzig und neunundfünfzig Jahren haben 2018 doppelt so viele Männer und 44 Prozent mehr Frauen ein künstliches Kniegelenk erhalten als noch 2008. Betrachtet man die relative Häufigkeit solcher Gelenkersatzverfahren insbesondere bei den Älteren, etwa bei den Patienten über siebzig, so ist die Zahl der entsprechenden Eingriffe – der relative Anteil der Operierten an der betreffenden Zielbevölkerung – in den letzten zehn Jahren relativ stabil geblieben.18 Aber die regionalen Differenzen sind immens.
So wiesen AOK-Daten aus einzelnen Bundesländern erhebliche Schwankungen nach: Unterschiede von 40 Prozent bei den Hüfteingriffen und bis zu knapp 80 Prozent bei den Knien traten zutage (bezogen auf 100 000 AOK-Versicherte im Jahr 2009 beziehungsweise 2011).19 Berlin fiel in beiden Bereichen mit den niedrigsten Eingriffsraten auf, Bayern mit den höchsten. Auch die Stadtstaaten wichen untereinander erheblich ab. Auf Kreisebene waren die Diskrepanzen noch eklatanter. Allein bei den Hüften konnte man Schwankungen von 100 Prozent beobachten (eine Verdopplung der Eingriffszahlen pro 100 000 Versicherten zwischen den Kreisen mit den niedrigsten und denen mit den höchsten Werten, hier jeweils gemittelt über einen Zeitraum von fünf Jahren). Und auch auf Kreisebene galt, dass die Unterschiede in der Inanspruchnahme von Gelenkersatzverfahren am Knie deutlich größer waren als bei den Hüftverfahren – beim Knie kann von noch deutlicher ausgeprägten Unterschieden ausgegangen werden. Stichwort deutsche Einheit: Für beide Operationsverfahren wurde eine im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt niedrigere Inanspruchnahme in den Regionen Ostdeutschlands festgestellt (einzige Ausnahme: Thüringen).
Erklärungen für die zum Teil erheblichen Schwankungen bei den Gelenkeingriffen (analog zu den Herzkatheteruntersuchungen) waren: die unterschiedliche Facharztdichte sowie Differenzen in der Angebotsstruktur. Auch interessant: Je höher der sozioökonomische Status in einer Region war, umso häufiger wurden Eingriffe zum künstlichen Gelenkersatz von Versicherten, die in dieser Region wohnten, in Anspruch genommen. Zusätzlich schienen unterschiedliche Zugänge zur örtlichen Krankenhausversorgung, aber ebenso die konkrete Erlösstruktur vor Ort (Fehlanreize durch das jeweilige Vergütungssystem) eine Rolle gespielt zu haben.20 Im europäischen Vergleich ist zu sehen, dass nicht nur in Deutschland, sondern europaweit die absolute Zahl der künstlichen Gelenkersatzverfahren in den letzten fünfzehn Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Gemessen an den Eingriffen an der Hüfte pro 100 000 Einwohnern stehen die Schweiz, Deutschland und Österreich an der Spitze, beim Knie sind es Österreich und Deutschland (die Schweiz belegt Platz 5).21 Sicher ist es kein Zufall, dass nicht nur regional, sondern eben auch überregional und international sozioökonomische Fragen für die medizinische Angebotsstruktur mit entscheidend sind und vermeintlich wohlhabende Regionen und Länder häufig oben gelistet sind, wenn es um die Inanspruchnahme solch lukrativer Leistungen geht.
Also: Der Gesundheitsmarkt wächst weiter und breitet sich dabei nicht gleichförmig, sondern eher wellenförmig aus. Wie eine Flutwelle erobert er neue Territorien. Dabei ist nicht jede erbrachte Leistung allein durch die primäre Nachfrage – den Gesundheitszustand des Patienten – begründet. Manchmal spült die Welle uns ans rettende Ufer, manchmal rollt sie über uns hinweg. Und manchmal verschont sie uns.
Erfolgsgeschichten
Damit kein falscher Eindruck entsteht: Gesundheit und Medizin als zentrale Wissenschaft und Wirtschaft hinter einer allgemeinen Gesundheitsfürsorge sind nicht allein deswegen so bedeutsam, weil die Menschen allerorten danach rufen, neue Knie und Hüften zu bekommen – zumal in Fällen, wenn der Einsatz künstlicher Gelenke möglicherweise gar nicht medizinisch indiziert ist oder der Mitbürger, anders als man selbst vielleicht, keinen Zugang zu derartigen Angeboten hat. Das würde viel zu kurz greifen.
Der Gesundheitsmarkt als Ganzes wächst in erster Linie deswegen, weil die Medizin so erfolgreich ist. Die Produkte, die hier gehandelt werden, sind so nützlich und beliebt, dass Menschen sie aus nachvollziehbaren Gründen haben wollen und dafür bereit sind, einen Preis zu zahlen, mitunter sogar einen hohen. Anders gesagt: Selbstverständlich gehen die Versprechen der Medizin in der Regel auf. Krankheiten werden gelindert oder beseitigt, Medikamente und medizinische Dienstleistungen helfen, möglichst gut zu leben. Medizin ist gefragt! Ich selbst bin Mediziner durch und durch, als Arzt und als Wissenschaftler der Heilkunde engstens verbunden, aber auch als Kunde und Nutzer, als Familienvater, Bürger und Nachbar. Die Medizin rettet Leben, sie ist lebenswichtig – ohne Wenn und Aber. Durch die Behandlung von Erkrankungen und das verbesserte Wissen über ihre Entstehung und verschiedene Therapieoptionen ist es gelungen, die Lebensqualität für viele zu heben und auch in höheren Altersphasen, die früher häufig mit Siechtum und schwerer Last einhergingen, ein erstaunliches Maß an Alltagsfähigkeit und Teilhabe zu gewährleisten.
In diesem Kontext wird auch von der Morbiditätskompression gesprochen. Damit ist die Beobachtung gemeint, dass Menschen heute erst spät im Leben und dann innerhalb verkürzter Phasen hohe Krankheitslasten entwickeln. Vertreter dieser »beobachtenden Annahme« meinen, dass mit einer allgemeinen Verlängerung der Lebenszeit, einhergehend mit insgesamt verbesserten Bedingungen und einer fortschrittlichen medizinischen Versorgung, schwere Krankheiten statistisch erst im hohen Alter häufiger auftreten würden. Der Anteil der gesundheitlich beeinträchtigten Lebenszeit (an der Gesamtlebenszeit) würde fallen, der Prozess des Sterbens immer häufiger in einem schmalen Altersintervall auftreten – gesunde Lebenszeit für den Einzelnen würde so gewonnen. Dieser eher optimistischen Sichtweise steht die These gegenüber, nach der sich als Nebeneffekt des medizinischen Fortschritts die Zeiten verlängerten, welche die Menschen im Zustand von Krankheit und Behinderung verbrächten. Statt Kompression also Expansion. Demnach würden die Leidensphasen länger werden und die Gesundheitskosten über die Dauer erheblich steigen. Schließlich existiert als Kompromiss dieser beiden Ansätze die Annahme, dass Lebenserwartung und Zeiten in Krankheit und Behinderung zwar beide zunähmen, Fortschritte in der Medizin jedoch die damit verbundenen Leiden erheblich verringerten. Menschen mit Erkrankungen würden demnach trotzdem ihre Alltagsfähigkeiten und ihre Lebensqualität beibehalten, sodass sie lange aktiv am Leben teilnehmen könnten.22 Egal, welcher der drei Interpretationen man folgen möchte, in jedem Fall ist das Ergebnis ein großer Erfolg der Medizin.
Wie kam es dazu? Die westliche Medizingeschichte, die »Story« der Medizin der Neuzeit, ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte. Die moderne Medizin unserer Prägung beginnt bereits mit dem antiken griechischen Arzt Hippokrates. Er, wie später in seinem Fahrwasser Galen im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung oder Paracelsus im 16. Jahrhundert, waren Universalgelehrte. Ebenso waren große Anatomen, auf denen noch heute die moderne Anatomie und wesentliche Kenntnisse des menschlichen Körpers fußen, häufig Künstler, Bildhauer, Ingenieure – und fraglos universal gebildet. Denken wir etwa an Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert oder Andreas Vesalius im 16. Jahrhundert. Häufig wird bei diesen Personen auch von einer »Genialität« gesprochen, ohne dass jemals genau definiert wurde, was eine solche Zuschreibung eigentlich beinhaltet. Sicher kommt damit die Ehrfurcht vor einer schier atemraubenden Neugier, Forschertätigkeit, Produktivität und Meisterhaftigkeit zum Ausdruck.
Manchmal waren es jedoch eher zufällige Erkenntnisse, die die Medizin revolutionierten. So hatte der französische Militärarzt Ambroise Paré herausgefunden, dass bei Soldaten mit stark blutenden Wunden durch einfache Ligaturen, das heißt durch ein Abbinden verletzter Blutgefäße mit einem Faden, das Leben unzähliger Patienten gerettet werden konnte. Bis heute ist das eine Voraussetzung der modernen Chirurgie. Oder Samuel Hahnemann. Dieser hat, ebenfalls quasi nebenbei, die Homöopathie entdeckt und begründet. Er war promovierter Mediziner, Chemiker und Pharmazeut, der durch seine Interdisziplinarität und eine allgemeine Gelehrtheit häufig Streit mit Experten und Spezialisten hatte. Viele Erkenntnisse der modernen Pflanzenheilkunde und Pharmazie lassen sich auf Hahnemann zurückführen. Genauso wie Ideen einer exakten Anamnese und Untersuchung, eines akribisch zu dokumentierenden Arzt-Patienten-Gesprächs, wo das genaue Hinschauen, das Hören, Riechen und Schmecken eine wesentliche Rolle spielen. Hahnemann wird bei uns im öffentlichen Diskurs heute meist auf die Homöopathie reduziert, nicht selten im Kontext einer vermeintlichen »Unwissenschaftlichkeit«. Ein Vorwurf, der im 18. Jahrhundert, zu seinen Lebzeiten, so nicht zu hören war: Hahnemann wurde sogar in die Gelehrtengesellschaft Leopoldina aufgenommen, die heutige Nationale Akademie der Wissenschaften in Deutschland. In Washington, D. C., unweit des Weißen Hauses, gibt es eine zentrale Kreuzung, die von einem eindrucksvollen Hahnemann-Monument überblickt wird. Eher zufällig entdeckte ich dieses Denkmal im Rahmen eines beruflichen Aufenthalts und war beeindruckt von der Tatsache, dass das Werk und Schaffen Hahnemanns außerhalb seines ursprünglichen Wirkungskreises derart geschätzt wird.
Ein Zeitgenosse Hahnemanns war in Berlin der königliche Leibarzt und Direktor der Charité Christoph Wilhelm Hufeland – zugleich erster medizinischer Dekan der 1810 gegründeten Berliner Universität. Hufeland bezog einen Großteil seiner medizinischen Expertise wie Paré aus der Militärchirurgie und war doch zugleich weit mehr als ein praktischer Arzt. Er propagierte vehement einen Zusammenhang zwischen Armut und Krankheit und die Notwendigkeit, durch eine Anhebung des sozialen Status von »Unterprivilegierten« die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt zu verbessern. Seine Auffassungen von einer »Kunst«, wie er es nannte, das menschliche Leben zu verlängern, mündeten in ein umfassendes Verständnis einer ganzheitlichen Heilkunst und, wie wir heute sagen würden, auch Sozialmedizin. Hufeland war wohl einer der Ersten im Kontext der akademischen Medizin und Ausbildung von Ärzten, der auf die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und einer wirksamen Gesundheitspflege hinwies – Ärzte sollten hierin zwingend geschult sein. Zusätzlich brachte Hufeland das Journal der practischen Heilkunde heraus, in dem viele Aspekte einer aufblühenden Naturheilkunde sowie Überlegungen zu einer regulativen Lebenskraft und einem Selbsterhaltungsprinzip des Organismus zum Ausdruck kamen. Selbst die Homöopathie Hahnemanns wurde in dem Journal dargestellt.
Berlin war fortan ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für Medizinerkarrieren und zugleich Ausgangspunkt einer schnellen Abfolge von Erfolgsmeldungen aus der Welt der Medizin des 19. Jahrhunderts. In diesem Zusammenhang ist an Rudolf Virchow zu denken, Zellularpathologe und Vertreter einer »Sozialhygiene«, der wesentliche Erkenntnisse etwa zum Verständnis der Thrombose beitrug, jedoch auch als Politiker weit über Berlin hinaus wirkte. Oder Robert Koch, der 1882 das Tuberkel-Bakterium entdeckte und damit die Mikrobiologie und mikroskopische Medizin entscheidend mit voranbrachte. Solche Entdeckungen waren gleichzeitig Voraussetzung für die Entwicklung wirksamer Therapien. Erst durch Kochs Entdeckung konnte die Tuberkulose, die tödliche »Schwindsucht«, die »Arme-Leute-Krankheit«, erfolgreich behandelt werden. 1906 entwickelten die französischen Wissenschaftler Albert Calmette und Camille Guérin den ersten Impfstoff gegen diese Krankheit, die Bacille-Calmette-Guérin-Impfung (BCG). Interessanterweise erlebt genau diese Impfung, die seit den Neunzigerjahren bei uns gar nicht mehr offiziell empfohlen wurde, angesichts der Suche nach Therapien zur Eindämmung der Gefahr durch Virus-Pandemien und nach einer wirksamen Stimulierung des Immunsystems in diesem Kontext gerade eine Renaissance.
An der Tuberkulosebehandlung hatte auch Wilhelm Conrad Röntgen einen wesentlichen Anteil, ein weiterer Zeitgenosse Robert Kochs. Die Tuberkulose äußerte sich meist als Lungenerkrankung, und es bedurfte daher unter anderem bildgebender Verfahren, um sie möglichst frühzeitig und sicher erkennen zu können. Der Physiker Röntgen, der die später nach ihm benannte Strahlung entdeckte, mit der man von außen in die Lunge »hinein und hindurch« schauen konnte, erhielt dafür 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Röntgen wirkte neben Berlin auch wesentlich in Würzburg. Und so galt für viele Koryphäen jener Zeit, dass sie an mehreren Orten gefragt waren. Das hat sich bis heute nicht geändert, wie wir täglich in den Medien und an der Berichterstattung zu gesundheitlichen Themen und einer starken Tendenz zur Personifizierung ablesen können. Bedeutende Mediziner sind oft begehrte Medienstars – das waren sie damals schon, nur mit anderen Mitteln.
Aufsehen hatte so auch Edward Jenner erregt. Jenner war ein einfacher englischer Landarzt gewesen, der Ende des 18. Jahrhunderts beobachtet hatte, dass Melkerinnen, die bereits an harmlosen Kuhpocken gelitten hatten, sich nicht mehr an der tödlichen Variante der Pocken anzustecken schienen. Er wagte 1796 den riskanten Versuch, einen Bauernjungen zunächst mit harmlosen Kuhpocken zu infizieren, um ihn nach sechs Wochen mit dem tödlichen Pockensekret zu kontaminieren. Der Junge blieb gesund. Heute gelten die Pocken, die noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Hunderttausende von Menschen töteten, nach einer erfolgreichen Impfkampagne als besiegt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte die Erde 1979 als pockenfrei.
Ethisch fragwürdige Versuche, wie der seinerzeit von Edward Jenner, waren im Rahmen einer aufkommenden Immunologie und Mikrobiologie nicht ungewöhnlich. Der Erfolg rechtfertigte den heroischen Akt. Von den Fehlversuchen und mutmaßlichen Opfern wissen wir wenig. Auch der Franzose Louis Pasteur, der vergleichbar zu Robert Koch das Mikroskop als wesentliches Instrument seiner Forschungsarbeiten nutzte und so von Paris aus die Welt der Bakterien entdeckte und das Wissen diesbezüglich revolutionierte, hatte im Zusammenhang mit der Erforschung der Tollwut einen Impfstoff aus dem Rückenmark tollwütiger Kaninchen entwickelt. Er testete ihn 1885 erstmalig an einem Menschen – ebenfalls mit Erfolg.
Überhaupt: Hygiene und Impfen. Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts starb beispielsweise jeder dritte von zehn Säuglingen in den ersten Lebenswochen. Oft wurden die Kinder zeitgleich mit ihren unter der Geburt verstorbenen Müttern begraben. Diesem Zustand konnte unter anderem ein Ende dadurch bereitet werden, dass Ignaz Semmelweis in Wien Mitte des 19. Jahrhunderts das »Kindbettfieber« nicht mehr als einen vermeintlichen Fluch akzeptierte, sondern als Ursache vielmehr die schlechte Hygiene ausmachen konnte. Durch den erfolgreichen Gebrauch eines antibakteriell wirksamen Mittels zur Händedesinfektion konnten fortan unzählige Frauen vor dem Tod bewahrt werden. In diesem Umfeld muss auch von Alexander Fleming gesprochen werden, der in den Zwanzigerjahren die enorme Bedeutung von antibiotischen Wirkstoffen für die Medizin erkannte. Schon 1874 hatte Theodor Billroth die therapeutische Wirksamkeit von Penicillin vermutet, einem Wirk- und Schutzstoff des Schimmelpilzes, doch wissenschaftlich etabliert wurde es erst durch den schottischen Bakteriologen Fleming. Dieser hatte am 28. September 1928 in seinem Labor eher zufällig bemerkt, wie Schimmelpilze, die in eine Bakterienkultur hineingeraten waren, dort eine wachstumshemmende Wirkung entfalteten. Weitere Untersuchungen führten später zum Antibiotikum Penicillin, einer Revolution in der Therapie von unzähligen bakteriellen Erkrankungen – Fleming erhielt 1945 den Nobelpreis.
Neben London, Paris und Berlin war auch Wien ein Zentrum großer medizinischer Errungenschaften und Erfolgsgeschichten. Hier entdeckte unter anderem Karl Landsteiner 1901 die Existenz der Blutgruppen und bekam ebenfalls einen Nobelpreis. Er löste so das Rätsel der Agglutination, der tödlichen Verklumpung bei Blutübertragungen, und konnte damit die Blutspende als therapeutisches Verfahren etablieren. In Wien wirkte zeitgleich der Neuropathologe Sigmund Freud. Ganz in der Tradition eines Universalgelehrten, war er vielseitig interessiert und wurde schließlich weltweit als einflussreicher Denker sowie Begründer der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse bekannt.
Im Verlauf der Zeit spielte die Musik aber zunehmend andernorts. Mit viel Glück erstellten der britische Physiker Francis Crick und der aus Chicago stammende Biologe James Watson ein Modell der biochemischen Struktur der Gene und beschrieben den Aufbau der Desoxyribonukleinsäure, unserer DNA. Diese Entdeckung, ebenfalls mit einem Nobelpreis ausgezeichnet, ist bis heute zentrale Voraussetzung dafür, dass wir Gentherapien für viele Erkrankungen entwickeln können – oder zumindest davon träumen, Erkrankungen, die auf einen genetischen Defekt zurückzuführen sind, mittels solcher Therapien tatsächlich eines Tages heilen zu können. An vielen Orten der Welt wird derzeit an entsprechenden Verfahren gearbeitet. Modernste Medikamente und astronomisch teure Therapien, wie wir sie immer stärker auch im Bereich der Krebsheilkunde oder zur Eindämmung von chronisch-entzündlichen Erkrankungen finden – Therapien wie etwa mit rekombinanten Antikörper – , gehen letztlich auf Watson und Crick und ihr DNA-Modell von 1953 zurück. Solche Antikörpertherapien, auf denen eine große Hoffnung auch im Kampf gegen Multiple Sklerose, Morbus Parkinson und Alzheimer ruht, schwemmen gegenwärtig den Arzneimittelmarkt – und sprengen ihn. Die hohen Erwartungen konnten bis dato aber leider noch nicht erfüllt werden.
Was jedoch jetzt zu einer faszinierenden Veränderung von Wissenschaft und Methoden im Bereich der Bakteriologie, Immunologie und Humanbiologie geführt hat, wozu auch die medizinische Gentechnik gehört, ist die Entdeckung der sogenannten Gen-Schere, der CRISP/Cas-Methode. Hier handelt es sich um eine molekularbiologische Methode, mit deren Hilfe die DNA gezielt geschnitten und verändert werden kann. Gene können eingefügt, entfernt oder gezielt ausgeschaltet werden; auch nur einzelne Bausteine eines Gens können spezifisch verändert werden. Das eröffnet unbegrenzte Möglichkeiten für neue Therapieansätze. Aufgrund der einfachen Durchführung und der Skalierbarkeit, bei relativ geringen Kosten, erlebt diese Methode derzeit einen enormen Aufschwung. Hightech ist spätestens damit in der Medizin angekommen. Und 2020 wurde unter anderem der in Berlin arbeitenden Französin Emmanuelle Charpentier für die Entwicklung der Genschere der Chemie-Nobelpreis verliehen. Denken wir an dieser Stelle schließlich noch an die Entwicklung der neuartigen genbasierten mRNA-Corona-Impfstoffe in Rekordzeit …
Aber moderne Technik hat immer schon in der Medizin eine große Rolle gespielt. Das war bei Leonardo da Vinci bereits der Fall und auch, als Christiaan Barnard 1967 die erste erfolgreiche kurative Herztransplantation am Menschen in Kapstadt durchführte. Oder die Entwicklung von Exoskeletten: Seit Beginn dieses Jahrtausends sind große Bemühungen unternommen worden, um die Bewegung gelähmter Menschen mithilfe von Computertechnik und künstlichen Skelettanteilen zu ermöglichen. Die US