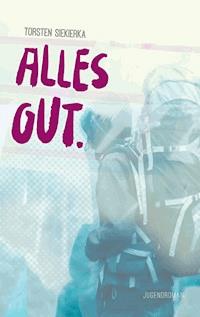4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Infinity Gaze Studios
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Unter normalen Umständen wären Luzie und Merten sich niemals begegnet: Sie, das Mädchen aus dem Berliner Plattenbau und der Junge aus einem prunkvollen Villenviertel in Hamburg-Harvestehude. Doch auf einer Jugendfahrt waren alle gleich. Die Armen, die Reichen, die Jungen und Mädchen. Aber stimmte das? Und überhaupt - was war schon normal? "Mein, dein, unser Sommer" - Eine Geschichte über Vorurteile und echte Freundschaften ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mein dein unser Sommer
Über den Autor
Torsten Siekierka, geboren im Jahr 1984 in Potsdam, wohnt inmitten der urbanen Wirren von Berlin. Er ist ein Geschichtenerzähler für jedes Alter. Seine all-age-Romane sind wie eine frische Brise im Sommer, die die Herzen der Leser erwärmen und ihre Fantasie entfachen. Mit seinem neuesten Werk "Mein Dein Unser Sommer" entführt er seine Leser in eine Welt voller Sehnsucht, Freundschaft und unvergesslicher Erlebnisse.
Siekierka ist ein Schriftsteller, der die Grenzen des Möglichen überschreitet und die Herzen seiner Leser im Sturm erobert.
Tag 1
Ich zog den pinken Rollkoffer die Bahnhofstreppen hinauf. Wie eine, die vieles gerne getan hätte, am ersten Morgen der Sommerferien:
Aber einen pinken Rollkoffer die Bahnhofstreppen hinaufzuziehen zählte eher zu den Dingen, auf die ich um 07:00 Uhr am Morgen keinen Bock hatte.
Klack, klack machten die Räder. Dann wieder: Klack, klack. Ich schaute nach oben und kniff wegen der Sonne meine Augen zusammen. Das würde noch oft klack, klack machen, bis ich das Ende der Treppen erreicht hatte. Erwähnte ich eigentlich, dass der Fahrstuhl, der mich vom S-Bahnsteig auf die Brücke hätte fahren können, schon vor ewigen Zeiten kaputt gegangen ist? Und erwähnte ich eigentlich, dass ich geantwortet hätte, du spinnst, wenn mir zwei Wochen vorher jemand gesagt hätte, dass ich an dieser Ferienfreizeit teilnehmen muss, obwohl ich gar nicht will?
Und was war das Ende vom Lied? Diese Frage stellte mir meine Mutter immer.
Was wäre das Ende vom Lied, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst?
Was wäre das Ende vom Lied, wenn du nicht für die Mathearbeit lernst?
Und was sagte dann mein Papa immer? Solange die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende. Das war eine Textzeile einer seiner Lieblingsbands.
An diesem Morgen war das Ende vom Lied, dass ich mich die Treppen vom S-Bahnsteig hinauf kämpfte, aber viel lieber wieder nach Hause wollte. Schlafen. Mit Mama und Papa abends am Esstisch sitzen und quatschen. Und ich hätte mich sogar mit an den Tisch gesetzt, hätte keine schlechte Laune gehabt. Diesmal nicht.
Ich legte beide Hände an den Griff meines Koffers und ließ es mehrere Male hintereinander taktvoll klackern. Bis ich ins Stolpern kam und nicht mehr auf den Treppenstufen stand, sondern lag. Das passte zu diesem Morgen. Schmerzen durchzogen mein rechtes Knie. Diese Schmerzen fühlten sich an, als stach jemand andauernd mit einer Nadel in mein Schienbein. Mit zusammengepressten Lippen setzte ich mich auf die Stufen und staunte über das Loch an meinem rechten Hosenbein. Dieses hätte mir nichts ausgemacht, weil ich links auch ein Loch hatte. Das war aber gewollt. Der Anblick meines Knies, den das rechte Loch freigab, erinnerte mich an die Bolognesesauce meiner Mutter. Und es sah genauso unappetitlich aus.
Ich konnte den Anblick von Blut noch nie ertragen. Deshalb schwor ich mir, als ich 14 war, nie wieder Fleisch zu essen, nachdem ich mir auf YouTube ein Video aus einem Schlachthof ansah. Das hielt ich in den letzten zwei Jahren auch durch. Soviel zum Thema Bolognesesauce meiner Mutter.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht erreichte ich die Brücke und schaute mich um. Eine schöne Aussicht war das nicht. Schon um 07:00 Uhr roch es nach Abgasen. Welch Überraschung, wenn man auf einer Brücke steht, die sich über eine mehrspurige Hauptverkehrsstraße zieht. Ich schaute Richtung Busbahnhof, der am anderen Ende der Brücke lag. Einen Reisebus erkannte ich zwischen den gelben Linienbussen noch nicht. Weil ich, wie immer, zu früh war. Aus Angst, zu spät zu kommen. Das musste man sich mal vorstellen. Ich trat eine Reise an, auf die ich keine Lust verspürte, hatte aber Angst, den Bus zu verpassen. Das war ich. Mehr musste man über mich nicht wissen. Aber ich stand auch jeden Morgen um kurz nach Sieben auf dem Schulhof, weil ich Angst hatte, zu spät zum Unterricht zu kommen.
Schon am ersten Tag der Sommerferien war ich mir sicher, es würden die schlimmsten Ferien werden, die ich je hatte. Übrigens auch meine Letzten, wie meine Mutter betonte. Ich sollte die Ferien nochmal genießen. In einem Jahr wäre ich mit der Schule durch. Ob ich mich darüber freuen sollte? Gute Frage. Ich freute mich auch auf diese Reise. Bis Klara abgesagt hatte. Zwei Wochen vor der Abfahrt. Wobei nicht sie abgesagt hatte, sondern ihre Eltern. Weil Klara einen Freund hatte, den ihre Eltern nicht mochten. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, aber das interessierte Klaras Eltern nicht die Bohne. Sie meinten, Klara dürfte die Reise nur antreten, wenn sie aus ihrem Freund einen Ex-Freund machte. Und Klara meinte dann, mehrere Tage nicht mehr nach Hause zu kommen. Sie war natürlich bei ihrem Freund. Der hatte schon eine eigene Wohnung und war vier Jahre älter als Klara und ich. Da waren ihre Eltern erst recht sauer und hätten sie am liebsten nicht mal mehr in die Schule gelassen. Und ich wollte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Klaras Eltern herausgefunden hätten, dass Klara immer öfter die Schule schwänzte. Aber spätestens mit dem Endjahreszeugnis wussten sie es. Und seit Klara mit dem Zeugnis den Heimweg antrat, hörte ich nichts mehr von ihr.
Ich schwänzte nie die Schule, aber ich hatte auch keinen Freund. Brauchte ich nicht. Ich bekam oft genug mit, wenn jemand in meiner Klasse Liebeskummer hatte. Nein Danke. Das Leben war so schon traurig genug. Natürlich nicht immer, aber schon oft. Was Gründe hatte, aber dazu später mehr. Als ich die Jungs in meiner Klasse erlebte, wie sie drauf waren, das waren noch richtige Kinder. Die hielten sich zwei Finger über die Lippen und meinten, wie Adolf Hitler reden zu müssen. Mehr muss man über die Jungs aus meiner Klasse wirklich nicht wissen.
Ich erreichte die Treppe auf der anderen Seite der Brücke und stellte fest, dass es schwerer war, einen Koffer die Treppen hinunterzuschleppen, als hochzuziehen. Was vor allem an zwei Dingen lag.
Ding 1: Die Treppe, die hinunterführte, war steiler, als die, die hinaufführte. Und ein Fettklops durfte man bei dieser Treppe auch nicht sein.
Ding 2: Das Gefühl mit der Nadel im Bein ließ in der Zwischenzeit nicht nach. Im Gegenteil.
Ich ließ die Treppe hinter mir, humpelte zum Busbahnhof und blieb stehen. Ich schaute mich um. Wo fuhr der Bus überhaupt ab? Ich hoffte, an einer Haltestelle Jugendliche mit Reisegepäck zu erkennen. Aber nirgendwo sah es nach einer Reisegruppe aus. Ich suchte mir erstmal eine Sitzmöglichkeit und half meinem Hosenbein, mit der Hälfte meines Taschentuch -Vorrats, das Blut aufzusaugen. Dank des riesigen Lochs war das so einfach wie schmerzhaft. Das Hellblau meines rechten Hosenbeins war nur noch im Ansatz zu erkennen. Ich sah aus wie die besoffenen Leute bei uns vorm Netto, die sich manchmal prügelten und anschließend blutverschmiert nach Hause humpelten. Nach Hause wollte ich auch wieder humpeln, weil ich mich dafür schämte, so verdreckt auszusehen. Aber meine Eltern ...
Mit zwei meiner Stirnbänder klemmte ich zwei Taschentücher an meine Kniescheibe, dann erhob ich mich wieder und setze meine Suche nach dem Bussteig fort, an welchem der Reisebus abfahren sollte. Ich schaute auf die Zahlen der Buslinien an den Haltestellen. 190, 192. Hier nur Ausstieg. Natürlich stand nirgends dieses Langeoog dran. Das war mir klar. Als hätten die nur für eine Reisegruppe eine Extra-Bushaltestelle anfertigen lassen. Aber ein Zettel oder ein Schild wäre doch hilfreich gewesen. Aber nichts konnte ich erkennen. Außer dem Shopping Center Eastgate. Da war ich noch nie drin. Was auch traurig war, denn mal eben shoppen gehen, das war nicht möglich. Ein kleiner Trost war nur, dass ich nicht die Einzige in meinem Freundeskreis war, deren Eltern brutal wenig Geld hatten.
Von außen sah das Center ein wenig nach einer Strecke für Rennautos aus. Zumindest der Balken rund um das Center. Mit Loopings und allem, was dazugehörte.
Ich fuhr mit meiner rechten Hand durch meine Haare. Meine Haare. Ich liebte meine Haare, weil ich sie nicht kämmen musste. Die lagen einfach immer perfekt. Ein bisschen wild, nicht ganz schulterlang, die hingen einfach runter und so, wie sie herunterhingen, gefielen sie mir. Und wenn ich es etwas wilder mochte, schob ich mir ein Stirnband unter die Haare. Und auch meine Haarfarbe wollte ich nicht ändern. Weil ich mal gehört hatte, dass das Färben die Haare kaputt macht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ausprobieren wollte ich es lieber nicht.
Auf der anderen Seite des Busbahnhofs beobachtete ich, wie ein Reisebus um die Ecke bog. Der war schwarz und sah aus wie einer dieser Busse, mit denen berühmte Bands fuhren, wenn sie auf Tour waren. Der Bus hielt, aber da, wo er hielt, war keine Haltestelle. Okay, da war eine Haltestelle, aber keine für einen Bus, sondern für die Straßenbahnen. Und neben der Straßenbahnhaltestelle war das Le-Prom. Das war ein Kino und eine Cocktailbar. Auch da war ich noch nie drin. Das war, im Gegensatz zum Eastgate, aber nicht schade.
Meine rechte Hand griff nach meinem Rollkoffer und zog ihn ein Stück Richtung Tourbus. Bis jemand um den Bus herumgelaufen kam. Vermutlich der Fahrer. Ich blieb stehen. Wie hätte es auch ausgesehen, wenn eine Püppi mit Löchern in der blutverschmierten Hose auf einen Mann zugeht, der teure Jeans und ein Sakko trug? Püppi nannte mich übrigens mein Vater. Was mich weniger störte, als wenn mich jemand bei meinen Vornamen nannte. Was oft genug vorkam. Wobei, mein Vorname. Ich liebte und hasste ihn.
Ich schaute mich wieder um und erkannte, dass auf einem Bussteig inzwischen drei Leute mit Koffern standen. Das sah doch nach dem aus, wonach ich suchte. Oder nicht suchte. Ich hatte keine Lust auf diese Fahrt. Aber meine Eltern ..., die hätten mir das nie verziehen. Dabei waren meine Eltern wirklich cool, aber wir schwammen nicht im Geld. Im Gegenteil. Bei uns war es eher Ebbe, wie mein Vater stets betonte. Ich lernte in der Schule, was eine Ebbe war, konnte mir darunter aber nichts vorstellen. Manchmal lachten wir gemeinsam darüber, dass wir nicht im Geld schwammen. Da meinte ich einmal, dass wir eher in der Wüste leben würden, weil es dort so gut wie kein Wasser gab. Da lachten meine Eltern. Obwohl ich wusste, wie sehr sie das belastete mit dem Geld.
Ich schlich Richtung Bussteig, wo jetzt Leute mit Koffern standen. Ich zählte acht Personen. Drei davon sahen aus wie Eltern. Meine Eltern hätten mich auch gerne zum Bus gebracht, aber das war nicht möglich, weil beide jeden Morgen um 04:00 Uhr zur Arbeit mussten. Meine Mama arbeitete in einem Backshop, und mein Vater reinigte Büros, damit die Herren in ihren schicken Anzügen sich an ihren Arbeitsplätzen wohlfühlen. So sagte er es oft. Und obwohl beide viel arbeiteten, schwammen wir eben nicht im Geld, wir saßen eher auf dem Trockenen. Dann legte mein Papa einen seiner Lieblingssongs auf und wir lachten, als der Sänger davon sang, dass das Geld aus der Wand käme. Shoppen gehen im Eastgate, das war nur ein Traum. Deswegen wusste ich, was es meinen Eltern bedeutete, dass ich an dieser Ferienfreizeit teilnahm. Wir drei fuhren nie zusammen in den Urlaub. Weil das zu viel Geld gekostet hätte. Jetzt fuhr ich zum ersten Mal in den Urlaub. Und zum ersten Mal allein. Von der Schulfahrt in der sechsten Klasse mal abgesehen.
Wie sehr ich doch meine Eltern anbettelte. Klara und ich wollten gemeinsam in den Urlaub fahren. Ohne Eltern. Der Kompromiss war eine Jugendfreizeit (wir würden also mit anderen Jugendlichen und einem Betreuer-Team fahren). Dabei waren es meine Eltern, die die meisten Kompromisse eingingen. Natürlich bekam ich mit, auf was sie alles verzichteten, um mir den Wunsch der Reise mit Klara zu erfüllen. Deshalb hatte meine Mutter auch Tränen in den Augen, als ich ihr sagte, dass ich nicht mehr mitfahren wollte, weil Klara ja auch nicht mehr durfte. Das Geld wäre weg gewesen. Verbrannt. Da blieb mir keine andere Wahl, als mich früh auf den Weg zum Busbahnhof zu machen.
Ich schielte zu den Jugendlichen auf dem Bussteig und stellte mich etwas abseits. Ich wollte nicht angesprochen werden. Wobei mich Joelina erkannt haben musste, denn sie winkte mir zu. Es war nur ein zartes, kurzes Winken. Sie winkte, als wollte sie sich dafür entschuldigen, dass sie auch an dieser Fahrt teilnahm.
Joelina war die Widersprüchlichkeit in Person. Eigentlich war sie mega-hübsch, aber sie trug nur Klamotten, die ich selbst nicht getragen hätte.
Und ich war wirklich anspruchslos. Die Sachen, die Joelina trug, kamen für mich gleich nach einem Kartoffelsack. Das war in der Schule so, und das sah an diesem Morgen am Busbahnhof genauso aus.
Vorhin erzählte ich ja, dass meine Eltern und ich nur wenig Geld hatten. Aber Joelina war die personifizierte Armut. Ihre Mutter war arbeitslos, ihren Vater kannte Joelina nicht, und sie hatte drei Geschwister, von denen zwei schon mal im Gefängnis saßen. Alles Gerüchte, die man über Joelina erzählte, aber etwas Wahrheit war da bestimmt dran. Wobei, wie konnte Joelina an solch einer Fahrt teilnehmen, wenn meine Eltern schon echt haushalten mussten, um meine Teilnahme zu ermöglichen, wie sie oft betonten?
Joelina stank nach Scheiße. Das wurde auch immer erzählt. Konnte ich aber nicht bestätigen. Was aber daran lag, dass ich ihr möglichst aus dem Weg ging. Es war nicht schwer, denn Joelina war zwar nur ein Jahr jünger als ich, aber zwei Klassen unter mir. Das war kein Gerücht, das wusste ich aus der Schule.
Ich saß auf dem weißen Geländer und beobachtete aus sicherer Entfernung, wie sich der Bussteig weiter mit Jugendlichen füllte. Eine Frau, die einen halben Kopf größer als ich war, wuselte durch die Menschen hindurch und notierte sich irgendwas auf einem Blatt, welches an einem schwarzen Klemmbrett befestigt war. Sie drehte sich um und ich erkannte ein hübsches Gesicht. Trotz der Pausbäckchen sah ich der Frau an, dass sie bestimmt schon 20 war. Ein Bus fuhr vor und die vordere Tür öffnete sich. Es war aber nicht der schwarze Tourbus für berühmte Bands, sondern ein blauer Bus. Und das Sakko war jetzt eine Weste und die teure Jeans eine formlose Cordhose.
«Koffer andere Seite!», rief der dicke Fahrer und alle setzten sich in Bewegung. Auch Joelina. Nur ich blieb auf dem Geländer sitzen. Weil mir das zu hektisch und zu voll war. Die ersten Leute kamen wieder hinter dem Bus hervor und verschwanden in der Tür.
«Gehörst du zur Reisegruppe?» Ich starrte auf einen Oberlippenbart mit Nasenring. Da fiel es wohl jemandem schwer, sich zwischen älter oder jünger aussehen zu entscheiden. Den Typen in seiner Jeansjacke schätzte ich auf ungefähr 20 Jahre. Wobei ich mir die Frage stellte, wer mit 20 Jahren bitte einen Oberlippenbart trug? Das war ja nun mega-oldschool.
«Ja», antwortete ich.
«Und?» Ich wusste nicht, worauf der Typ mit seinem und hinaus wollte.
«Alter, soll ich dir den roten Teppich zu den Gepäckfächern ausrollen, oder was?» Ich war etwas durcheinander, weil ich nicht erwartet hatte, dass so mit mir geredet wird. Ich fuhr doch auf eine Jugendfreizeit und in kein Boat-Camp.
Was dann passierte, brachte mich beinahe zum Lachen. Ich saß noch immer auf dem weißen Geländer und beobachtete, wie der Typ in der Jeansjacke sich vor mir aufbaute, indem er die Hände in die Hüften stellte.
«Eins! Zwei! Drei! Vier!»
Bis zu welcher Zahl der wohl vorhatte zu zählen? Und was wäre passiert, wenn ich einfach sitzen geblieben wäre?
«Fünf! Sechs! Sieben!» Jetzt hielt er mir beide Hände vor das Gesicht und ließ mit jeder Zahl einen weiteren Finger hochschnellen. Das konnte er bei einer Fünfjährigen abziehen, aber ich war seit zehn Jahren raus aus diesem Alter. Da funktionierte das nicht mehr. Und wenn doch, dann nur, weil ich meine Ruhe haben wollte. Das war auch der Grund, weshalb ich mich schließlich erhob und meinen Trolley hinter den Bus zog. Dort riss der Fahrer mein Gepäck an sich, an welchem noch meine Hand klebte, und schmiss es zu den anderen Koffern in das Gepäckfach. Ich begab mich mit meinem Rucksack, der mein Handgepäck war, zur Vordertür und stieg in den Bus. Ich schaute mich um und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Unten war alles leer. Alle Leute saßen oben. Vielleicht wegen der Aussicht. Aber Fenster gab es unten ja auch. Ich jubelte still, weil ich das gesamte Unterdeck für mich hatte. Ich setzte mich auf einen Viererplatz und breitete mein Buch, meine Trinkflasche und mein Stullenpaket auf dem Tisch vor mir aus.
Ich zog meine Schuhe aus und legte meine Beine auf den gegenüberliegenden Sitz. Ein cooles Gefühl. Und zu diesem Gefühl zuckte mein lädiertes Knie zweimal kurz, als wollte es sich bedanken, dass es nun endlich Ruhe hatte. Wenn die gesamte Fahrt so ablief, wäre es doch gemütlicher, als ich annahm. Das waren meine Gedanken, bis wieder der Typ mit dem Nasenring und dem Schnauzbart vor mir stand. Die Hände presste er wieder in seine Hüften und seine Beine standen so weit auseinander, ich hätte problemlos durchkriechen können.
«Eins! Zwei! Drei! Vier!» Ich stierte auf den silbernen Nasenring. Vielleicht konnte er mir erklären, was sein Träger schon wieder von mir wollte.
«Fünf! Sechs! Sieben!» Ich kniff die Augen zusammen. «Acht!» Ich schielte nach links, nach rechts, fragte mich, was Sache war. Ich suchte nach Hilfe, die es hier unten natürlich nicht gab. Ich saß ja hier alleine.
«Wenn du bei Zehn nicht oben bist, hast du die längste Zeit an dieser Reise teilgenommen!» Dieser Satz ließ mich zumindest ahnen, was der Typ mit seiner Zählerei erreichen wollte. Ich stopfte meine Sachen zurück in den Rucksack, schlüpfte in meine Schuhe und schob mich an dem Typen vorbei. Über eine Treppe erreichte ich das Oberdeck, einen freien Platz erkannte ich zuerst nicht. Ich schlich durch den Gang. Die miefige Luft hier oben kratzte in meinem Hals. Ich vermied es, zu husten. Wie hätte das auch ausgesehen, wenn ich bellend durch den Gang spaziert wäre? Was hätten all die anderen gedacht? Schaut mal, da kommt die Bazillenschleuder, die uns alle krank machen will. Ich mied die Blicke der anderen, während ich den einzigen freien Sitzplatz ansteuerte. Auf dem lag aber ein Rucksack. Und nun? Sollte ich ihn runternehmen?
«Da sitzt Maurice. Da kannst du dich leider nicht hinsetzen.» Ich drehte mich um und erkannte Joelina. Sie redete aber nicht mit mir. Neben ihr saß die pausbäckige 20-Jährige. Während sie mit mir sprach, fiel mir ein, an wen mich ihr Gesicht erinnerte. An Frau Holle. Also nicht an die Märchenfigur, sondern an meine Lieblingspuppe, als ich noch jünger war.
Die nannte ich damals auch Frau Holle, aber warum ich sie damals auf diesen Namen taufte, weiß ich nicht mehr.
«Schau doch mal, ob du noch woanders einen Platz findest!» Ich nickte und lief weiter. Einen Platz suchte ich vergebens. Also stieg ich die hintere Treppe wieder hinunter. Ich erkannte, dass sich dieser Maurice gerade auf den Weg machte, die vordere Treppe hochzugehen. Das passte, denn so konnte ich mich wieder auf meinen alten Platz setzen. Nur räumte ich meinen Rucksack diesmal nicht aus, und auch meine Schuhe behielt ich an. Ich rechnete ganz fest damit, dass der Typ mit seinem Schnauzbart und seinem Nasenring wieder auftauchen würde. Aber was hätte dann passieren können? Er drohte ja bereits beim ersten Mal, dass ich in Berlin bleiben müsste, wenn ich nicht nach oben gehe. Mir hätte das gefallen. Sehr sogar. Ich hätte meinen Eltern dann berichten können, dass ich nicht mitfahren durfte, weil unten im Bus alles leer und oben alles voll war, ich aber oben sitzen sollte. Das hätten meine Eltern genauso wenig verstanden wie ich. Dann war es soweit. Dieser Maurice tauchte wieder auf. Er verzog sein Gesicht und schnaufte wie eine Lokomotive. Dazu ragte sein rechter Arm in die Höhe. Bevor ich die nächste Vorstellung im Bis zehn zählen geboten bekam, stand ich auf, quälte mich ein weiteres Mal die Treppe zum Oberdeck hinauf und schlich wieder durch die Sitzreihen. Die Frau mit dem Puppengesicht bemerkte mich diesmal nicht. Sie tippte auf ihrem Telefon herum, das in einer roten Hülle steckte. Ab diesem Moment wusste ich, dass sie zum Betreuerteam zählte. Das war mir vorhin noch nicht ganz klar, weil manche 15-Jährige schon aussehen, als wären sie 20. Ich zum Glück nicht, aber auffallen hätte es mir vorhin trotzdem können. Sie trug ja, als wir auf den Bus warteten, ein Klemmbrett unter dem Arm. Und jetzt war ich mir sicher, dass sie zum Betreuerteam zählte, denn uns Jugendlichen war es verboten, Handys mitzunehmen. Womit ich kein Problem hatte, ich besaß nämlich keins. Und Joelina bestimmt auch nicht. Okay, ich hatte ein Handy. Eigentlich. Aber das gehörte nicht nur mir. Das gehörte auch meiner Mutter und meinem Vater. Uns reichte ein Familienhandy.
Wieder stieg ich die hintere Treppe hinab. Diesmal setzte ich mich aber nicht an den großen Tisch. Ich verkroch mich in die hintere Sitzreihe vor dem Ausstieg. Immerhin gab es hier einen kleinen Klapptisch. Den wollte ich aber erst ausklappen, wenn der Bus losgefahren war. So lange hoffte ich, dass man mich möglichst nicht sah.
Röööaaahhh machte der Bus, die Vordertür machte zsssschhhup und los ging die Fahrt. An einen Ort, von dem ich bis dahin noch nie gehört hatte, aber der Name allein klang schon nach Langeweile. Langeoog – Langeweile. Ich sah sehnsuchtsvoll aus dem Fenster und vermisste meine Eltern schon jetzt. Berlin war trist und grau, aber selten langweilig. Auch wenn alle Wohnblöcke in Marzahn ziemlich gleich aussahen, man machte das Beste daraus. Und jetzt fuhr ich an einen Ort, den ich nicht kannte, und hatte keinen Schimmer, was mich erwartete. Dazu Joelina und der Mann mit dem Nasenring und dem Oberlippenbart. Hinter Ahrensfelde, das an Berlin grenzte, fuhren wir auf die Autobahn.
Wann fuhr ich das letzte Mal auf einer Autobahn? Ich konnte mich nicht erinnern. Wir sind mal mit dem Zug gefahren, aber mit dem Auto auf der Autobahn, das scheiterte schon daran, dass wir kein Auto hatten.
Der Bus beschleunigte und mein Herzschlag ebenso, denn jemand kam die Treppe hinunter. Ich ahnte, wer. Natürlich erschien wieder die Person vor mir, der ich nur noch einen genervten Blick zuwerfen konnte. Obwohl das nicht meine Absicht war. Wieder baute sich der Typ vor mir auf, sein Zeigefinger tanzte vor meinen Augen.
«Alter, das wird Konsequenzen haben!» Ich ließ meine Augenbrauen nach oben schnellen und hätte am liebsten entgegnet, dass ich, wenn überhaupt, eine Alte und kein Alter bin. Und wie sollten diese Konsequenzen bitte aussehen? Wollte er mich auf der Autobahn aussetzen, wie die Straßenhunde in den Videos auf Youtube? Die Frau, die oben neben Joelina saß, kam jetzt dazu. Sie trug wieder ein Klemmbrett unter dem Arm.
«Verrätst du mir einmal deinen Namen?»
«Luzie», antworte ich.
«Luzie? Und weiter?»
«Kusch!» Die Augen der Frau mit den braunen, schulterlangen Haaren und dem Puppengesicht wanderten die Liste hoch und wieder runter. Dann schauten die Augen zu mir.
«Hi Luzie, ich heiße Emilia, das ist Maurice. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du jederzeit zu uns kommen.» Ich nickte, wollte aber gerne auf diesen Maurice verweisen. Denn der brauchte Hilfe. Dringend.
Ich habe ja bereits erwähnt, dass ich meinen Namen hasste und liebte. Luzie Kusch. Ja, ja. Kusch, kusch. Geh mal weg. Oder Kusch, Kusch, verpiss dich mal. Ich konnte es nicht mehr hören. Das war das, was ich an meinem Namen hasste. Ich hatte aber noch einen zweiten Vornamen. Richtigerweise hätte auf der Liste also Luzie – Franka – Kusch stehen müssen. Den Namen Franka liebte ich an meinem Namen. Es war der Name meiner Oma, die vor vier Jahren starb. Ich bin irre stolz, dass ich ihren Namen tragen darf. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich am liebsten von jedem Menschen nur Franka rufen lassen. Aber das war unmöglich. Und da sind wir wieder bei meinen Eltern. Oma Franka war die Mama meiner Mutter. Ich denke oft an den Moment zurück, als wir erfuhren, dass sie im Krankenhaus gestorben war. Nierenversagen. Meine Mutter hatte ich vorher nie so traurig erlebt. Und danach auch nie mehr.
Meine Mutter hätte jeden Tag an ihre Mutter denken müssen, wenn sie mich auch hätte Franka nennen sollen. Und dann wäre sie wieder traurig gewesen. Das wollte ich auf keinen Fall.
Der Bus zuckelte durch eine Baustelle. Die rot-weißen Poller sahen aus, als würden sie jeden Moment vom Bus weggeschubst werden. Abgesehen vom Fahrer war ich jetzt tatsächlich alleine im Unterdeck. Ich fand den Hebel, mit dem ich die Lehne nach hinten drücken konnte, dann schloss ich die Augen. Ich stellte mir vor, ich wäre eine Prinzessin, der Bus meine Luxuslimousine und der Fahrer mein Chauffeur.
Ich stand hinter dem schwarzen Mercedes und starrte auf den bereits geschlossenen Kofferraum, unter dem Abgase aus zwei silbernen Röhren gepustet wurden. Ich war schlauer als mein Vater, denn ich wusste, dass das verboten war, denn das Auto stand schon seit 4 Minuten und 29 Sekunden mit laufendem Motor in der Einfahrt. Mein Vater wiederholte sich zum dritten Mal, während ich mich fragte, warum mein Vater den Zündschlüssel nicht zurückdrehte. Dann wäre der Motor wieder aus gewesen. Wusste er nicht, wie viele Abgase er in die Luft ausstieß? Einfach so. Außerdem hätte ich dann die Rosen gerochen, die in unserem Garten blühten, aber wegen meinem Vater roch ich nur verbrannten Diesel.
«Merten. Es wird wirklich Zeit», sprach jetzt auch die Frau durch das Fenster der Beifahrertür. Auch die war schon geschlossen. Also die Beifahrertür war geschlossen, nicht die Frau. Die war nämlich nicht ganz dicht. So hätten es normale Menschen ausgedrückt, aber ich war nicht normal und daher wusste ich, dass der Spruch eine Lüge war. Denn wenn Menschen nicht dicht wären, würden sie auslaufen.
«Merten, bitte, es wird wirklich Zeit.» Die Stimme meines Vaters klang jetzt so, als konnte sie sich nicht entscheiden, ob sie weinerlich klingen oder schreien sollte.
Ja, für euch wird es Zeit. Weil ihr euer Flugzeug bekommen wollt, mit welchem ihr auf die Malediven fliegen wollt, dachte ich mir.
Als ich Papas neue Freundin zum ersten Mal sah, fand ich sie hübsch. Sie sah nicht viel älter aus als ich. War sie aber auch nicht. Sie war achtzehn, ich war vierzehn. Und an dem Tag, als der Mercedes mit laufendem Motor in der Einfahrt stand, war sie zwanzig, ich war sechzehn, vier Monate und drei Tage alt, mein Vater war 48 Jahre und sieben Monate und 19 Tage alt. Aber als Freundin hätte ich Marni nicht gewollt. Auch als Mama wollte ich sie nicht. Obwohl sie immer wieder betonte, dass sie jetzt meine Mama wäre. Dann hätte sie mich im Alter von vier Jahren geboren. Das ging so wenig, wie Menschen nicht dicht sein konnten.
Meine richtige Mama sah ich das letzte Mal, als ich fünf war. Ich denke oft an meine Mama. Wie sie mich auf dem Dreirad anschob, mich in den Kindergarten fuhr, mich mit Zwieback und Pfefferminztee fütterte, als ich krank war. An andere Momente mit ihr erinnerte ich mich nicht.
Und dann war sie plötzlich weg. Dann kam Petra, die war aber auch schnell wieder weg. Wohl, weil sie mit mir nicht klarkam. Ob das stimmte? Möglich. Ein Lehrer sagte mal zu mir, dass ich eine spezielle Type wäre. Ich meinte dann, dass das nicht stimmte. Ich bin keine spezielle Type, ich bin Merten Schulz. Da lachten alle in der Klasse.
«Ich steige erst ein, wenn der Motor aus ist.» Das sagte ich, weil mir die Umwelt leid tat. Durch die offene Tür hörte ich Papas Freundin stöhnend von sich geben: «Mach doch, was er will. Hauptsache, wir bekommen noch unserem Flug.» Und mein Vater hörte auf seine Freundin. Ich presste mein Buch an meinen Bauch und anschließend meinen Rücken gegen das Leder der Lehne des Rücksitzes.
Der Motor brummte wieder los, das Auto fuhr rückwärts aus der Ausfahrt und dann aus der Milchstraße. Ich wohnte wirklich in der Milchstraße. Aber nicht in der im Weltall, sondern in der in Hamburg-Harvestehude.
Mein Vater fluchte sich durch den Straßenverkehr, und es war unüberhörbar, dass ihr Flugzeug wohl ohne sie abhob.
Am Hauptbahnhof suchte mein Vater einen Parkplatz. Es gab aber keinen. Marni meinte, dass ich doch aussteigen und alleine zum Busbahnhof laufen könnte. Mein Vater meinte aber, dass das doch nicht ginge.
Es wäre schon gegangen, schließlich befand sich der zentrale Omnibusbahnhof ganz nah am Hauptbahnhof, aber vielleicht wollte mein Vater auch nur sicher sein, dass ich wirklich in den Bus stieg und wegfuhr. Ich schaute aus dem Fenster und suchte jetzt ebenfalls nach einem Parkplatz. Und ich fand einen.
«Papa, in der zweiten Reihe ist ein Platz frei. Wenn du dich richtig hinstellst, hast du links und rechts mehr als zwanzig Zentimeter Platz, um auszusteigen.» Marni schaute meinen Vater an, der steuerte die schwarze Limousine in die zweite Reihe des Parkplatzes und kurz darauf standen wir am Omnibusbahnhof und ich klammerte mich an mein Buch.
Ich schlummerte friedlich weg und träumte meinen Prinzessinnentraum. Plötzlich riss ich meine Augen auf und presste mich in meinen Sitz. Ich hoffte, dass meine Rückenlehne mich fraß und wieder ausspuckte, wenn das hier vorbei war. Jemand schrie: «Bek! Bek! Bek!» Neben meiner Sitzreihe erkannte ich meinen Chauffeur. Sein Gesicht erinnerte mich aber eher an einen Sklaventreiber.
«Beeeek!» Er wedelte wild mit seinem linken Arm. Ich konnte seine Worte nicht zuordnen und auch sonst nicht erkennen, was das Ledersakko mit dem weißen Shirt von mir wollte. Wobei es ja nur ein Wort war. Hilfesuchend schaute ich mich um. Wie vorhin, als der Typ mit dem Nasenring mich voll zählte.
Die Verzweiflung des Busfahrers erinnerte mich an Mathe. Proportionale Zuordnungen. Steigt das Eine, steigt das Andere. In diesem Fall stieg die Verzweiflung und gleichzeitig das Rot im Gesicht des Busfahrers. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, was der von mir wollte. Ich hätte so gerne getan, was er verlangte, aber was sollte ich tun?
«Beeek! Beeek!» Seine Stimme war jetzt noch lauter, klang dabei aber so, als würde er jeden Moment anfangen zu weinen. Und sein linker Arm drohte wegzufliegen, weil er mit diesem so dermaßen durch die Luft wedelte, dass es aussah, als wollte er seinen Arm abschütteln. Ich sah, wie Emilia durch die Vordertür den Bus bestieg. Jetzt. Jetzt dämmerte es mir. Langsam.
«Es ist Pause. Wir müssen alle aussteigen, damit der Fahrer die Türen zumachen kann.»
«Hast du dich erschrocken?»
«Ein bisschen», antwortete ich der Frau mit den Pausbäckchen. Ich schaute mich um und erkannte, dass wir allein auf dem Parkplatz standen. Währenddessen saß Joelina im Gras und pflückte Gänseblümchen. Sollte ich zu ihr gehen? Nein. Auch wenn das für mich keine Priorität hatte, aber würde ich mich mit Joelina abgeben, wären meine Chancen, überhaupt zu anderen Leuten Kontakt aufzunehmen, in den nächsten Gully geflossen.
«Wo sind die Anderen?», fragte ich.
«Ich glaube, die lassen ihr erstes Taschengeld bei Esso. Möchtest du dir auch was kaufen gehen?» Ich schüttelte mit dem Kopf und hoffte, dass Emilia mir nicht meine Gedanken ansah. Es waren Gedanken an meine zwei 2-Euro-Stücke und an das eine 1-Euro-Stück in meiner Geldbörse. Mehr Taschengeld war nicht drin.
Keine Ahnung, wie sie das schaffte, aber Emilia musste mir meine Gedanken angesehen haben. Oder sie gelesen haben. Manche Menschen können so was.
«Ist eh scheißteuer da drin.» Ich war Emilia so dankbar für diesen Satz. Überhaupt war ich schon nach den ersten Stunden dankbar, dass Emilia mit in dieses Langeoog fuhr. Mehr noch. Ich war froh, sie kennengelernt zu haben.
Die Vorstellung, allein mit Mister Nasenring in dieses Langeoog zu fahren ..., ich wäre zurückgelaufen. Von der Raststätte, von der ich nicht mal wusste, wo sie lag.
Dieser Maurice kam auf uns zugelaufen. Eher auf Emilia, mich beachtete er nicht. Zum Glück nicht, bis Zehn zählen konnte ich auch alleine. In seinen Händen trug er zwei Pappbecher. Einen davon reichte er Emilia.
«Mit Milch und Zucker. Hoffe, ist okay.»
Ich konnte den herben Duft des Kaffees riechen. Der war bestimmt auch scheißteuer, wie Emilia es vorhin beschrieb. Schließlich kam der auch von Esso. Wie ich darauf kam? Ich erkannte es in Emilias Gesicht. Ihr war das unangenehm mit dem Kaffee. Sie schielte etwas hilflos zu mir rüber, ich hoffte, ihr mit einem Lächeln etwas Mut zu schenken. Das klappte aber nicht, weil sich so viel Mut, wie Emilia ihn in diesem Moment benötigte, nicht mit einem Lächeln schenken ließ. Das lag daran, dass dieser schnulzige Schnauzbart seinen Arm um ihre Hüfte legte und sie von mir wegschob. Die Frage, ob Emilia das wollte, sparte ich mir. Die Antwort las ich in ihrem Gesicht ab. Aber sie wehrte sich nicht gegen die Umarmung.
Joelina lag inzwischen im Gras, während die ersten Jugendlichen von der Tankstelle zurück zum Bus kamen. Bei dem Anblick der unzähligen Chipstüten und der Colaflaschen dachte ich an meinen Klassenlehrer, der oft betonte, dass arme Menschen sich ungesünder ernährten. Ja, ja.
Ich holte mein Käsebrot aus dem Rucksack, pellte es aus der Frischhaltefolie und stille damit meinen Appetit, während die anderen scheißteure Chips und Cola in sich hineinstopften.
Die Bustüren öffneten sich wieder.
«Wer bei zehn nicht im Bus ist, bleibt hier. Eins! Zwei! Drei!»
Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich tat das, was dieser Maurice verlangte. Ich stieg wieder in den Bus und setzte mich auf meinen Sitz im Unterdeck. Gleich neben der Tür. Aber nicht, weil er mir mit seinen Ansagen und sein Zählen Angst einflößte, ich war einfach völlig satt, wie es mein Vater immer ausdrückte, wenn ihn etwas nervte. Das kam nicht häufig vor, aber wenn, dann war er satt. Satt von der Arbeit, satt von Thomas, der so etwas wie sein Vorarbeiter war. Einmal war er sogar satt von meinen Hausaufgaben. Das verstand ich.
Auf dem Weg in den Bus erkannte ich Emilias Kaffeebecher im Mülleimer. Durch das Loch im Deckel, aus dem man trinken konnte, tropfte noch Kaffee heraus. Hatte sie den Kaffee heimlich weggeschmissen, weiß der von Esso und scheißteuer war?
Ich wünschte mir, dass Emilia sich im Bus neben mich setzte, aber dieser Ekeltyp mit dem Schnauzbart verfolgte sie auf Schritt und Tritt. Ihr blieb nichts anderes übrig, als vor ihm die Treppe zum Oberdeck hinaufzusteigen. Das sah aus, als schob er Emilia vor sich her. Dabei glotzte er außerdem auf ihren Hintern.
Mit jedem Meter, den der Bus auf der Autobahn zurücklegte, stieg das Kitzeln in meinem Bauch. Es war das gleiche Kitzeln, welches ich oft vor Klassenarbeiten oder Referaten spürte. Keine Ahnung, wann ich dieses Kitzeln zum ersten Mal spürte, ich konnte mich aber an die Klassenfahrt in der sechsten Klasse, die ich ja vorhin schon einmal erwähnte, erinnern. Da fuhren wir auch mit dem Bus. Und damals war es so, dass das Kitzeln zu einem Kneifen mutierte, je weiter wir uns von Berlin entfernten. Wir fuhren jetzt aber schon länger als damals, waren also auch schon weiter weg von Berlin, was mich etwas beruhigte, weil das Kitzeln trotzdem noch erträglich war. Ich schaute aus dem Fenster und erkannte auf einem blauen Schild mit weißer Schrift, dass Hamburg noch 80 km entfernt war.
Hamburg. Das war die Geburtsstadt meines Papas. Ich war noch nie dort und ich wusste, wie gerne mein Vater mal wieder nach Hamburg fahren wollte. Das ging aber nicht, weil dafür das Geld nicht reichte. Deshalb tröstete er sich mit Musik aus Hamburg. Seine Lieblingsbands waren Kettcar und Tocotronic.
Wir fuhren in jedem Fall Richtung Norden, denn mein Papa kam aus Hamburg und meine Mama erwähnte manchmal, dass er ein Nordlicht wäre. Im Süden sollte es sehr heiß sein, im Osten, in Polen, konnte man billig einkaufen. Im Westen lagen die alten Bundesländer, aber Hamburg zählte auch zu den alten Bundesländern, fiel mir ein. Also fuhren wir wahrscheinlich Richtung Nordwesten. Das überforderte mich etwas, was doof war, weil ich ja nur versuchte, mich vom Kribbeln in meinem Bauch abzulenken. Es gelang mir nicht. Zum ersten Mal spüre ich das Verlangen, aufs Klo zu gehen. Im Bus gab es zum Glück eine Toilette.
Ich stand auf, hatte aber Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zu halten. Zur Toilette war es nicht weit und doch war ich froh, dass mir niemand zusah, wie ich in die Richtung der schmalen, grauen Tür wankte.
Oma Franka litt unter heftiger Platzangst, weil sie früher, als Deutschland noch geteilt war, lange eingesperrt war und die Wärter im Gefängnis Sachen mit ihr gemacht haben, die meine Mama mir bis heute nicht erzählen wollte. Sie meinte immer, ich wäre noch zu jung. Das meinte sie selbst noch, als wir die DDR im Unterricht behandelten. Aber wie kam ich darauf? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass man auf der Toilette keine Platzangst haben durfte, weil die so eng war. Und das erinnerte mich halt an Oma Franka. Auch wenn eine Toilette im Reisebus kein Gefängnis in der DDR war. Natürlich nicht.
Ich setzte mich wieder auf meinen Platz und horchte in mich hinein. Das Kribbeln spürte ich noch ein bisschen. Ich schaute aus dem Fenster. Ich wollte mich ablenken. Und ich dachte wieder an meine Oma. Der Bus fuhr gerade an einem braunen Schild vorbei. Auf dem stand in weißer Schrift: Ehemalige innerdeutsche Grenze 1945 – 1989.
Ich war jetzt keine, die sich besonders für Geschichte interessierte, aber das fand ich schon spannend.
«Na, alles gut bei dir?» Erschrocken schaute ich in Richtung Gang und erkannte Emilia. Ohne dass sie etwas sagte, nahm ich meinen Rucksack vom Nachbarsitz und ohne dass ich etwas sagte, setzte sie sich neben mich. Das Kribbeln in meinem Bauch war für einen kurzen Moment ein Kneifen.
«Du hast es ja ruhig hier unten.» Ich bejahte stumm und lächelte.
«Mach dir nichts aus Maurice. Der ist wirklich nett.» Ich verneinte stumm. So stumm, dass ich nur in meinem Kopf NEIN schrie. Meine Birne selber schüttelte sich nicht mal im Ansatz. Ich wollte Emilia nicht verärgern. Oder noch schlimmer: Vergraulen. So sehr ich es genoss, bis eben hier unten allein gesessen zu haben, so sehr genoss ich jetzt Emilias Anwesenheit. Ich überlegte, was ich hätte sagen können, dann fiel mir die Situation mit dem Kaffee wieder ein, der scheißteuer war, und den Emilia heimlich weggeworfen hatte.
«Magst du keinen Kaffee?», fragte ich. Aber nur vorsichtig. Ich vermutete nämlich, dass Maurice wie der Kaffee war. Emilia nahm ihn zwar an, schüttelte ihn dann aber heimlich weg. Und zu Maurice war sie nett, obwohl sie ihn nicht leiden konnte. So waren ja viele Erwachsene. Obwohl, so war ich eigentlich auch und ich war noch nicht ganz erwachsen.
«Weil ich den heimlich weggeschmissen habe?» Jetzt nickte ich. «Maurice konnte ja nicht wissen, dass ich keine Milch mag.» Ich dachte an den warmen Kakao, den ich jeden Morgen trank, an Kartoffelbrei und Käse. Es war für mich unvorstellbar, dass jemand keine Milch mochte. Es sei denn, man vertrug keine Milch.
«Hast du diese Lactose Dings?» Emilia schnaubte leicht und grinste dabei.
«Nein, laktoseintolerant bin ich nicht. Obwohl, eigentlich sind alle Erwachsenen laktoseintolerant.»
«Wie meinst du das?»
«Der erwachsene Körper verträgt gar keine Milch. Er kann die Enzyme, die in der Milch sind, nicht abbauen.» Emilia musste an meinem Blick erkannt haben, dass mich ihre Worte überforderten. «Kannst du ein Geheimnis für dich behalten?» Wie ein Punchingball sprang mein Kopf auf und ab. «Ich ernähre mich vegan.» Meine Augenbrauen schossen reflexartig nach oben. Ich wusste, was das bedeutete. Aber was ich nicht wusste: Warum durfte ich das nicht weitererzählen? Da war doch nichts dabei. Und genau diese Frage stellte ich Emilia.
«Ich möchte mich nicht immer dafür rechtfertigen, dass ich keine tierischen Produkte esse. Das nervt. Total. Manche wollen mir erzählen, dass der Mensch Fleisch braucht, andere reagieren total aggressiv und meinen, ich will ihnen meinen Lebensstil aufdrängen. Darauf habe ich keine Lust mehr.»
Ob ich erzählen sollte, dass ich mich auch vegetarisch ernährte? Vielleicht war ich dann aber in Emilias Augen ein Monster. Obwohl sie den Nasenring mit dem Schnauzbart nett fand, und wenn sie den nett fand, hatte sie bestimmt auch Verständnis, dass ich nur Vegetarierin war.
«Ich finde das voll cool, dass du das machst. Ich würde das auch gerne machen. Ich schaffe es zwar, auf Fleisch und Wurst zu verzichten, aber auf Käse und Milch nicht. Und ich liebe heiße Schokolade.» Emilia lachte leise und legte ihren Arm um mich. «Und meine Eltern meinen, dass vegane Ernährung zu teuer wäre.»
«Das stimmt nicht. Sich vegan zu ernähren heißt vor allem, zu verzichten. Sich Tomatenscheiben oder Gurkenscheiben aufs Brot zu legen, ist ja nun nicht teurer als eine Scheibe Wurst.» Das fand ich interessant, weil es logisch klang.
Der Busfahrer bremste den Bus etwas ab. Ein Blick aus dem Fenster hatte mir verraten, dass wir jetzt Schleswig-Holstein verlassen hatten. Das irritierte mich. Schleswig-Holstein war doch das nördlichste Bundesland. Also müssten wir jetzt in Dänemark sein. Das war aber nicht möglich. Oder lag dieses Langeoog in einem anderen Land? Dann verstand ich gar nichts mehr. Hamburg begrüßt seine Gäste, stand auf einem weiteren Schild. Hä?
«Mit der Ruhe ist es hier unten gleich vorbei. In Hamburg steigt noch eine zweite Jugendgruppe in den Bus.» Das geographische Durcheinander und Emilias Botschaft ließen meine Laune etwas sinken. Aber nur für einen Moment, denn ich klebte meine Nase an die Fensterscheibe. Nachdem der Bus durch einen Kreisverkehr gefahren war, tuckerte er anschließend durch Hamburg. Und wenn ich mir Hamburg hätte vorher vorstellen müssen, hätte meine Vorstellung anders ausgesehen. Natürlich erkannte ich auch hier Häuser. Aber die meisten waren nicht grau und nicht besonders hoch. Viele Häuser waren rot und sahen viel älter aus als die großen Wohnblöcke in Marzahn. Dort gab es auch keine kleinen Läden, in Marzahn gab es nur Einkaufscenter. Das Plaza Marzahn, das Eastgate und wie die alle hießen. Einkaufscenter gab es in Hamburg bestimmt auch, aber die kleinen Läden in den Straßen ... so etwas kannte ich nicht.
Nur der Autoverkehr, der war viel schlimmer als in Marzahn. Immer wieder hielt der Bus, fuhr ein Stück, hielt wieder an, setzte ein weiteres Stück nach vorne, und dabei lernte ich viele Schimpfwörter in einer fremden Sprache kennen, die vom Fahrersitz kamen. Wobei, so viele waren es gar nicht. Vor allem blieb mir das Wort im Kopf, dass sich wie Krmak anhörte. Weil der Fahrer es andauernd wiederholte. Was nicht heißen soll, dass ich wusste, was es bedeutete.Ich hätte Emilia fragen können, aber sie sah auch nicht so aus, als würde sie wissen, was Krmak hieß. Aber da irrte ich mich, was ich erst Tage später erfahren sollte.
Wir überquerten eine Brücke und ich erkannte links und rechts kleine Schiffe, kurz darauf fuhren wir unter einer Brücke entlang, über welcher zeitgleich ein Güterzug donnerte. Minuten später hielt der Bus am ZOB. Das stand an dem Gebäude, das ich erkannte. Vor dem Bus standen Jugendliche mit ihren Koffern. Es waren weniger als in Berlin. Zum Glück, denn viel Platz war im Bus ja nicht mehr. Die vordere Tür des Busses öffnete sich, noch während der Motor lief. Ein schmächtiger Junge legte scheinbar viel Wert darauf, der Erste im Bus zu sein. Da kam er aber vier Stunden zu spät. Außerdem machte er die Rechnung ohne das fluchende Sakko mit der Cordhose.
«Magare, warum wartest du nicht?», schnauzte der Fahrer den Jungen in gebrochenem Deutsch an. Magare war irgendeine andere Sprache und das klang auch nicht gebrochen. Nicht gebrochen klang auch die Reaktion der Mutter des Jungen, die den Fahrer erst böse anstarrte und dann etwas sagte, was ebenfalls nicht freundlich klang. Ich hätte zu gerne gewusst, was sie gesagt hatte, denn die Reaktion des Fahrers war lustig. Er erhob sich von seinem Sitz und an seiner Gestik erkannte ich, dass er die Mutter um Verzeihung bat. Die Mutter wusste wohl, was Magare bedeutete. Sie sah dem Fahrer auch etwas ähnlich. Sie war zwar viel schlanker, aber der Hautton war ähnlich. Nur der Junge wirkte blass, als seine Mutter ihn in die vorderste Reihe setzte.
«Ich setze mich mal wieder oben auf meinen Platz. Bis nachher», flüsterte Emilia, stand auf und stieg die hintere Treppe hinauf. Ich hatte keine Erklärung dafür, aber in diesem Moment wuchs in mir das Gefühl von Einsamkeit. Die restliche Busfahrt würde ich von Menschen umgeben sein, die ich noch nie im Leben gesehen hatte. Ein komisches Gefühl. Komisch war es vor allem, weil ich, als ich in Berlin in den Bus stieg, auch niemanden kannte. Aber da hatte ich dieses Gefühl nicht. Da war nur die Sehnsucht nach meinen Eltern und das Wissen, diese Fahrt nicht antreten zu wollen.
Der Viererplatz vor mir, auf dem ich zuerst saß, war jetzt komplett besetzt. Der Viererplatz auf der linken Seite auch. Während der Junge mit dem übergroßen Basecap und die anderen drei mich aber so wenig beachteten wie einen Kaugummi, der an der Schuhsohle klebte, schauten die Mädchen auf der anderen Seite ständig zu mir rüber und gaben mir das Gefühl, ein Clown zu sein. Sie zeigten mit ihren lackierten Fingernägeln auf mich und kicherten. Ich vermied ihren Blick und schaute lieber aus dem Fenster. Neben dem Bus sah ich einen Jungen, der aussah wie ein abgemagerter Riese mit Sehschwäche.
Er hielt ein Buch in der Hand und schaute den Bus an, als würde ein Monster vor ihm stehen. Und er wirkte wie ein Eisblock. Ich schaute wieder nach vorne, ohne die kichernde Mädchengruppe anzuschauen, und im nächsten Moment war ich auch ein Eisblock. Neben mir befand sich noch der einzige freie Sitzplatz im Bus. Wenn dieser Spargeltarzan mit vier Augen tatsächlich mitfahren sollte, wonach es glücklicherweise noch nicht aussah, hätte der neben mir sitzen müssen. Der Motor lief übrigens noch immer, wodurch auch die Drehzahl meiner Hoffnung zunahm, dass der Busfahrer endlich einstieg und die Türen schloss. Von wegen. Er stapfte auf den Jungen zu und fragte ihn nach seinem Gepäck. Mit nur einem Wort.
«Gepäck?» Aber diesmal war der Fahrer freundlich. Die Standpauke der Mutter, die noch immer neben ihrem Sohn in der ersten Reihe stand, schien geholfen zu haben. Der Busfahrer sah der abgemagerten Brillenschlange dabei zu, wie die ihren Rollkoffer auf die andere Seite des Busses zog. Dann knallten die Gepäckfächer zu.
Ich kramte meine Trinkflasche aus dem Rucksack und stellte diesen wieder auf den Platz neben mich. Der Riese flüsterte dem Fahrer etwas zu, der nickte und schaltete den Motor ab. Dann stieg er tatsächlich ein. Mist. Die Vorstellung, die Fahrt über neben dem sitzen zu müssen, stellte ich mir nicht prickelnd vor. Er stand vorne im Gang, dann marschierte er los. Er rannte fast, dann schaute ich ihm hinterher, wie er durch die Hintertür wieder ausstieg. Also, mir war es recht. Auch der Busfahrer stieg nochmal aus.
«Alles voll», hörte ich den Jungen sagen. Vor der Abfahrt in Berlin erging es mir wie ihm, aber mir blieb wenigstens das Unterdeck. Ich wusste also, wie er sich fühlte. Deswegen spielte ich mit dem Gedanken, meinen Rucksack vom Sitz zu nehmen. Aber noch bevor ich meine Gedanken beenden konnte, stand der Riese mit seinen Glubschen vor mir.
«Guten Tag. Mein Name ist Merten Schulz und ich möchte mich da hinsetzen. Bitte.» Meine Augen fielen jeden Moment raus. Ich schluckte und fragte mich, was mit dem Typen nicht stimmte. Die Mädchen, von denen ich mich die ganze Zeit beobachtet fühlte, kicherten jetzt nicht mehr. Zwei von ihnen lagen lachend übereinander.
Mein Blick sollte dem Riesen mit der Sehschwäche klarmachen, dass ich nicht neben ihm sitzen wollte. Aber das hätte ich niemals gesagt, so gemein war ich nicht.
Der Bus hatte die Geburtsstadt meines Vaters wieder verlassen und die Autobahnschilder hatten mir verraten, dass wir jetzt Richtung Bremen unterwegs waren. Ich stierte ausschließlich aus dem Fenster, denn den abgemagerten Riesen mit den vier Guckern neben mir wollte ich nicht anschauen. Und dem ging es nicht anders. Sonst hätte der nicht die ganze Zeit in sein komisches Buch geschaut und im Sekundentakt die Seiten umgeblättert. So schnell konnte niemand lesen. Und überhaupt, der sah aus, als wollte er seinen Kopf im Buch verschwinden lassen. Das war das erste Mal, dass mich jemand ärgerte, ohne dass er etwas sagte. Der tat nichts, außer in seinem Buch zu blättern. Was war das überhaupt für ein Buch? Nachdem er die nächste Seite umblätterte, las ich ein paar Zeilen mit. Und ich erschrak. Wie krank war das bitte? Ich meine, jeder hat einen anderen Geschmack, das predigten meine Eltern jeden Tag, aber das, was dieser Merten Schulz vor sein Gesicht hielt, las kein anderer Jugendlicher. Nicht freiwillig. Ich las, wie Krabat seinen Körper verließ und die Kantorka aus der Nähe sah. Dann blätterte der Typ weiter. Der las wirklich Krabat. Ich erinnerte mich daran, wie ich mich in der sechsten Klasse durch diesen Wälzer kämpfen musste. Ich musste ein Leseprotokoll führen, Figuren aus dem Buch vorstellen, Steckbriefe schreiben und Tagebucheinträge verfassen, die die Figuren aus dem Buch geschrieben haben sollten. Und am Ende bekam ich für meine Mühen eine Zwei mit einem Minus. Das war der Dank, dass ich mich durch das langweiligste Buch kämpfen musste, was es auf der Welt gab. Okay, ich las generell nicht viel, aber Krabat war furchtbar. Vor allem, als sich der eine Typ umgebracht hat. Und jetzt saß Merten Schulz neben mir und las diesen langweiligen Schinken. Ich schüttelte mich innerlich. Dann dämmerte es mir. Merten hieß doch auch dieser gutmütige Typ aus dem Buch. Das war einer dieser Mühlknappen. Vielleicht hieß der Typ neben mir gar nicht Merten. Vielleicht nannte der sich nur so, weil er die Rolle in dem Buch cool fand. Bei dem hätte mich das nicht gewundert.
Der Bus quetschte sich durch die nächste Baustelle, hinter uns hupte jemand und ich nahm mir vor, Merten Schulz anzusprechen. Wenn der wirklich so hieß. Ich hielt das nämlich nicht länger aus. Ich konnte nicht die ganze Zeit aus dem Fenster starren und vor mich hin schweigen. Der dünne Riese stand plötzlich auf und ging Richtung Toilette. Mit seinem Buch.
«Wie eklig, guckt mal. Der macht nicht mal die Tür zu», ertönte es vom Vierersitz der kichernden Mädchen. Eine von ihnen stand auf und lief zum WC.
«Ich mach hier mal zu.»
«Nein, bitte nicht. Ich bin doch gleich fertig.»
«Aber niemand möchte hören oder sehen, was du da drin machst.»
«Bitte, lassen Sie die Tür offen. Bitte!» Die Frau musste zum Betreuerteam gehören, denn auch sie hatte, wie Emilia, ein Handy in der Hand. Aber sie war nicht so hübsch wie Emilia. Sie war dicker, ihre Haare waren kürzer als meine und hatten die Farbe von Herbstlaub. Ihre Klamotten hatten den gleichen Farbton. Beides erinnerte mich an diesen superteuren Ökostyle, aber dieser Style passte nicht zu der Frau, die jetzt daran schuld war, dass der Riese auf der Toilette schrie. Es war ein Angstschrei. Das hörte ich deutlich. Ich drehte meinen Kopf in Richtung Toilette. Und ich dachte wieder an Oma Franka, an ihre Platzangst, und Merten Schulz tat mir plötzlich leid. Die Frau setzte sich wieder zu den Mädchen, die noch immer lachend auf ihren Sitzen lagen. Aus dem WC-Raum knallte es und die Tür öffnete sich. Was auch nicht schwer war, denn auf dem WC war so wenig Platz, man konnte die Tür locker wieder öffnen, während man sein Geschäft verrichtete. Ich warf einen flüchtigen Blick zum Fahrer, aber er ließ sich von dem Krach nicht stören.
«Der hat die Tür wieder aufgemacht», petzte ein Mädchen und zeigte Richtung WC. Mir fiel die Oberweite des Mädchens auf. Weil sie dreimal größer als meine war. Ihr kleines Gesicht passte überhaupt nicht zu ihrem fulminanten Busen. Daran konnten auch die drei Kilogramm Make-up nichts ändern. Ihr Gesicht sah aus wie von einer Zwölfjährigen, aber die Größe ihrer Oberweite ließ mich an meine Mutter denken. Und an Klara.
Sie meinte einmal, als wir uns bei ihr trafen, dass wir viel Käse essen müssten, dann würden unsere Brüste schneller wachsen. Na ja, ich mochte Käse, aber meine Mutter lehrte mich früh, dass ich niemals auf Äußerlichkeiten Wert legen sollte. Nicht bei mir, nicht bei anderen. Deshalb aß ich zwar weiter Käse, aber nicht, um meine Brüste wachsen zu lassen. Außerdem hatte ich keine Lust, solch einen Atombusen vor mich herschieben zu müssen. Das sah doch krass aus und war bestimmt unangenehm. Und dann erst die Jungs, die sich darüber lustig machten.
Merten kam zurück. Er stand vor unserer Sitzreihe, konnte sich aber kaum auf den Beinen halten. Seine Knie zitterten. Dann fletschte er die Zähne, knurrte in Richtung der vier Sitze und platzierte sich wieder neben mich. Und auch wenn dieses Knurren an einen zu großgewachsenen Rottweiler erinnerte, wuchs meine Sympathie für Merten von Minute zu Minute. Daran änderte auch das Gegacker der Mädchen nichts.
Ich konnte jetzt verstehen, warum er sich ärgerte (auch wenn er es auf eine komische Art zeigte) und ich lernte von meinen Eltern, dass man sich nicht über andere Menschen lustig macht.
Der Bus verließ die Autobahn und steuerte einen Rasthof an. Immerhin bekam ich diesmal mit, dass wir eine Pause einlegten. Der Fahrer musste mich also nicht wieder anschreien. Die Türen gaben ein zssschhhh von sich und von oben stiegen die ersten Jugendlichen die Treppen hinunter. Ich schnappte mir meinen Rucksack und stieg ebenfalls aus. Die Luft, hier auf dem Rasthof, an der Autobahn, roch ganz anders als in Berlin. Sie fühlte sich leichter an, sie kribbelte in der Nase und ich streckte mein Gesicht genüsslich in Richtung Sonne.
«Na, alles gut bei dir?»
Ich schmunzelte Emilia entgegen. Ich schmunzelte, weil die Luft und die Sonne bei mir für gute Laune sorgten. Trotz der Nähe zur Autobahn. Das musste man sich mal vorstellen. Selbst an der Autobahn, irgendwo im Nordwesten von Deutschland, war die Luft besser als in Marzahn. Und ich musste mir eingestehen, dass es allein diese Tatsache war, die die Reise bis hierhin lohnenswert machte. Danke Mama, danke Papa.
Joelina stand neben Emilia und lächelte mich an. Ich lächelte zurück. Sie stank überhaupt nicht nach Scheiße, wie viele in der Schule behaupteten. Sie roch nach Pfefferminztee. Wieder standen wir ziemlich allein auf dem Rasthof, weil die meisten anderen zu Mc Donalds gingen, um sich etwas zu Essen zu holen.
Ich hatte auch Hunger, meine Käsebrote waren aufgegessen, aber deswegen zu Mc.Donalds gehen? Da gab es doch nur Sachen mit Fleisch. Und Fleisch aß ich nicht. Meine Eltern erzählten mir mal, wie ungesund das Essen bei Mc Donalds sei und sich Leute mit wenig Geld einen Besuch dort sowieso nicht leisten konnten. Ich dachte an meine letzte Pause zurück, an die Chips und an die Coladosen der anderen. Und ich war mir sicher, es stimmte nicht, dass sich Menschen mit wenig Geld ungesünder ernährten. Zumindest bekam ich das hier nicht mit.
Die Mädchengruppe kam zurück. Alle trugen eine hellbraune Papiertüte in der Hand und stiegen wieder in den Bus. Ein Mädchen mit dunkelblonden langen Haaren stopfte sich noch draußen einen Burger in den Mund. Die Soße, die an ihren Mundwinkeln herunter lief, hatte die gleiche Farbe wie ihr Wangen-Rouge.
Mit Fremden sollte man nicht sprechen, und das Mädchen neben mir kannte ich nicht, also war sie eine Fremde. Dann fiel mir aber ein, dass sie wusste, dass ich Merten Schulz heiße. Für sie war ich also kein Fremder mehr. Vielleicht stellte sie mir deshalb drei Fragen. Und ich nahm mir vor, mutig jede Frage zu beantworten.
Sie: «Heißt du wirklich Merten?»
Ich: «Ja.»
Sie: «Kommst du aus Hamburg?»
Ich: «Ja.»
Sie: «Und wo wohnst du in Hamburg?»
Ich: «Milchstrasse.»
Sie: «Cool, und ich wohne auf dem Mars.» Sie lachte. Wahrscheinlich, weil sie selber wusste, dass das gelogen war. Ich sagte aber, dass ich nicht gelogen hatte. Ich wohnte wirklich in der Milchstraße, in Harvteshude. Aber die Hausnummer durfte ich nicht verraten, weil mein Vater Angst hatte, überfallen zu werden. Wir waren nämlich sehr reich.
Die Landschaft hatte sich verändert. Klar, die Autobahn hörte irgendwann einfach auf, jetzt erkannte ich links und rechts gelbe Sonnen- und rote Mohnblumenfelder, grüne Wiesen, dazu Kühe und Pferde auf den Weiden. Der Bus durchfuhr einige kleine Ortschaften, bis wir nicht weiter konnten, weil vor uns eine Autoschlange wartete. Ich zählte 23 Autos, danach erkannte ich nichts mehr, weil die Straße einen Knick machte. Der Busfahrer schrie etwas, was ich nicht verstand, und die Mädchen auf den Viererplätzen kicherten. Aber die kicherten schon seit der letzten Pause. Abgesehen von der dicken Betreuerin mit den kurzen Haaren, die tippte auf ihrem Smartphone herum.
Der Bus kam Meter für Meter voran, mal war es ein halber Meter, aber auch mal fünf. Die Mädchen auf dem Vierersitz schauten manchmal zu mir, dann kicherten sie umso lauter. Deshalb schlug ich wieder mein Buch auf und schaute hinein. Hauptsache, ich musste nicht sehen, wie mich andere Menschen anschauten.
«Ich habe Krabat gelesen, da war ich in der sechsten Klasse», sprach das Mädchen neben mir. Ich reagierte nicht. Das musste ich auch nicht, weil das Mädchen keine Frage stellte. Außerdem wollte ich nicht über das Buch sprechen, weil ich nicht ausgelacht werden wollte. Ich wusste, was in dem Buch passierte, weil ich das Hörbuch oft hörte. Aber ich konnte nicht lesen. Aber das durfte niemand wissen.
Der Bus fuhr wieder ein Stück nach vorne. Ich erkannte jetzt den blauen Himmel, der vorher noch von Bäumen verdeckt war. Der Himmel hatte ein so helles Blau, so ein hellblau hatte ich noch nie am Himmel gesehen.
«Wo bist du gerade in dem Buch?» Ich atmete schneller und spürte, wie immer mehr Schweißtropfen meinen Rücken hinunter rannen. Diesmal stellte sie mir eine Frage. Und auf Fragen musste man antworten. Aber niemals mit einer Gegenfrage, das wäre unhöflich gewesen.
«Ich, ... also, als Lobosch seine Arbeit an der Mühle begann. Da bin ich gerade.»
«Ach, Lobosch, ich erinnere mich. Das ist doch der, dem Krabat half, weil er sonst die Arbeit an der schwarzen Mühle nicht geschafft hätte. Dann bist du ja auch bald an der Stelle, als dieser Merten sich erhängen wollte. «Fand die Stelle voll krass! » Ich sprang auf und saß eine Minute später auf dem geschlossenen Klodeckel. Die Tür ließ ich offen. Ich versuchte, wieder ruhiger zu atmen. Ich wusste, was mit dem Merten aus dem Buch passierte. Und ich wusste auch, dass der Tod etwas Schlimmes war. Wieder tauchte die dicke Frau in der Klotür auf.
Sie: «Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du die Tür zu machen sollst, wenn du dein Geschäft verrichtest?»
Ich: «Ich verrichte nicht mein Geschäft.»
Der Bus fuhr jetzt wieder schneller, dann bremste er scharf. Die Frau knallte gegen die offene Tür des WCs und ich hörte die Mädchen lauter lachen. Dann hörte ich, wie sich die Bustüren öffneten.
«Darüber reden wir noch», sprach die dicke Frau und verschwand wieder aus meinem Sichtfeld.
Ich verließ jetzt den winzigen Raum und stieg aus dem Bus. Vor mir sah ich viele Menschen. Sie strömten in das hellbraune Gebäude, das aussah, als wäre es aus Holz. Neben mir hupte jemand und rief, dass der Bus weiterfahren soll. Er stehe hier im Weg. Der Busfahrer antwortete: «Magare, ich muss hier Kinder ausladen.» Das stimmte nicht, der Busfahrer musste keine Kinder ausladen.
Die Kinder stiegen selbst aus und das Gepäck holten sie ebenfalls selbst aus den Gepäckfächern. In dem Moment fiel mir auch mein schwarzer Koffer ein. Zügig begab ich mich zu den Gepäckfächern, sah meinen Koffer und dann rief jemand, drängeln sei verboten. Aber ich drängelte nicht. Ich wollte nur meine Sachen holen. Ich zog meinen Koffer aus dem Fach und stellte mich etwas abseits der anderen Leute. Hier konnte ich alles besser beobachten und hatte etwas Ruhe. Ich schlug mein Buch mit dem hellblauen Umschlag auf. Wieder schrie jemand, dass der Reisebus im Weg stehe. Der Busfahrer sah jetzt aus, als würde er jeden Moment anfangen zu weinen. Dann schrie er wieder etwas, was ich nicht verstand.