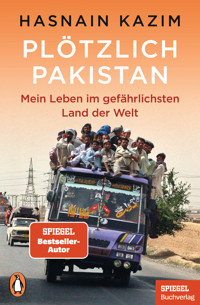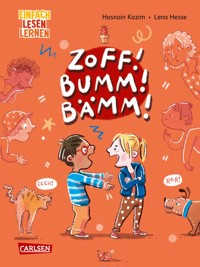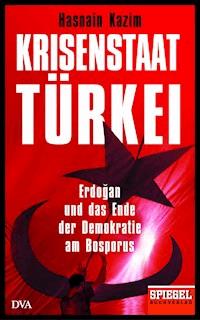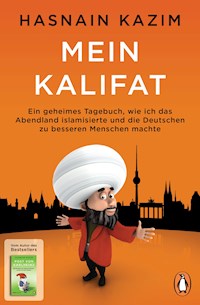
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Endlich da: die Islamisierung des Abendlands!
Hasnain Kazim ist nicht nur Journalist und Bestsellerautor, vor einigen Jahren hat er sich auch eine zweite Identität zugelegt – als Kalif. Das war seine nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf die permanenten Ängste von Menschen vor einer »Islamisierung des Abendlandes« und auf Dauervorwürfe von Rechtsextremisten, er sei in Wahrheit ein »Islamist«, der »Deutschland islamisieren« wolle. Doch schnell stellte Hasnain Kazim fest, dass sich seine Kalifatspläne verselbständigten: In den sozialen Medien und bei Lesungen huldigten Fans ihrem weisen Kalifen, sie wollten Wesir oder Mitglied des Harems werden. Viele fragten sehnsüchtig, wann denn nun das Kalifat ausgerufen werde. Die gute Nachricht: Es ist endlich soweit! Und die noch bessere Nachricht: Der Kalif hat dabei ein geheimes Tagebuch geführt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Autor
HASNAIN KAZIM ist gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er wuchs im Alten Land, vor den Toren Hamburgs, und in Karatschi in Pakistan auf, studierte Politikwissenschaften und schlug eine Laufbahn als Marineoffizier ein. Er liebt Grünkohl und Curry, aber nicht zusammen. Das journalistische Handwerk lernte er im Schwäbischen, bei der »Heilbronner Stimme«, schrieb unter anderem für das dpa-Südasienbüro in Delhi und von 2004 bis 2019 für den SPIEGEL und SPIEGEL ONLINE, die meiste Zeit davon als Auslandskorrespondent in Islamabad, Istanbul und Wien. Für seine Arbeit wurde er mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter dem »CNN Journalist Award«. Er lebt als freier Autor nach wie vor in der österreichischen Hauptstadt und hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem »Grünkohl und Curry«, »Plötzlich Pakistan« und »Krisenstaat Türkei«. Das Taschenbuch »Post von Karlheinz« (2018), das seine Dialoge mit wütenden Lesern versammelt, stand viele Wochen auf der Bestsellerliste. »Auf sie mit Gebrüll!« (2020), eine Anleitung zum richtigen Streiten, wurde ebenfalls direkt nach Erscheinen ein Bestseller.
Zum Buch
Hasnain Kazim ist nicht nur Journalist und Bestsellerautor, vor einigen Jahren hat er sich auch eine zweite Identität zugelegt – als Kalif. Das war seine nicht ganz ernst gemeinte Antwort auf die permanenten Ängste von Menschen vor einer »Islamisierung des Abendlands«, und auf Dauervorwürfe von Rechtsextremisten, er sei in Wahrheit ein »Islamist«, der »Deutschland islamieren« wolle. Doch schnell stellte Hasnain Kazim fest, dass sich seine Kalifatspläne verselbständigten: In den sozialen Medien und bei Lesungen huldigten Fans ihrem Kalifen, sie wollten Wesir oder Mitglied seines Harems werden. Viele fragten sehnsüchtig, wann endlich das Kalifat ausgerufen werde. Die gute Nachricht: Es ist endlich so weit! Und die noch bessere Nachricht: Der Kalif hat dabei ein geheimes Tagebuch geführt …
HASNAIN KAZIM
MEIN KALIFAT
Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Grafiken: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlaggestaltung und Umschlagmotiv: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27584-6V001
www.penguin-verlag.de
Für Janna und Seth
Apologie
Zuvoran vermahnet dies Büchlein alle, die es lesen und verstehen wollen, dass sie nit sich selbst mit vorschnellem Urteil übereilen, da es in etlichen Worten untüchtig erscheint und aus der Weise gewöhnlicher Prediger und Lehrer. Ja! es schwebt nit oben wie Schaum auf dem Wasser, sondern es ist aus dem Grund der Elbe von einem wahrhaftigen Altländer erlesen, welches Namen Gott weiß.1 Dies ist ein fiktives Werk – auch wenn darin viele echte Zitate vorkommen, die, man mag es bisweilen kaum glauben, echte Menschen so gesagt haben. Die Orte, an denen sich die Geschichte abspielt, sind zwar nicht erfunden, jedenfalls die meisten nicht, sehr wohl aber sämtliche Handlungen und Figuren. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen und Personen sind nicht beabsichtigt und reiner Zufall. Wo immer Daten, Fakten, Tatsachen in den Kram passten, habe ich sie verwendet. Dort, wo das nicht der Fall war, habe ich sie reinen Gewissens zurechtgebogen. Manch ein Mensch wird nun sagen (und es wird als Vorwurf gemeint sein): »War ja klar, dass er uns in seinem Sachbuch Erfundenes unterjubelt!« Umgekehrt ist es richtig: Ich habe Fiktion mit Sachbuchelementen ausgeschmückt.
Gerade deshalb ist dies kleine Buch eines, das jedermann lesen müsste, ob hochgestellt oder niedrig, weise oder einfältig, gelehrt oder ununterrichtet, denn es wendet sich an jedermann; und dies ist ein Buch, das jedermann nicht bloß lesen, sondern sorgfältig studieren, innerlich nacherleben, am besten Wort für Wort auswendig lernen sollte. Denn es ist eines der schönsten Denkmäler menschlicher Höhen und Tiefen, Größe und Demut.
1 Danke, Luther!!!!!!!
»… die Lüge spannt frech ihre Flügel und die Wahrheit ist vogelfrei; die Kloaken stehen offen und die Menschen atmen ihren Stank ein wie einen Wohlgeruch.«
(Stefan Zweig, im Briefwechsel mit Thomas Mann, 18. April 1933)
»Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.«
(Erich Kästner)
»Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt.«
(Charlie Chaplin)
»Für ein Kalifat, in dem wir gut und gerne leben.«
(Angela Merkel)
Kalifatische Losungen2
Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Inschallah, Maschallah, Alhamdulillah.
Grünkohl und Curry und Punschkrapfen.
2 Gemeint ist: Losung, die, Substantiv, feminin, Leitwort, Parole, Wahlspruch, nach dem jemand sich richten will. Nicht gemeint ist: Losung, die, Substantiv, feminin, Kot vom Wild und vom Hund (Jägersprache).
Ich bin …
… dein Kalif. Ich bin der Kalif der Kalifen. Ich bin unfehlbar und habe immer Recht. Alles, was in diesem Buch steht, ist des Kalifen Wort und hat Rechtskraft. Dieses Buch ist Gesetzestext und Geschichtsbuch, Predigt und Erzählung, Dichtung und gute Nachricht, Ratgeber und Handlungsanleitung, Notizensammlung und Tagebuch. Und ein kleines bisschen Rezeptsammlung. Es ist, vor allem, nichts als die reine Wahrheit.3 Und die reine Wahrheit ist: Du sollst mir gehorchen, mich loben und preisen und mir huldigen, dann wirst du es gut haben. Mein Kalifat soll dir Heimat sein.4 Mein Wille geschehe.
3 Die Wahrheit in einer aufgeklärten Welt ist aber auch: Nimm keine Schrift für bare Münze, auch keine heilige. Interpretiere sie. Ordne sie in die Zeit ein, in der sie verfasst wurde. Schriften, die vor langer Zeit verfasst wurden, bedürfen ständiger Anpassung an die Entwicklung der Gesellschaft. Bedenke also, wer was wann wie und warum gesagt oder geschrieben hat. Von mir aus glaube, aber benutze auf jeden Fall auch deinen Verstand. Dann wird alles gut.
4 Heimat, die, (kein Plural), aus der Brockhaus Enzyklopädie: »Begriff, der die Vorstellung einer teils imaginativ erschlossenen, teils real angebbaren Landschaft oder eines Ortes bezeichnet, zu denen (…) eine unmittelbare (…) Vertrautheit besteht. Diese Erfahrung ist (…) im Ablauf der Generationen durch die Familie und andere Sozialisationsinstanzen oder auch durch politische Programme weitergegeben. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Heimat zunächst auf den Ort (auch als Landschaft verstanden) bezogen, in den der Mensch hineingeboren wird, wo er die frühen Sozialisationserlebnisse hat, die weithin Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und schließlich auch Weltauffassungen prägen. (…) Der Nationalsozialismus stellte (…) insbesondere das rückwärtsgewandte Moment von Heimat heraus. So bezeichnete der Bezug auf eine jeweils besonders und affektiv ausgelegte Heimat zunächst den Rückzugsraum für v. a. jene sozialen Gruppen, die (…) ein umfassendes, gefühlsmächtiges und möglichst einfaches Orientierungsmuster suchten.« Zitiert nach: Nora Krug: Heimat. Ein deutsches Familienalbum, München 2018.
Tagebucheintrag des Kalifen
[undatiert, verfasst wahrscheinlich im Jahr 1980 oder 1981]
Libes Tagebuch, ich habe angst for eine Monsta das in unsere holtstrue wont. Di true stet in Unseren flur und imer wen ich fon mein Zimer zu toilete mus mus ich an der true forbai. Deshalb gehe ich in der Nacht ni zua Toilete sondan wate bis morgents das ich pinkeln kan. Meine Mama und mein papa sagen da ist kein Monsta aba ich glaube inen nicht.
Tagebucheintrag des Kalifen
[undatiert, dem Inhalt nach wahrscheinlich verfasst Ende 1983]
Liebes Tagebuch, mein 9. Geburtstag war sehr schön. Es waren sehr viele Freunde da. Wir haben Kuchen gegessen. Mama hat einen Schokoladenkuchen gebacken. Den, den ich sehr gerne mag. Stefan hat mir eine Knallpistole geschenkt, wo man rote Ringe reintut und es so schön knallt und riecht, wenn man schießt. So eine habe ich mir lange gewünscht. Früher hätte ich die benutzt, um nachts zur Toilette zu gehen. Ich dachte immer, es wohnt ein Monster in unserer Holztruhe. Das kommt dann heraus, zieht mich in die Truhe, und ich bin verschwunden. Ich finde es immer noch unheimlich, nachts über den Flur zu gehen, aber natürlich weiß ich, daß es keine Monster gibt. Hätte dort bloß in echt ein Monster gewohnt! Dann hätte ich nicht umsonst so viele Jahre lang mit dem Pinkeln gewartet (und mir manchmal in die Hose gemacht)! Dann hätte meine Angst wenigstens Sinn gemacht!
Wie alles anfing – die Legende
Der Mann mit dem langen Bart und dem grotesk bunten Kaftan steht auf dem Theaterplatz, vor der Semperoper, und tippt auf sein Tablet.
»Ich bin dein Kalif. Du sollst keine anderen Kalifen haben neben mir«, schreibt er. Er lächelt vor sich hin. Die Leute werden jetzt bestimmt vermuten, der Kazim sei völlig durchgeknallt, denkt er. Für wen hält sich der eigentlich?! Aber, denkt er weiter, die Leute sind doof. Natürlich nicht Sie, verehrte Leserinnen und Leser, denn Sie erinnern sich ja noch ganz genau an Ihren Deutschunterricht, wo Ihnen eingebläut wurde: Der Autor ist nicht der Erzähler! Sollten Sie das vergessen haben, hier noch einmal extra für Sie: Der Autor ist nicht der Erzähler!
Hoffentlich lassen mich die Leute bloß mit diesem Autor Kazim in Ruhe, denkt der Kalif weiter, denn der ist ja wirklich nicht mehr ganz dicht: Glaubt, er habe mich, den Kalifen, »erfunden«. Redet ständig von »meiner Figur«. Idiot.
Der Kalif schüttelt kaum merklich den Kopf, er seufzt, dann konzentriert er sich wieder auf sein Tablet, die Steintafel der Neuzeit. Also von vorne: »Ich bin dein Kalif. Du sollst keine anderen Kalifen haben neben mir«, murmelt er. Jetzt schreibt er weiter: »Ich bin der Stellvertreter …« Er wischt das Schreibprogramm weg und klickt auf die Wikipedia-App. Er tippt »Papst« ein. Es dauert eine ewige Minute, bis der Eintrag angezeigt wird. »Deutschland und das mobile Internet!«, grummelt er und schüttelt wieder den Kopf. Er scrollt nach unten. Er liest, dass die Titel des Papstes nach dem Annuario Pontificio, dem Jahrbuch des Heiligen Stuhls, die folgenden sind: Episcopus Romanus, Bischof von Rom, außerdem Vicarius Iesu Christi, Stellvertreter Jesu Christi. Ein weiteres halbes Dutzend Titel überfliegt er nur, scrollt zurück und entdeckt, dass der Papst auch Pontifex Maximus genannt wird. Das, steht dort, sei Lateinisch und bedeute: oberster Brückenbauer.
»Exkrementa!«, denkt der Kalif. »Ich dachte immer, der Papst sei der Stellvertreter Gottes auf Erden. Aber nur Stellvertreter von dessen Sohn?«
Er löscht den angefangenen Satz »Ich bin der Stellvertreter« wieder und denkt sich: Allah sei gepriesen, früher hätte ich Stunden damit verbracht, das mit einem Hämmerchen aus der Steinplatte zu dengeln!5 Da sind ein paar Minuten Warterei durch das langsame mobile Internet doch besser! Er schreibt: »Du sollst mich Kalifex Maximus nennen.«
Er vertippt sich mehrmals, trotz seiner filigranen Finger, die flink, aber präzise über das Tablet fliegen. »Beschissene Touchscreentastatur!«, murmelt er. Er öffnet eine neue Seite, klickt auf die Diktierfunktion und spricht:
»Und es ging hin ein Mann und traf eine Frau. Und sie ward unehelich schwanger und gebar einen Sohn. Damals sagte man in einem solchen Fall noch: Oh Schande, oh Schmach! Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie es drei Monate. Als sie es aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie einen Amazon-Karton und kleidete ihn mit Luftpolsterfolie und Klebeband aus und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer der Elbe.
Und die Tochter des Ministerpräsidenten ging hinab und wollte baden in der Elbe, und ihre Gespielinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach: Es ist eins von den Wessi-Kindern. Da sprach die Magd: Soll ich hingehen und eine der Wessi-Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Ministerpräsidenten sprach zu ihr: Geh hin. Die Magd ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Ministerpräsidenten zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir; ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es.
Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Ministerpräsidenten, und es ward ihr Sohn, und sie nannte ihn Kasimir, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen.6 Und Kasimir wurde Kalif. Und Dresden wurde seine Heilige Residenzstadt.«7
Das Diktierprogramm hat aus »Wessi-Kindern« »West-Inder« gemacht. Der Kalif korrigiert es. Er sieht, was er geschrieben hat, und siehe, es ist sehr gut. Dann klickt er auf »Speichern unter« und tippt den Dateinamen ein: »Mein Kalifat. Eine Heilige Schrift«.
5 Dem Kalifen ist bewusst, dass »dengeln« laut Duden bedeutet: »(die Schneide der Sense o. Ä.) durch Hämmern glätten und schärfen«, aber er findet, dass es ab sofort im kalifatischen Sprachgebrauch auch bedeuten soll: »etwas mit einem Hämmerchen bearbeiten«.
6 Wissenschaftler vermuten, dass das in einer längst untergegangenen sächsischen Sprache »Der aus dem Wasser Gezogene« bedeutet.
7 Verfasser religiöser Texte haben die bemerkenswerte Angewohnheit, Stellen, die unglaublich spannend sind oder einer Menge Erklärungen bedürfen, einfach auf einen Satz zu reduzieren. So möchte man zum Beispiel gerne mehr über die Auferstehung Jesu Christi erfahren. Der Evangelist Markus schreibt aber nur: »Er ist auferstanden, er ist nicht hier.« Aha. Reicht. Sollen die Leute halt glauben, wir sind hier ja bei der Religion, nicht in der Wissenschaft! Wie Kasimir also Kalif wurde, sei eurer frommen Fantasie überlassen.
Wie alles anfing – die Wahrheit
Jede Geschichte hat zwei Seiten, selbst heilige Geschichten.
Das Kalifat ist ein ehrliches Kalifat, der Kalif möchte eine offene, transparente, tolerante, liberale, demokratische Gesellschaft. Das vorherige Kapitel ist für die Frommen. Damit im Kalifat aber kein Streit entsteht zwischen der »So steht es aber in der Heiligen Schrift!«-Fraktion und der »Nur die Gesetze der Wissenschaft zählen!«-Truppe, hier die Geschichte für die Letzteren: die ungeschminkte, wissenschaftlich korrekte Wahrheit über die Entstehung des Kalifats. Fakten, Fakten, Fakten!
Ein junger, gut aussehender Mann sitzt im Eurocity von Berlin nach Prag. Er will nach Hause, nach Wien. In Prag hat er eine gute Stunde Aufenthalt, genug Zeit, um dort Vepřo-knedlo-zelo zu essen, Schweinebraten, Knödel, Sauerkraut.
Berlin hat ihn erschöpft. Dabei ist nicht einmal etwas passiert. Er war nur einen Tag da, zu einer Lesung. Rein, lesen, eine Nacht im Hotel, raus. Der Busfahrer hat ihn angepampt, weil er das Busticket vom Hotel zum Bahnhof mit einem Fünfzig-Euro-Schein bezahlen wollte. »Größer hamses nich, wa?!« Der junge Mann ist ein höflicher Mensch, er kramt in seinem Portemonnaie herum und sucht nach passendem Kleingeld. Der Busfahrer sagt: »Also, wir ham nich ewich Zeit!«, und noch während der junge Mann in seiner Geldbörse wühlt, drückt der Busfahrer aufs Gaspedal. Der junge Mann fliegt ruckartig nach hinten und stößt sich den Kopf an einer Haltestange. Sein Portemonnaie wird ihm aus der Hand geschleudert, die Münzen verteilen sich im Bus. Er sammelt die Geldstücke ein, die er auf die Schnelle finden kann, reibt sich die schmerzende Stelle an der Stirn und sucht sich einen freien Platz.
Berlin verlangt einem echt viel ab, denkt er, während er aus dem Fenster blickt. Graue Hauswände, viele Graffiti, aber nicht von der schönen Sorte wie in seiner Heimatstadt Wien, wo manche Wände kunstvoll verziert sind, sondern hässliches Zeug. »Nichtskönner!«, geht ihm durch den Kopf. Ihn ärgert, dass manche Leute diesen – und anderen – Schrott einfach zu Kunst erklären. Man muss die Dinge einfach so umdeuten, dass sie einem in den Kram passen!, denkt er. Hässliche Gebäude, zugige Wohnungen, der ruppige Ton, das Versiffte, Verdreckte, Abgewrackte, Pseudocoole – man muss es nur oft genug als jung, hip, schick, trendy bezeichnen, und schon glauben es die Leute und wollen unbedingt in diese Stadt ziehen, wie einem Herdentrieb folgend. Niemand sagt: Berlin ist eine Zumutung! Der Kaiser ist nackt! Stattdessen verklären sie die Hässlichkeit der Stadt und erdulden all ihre Härten, warten monatelang auf einen Kitaplatz oder auf einen Termin bei der Behörde, um einen neuen Pass zu beantragen. Und die ganze Hundescheiße überall!, denkt er. Gehet hin und machet eure Nachbarschaft schön, das müsste man den Berlinern mal mit auf den Weg geben!
Aber wenn er Berlinern so etwas sagt, erntet er selten Zustimmung. Meist erhält er dann mitleidige bis verachtende Blicke. Mit ihrem Umzug nach Berlin wurden die alle einer Gehirnwäsche unterzogen!, denkt er. Einmal äußerte er seine Ansichten gegenüber einer Berliner Freundin, die in – ohgottohgott! – Kreuzberg lebt. Er schimpfte, die Menschen in Berlin würden, anstatt sich mal zusammenzureißen und die Dinge voranzubringen und schön zu machen, die faule Variante wählen, indem sie einfach nichts tun und den Schrott zum Kult erklären. Sie fand das gar nicht lustig. »Du klingst wie ein verbitterter alter Sack!«, hatte sie ihm geantwortet. »Vielleicht bist du ein verbitterter alter Sack! Auf jeden Fall bist du voreingenommen gegenüber Berlin!« Und nach einer kurzen Pause: »Das mit den Hundehaufen ist übrigens viel besser geworden. Das war vielleicht früher mal so.« Und später, als er das Thema längst abgehandelt glaubte: »Wien macht dich wirklich spießig.«
Der Bus hält vor dem Berliner Hauptbahnhof, einem monströsen mehrstöckigen Klotz aus Beton und Glas, in dem die Züge auf mehreren Ebenen ein- und ausfahren. Bis zur Abfahrt hat er noch eine Viertelstunde, er kauft sich zwei Zeitungen, einmal seine Lieblingszeitung (für die Selbstbestätigung und das Vergnügen) und einmal die, in der überwiegend Positionen vertreten sind, die er für rückständig und reaktionär hält (für die Feindbeobachtung, know your enemy!).
Als der Zug die Stadt langsam hinter sich lässt, steigt seine Laune merklich. Bei einem freundlichen Mann, der mit dem Wägelchen durch den Zug geht und Getränke und Snacks verkauft, bestellt er einen Tee. Erst als der Verkäufer ihm einen Pappbecher mit lauwarmem Wasser und einem Teebeutel darin auf den Tisch stellt, erkennt er seinen Fehler. Verdammt, jedes Mal vergesse ich, dass das die schlimmste Brühe der Welt ist, denkt er. Er bestellt gleich noch einen Kaffee dazu, der ist zwar auch nicht prima, aber wenigstens muss er sich, anders als beim Tee, nicht mühsam überwinden, ihn herunterzuschlucken. Bei Kaffee geben sie sich in diesem Land mehr Mühe. Warum nur? Was ist so schwierig daran, die richtige Menge Teeblätter mit Wasser knapp unter dem Siedepunkt zu übergießen und drei bis fünf Minuten ziehen zu lassen?
Er schläft ein. Er träumt von blühenden Landschaften. Felder voller Duftveilchen, Buschwindröschen, Blausternen und Traubenhyazinthen. »Blau ist eine Farbe, die in der Botanik kaum vorkommt!«, liest er im Traum im Internet. Quatsch! Drei der vier genannten Blumen sind blau. Und es gibt noch einige mehr! Bilder von Friedensreich Hundertwasser ziehen an ihm vorbei. Der große Gegner der geraden Linien, der alte Kurvenmaler! »Die Natur kennt keine geraden Linien!«, liest er wieder in einem Post oder Tweet, irgendein selbst ernannter Hundertwasser-Experte meldet sich da zu Wort. In dem Moment fährt er im Traum durch einen dichten Wald. Baum an Baum. Wie mit dem Lineal gezogen ragen sie in den Himmel. Von wegen, die Natur kennt keine geraden Linien! Warum geben die Leute so viel Unsinn von sich? Überhaupt, warum ist es so vielen heute gar nicht peinlich, mit ihrem Unwissen hausieren zu gehen? Warum werden Leute heute für ihre Dummheit nicht nur nicht bestraft, sondern sogar gelobt? Nur weil sie sie besonders laut kundtun? Der unverschämte Berliner Busfahrer erscheint ihm im Traum, er fragt sich: Wann ist Unfreundlichkeit gesellschaftlich akzeptabel geworden? Warum läuft so vieles schief in unserer Gesellschaft, aber niemand versucht, etwas daran zu ändern? Wie toll wäre es, gäbe es eine gute, mächtige Figur, die uns wieder auf die richtige Bahn lenkt, die die Menschheit von ihrer Dummheit befreit und sie zur Freundlichkeit erzieht! Hätte er Macht, wäre genau das sein Programm: die Entidiotisierung der Menschheit!8 Eine Entideologisierung der Welt! Ein Herrscher zum Besten der Demokratie! Ein Kalifat für das Gute!
Noch immer fährt er träumend durch den Wald. Er hört ein Stampfen, als ginge da ein großes Monster oder ein Tyrannosaurus Rex. Die Baumlinien erschüttern, in seinem Kopf wackeln die senkrechten Linien wie bei einem Elektrokardiogramm. Dann plötzlich ein Quietschen, »… fällt dieser Zug wegen eines Schadens an der Bremse leider aus …«. Unverständliches Genuschel. »… müssen Fahrgäste nach Prag hier in Dresden in einen anderen Zug umsteigen, der in Kürze bereitgestellt wird. Weitere Informationen …« Ein Ruck geht durch seinen Körper.
Jemand klopft ihm sachte auf die Schulter. Es ist der Schaffner, ein kleiner Mann, vielleicht Mitte zwanzig, mit rosigem Gesicht und für sein Alter eindrucksvoll voluminösem Bauch, über dem sich ein Pullunder spannt. »Alle Fahrgäste bitte aussteigen!«, sagt er. Er spricht einen heftigen sächsischen Dialekt. Große Güte, schlimm genug, aber muss man in dieser Sprache auch noch geweckt werden? Noch im Halbschlaf schaut der junge Mann irritiert auf. Der kleine Dicke blickt ihn freundlich an. »Gut geschlafen?«, fragt er und lächelt. »Tut mir leid, dass wir Ihren Schönheitsschlaf unterbrechen müssen, aber wir haben ein technisches Problem. Dieser Zug fällt ab hier in Dresden aus. Über Ihre Möglichkeiten zur Weiterfahrt können Sie sich am Bahnsteig informieren.«
Der Mann reibt sich die Augen und seufzt.
Wieder lächelt der Schaffner. »Ich weiß, ist scheiße. Kann ich leider auch nicht ändern. Aber für mich ist es gut, ich darf nämlich Feierabend machen. Ich wohn’ in Dresden, und ich gehe jetzt zur ›Pegida‹-Demo!«
Der Mann kann ihm inhaltlich nur schwer folgen, so sehr ist er auf den Dialekt fixiert. »Isch wööhn in Dräääsdn«, hört er.
»Sie gehen zu ›Pegida‹?«, fragt der Mann, nun noch irritierter.
Der Schaffner grinst. »Nein. Ich bin die Gegendemo.«
Der Mann schaut auf seine Uhr. Zwei Stunden sind seit der Abfahrt in Berlin vergangen. Mühsam steht er auf, der Nacken schmerzt, er packt seine Sachen zusammen. Der Gedanke, dass es heute möglicherweise mit dem geliebten böhmischen Essen nichts wird, schmerzt ihn. Er macht sich gefasst darauf, dass er mit mehreren Stunden Verspätung zu Hause ankommen wird.
Am Informationsschalter der Bahn erfährt er, dass er entweder in einer Stunde weiterfahren kann, dafür aber mehrmals umsteigen muss – oder erst in drei Stunden.
Er wählt die Variante ohne Umsteigen. Der Zugbegleiter kommt ihm entgegen. »So, Sie kommen klar?«, fragt er freundlich. Der Mann nickt. »Ja, in drei Stunden geht’s weiter.« Der Schaffner grinst. »Kommen Sie doch mit zur ›Pegida‹-Gegendemo! Wir können jeden gebrauchen!« Er streckt ihm seine weiche, etwas feuchte Hand entgegen: »Ich bin Udo! Udo Kaluppke!« Der junge Mann hört: »Üdö Kalübbge«.
Er überlegt. Wie oft hat er sich schon über diese bösartig keifenden und brüllenden Typen aufgeregt, die mit selbstgebastelten Galgen durch die Dresdner Innenstadt gehen? Die Flüchtlingen »Absaufen! Absaufen!« entgegenbrüllen und Affenlaute machen, wenn sie schwarze Menschen sehen? Wie oft hat er ihnen mal so richtig seine Meinung geigen wollen? Was für ein niederträchtiges Volk!, denkt er. »Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlands«, ha! Volltrottel! Demonstrieren in einer Region gegen Islamisierung, wo kaum ein Muslim lebt! Man kann, nein, man muss gegen religiösen Extremismus … Vielleicht ist das … Also, man könnte doch … Er denkt nach. »Okay. Ich bin dabei«, sagt er.
Üdö grinst. »Wieder einen gewonnen! Aber wissen Sie was? Auf dem Weg zur Gegendemo gehen wir bei mir vorbei, das liegt auf dem Weg, dann kriegen Sie von mir einen Kaffee, besser als der im Zug! Und ich kann mich schnell noch umziehen!« Er lacht.
Vertrauensseliger Kerl, denkt sich der Mann. Aber freundlich. Der sächsische Dialekt macht ihn immer noch fertig. Und dass ein so junger Mann Udo heißt, findet er auch bemerkenswert. War dieser Name nicht schon ausgestorben? Und nennen nicht manche arroganten Wessis jeden Ossi »Udo«, für »Unser dummer Ossi«?
Nach dem Kaffee in der mit Büchern vollgestopften Zwei-Zimmer-Wohnung Kaluppkes – der Mann hat sich zeitweise Vorwürfe gemacht wegen seiner Vorurteile, denn nie im Leben hat er sich die Wohnung eines Schaffners mit so vielen Büchern vorgestellt – schlendern sie Richtung Innenstadt, zum Dresdner Neumarkt. Auf dem Weg verschwindet Kaluppke kurz in einer Bäckerei und kommt mit zwei Papptellern wieder, auf denen jeweils ein Kuchenstück und eine Plastikgabel liegen. »Hier, zur Stärkung vor unserer Demo. Eierschecke«, sagt er und grinst und reicht einen Teller an seinen Gast weiter. »Ohne Mampf kein Kampf!«
Der Mann schaut ihn fragend an.
»Kennen Sie nicht?«
Der Mann schüttelt den Kopf.
»Das ist eine sächsische Spezialität. Mit Quark. Probieren Sie mal.«
Der Mann nimmt einen Bissen und nickt anerkennend. »Gut. Sehr gut. Nicht so gut wie Punschkrapfen, aber immerhin.«
»Wie was?«
»Wie Punschkrapfen. Das ist, äh, eine Kuchenspezialität aus Österreich. Esse ich in Wien immer.«
»So, so. Sie mögen also Kuchen?« Er mustert den Mann von oben bis unten. »Sieht man jetzt nicht so.«
»Nein, ich esse nicht gerne Kuchen. Ich esse gerne Punschkrapfen.«
»Ist das mit Alkohol?«, fragt Kaluppke, und als der Mann ihn »Allgöhöhl« sagen hört, verschluckt er sich an seiner Eierschecke.
»Ja, ist es.«
»Ich dachte, Sie wären Muslim.«
Der Mann verschluckt sich erneut.
»Und Sie glauben, Muslime konsumieren keinen Alkohol? Überhaupt, wie kommen Sie darauf, ich wäre ein Muslim?«
»Ach, egal. Ich dachte nur … Ihr Bart … Egal. War blöd von mir. Entschuldigung.«
»Passt schon.«
Kaluppke schaut den Mann freundlich an.
»Ja, aber was ist das denn genau, ein Punschkrapfen?« Er sagt »Bünschgröbbfn«.
»Das ist, wie gesagt, eine österreichische, wie sagt man … Mehlspeise. Ein Gebäck. Ein rosafarbener Würfel. Also, ein brauner Kuchenwürfel mit einer rosafarbenen Zuckerglasur. Und im Teig ist viel Alkohol. Ich glaube, Rum. Sozusagen die österreichische Variante der Rumkugel: Früher nahm der Bäcker die Teigreste des Tages, kippte ordentlich Alkohol rein, damit es halbwegs okay schmeckt, und machte ein Gebäck daraus. Resteverwertung mit Rum, wenn man so will. Heutzutage nehmen die keine Teigreste mehr. Hoffe ich jedenfalls.«
»Und das schmeckt?«, fragt Kaluppke.
»Und wie! Ich liebe Punschkrapfen! Dass man das in Deutschland noch nicht entdeckt hat, ist ein Frevel! Und dass man mit Österreich stattdessen die Sachertorte in Verbindung bringt, einen furztrockenen Schokoladenkuchen mit einer homöopathisch dünnen Schicht Aprikosenmarmelade, die man in Österreich Marillenmarmelade nennt, ist ein Riesenmarketingerfolg, aber never ever dem Geschmack des Kuchens geschuldet.«
»So?«
»Ja. Sachertorte wird maßlos überschätzt. Wohingegen Punschkrapfen maßlos unterschätzt werden. Und das Beste: Sie verkörpern die österreichische Seele, wie der Psychologe Erwin Ringel es einmal auf Kärnten bezog: ›Was ist Kärnten? Antwort: Ein Punschkrapferl, außen rosa, innen braun und immer unter Alkohol.‹«
Kaluppke kichert. »Das ist lustig. Könnte man auch über uns Sachsen sagen.«
»Ja. Später wurde der Witz dem großen österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard zugeschrieben: ›Die Mentalität der Österreicher ist wie ein Punschkrapfen: Außen rot, innen braun und immer ein bisschen betrunken.‹ Ich habe keine Ahnung, wer sich diesen Spruch ausgedacht hat. Aber auf jeden Fall ist er gut.«
»Ja, sehr«, sagt Kaluppke und nimmt noch eine Gabel von seiner Eierschecke. Zucker klebt in seinen Mundwinkeln, den er nach und nach mit der Zunge entfernt, die aussieht wie ein dicker, feuchter Wurm.
Menschen mit Deutschlandflaggen kommen ihnen entgegen. Manche tragen auch eine rote Flagge mit schwarz-goldenem Kreuz.
»Merkwürdige Reichskriegsflagge«, bemerkt der Mann.
Kaluppke grinst. »Aber das ist doch nicht die Reichskriegsflagge!«
»Sondern?«
»Die ›Pegida‹-Flagge.« Er räuspert sich. Offensichtlich will er zu einer längeren Erklärung ausholen. »Also: Eigentlich ist das die Wirmer-Flagge, benannt nach ihrem Erfinder Josef Wirmer. Ursprünglich war sie ein Symbol des Widerstands gegen Adolf Hitler. Sie sollte nach einem erfolgreichen Attentat auf Hitler durch Claus Schenk Graf von Stauffenberg die neue Nationalflagge werden, weil man nicht zurück zur verhassten Trikolore der Weimarer Republik wollte. Das Attentat ist bekanntlich gescheitert …«
»Ja, genau, Wolfsschanze, Aktentasche, Bombe, nicht gezündet«, wirft der Mann ein.
»Doch, doch, gezündet schon, aber Hitler und die anderen Anwesenden überlebten«, korrigiert ihn Kaluppke. »Die Flagge war dann später, nach Kriegsende und bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, kurz im Gespräch als Nationalflagge, wurde aber vom Parlamentarischen Rat verworfen und geriet in Vergessenheit. In den Neunzigern wurde sie dann von Rechtsextremisten, Reichsbürgern und sonstigen Idioten wiederentdeckt.«
Der Mann kann einen Lacher nicht unterdrücken, weil Kaluppke »Idiöten« sagt. Doch der redet unbeirrt weiter.
»Und jetzt benutzt ›Pegida‹ sie. Daher sieht man sie bei deren Demonstrationen so häufig. Sie ist ein neo-konservatives Kampfzeichen, ein Symbol von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten.«
»Ich bin beeindruckt«, sagt der Mann. »Woher wissen Sie das alles?«
Kaluppke grinst über das ganze Gesicht. »Geschichtsbücher. Und Zeitungen«, antwortet er stolz. »Ich lese gern und viel.«
»Irre: Die Flagge des Widerstands, die für Freiheit und Toleranz stand, wird jetzt von Leuten verwendet, die genau das Gegenteil vertreten. Das ist ja eine komplette Verdrehung! Haben diese Leute denn gar keine historischen Kenntnisse?«
»Ich sag ja: Idioten! Die glauben ernsthaft, diese Flagge stünde für ihre bescheuerte ›Für Führer, Volk und Vaterland!‹-Mentalität. Geschichtswissen hin oder her, Fakten, Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse sind denen völlig egal. Die basteln sich ihre eigene Fantasiewelt zurecht.«
Der Mann betrachtet Kaluppke genauer. Er hatte ihn als dick abgespeichert, jetzt korrigiert er sein Bild, denn der Schaffner ist eigentlich gar nicht dick, sondern einfach rundlich, teigig, weich. Auch seine Gesichtszüge sind weich, die Haut blass, an den Wangen gesund rot. Sommersprossen überziehen den Nasenbereich, die rötlichen Haare fallen strubbelig zur Seite. Dieser Mann gefällt ihm.
Von Weitem sind Rufe zu hören, die Worte verwischen zu Tonwolken, dafür ist der Rhythmus der Sprechchöre umso deutlicher: Daaa-da-da-dammm! Daaa-da-da-dammm! Erst ein paar Minuten später nehmen auch die Worte Kontur an: »Wir sind das Volk!« in Dauerschleife. Unter die Flaggen mischen sich nun auch immer mehr Banner. »Keine Scharia in Europa!«, steht auf einem. »Alibaba und die 40 Dealer! Ausweisung sofort!« auf einem anderen. »Bitte weiterflüchten!«, hält jemand für mitteilungswert, jemand anders »Refutschis go home!« Wie viel Unverständnis und Ignoranz kann man auf einem einzigen Transparent zum Ausdruck bringen?, fragt sich der Mann. Ein Opa, beigefarbene Jacke, beigefarbene kurze Hose, beigefarbene Socken, beigefarbene Sandalen, lässt seine Umwelt per Schild wissen: »Jedem Volk sein Land! Nicht jedem Volk ein Stück Deutschland!« Zwei junge Frauen, schwarze Kleidung, Sonnenbrillen, die eine mit kahlrasiertem Kopf, die andere auf der einen Seite raspelkurze Haare, auf der anderen schulterlange, tragen ein Plakat mit der Aufschrift: »Wir vermissen unser Land, es hatte folgende Eigenschaften: Redefreiheit, Pressefreiheit, Demokratie, christländische Abendlandkultur, Sicherheit, Geborgenheit, Solidarität und Anstand, Rechtssicherheit, ungenderisierte & blumige Sprache«. Es steht noch etwas darunter, etwas von »irgendwo sehen« und »bewahren«, aber sie halten es so tief, dass der Mann die letzten Zeilen nicht lesen kann. Dutzende Demonstranten tragen den Spruch »Gegen die Islamisierung Deutschlands!« und »Kein Kalifat in Deutschland!« vor sich her. Von Weitem ist eine Stimme zu hören, jemand spricht offensichtlich auf einer Bühne, aber der Mann und Kaluppke können nicht sehen, wer der Redner ist. »Es ist am Horizont eine neue Möglichkeit aufgegangen! Eine politische Morgenröte. Und es ist eine Lust, zornig zu sein und der Politik die Zähne zu zeigen!«, tönt die Stimme.
Der Mann blickt zu Kaluppke, der unbeirrt auf ein Ziel zusteuert, zur Gegendemo. Er selbst kennt sich in Dresden kaum aus und verlässt sich deshalb auf den Einheimischen. Je mehr Bannerträger ihnen entgegenkommen, je länger er die gebrüllten Worte aus irgendwelchen Lautsprechern und die »Wir sind das Volk!«-Rufe hört, desto stärker fühlt er in sich eine Wut aufsteigen. Eine Urwut, wie er sie noch nie gespürt hat. Etwas Dunkles, Unbändiges, Unkontrollierbares, kein Hass, mehr Verärgerung, auch Entsetzen und Enttäuschung über diese Menschen, aber aus der Tiefe seines Inneren. Er möchte sie anbrüllen, zurechtstutzen, auf ihre unendliche Dummheit hinweisen.
Kaluppke fällt auf, dass der Mann in Gedanken versunken ist und zurückfällt. Er deutet es als Müdigkeit nach der Reise. »Kommen Sie, wir sind gleich da«, ruft er ihm zu. Um ihn aufzumuntern, zeigt er in Reiseführermanier auf ein hübsches Gebäude. »Schauen Sie, das ist die berühmte Semperoper! Kennen Sie bestimmt, oder?« Der Mann betrachtet das Bauwerk. Ein steinernes Monument, das ihm tatsächlich aus einer Bierwerbung bekannt vorkommt. »Ist das nicht die berühmte Dresdner Brauerei?«, fragt er und kichert. Kaluppke scheint das nicht lustig zu finden. Er ignoriert die Frage. Vor der Oper steht eine kleine Bühne, darauf ein Mikrofon, sonst nichts. Menschen sammeln sich vor der Bühne, sie scheinen auf irgendeinen Auftritt zu warten.
Als der junge Mann aber die Bühne sieht, geht er hinauf und setzt sich. Und mehrere Menschen treten zu ihm. Und er tut seinen Mund auf, lehrt sie und spricht: »Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Kalifat.«
Kaluppke steht mit offenem Mund da und starrt den Mann an. Nach ein paar langen Sekunden scheint er sich zu fangen und sagt: »Aber was …«
Der junge Mann betrachtet jetzt das Mikrofon, das ihm da ins Gesicht ragt, ein Mikrofon wie eine Offenbarung, eine Chance, ein Wunder. Es ist eingeschaltet, seine Worte hallen über den Platz vor der Semperoper. Das Wort »Kalifat« schwebt über der versammelten Menschenmenge. Der Mann pustet ins Mikrofon und klopft mit dem Zeigefinger darauf, um sich zu vergewissern, dass es wirklich eingeschaltet ist. Dass es wirklich seine Worte sind, die er da gerade gehört hat.
»Kommen Sie, lassen Sie uns weitergehen, wir sind gleich da«, drängt Kaluppke und möchte ihn weiterziehen. Aber der Mann hört nicht. Er starrt weiter fasziniert auf das Mikrofon. Immer mehr Menschen strömen zur Bühne. Der Mann vor dem Mikrofon scheint sie, obwohl er nur diese wenigen Worte gesagt hat, magisch anzuziehen: eine leuchtende Figur, freundlich lächelnd, mit großen warmen braunen Augen, schwarzen Haaren, kaffeebrauner Haut und einem schwarz-grauen Bart. Er trägt Jeans, ein blaues, kragenloses Hemd, ein bunt besticktes Tuch um den Hals, das ihm wie eine Stola am Körper hängt. An beiden Händen hat er, wie man aus der Ferne nur vermuten kann, einen Ring, jedenfalls funkelt da etwas, man erkennt nicht, ob es Edelsteine sind oder etwas Metallisches. Ein Gemurmel macht sich breit, die Menschen rätseln, wer dieser »Mann vor der Semperoper« ist, sie sprechen von einem »neuen Politiker«, der »vor der Semperoper Sensationelles verkünden« werde.
Zuerst stehen ein paar Dutzend Leute vor der Bühne. Dann Hunderte. Schließlich Tausende.
»Moin, grüß Gott und Salam Aleikum!«, spricht der Mann ins Mikrofon.
»Pfui!«, ruft einer aus dem Publikum, ein paar »Buuuh!«-Rufe sind zu hören. »Was soll das werden?«, hört er einen Zuschauer fragen. Gelächter. Dann Schweigen. Warten darauf, was er als Nächstes zu sagen hat.
»Ich aber sage euch: Wer seinen Mitmenschen zürnt, ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinen Mitmenschen sagt: Ihr Nichtsnutze!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Ihr Narren!, der ist des höllischen Feuers schuldig!«
Der Mann blickt in ein Meer von Menschen, staunende Gesichter blicken zurück, Frieden liegt in ihrem Antlitz. Die »Wir sind das Volk«-Rufe sind verstummt.
Kaluppke ist nun auch auf die Bühne geklettert und steht ein paar Meter hinter dem Mann. »Äh, Chef, hören Sie, wir sollten jetzt vielleicht besser weitergehen«, flüstert er.
Doch der Mann hört Kaluppke nicht. Er redet weiter: »Ich aber sage euch: Öffnet eure Türen und eure Herzen. Seid gastfreundlich, aber nicht dumm. Redet, aber hört auch zu. Unterwerft euch nicht, aber stellt euch auch nicht über andere. Ich bin …« Er unterbricht seinen Redefluss, um nachzudenken, was er eigentlich sagen will. Die Menschen, die eben noch so wütend Parolen schrien, wirken jetzt friedlich, besänftigt. Keiner sagt etwas, alle blicken erwartungsvoll auf ihn, als wäre er der Heiland. Wie oft hat er sich über diese Leute geärgert?
Ihm fällt ein, worüber er vorhin am Informationsschalter der Bahn nachgedacht hat: dass diese Leute in permanenter Angst vor etwas leben, das es gar nicht gibt. So wie er als Kind Angst hatte, nachts alleine aufs Klo zu müssen, weil er glaubte, in der alten Holztruhe im Flur, auf dem Weg zur Toilette, lebe ein Monster, das in der Dunkelheit herauskomme und sein Unwesen im Haus treibe und nur darauf warte, ihn, den kleinen, dünnen Jungen, zu fressen. Seine Angst war so groß, dass er immer versuchte, mit voller Blase wieder einzuschlafen. Irgendwann war er so geübt, dass er grundsätzlich nur noch selten urinieren musste. Erst als er begriff, dass es kein Monster im Flur gibt, keine Gefahr, entspannte sich sein Leben. Er ärgerte sich, dass er sinnlos monatelang – oder gar jahrelang? – den Drang zu pinkeln unterdrückt und manche gute Stunde Schlaf verpasst hatte wegen etwas, das er sich nur eingebildet hatte. Hätte es doch nur wirklich ein Monster gegeben!
Ich muss diesen Menschen jetzt bieten, wovor sie Angst haben und wogegen sie demonstrieren, sonst machen sie sich irgendwann Vorwürfe, wenn ihnen ihr irrationales Verhalten bewusst wird, denkt er. Werden sie je herausfinden, dass sie gegen ein Phantom protestieren, dass es all diesen Unsinn – die Überfremdung, die »Islamisierung des Abendlands«, die Meinungsdiktatur und den Bevölkerungsaustausch – so, in dieser Form, wie sie es sich ausmalen, gar nicht gibt? Was, wenn sie nie von selbst darauf kommen? Also gebe ich ihnen Islamisierung! Ich gebe ihnen Scharia! Ich mach ihnen Bevölkerungsaustausch! Ich will die Islamisierung Deutschlands!
»Ich bin euer Kalif!«, sagt er ins Mikrofon, und dabei betont er jedes einzelne Wort. »Ich! Bin! Euer! Kalif!« Kaum sind seine Worte verhallt, herrscht auf dem Platz vor der Oper tiefes Schweigen. Kein Geräusch ist zu hören, nicht mal ein Grundrauschen, trotz der großen Menschenmenge. Stattdessen: wohlwollendes, zustimmendes Schweigen, kein eisiges, feindseliges. Der Mann ist erstaunt über die Wirkung seiner Worte. Offensichtlich schließen sie eine Lücke in den Köpfen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Als hätten die Menschen nur auf ihn und seine Verkündung gewartet.
Plötzlich unterbricht eine Männerstimme die Stille. »Weg mit dem Islam!« Ein paar andere Stimmen gesellen sich jetzt dazu. »Genau!« – »Jawoll!« – »Weg mit dem Scheiß!« – »Moslems raus!« Aber die meisten bleiben stumm, sie scheinen auf weitere Worte des Kalifen zu warten. »Jetzt haltet doch mal die Fresse!«, ruft eine Frau den Brüllenden zu. Der »Weg mit dem Islam!«-Mann ruft: »Ich seh das aber so! Der Islam ist eine Gefahr! Für mich ist das wahr!«
Der Mann, der sich nun Kalif nennt, fixiert diesen Mann mit seinem Blick. Wie hypnotisiert schaut der Mann zurück.
»So, du siehst das also so?«, fragt ihn der Kalif von der Bühne, und seine Stimme donnert aus den Lautsprechern vor der Semperoper.
Der Brüller nickt.
»Der Islam ist also eine Gefahr?«
Wieder nickt er.
»Und das ist für dich wahr?«
Nicken.
Kaluppke tippt dem Kalifen auf die Schulter und flüstert: »Hallo? Entschuldigung? Wir sollten jetzt gehen!«
»Schweig, Wesir!«, fährt ihn der Kalif an, eine Hand aufs Mikrofon haltend, damit nicht alle mithören, mit der anderen eine wegwischende Bewegung machend, die Kaluppke bedeuten soll, nicht nur zu schweigen, sondern auch von der Bühne zu verschwinden. Schmollend zieht sich Kaluppke zurück, steigt die fünf Stufen hinab und stellt sich an den Bühnenrand, um auf den Kalifen zu warten.
Der Kalif hat immer noch den Brüller im Blick.
»Was du sagst, mein Bruder, ist nicht wahr.«
Der antwortet: »Ach, und was wahr ist und was nicht, bestimmst du?«
Einige seiner Mitstreiter lachen hämisch.
Der Kalif rollt mit den Augen. »Uff!«, sagt er, und eine Sekunde zu spät bemerkt er, dass er das Mikrofon nicht mehr verdeckt. »Uff!«, hallt es vor der Semperoper. »Hier steht ein Mann, der infrage stellt, ich könne zwischen wahr und unwahr unterscheiden. Also gut. Du entziehst dich der Angabe von Fakten, von Tatsachen. Du bringst keine Argumente, sondern flüchtest dich in deine eigene Wahrheit.« Der Kalif versucht, am Gesichtsausdruck des Typen zu lesen, ob er ihm folgen kann. Der Brüller steht nah genug an der Bühne, dass der Kalif das Grinsen des Mannes erkennen kann. »Angenommen, ich sage: In der Truhe im Flur unseres Hauses lebt ein Monster! Jemand versucht, mich davon zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist und dass es gar keine Monster gibt. Ich aber beharre darauf und antworte: Doch, für mich ist es wahr, dass da ein Monster lebt! Ist die Wahrheit über die Existenz von Monstern dann relativ? Können wir über diese Wahrheit also verhandeln? Du siehst es so, und ich sehe es so?«
Der Brüller grinst immer noch. Aber er sagt nichts mehr.
»Was, wenn ich glaubte, dass Forellen fliegen können? Daraus folgt noch lange nicht, dass es wahr ist, dass Forellen fliegen können.«
»Wenn das deine Wahrheit ist, ist das deine Wahrheit!«, wagt der Brüller nun doch eine Diskussion.
»Falsch! Denn sonst wäre jede Behauptung wahr, nur weil ich daran glaube. Ist sie aber nicht! Nur weil jemand etwas glaubt, seine Überzeugung also tatsächlich existiert, heißt das noch lange nicht, dass der Inhalt seines Glaubens auch tatsächlich existiert, also Wahrheit ist.«
»Doch!«, kommt als Antwort aus dem Publikum, aber verhalten, leise. Der Brüller grinst immer noch. Sein Gesichtsausdruck sagt: ›Mir doch egal, was du redest – ich bleibe dabei: Der Islam ist eine Gefahr!‹
Ein anderer Mann mischt sich ein: »Wir sind hier abgehängt, den Politikern sind wir egal! Das sind vor allem Wessis! Die sind gleich nach der Wende gekommen und haben uns alles weggenommen!«
»Alles weggenommen? Ich dachte, ihr hattet nichts in der DDR!«, entgegnet ihm der Kalif.