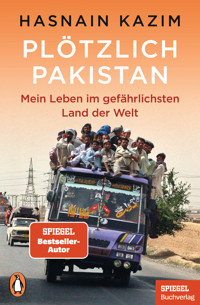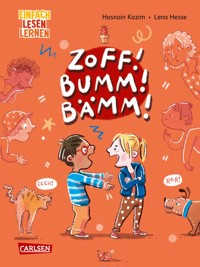19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, ein Land, ein Fahrrad - Hasnain Kazim unterwegs, auf der Suche nach der deutschen Seele
Hasnain Kazim zieht aus, sein Land zu erkunden. Mit seinem Lieblingsverkehrsmittel, dem Fahrrad, macht er sich auf, ein aktuelles Deutschlandporträt zu zeichnen. Was eint die Menschen, was trennt sie? Kazim radelt entlang von Elbe, Ruhr, Rhein, Oder/Neiße, Neckar und Donau und lässt dem Zufall Raum. Er trifft unterschiedliche Menschen, spricht mit ihnen über ihr Leben in diesem Land: Worüber darf man eigentlich noch lachen? Was ist Heimat? Das Buch ist auch eine Selbstverortung: Von einigen wird Hasnain Kazim regelmäßig sein Deutschsein abgesprochen. Wann und wie also gehören Menschen hierhin? Was ist Diversität? Kann man mit Wohlwollen und Zugewandtheit nicht doch mit allen reden, sie vielleicht sogar versöhnen und Gräben überwinden? Eine Fahrradtour in dem Versuch, mit der Kraft des Wortes zu verbinden. Und die deutsche Seele zu ergründen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ein Mann, ein Land, ein Fahrrad – Hasnain Kazim unterwegs, auf der Suche nach der deutschen Seele
Was ist los in unserem Land? Worüber wird diskutiert, gelacht, gestritten? Hasnain Kazim macht sich auf, ein Deutschlandportrait zu zeichnen. Er radelt entlang von Elbe, Ruhr, Rhein, Oder/Neiße, Neckar und Donau und lässt dem Zufall Raum. Trifft die unterschiedlichsten Leute und spricht mit ihnen über ihr Leben. Was hat der Duisburger gemein mit der Görlitzerin? Wer fühlt sich hier zu Hause? Woher rührt der jüngst zu verzeichnende »Rechtsruck« in unserer Gesellschaft? Kann man mit Wohlwollen und Zugewandtheit nicht doch mit allen reden, sie vielleicht sogar versöhnen und Gräben überwinden?
Eine Fahrradtour in dem Versuch, mit der Kraft des Wortes zu verbinden. Und die deutsche Seele zu ergründen.
Hasnain Kazim ist gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er wuchs im Alten Land, vor den Toren Hamburgs, und in Karatschi in Pakistan auf, studierte Politikwissenschaften und schlug eine Laufbahn als Marineoffizier ein. Er schrieb unter anderem für das dpa-Südasienbüro in Delhi und von 2004 bis 2019 für den SPIEGEL und SPIEGELONLINE, die meiste Zeit davon als Auslandskorrespondent in Islamabad, Istanbul und Wien. Für seine Arbeit wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter der »CNN Journalist Award«. Er lebt als freier Autor nach wie vor in der österreichischen Hauptstadt und hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem »Grünkohl und Curry«, »Plötzlich Pakistan« und »Krisenstaat Türkei«. Das Taschenbuch »Post von Karlheinz« (2018), das seine Dialoge mit wütenden Leserinnen und Lesern versammelt, stand viele Wochen auf der Bestsellerliste. »Auf sie mit Gebrüll!« (2020), eine Anleitung zum richtigen Streiten, wurde ebenfalls direkt nach Erscheinen ein Bestseller. Zuletzt erschienen »Mein Kalifat. Ein geheimes Tagebuch, wie ich das Abendland islamisierte und die Deutschen zu besseren Menschen machte« und das dazugehörige »Kalifatskochbuch. Weisheiten und Rezepte«.
www.penguin-verlag.de
HASNAIN KAZIM
DEUTSCHLANDTOUR
AUF DER SUCHE NACH DEM, WAS UNSER LAND ZUSAMMENHÄLT
EIN POLITISCHER REISEBERICHT
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Karten: Peter Palm, Berlin
Bildbearbeitung: Lorenz + Zeller GmbH, Inning a. Ammersee
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Umschlagabbildungen: © Peter Rigaud
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27748-2V002
www.penguin-verlag.de
Meinem Weggefährten, Kameraden und Freund Carsten Klein
Inhalt
Zum Geleite
Hoch im Norden
Entlang der Elbe von Cuxhaven nach Bad Schandau
Losfahren
Heimat! Endlich Heimat!
Deutschem Humor auf der Spur
Deutsche Äpfel
Alter weißer Mann
Richtung einstiger innerdeutscher Grenze
Gelbe Kreuze
»Deutschland, aber normal«
Wir schaffen das
Ein Freund in Magdeburg
Auf nach Sachstzschen
Neu in Sachsen, neu in Deutschland
Zur Sicherheitslage im Osten
Erkenntnisse an der Elbe
Tief im Westen
Entlang der Ruhr von Winterberg nach Duisburg
Zechen, Schlote, Kumpel – nicht
Endlich echtes Ruhrgebiet
Currywurst und Gyros – Ruhrdiversität
Vom Wandern
Scheiße, wat is dat schön!
Erkenntnisse an der Ruhr
Am deutschesten aller Flüsse
Entlang des Rheins von Mainz NACH Duisburg
Geheimnisvoller Vater Rhein
»Integrieren Sie sich besser nicht«
Friede, Glück und Sicherheit
Jede Jeck is anders
»Es trifft immer die Falschen«
Erkenntnisse am Rhein
Grenzflüsse, Grenzerfahrungen
Entlang von Oder und Neiße von Anklam nach Zittau
Going East
Zwischen Mate-Kombucha und Cola-Korn
Was hat ein Eis mit Freiheit zu tun?
Zum Reden braucht es mindestens zwei
Verbrannte Erde
Blühende Landschaften
Erkenntnisse an Oder und Neiße
Am Wilden Wasser
Entlang des Neckars von Villingen-Schwenningen nach Mannheim
Schaffe, schaffe … unterwegs im Schwabenland
Digitalisierung made in Germany
Streiten für die Demokratie
Übers Kinderkriegen
Abstecher in die Vergangenheit
Wo Deutschland floriert
Wahlkampfversprechen
Malerische Zustände
Erkenntnisse am Neckar
Zu Besuch bei Ihrer Majestät
Entlang der Donau von Donaueschingen nach Passau
Wer den Hirsch beim Röhren stört
Tauet, Himmel, den Gerechten
Wälder, Wurst und Grünkohl
Are you a refugee?
Herausforderungen des Miteinanders
Deutsche Päpste, deutsche Helden – und Heldinnen
Erkenntnisse an der Donau
Postludium, natürlich!
Danksagung
Zitatnachweis
Bildteil
Zum Geleite
Es waren magische Momente. Wir bretterten mit unseren Fahrrädern durch unser Dorf, liefen durch die Obstplantagen, fuhren an die Elbe, waren frei und glücklich. Manchmal trauten wir uns sogar, die Ortsgrenze zu überqueren. Das war dann das ganz große Abenteuer. Meine Mutter sagte mir, ich solle zu Hause sein, wenn’s dunkel wird. Im Winter also früh, im Sommer spät, zumindest an den Wochenenden und in den Sommerferien. Die anderen Kinder hatten auch keine genaueren Vorgaben als ich. Wir aßen Kirschen von den Bäumen, später, im Herbst, Äpfel. Wir radelten ins Freibad am Deich, kauften uns an der Bude Pommes rot-weiß und hin und wieder eine Frikadelle, für fünfzig Pfennig Gummizeug, Eis, manchmal sogar beides. Abendbrot aßen wir mal bei dem einen, mal bei der anderen. Wer uns suchte, fand uns dort, wo unsere Räder im Vorgarten lagen. Manchmal dachten wir mit und riefen zu Hause an, um Bescheid zu sagen, von Wählscheibentelefon zu Wählscheibentelefon, die Telefonnummer vierstellig: sieben vier sieben sieben.
Wie alt mögen wir gewesen sein? Acht? Vielleicht neun? Sicher nicht zehn. Das Böse war weit weg, in unserer wunderbaren Schwimmbad-Pommes-Welt und auch im großen weiten Universum. Rocky Balboa kämpfte dagegen, Maverick auch, Colt Seavers, Howie Munson und Jody Banks sowieso, und wir bejubelten sie dafür. Ach, diese Eindeutigkeiten! Hier die Guten, da die Bösen! Begeistert spielten wir diese Kämpfe nach, klärten wie TKKG und Drei Fragezeichen Verbrechen auf, mit Wasserpistolen und Wasserbomben, unsere Fahrräder waren mal Panzer, mal Kampfjet. Sie konnten auch Polizeiauto, Rennwagen oder Pick-up sein, Raumschiff von Captain Future oder, eher bei den Mädchen, Pferd.
Unsere Eltern sagten nichts gegen unsere Spiele. Mag sein, dass manche nicht gut fanden, dass wir Wasserpistolen und Erbsenpistolen und Pistolen mit diesen roten Knallerringen hatten, die immer so gut rochen, wenn man geschossen hatte. Ich bekam davon aber nichts mit. Und soweit ich weiß, ist aus niemandem von uns ein Killer geworden. Ich glaube sogar, niemand von uns besitzt heute überhaupt eine echte Schusswaffe. Wasserpistolen allerdings, finde ich immer noch, gehören in die Grundausstattung eines jeden Menschen.
Insgeheim wünschten wir uns in unserer kindlichen Naivität, dass das Böse zu uns käme, damit wir es bekämpfen und Helden sein könnten, wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Mal einen Mord aufklären! Einem Verbrecher das Handwerk legen! Aber weil das Böse nicht kam und wir mit unseren Fahrrädern nicht zu ihm fahren konnten, fantasierten wir es uns herbei. Vermuteten in diesem oder jenem Haus einen Schatz. Oder irgendeinen Spuk. Sahen in dem griesgrämigen Alten, der in dem düsteren Haus lebte, einen Bösewicht. Oder in dem Lumpensammler, der sein altes, bepacktes Fahrrad – was schleppte er da eigentlich in den Taschen mit sich herum? Diebesgut? Waffen? Einen abgeschnittenen Kopf? – durch das Dorf schob und wirres Zeug knurrte, wenn wir ihm zu nahe kamen.
Woher stammten diese Zuschreibungen? Hatte sie uns jemand in den Kopf gesetzt? Übernahmen wir sie von anderen? Von den Erwachsenen oder von Freunden? Oder entsprangen sie unserer eigenen Fantasie?
Wir suchten das Neue. Das Unbekannte. Das Überraschende. Wir freuten uns über jede Seitenstraße, jeden Hinterhof, jeden Winkel, den wir entdeckten, denn wir sehnten uns nach der Fremde, nach einem Land, in dem uns niemand kannte und wo wir uns behaupten konnten.
Mit zunehmendem Alter kam mir zwar das Gefühl der Unbeschwertheit abhanden; ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Was aber nie verloren ging, war die Sehnsucht nach dieser Freiheit, die ich auf meinem gelben Rad empfunden hatte, Sechzehn-Zoll-Reifen, ohne Gangschaltung, durchs Dorf fahrend, vagabundierend, streunend, ziellos und doch mit dem guten Gefühl, auf einer großen Mission zu sein, nämlich irgendwie die Welt zu retten oder wenigstens irgendwo einen Apfel zu klauen.
Ich beschloss, dieser Sehnsucht nachzugehen. Mich auf den Sattel zu schwingen und in die Freiheit zu radeln, wie damals als Kind, ohne Ziel und doch nicht ohne Plan. Gewiss nicht, um Verbrecher zu jagen oder das Böse aufzuspüren und zu bekämpfen, aber mit der Absicht, das Land zu erkunden, Neues zu entdecken, zu verstehen. Im Grunde genommen, da weiterzumachen, wo ich als Kind aufgehört hatte. Mich im besten Sinne des Wortes gehen zu lassen. In den Tag hinein zu fahren. Ohne festes Ziel, sich in der Welt verlierend, getrieben von der Lust, alles stehen und liegen zu lassen und einfach davonzufahren, gewiss auch eine Art Flucht. Losfahren und schauen, wohin es einen treibt. Wem man begegnet. Dem Zufall Raum lassen. Nicht jeden Tag das Gleiche, immer wieder. Schauen, welche Gedanken von einem Besitz ergreifen. Ein Driften, ein Schweben, fast schwerelos, ich weiß, jetzt übertreibe ich, man verweilt hier, bleibt dort, löst sich wieder, zieht weiter, endlos viel Zeit, frei von Zwängen, ohne Verpflichtungen.
Als Auslandskorrespondent habe ich viele Länder kennenlernen, sie mir systematisch erschließen dürfen: in alle Regionen, Provinzen, Bundesländer reisen, die Regierenden treffen, mit Oppositionellen sprechen, Akteure der Zivilgesellschaft beobachten, Kulturschaffende kennenlernen, Literatur lesen.
Jetzt wollte ich mir endlich Deutschland vornehmen.
Dem Land wie zum ersten Mal begegnen.
Eine Deutschlanderschließung.
Radelnd.
Denn mit dem Fahrrad sieht man viel, bekommt viel mit. Man nimmt Kontakt zu seiner Umgebung, zur Natur, zur Landschaft auf, man ist zu Lande unterwegs, auf dem Boden, geerdet sozusagen, nicht so wahnsinnig langsam wie zu Fuß, weswegen das Wandern nicht meine Art der Fortbewegung ist, aber eben auch nicht so schnell wie mit dem Auto, mit dem man so viel verpasst und übersieht und vorbeirauschen lässt. Und schon gar nicht wie mit dem Flugzeug, wo man innerhalb von Stunden andere Zeitzonen erreicht, das Fortbewegen also gar nicht im wahrsten Sinne des Wortes erfährt oder, genauer, erfliegt, sondern sich wie in eine fremde Welt katapultiert vorkommt.
Mit dem Rad kann man gut hundert Kilometer am Tag schaffen, das ist nicht wenig, aber auch nicht übermäßig ambitioniert, wenn man einigermaßen in Form ist. Am Ende einer solchen Etappe weiß man, was man geleistet hat. Man hat für seine Strecke gearbeitet. Wissenschaftler haben berechnet, dass keine Fortbewegungsart so effizient, dass nirgends der Einsatz von Energie im Verhältnis zur zurückgelegten Strecke so günstig sei wie beim Fahrradfahren. Das will ich gerne glauben! Und dann macht es auch noch so viel Spaß (außer man fährt bergauf oder hat Gegenwind; Regen hingegen macht mir nicht so viel aus)! Die frische Luft! Der Fahrtwind! Die tolle Aussicht! Das Fahrrad lässt Zeit und Raum zum Denken, ohne sich in den Untiefen der Grübelei zu verlieren, weil man dazu dann doch zu sehr aufs Fahren, auf die Straßen und Wege und den Verkehr achten muss. Man findet Ruhe in der Bewegung, Konzentration in der Zerstreuung, Erkenntnis im Entkommen. Das Rad gesteht einem zu, die Umgebung wahrzunehmen und gleichzeitig seinen Gedanken nachzuhängen.
Ich mag Fahrräder. Sie ziehen mich als Objekt an. Wenn schöne Fahrräder vorbeifahren, muss ich ihnen zwanghaft hinterherschauen. Welche Marke? Welches Modell? Welche Ausstattung? Das hat schon zu manchen missverständlichen Situationen geführt. Fahrräder sind eben nicht nur effizient, sondern können auch wahnsinnig schön sein. Sie sind so einfach und so praktisch, technisch ist da kaum noch etwas zu verbessern. In dieser Kombination – Effizienz, Schönheit, Einfachheit, Ausgereiftheit – sind sie geradezu genial. Eine Erfindung des Himmels!
Wunderbar.
Ich besitze mehrere Fahrräder. Ein Luxus, ich weiß, aber einer, den ich mir guten Gewissens leiste. Ich habe alle Räder selbst gekauft im Laufe der Jahre, da ist nichts gesponsert, und schon gar nicht habe ich mir für dieses Buch was schenken lassen von einem Radhersteller, damit ich dessen Produkt noch bewerbe. Ich bin ja nicht … Aber ich will nicht lästern.
So habe ich zwei Räder, die man Reise- oder Expeditionsräder nennt, beide haben einen Rahmen aus Stahl. Das größere davon ist bullig und schwer, wie ein Traktor, wahrscheinlich könnte man damit einen Dschungel durchqueren, jedenfalls hält es sich selbst auf unebenen Schotterpisten ruhig auf der Straße und verzeiht so manches Schlagloch. Das kleinere ist wendig, bergauf geht es damit wie im Flug, mehr Geländewagen. Beide sind toll.
Ich habe auch ein Rennrad, wobei es mehr Alltagsrad mit Rennlenker ist. Es taugt auch für die Stadt, für den Ausflug in den Wald, für die Fahrt über Feldwege. Heute nennt man so etwas »Gravelbike«. Der größte Vorzug dieses Rades ist, dass es unglaublich elegant ist. Ästhetisch kommt da kein anderes Rad ran: anthrazitfarbener Stahlrahmen aus Finnland, Lenker und Sattel aus cognacfarbenem Rindsleder, Gepäckträger und Schutzbleche chromglänzend. Dazu schwarze Slicks, Reifen ohne Profil. Die Einzelteile habe ich mir selbst ausgesucht und zusammenbauen lassen. Zum Reisen ist dieses Rad okay, zum Schnellfahren auch, aber geradezu perfekt ist es zum Flanieren. Zum Sehen und Gesehenwerden. Ein Rad, nach dem sich Köpfe umdrehen, jedenfalls die von Fahrradliebhabern.
Dann ist da noch mein oranges Klapprad, zu dem man heute »Faltrad« sagt, was auch schicker klingt und es wahrscheinlich teurer macht. Was früher eine Angelegenheit für Camper war, ist heute ebenfalls ein Zeichen der Avantgarde. Meines nenne ich »Orange«. Meine Orange begleitet mich auf Lesereisen, sie gilt im Zug als Handgepäck, ich bin also nicht auf einen reservierten Fahrradstellplatz angewiesen. (Das wird sich auch bei meinen Recherchen für dieses Buch als Vorteil erweisen, aber dazu später mehr.) Wenn ich zu Lesungen unterwegs bin, sind das nicht immer die größten Metropolen. Mit der Orange bin ich vor Ort mobil und kann die Umgebung erkunden, unabhängig von oft komplizierten kommunalen Verkehrssystemen oder von nicht vorhandenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Überteuerte Taxitarife lassen mich lächeln – ich bin kostenlos unterwegs. Ich finde, die Kombination Bahn und Faltrad ist ein match made in heaven. Man kommt an und fährt gleich weiter. Fahrpläne? Tarifzonen? Pfff! Besser geht’s nicht.
Aber jetzt bin ich vom Weg abgekommen. Jedenfalls geht es mir auch um Deutschland. Darum, mir mein eigenes Land besser und anders zu erschließen, ein Land, mit dem ich immer mal wieder hadere, das ich aber auch mag – und das ist immer ein bisschen heikel zu sagen, dass man Deutschland mag, man gilt in bestimmten Kreisen ja schnell als was weiß ich, aber Tatsache ist, dass ich Deutschland wirklich mag, ohne was weiß ich zu sein. Darum, Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen auf unser Land kennenzulernen, neue Räume zu verinnerlichen.
Als Suchender unterwegs sein zu dürfen, das ist ein Privileg. Seiner Neugier hemmungslos nachgehen zu dürfen, das ist befriedigend.
Ich habe zwar schon alle Bundesländer bereist, aber kenne ich Deutschland, dieses »alte Wunderland«, diesen »weitläufigen Garten«, wie Mark Twain Deutschland beschreibt*, wirklich? Was weiß ich von den Menschen? Von dem, was sie umtreibt? Was sie als Gesellschaft zusammenhält? Worüber sie streiten? Was diese Gesellschaft spaltet? Und was, um Himmels willen, ist die oft beschworene, aber für mich nie wirklich befriedigend definierte »deutsche Leitkultur«? Was hat der Cuxhavener gemein mit der Bad Schandauerin? Was die Görlitzerin mit dem Duisburger?
Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, habe ich den Eindruck, dass mir dieses Deutschland immer fremder, entrückter, in seinen Debatten seltsamer wird. Überall Drama, überall Zukurzgekommene, überall das Klagen über Ungerechtigkeiten. Die anderen haben’s immer besser! Und warum haben so viele Menschen ständig Angst vor irgendwem? Und schaffen es nicht, ihre Ängste so zu artikulieren, dass sie sie nicht auf ganze Gruppen projizieren, verallgemeinern, Vorurteile bedienen?
Mal drohe ein »Rechtsruck«, eine »konservative Revolution« gar, beklagen manche und verweisen auf Wahlerfolge von Rechtspopulisten. Dann wieder warnen andere vor einer »Ökodiktatur«, vor »Klimafaschisten« und einer »linksgrünen Elite«, die »alles verbieten« wolle und »längst die Agenda« setze, in der Politik, in den Medien, überall, und das machen sie unter anderem an »zunehmender Sprachregulierung« fest.
Aber was stimmt denn nun? Und stimmt es überhaupt?
Ich stelle immer wieder fest, dass es vielen, wenn sie miteinander streiten, nicht darum geht, den anderen für seine Sicht zu gewinnen, ihn zu überzeugen, sondern es geht leider oft darum, den anderen zum Schweigen zu bringen, ihn fertig- oder mundtot zu machen, ihn dumm dastehen zu lassen oder, schlimmer noch, ihm das Leben schwer zu machen.
Ich möchte zuhören, lernen, debattieren, auch mal widersprechen und streiten, klar. Ich möchte mich treiben lassen und Menschen kennenlernen, die vielleicht ganz anders denken als ich. Die eine andere Lebensrealität haben. Als Schreiber muss man auch Welten verstehen, in denen man nicht lebt. Menschen treffen, denen man sonst nicht begegnet. Ich möchte, wie man heutzutage sagt, »raus aus der Komfortzone«, »raus aus der Blase«, mich unterschiedlichen Meinungen und Haltungen aussetzen, mit kritischem Ohr und offenem Herzen. Ich möchte diese unterschiedlichen Menschen fragen, was sie auszusetzen haben an unserer Gesellschaft und wie wir sie ihrer Meinung nach besser gestalten könnten. Ich möchte herausfinden, warum sie denken, wie sie denken. Wie wir Probleme lösen können. Und wie wir, wo es sie gibt, Spaltungen überwinden, Gräben zuschütten, Mauern einreißen können. Oder auch Grenzen ziehen, wenn nötig. Ich möchte nicht in einem geistigen Bunker verharren, sondern dazulernen, meine eigenen Positionen hinterfragen und, wenn nötig, korrigieren.
Auf die Frage »Lieben Sie Deutschland?« hat der dritte Bundespräsident, Gustav Heinemann, geantwortet: »Ich liebe meine Frau.« Für mich ist »lieben« auch ein unpassendes Wort im Zusammenhang mit den Emotionen zu einem Land; es gibt Menschen und Dinge die ich sehr mag, von mir aus: liebe, meine Frau natürlich sowieso; aber es gibt in diesem Land auch Dinge, Gedankengut und, ja, auch Leute, die ich überhaupt nicht schätze. Unterm Strich: Ich mag dieses Land, ich mag die Menschen. Sehr sogar. Ich glaube, die meisten sind nicht böse. Sie drücken sich bisweilen unbeholfen oder unüberlegt aus. Einige sind, glaube ich, ängstlich, frustriert, wieder andere ein bisschen kleingeistig, aber das ist alles menschlich genug, um es hinnehmen zu können. Manche allerdings, befürchte ich, sind tatsächlich menschenverachtend, niederträchtig, böse. Ich möchte herausfinden, ob und inwieweit das wirklich so ist.
Alles in allem mag ich die Art, wie man hier lebt. Ich mag die Möglichkeiten, die dieses Land bietet. Ich mag, dass ich hier zur Schule und zur Universität gehen durfte, ohne dafür bezahlen zu müssen. Ich mag die Vielfalt, die dieses Land durchaus bietet, die Sicherheit, die Natur, die Städte, die Dörfer, vor allem: die Sprache.
Stimmt mein Deutschlandbild?
Um das zu überprüfen und um das Freiheitsgefühl wiederzuerlangen, das mir das Fahrradfahren beschert, kündigte ich beim SPIEGEL, wo ich viele Jahre als Auslandskorrespondent tätig war. Es gab Freunde und Kollegen, die das nicht verstanden. »Wie kannst du so einen Job aufgeben für ein bisschen Fahrradfahren?«, fragte mich eine Kollegin. Ein Kollege merkte an: »Ein Sabbatical hätte doch auch ausgereicht.« Eine andere sagte: »Verstehe deinen Schritt absolut! Viel Glück!«
Ich radele also durch Deutschland. Am besten entlang der Flüsse, wo es – ein sehr deutsches Wort – Radfernwege gibt. Dabei treibt mich kein sportlicher Ehrgeiz. Es muss nicht eine bestimmte Strecke innerhalb einer vorgegebenen Zeit zurückgelegt werden. Ich will keine Rekorde aufstellen, nicht mal eine persönliche Bestzeit erreichen. Und es muss auch nicht die gesamte Strecke mit dem Fahrrad gefahren werden – wo es die Notwendigkeit gibt, hüpfe ich auch mal mit dem Rad in einen Zug. Ich habe Zeit. Ich fahre einfach los. Und spreche mit Menschen, die mir begegnen. Erst die Elbe: lang, sehr lang, das Gebiet drum herum oft dünn besiedelt, geradezu menschenleer. Dann die Ruhr: das Gegenteil von der Elbe, dicht besiedelt, viele Menschen, eigentlich eine einzige Metropolregion. Der Rhein natürlich, wie sollte man Deutschland beschreiben, ohne den Rhein entlanggefahren zu sein? Der längste Fluss des Landes steckt in den Namen gleich zweier Bundesländer, fließt durch vier Bundesländer – Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen – oder sogar durch fünf, wenn man den Bodensee zum Rhein zählt, an dem Bayern immerhin einen Uferanteil hat, das Rheinland ist nach ihm benannt, irgendwie scheint das Rheinische einer ganzen Kultur gleichzukommen. Die Oder und die Neiße, Grenzflüsse, Grenzerfahrungen. Der Neckar, jener Fluss, an dem ich, wie auch an der Elbe, viele Jahre gelebt habe. Und die Donau natürlich, der Fluss, an dem ich jetzt zu Hause bin, allerdings weiter östlich, in Wien.
Und als ich so losfahre, fühle ich mich ein bisschen wie Joseph von Eichendorffs »Taugenichts«: »Ich hatte recht meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links, wie gestern und vorgestern und immerdar, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich.«
* Ich empfehle sehr den Text »Die schreckliche deutsche Sprache« von Mark Twain, in dem er schreibt: »Meine philologischen Studien haben mich davon überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch (außer Rechtschreibung und Aussprache) in 30 Stunden, Französisch in 30 Tagen und Deutsch in 30 Jahren lernen kann.« Zu den Absonderlichkeiten der deutschen Sprache gehörten laut Twain, der im Jahr 1878 während seiner zweiten Europareise auch Deutschland besuchte, kilometerlange Wörter, Sätze, bei denen nach einer Viertelstunde ganz zum Schluss das Verb komme, »und hinter das Verb stellt der Verfasser noch haben sind gewesen gehabt haben geworden sein«. Wunderbar!
HOCH IM NORDEN ENTLANG DER ELBE VON CUXHAVEN NACH BAD SCHANDAU
Losfahren
Früher war nicht alles besser. Die Elbe ist ein gutes Beispiel dafür.
Ich beginne also mit der Elbe. Mit jenem Fluss, an dessen Ufer ich aufgewachsen bin. In den ich als Kind gar nicht so oft meine Füße gehalten habe, weil es hieß, er sei dreckig, ja vergiftet, in der Tschechoslowakei und in der DDR werde weiß Gott welche Brühe eingeleitet. Ein einziges Mal habe ich, zusammen mit einem Schulfreund, in der Elbe geangelt. Wir waren dreizehn Jahre alt, und statt gemeinsam für eine Mathearbeit am nächsten Tag zu lernen, fingen wir einen Aal, der ein blumenkohlartiges Geschwür am Kopf hatte. Die Mathearbeit fiel dann nicht so gut aus. Habe ich bereut, nicht gelernt und stattdessen geangelt zu haben? Schon. Aber von der Mathearbeit weiß ich inhaltlich kaum mehr etwas, an den Aal erinnere ich mich heute noch.
Eine Schulfreundin erzählte mal einen Witz: »Was heißt ›schmutziger Fluss‹ auf Spanisch? El bäh!« War jetzt nicht wirklich lustig, aber wir verstanden schon, was die Alten uns eingetrichtert hatten: besser fernhalten von dieser Brühe namens Elbe.
Ganz abgesehen davon, dass die Schiffe, die an meinem Dorf Hollern-Twielenfleth vorbeizogen, auf dem Weg von Hamburg in die weite Welt, ganz schön große Wellen verursachten, die uns Kinder umwerfen konnten. Was wir, die Warnungen der Erwachsenen ignorierend, allerdings genossen, wenn wir uns am Elbstrand, das Atomkraftwerk Stade in Sicht, doch mal bis zu den Knien ins Wasser wagten. Die Erwachsenen warnten uns außerdem vor »gefährlichen Strömungen« und vor »Strudeln«, und auch wenn ich mir nicht so recht vorstellen konnte, was das bedeutete, verstand ich: Selbst als guter Schwimmer kann man in der Elbe ertrinken. Wenn die Erwachsenen davon redeten, fielen die Worte »stark« und »tückisch«. Das hat sich damals bei mir eingebrannt. Stark und tückisch.
Die Strömungen sind nach wie vor gefährlich. Manche sagen, durch mehrere Elbvertiefungen in der Unterelbe, also zwischen Hamburger Hafen und Mündung, damit immer größere Schiffe den Hafen ansteuern können, sogar noch gefährlicher. Immer wieder gibt es Meldungen von Todesfällen. Aber wahr ist auch: Das Wasser gilt jetzt als viel sauberer, man kann darin baden und, mit aller gebotenen Vorsicht, schwimmen. Elbbadestrände! Wunderbar!
Die Elbe ist, nach dem Rhein, der zweitlängste Fluss innerhalb Deutschlands. (Die Donau ist, über ihre Gesamtlänge, mehr als doppelt so lang wie der Rhein und der zweitlängste Fluss Europas nach der Wolga, aber innerhalb der deutschen Grenzen auf Platz drei.) Als ich über meine Deutschlanderkundungen nachdachte, wurde mir klar, dass ich von meinem Heimatfluss kaum etwas kenne. Ein bisschen was vom Teil hinter Hamburg, weil ich schon mal in Lauenburg war, bis zur Mündung in die Nordsee in Cuxhaven. Im Wesentlichen also die Unterelbe, den gezeitenabhängigen Teil. Ebbe und Flut sind mir seit Kindheit vertraut. Das meiste von der Elbe aber – Oberelbe und Mittelelbe – kannte ich nicht. Also beschloss ich, diesen Fluss als Erstes entlangzufahren.
Sollte ich in die Richtung fahren, in die das Wasser fließt? Also von Bad Schandau in Sachsen hoch in den Norden, bis Cuxhaven? (Zur Quelle in Tschechien, im Riesengebirge, wollte ich nicht, ich wollte meine Touren auf Deutschland beschränken.) Eigentlich empfiehlt sich das, denn das Wasser fließt ja abwärts, man kann also davon ausgehen, dass auch die Radstrecke in diese Richtung eher bergab als bergauf geht. Allerdings rieten mir Freunde, lieber in Cuxhaven zu starten, denn dann sei die Wahrscheinlichkeit größer, Rückenwind zu haben. Als Jugendlicher bin ich mit dem Fahrrad täglich mehrere Kilometer zur Schule gefahren. Ich weiß, was Gegenwind bedeutet.
Cuxhaven also. Ausgerechnet Cuxhaven. Hier, wo die Elbe in die Nordsee mündet, beginnt meine Landeserkundung. In Norddeutschland. Natürlich gibt es eine Unwetterwarnung, wie sollte es anders sein? Sturmtief Ulf fegt über die Region und sorgt für heftige Böen. Dazu dieser Piesel. Furchtbar! Kein richtiger Schauer, kein ordentlicher Guss, da kippt nix runter wie aus Kübeln im Monsun – wenn schon, denn schon! –, sondern Tröpfchen wehen waagerecht und schneiden einem wie eine Wolke aus kleinen Klingen ins Gesicht. Dieser ewige Möchtegernregen, mehr feuchte Luft als Niederschlag! An Tagen ohne Wind stehen die Tropfen einfach dumm in der Gegend rum, und das geht mir gehörig auf die Nerven, weil kein Schirm hilft und auch keine Regenkleidung. Die Tropfen finden immer einen Weg durch die Ritzen bis auf die Haut. Damit muss man hier rechnen, das gehört dazu, ja, Scheiße.
Ich habe Cuxhaven nie gemocht. Cuxhaven ist vom Ort meiner Kindheit ein bisschen weiter entfernt als Hamburg: etwa siebzig Kilometer. Cuxhaven in die eine Richtung, elbabwärts, Hamburg in die andere, elbaufwärts. Cuxhaven, das man wie alle »Havens«, die an der Küste liegen – Wilhelmshaven, Bremerhaven oder eben Cuxhaven, übrigens auch Kopenhagen, auf Dänisch København –, mit v schreibt, während die »Hafens« im Binnenland – zum Beispiel Ludwigshafen oder Friedrichshafen – mit f geschrieben werden, ist ein typisches Beispiel dafür, dass ein Ort nichts dafür kann, ob man ihn mag oder nicht. Cuxhaven hat seine Vorzüge, natürlich. Die Küste, die Nordsee, die Ahnung von der großen weiten Welt dahinter. Nächster Halt: New York. Selbst das kleinste Kaff hat große Bedeutung, wenn es das Tor zu einem großen Meer ist.
Mein Nichtmögen – Abneigung ist vielleicht zu viel – gegenüber Cuxhaven beruht darauf, dass ich schlechte Erinnerungen habe. Mein Vater, in den Sechzigerjahren aus Pakistan nach Deutschland gekommen, als Seemann für eine deutsche Reederei, wurde Mitte der Achtzigerjahre von der Ausländerbehörde in Stade dazu verdonnert, an der Seefahrtschule in Cuxhaven ein Patent zu machen. Wir waren damals noch pakistanische Staatsbürger. Es hieß: Entweder besteht er den Lehrgang und schafft alle Prüfungen – oder wir, er und seine gesamte Familie, müssen Deutschland verlassen. Mein Vater war damals Mitte vierzig, und in diesem Jahr würde er natürlich kein Geld verdienen und seine insgesamt vierköpfige Familie – sich selbst, meine Mutter, meine Schwester und mich – nicht ernähren können. Wir müssten also von Ersparnissen leben und uns von der Verwandtschaft in Pakistan und in den USA helfen lassen.
Mein Vater hat in Cuxhaven sein Patent gemacht. Er hat alle Prüfungen bestanden. Er hat sich dort, obwohl wir kaum Geld hatten, zusammen mit einem anderen Lehrgangsteilnehmer eine Wohnung genommen. Ich erinnere mich, dass wir ihn ab und zu dort besucht haben, in einem ziemlich spießigen Wohngebiet: Unten lebte eine übellaunige Frau mit ihren Kindern, die obere Etage vermietete sie. Mein Vater in einer WG mit einem anderen Seemann – so sehr meine Eltern bemüht waren, uns Kinder nichts spüren zu lassen, war die Stimmung doch gedrückt. Wenig Geld. Die Angst vor der Abschiebung. Die tagelange Trennung vom Vater, obwohl die besser war als seine Seefahrerei, denn da war er monatelang weg.
Deutsche Staatsbürger wurden wir trotzdem noch nicht, sondern hangelten uns weitere fünf Jahre von Aufenthaltsgenehmigung zu Aufenthaltsgenehmigung. Erst 1990 sollten wir, überraschend, eingebürgert werden.
Ich verbinde mit Cuxhaven diese Trostlosigkeit. Dieses uns gegenüber feindselige Behördendeutschland. Dieses Ausgegrenztwerden. Wenig Geld haben, auf den Pfennig achten müssen, die ständige Autofahrerei zwischen Stade und Cuxhaven auf der hässlichen B73, die Angst, meine Freunde und meine Heimat zu verlieren, wenn wir abgeschoben würden.
Natürlich kann Cuxhaven nichts dafür. Mein Urteil ist unfair, es ist nicht mal ein Vorurteil, denn in Vorurteilen – wie zum Beispiel dem, dass man sich vor Autofahrern mit dem Kennzeichen CUX in Acht nehmen müsse, die könnten nämlich nicht Auto fahren und agierten meist erratisch – steckt oft ein wahrer Kern, aber hier beruht alles nur auf meinen dunklen Erinnerungen, nichts auf der Stadt. Cuxhaven ist nicht hässlich, die Menschen sind nicht unfreundlich, das Wetter, nun ja, reden wir nicht darüber, aber die alten Gedanken haben sich in meinem Kopf eingebrannt. Dieses Gefühl von damals. Anders als viele meiner Freunde bin ich deshalb später, als Erwachsener, nie nach Cuxhaven gefahren. Nicht für einen Tagesausflug an den Strand, schon gar nicht für einen längeren Urlaub, obwohl dieses Städtchen gut dafür geeignet ist.
Jetzt ist ein guter Anlass, den Reset-Knopf zu drücken und mit Cuxhaven neu anzufangen. Die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Alles auf null in Cuxhaven. Ich beschließe also, mit dem Zug von Wien nach Cuxhaven zu fahren, mein Reiserad mitzunehmen und dort die Deutschlanderkundungen zu beginnen.
Unerwartet stirbt in Hollern-Twielenfleth wenige Tage vor meiner Abreise ein Familienfreund, der Vater meiner Kindergarten- und Schulfreundinnen Marina und Sabine, und so mache ich einen Abstecher dorthin, um bei der Beerdigung von Heiner dabei sein zu können. Heiner mit dem trockenen Humor. Heiner, der eigentlich Karl-Heinz hieß und sich darüber amüsierte, dass ich mein Buch über Dialoge mit Wutbürgern »Post von Karlheinz« genannt hatte – und der sich kaputtlachte, als ich ihm versicherte, ich sei überzeugt, nicht alle Karlheinze seien schlecht. Heiner, der Polizist, dessen Uniform wir Kinder, vor allem die Jungen, im Dorf bewunderten, von dem wir wissen wollten, wie er Verbrecher festnahm, von dem wir uns vorstellten, wie er sich mit ihnen wilde Verfolgungsjagden lieferte, und den ich bis heute vor Augen habe, wenn wieder einmal die Polizei kritisiert wird. Oft ja zu Recht, aber leider eben oft auch zu undifferenziert und pauschal, denn die Polizei, das war eben auch der feine Mensch Heiner. So ist jeder geprägt von seinem Umfeld.
Mit der Bummelbahn fahre ich nach Cuxhaven. Es ist ein privates Bahnunternehmen, die Deutsche Bahn fährt hier schon lange nicht mehr.
Vor dem Hotel, das ich schon vor Wochen gebucht habe, steht ein älterer Herr und versucht, einen silbernen Koffer aus seinem silbernen SUV zu hieven. An einer Seite seines ansonsten kahlen Kopfes wehen lange silberne Haare im Wind, wie Lametta. Ich kann meinen Blick nicht abwenden von dieser seltsam lustigen Erscheinung. Und dann sehe ich etwas, das mich sehr erfreut: Der Silbertyp greift mit seiner rechten Hand in die rechte Gesäßtasche seiner Jeans, zieht einen braunen Kamm hervor, fährt mit ihm einmal über den Kopf und legt auf diese Weise die langen Haare, die ihm noch an der Seite wachsen, über den ansonsten kahlen Kopf. Wie ein Teppich verbergen sie die Glatze. Lange Strähnen auf glatter Platte. Diese Bewegung geschieht innerhalb des Bruchteils einer Sekunde. Chamäleonhafte Ästhetik, diese Blitzartigkeit und gleichzeitige Geschmeidigkeit, wie die Zunge, die so plötzlich, so unerwartet, so komisch eine Fliege fängt, und wie das Tier, das anschließend wieder in Regungslosigkeit verfällt, als wäre nichts geschehen, als habe es diese Bewegung nie gegeben. In der nächsten Sekunde fliegen die Haare des Mannes wieder von der glatten Platte. Sturmtief Ulf kennt keine Gnade.
Ich beschließe, zwei Tage in Cuxhaven zu bleiben, um mich mit dieser Stadt zu versöhnen. Es riecht nach Meer. Salzig, nach Fisch und Motorenöl, ich mag diesen Geruch. Ein großes Plakat lädt zur »Ü50-Disco« ein, im »Haus der Jugend Cuxhaven«. »Mit der besten Musik der 70er und 80er Jahre.« Musik aus der Zeit, als die Ü50er noch jung waren. Gleich daneben hängt Werbung für den Film »Die Goldenen Jahre«, der »eine Hommage an das letzte Drittel des Lebens« sein soll. »Es ist nie zu spät, sein Glück zu finden«, steht da.
Ich fahre zum Startpunkt meiner Reise, zur Kugelbake, dem Wahrzeichen der Stadt Cuxhaven. Es ist dunkel geworden, und in der Ferne glitzern die Lichter der Leuchtfeuer und Seezeichen. Ein paar Lichter bewegen sich. Schiffe, in See, auf großer Fahrt. Man hört das Brummen eines Frachters, der vor ein paar Stunden Hamburg verlassen haben muss und nun sein Ziel irgendwo in der großen weiten Welt ansteuert. Sehen kann man ihn in der Dunkelheit kaum, nur ein paar Lichter, er scheint riesig zu sein. Ein Containerriese vielleicht? Wo wird er als Nächstes festmachen? Jenseits des Atlantiks?
Ich denke an meinen Vater, der als Kapitän auf Frachtschiffen die Welt befahren hat. Daran, wie oft und schmerzhaft ich ihn als Kind vermisst habe. An seine Postkarten aus Brasilien und Südafrika und Hongkong und Japan.
Die Kugelbake heißt Kugelbake, weil etwas unterhalb der Spitze eine kleine Kugel angebracht ist. Baken sind Türme aus Holz, die entlang der Küste vor Gefahren wie Untiefen oder Sandbänken warnen oder Hafeneinfahrten oder Flussmündungen kennzeichnen. Heute würde man für so etwas kein Holz mehr verwenden, die Witterung und das Wasser setzen dem Turm zu, er gammelt weg, alle paar Jahrzehnte muss er erneuert werden. Die Cuxhavener Kugelbake hat überlebt, außer dass sie zum Beispiel beim Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 sowie im Ersten Weltkrieg aus taktischen Gründen abgebaut wurde, um dem Feind die Orientierung zu erschweren. Geplant vom Hamburger Rat im Jahr 1703 nach einer heftigen Sturmflut und vermutlich im selben Jahr erbaut, ist die fast dreißig Meter hohe Kugelbake heute ein schützenswertes Denkmal und auf dem Stadtwappen von Cuxhaven zu sehen. Sie markiert die geografische Trennung zwischen Nordsee und Elbe. Aus nautischer Sicht geht die Elbe allerdings noch weiter, nach dieser Betrachtungsweise trennt die Kugelbake Außenelbe und Unterelbe. Wie auch immer, hier ist eine der meistbefahrenen Seestraßen der Welt. Containerriesen, Schwergutfrachter, Tanker, Kreuzfahrtschiffe, Motor- und Segelyachten, Kriegsschiffe, die Hamburg ansteuern oder von dort in die Welt hinausfahren.
Seit Jahrhunderten ist die Kugelbake für Seefahrer das Erste, was sie von Deutschland sehen. Land in Sicht!
Für Auswanderer war sie das Letzte, was sie von ihrer alten Heimat sahen: ein Abschiedspunkt, ein letzter, vielleicht wehmütiger, trauriger, vielleicht aber auch glücklicher, erleichterter Blick auf das, was man dort zurückließ. Es gab Zeiten, in denen Zigtausende Menschen von hier aus Deutschland verließen, auf der Suche nach Glück oder zumindest einem besseren Leben, auf der Flucht vor Armut, Hunger oder Krieg oder allem zusammen. Die Motive, alles stehen und liegen zu lassen und der Heimat den Rücken zu kehren, waren früher dieselben wie heute.
Wie schnell wir vergessen.
Heute gilt Deutschland als das gelobte Land, in das Menschen aus vielen, meist armen, meist kriegsgeschundenen Ländern flüchten. Vergleichbare Flucht- und Migrationsbewegungen wie heute gab es schon immer. Damals waren es Menschen aus Deutschland, die migrierten. Flucht und Migration sind so alt wie die Menschheitsgeschichte. Ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, dass inzwischen »fast eine halbe Million Afghanen bei uns leben«, dazu einige kritische Kommentare von Politikern, denen das »zu viel« und »eine Überforderung der Gesellschaft« ist.
Ich radele zu den Hapag-Hallen, einem denkmalgeschützten Gebäudekomplex im Hafen von Cuxhaven. Der Reeder Albert Ballin, Generaldirektor der Hamburg-Amerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (Hapag), die unter ihm zur größten Schifffahrtslinie der Welt wuchs, ließ diese Hallen Ende des 19. Jahrhunderts in Cuxhaven bauen, weil die Auswandererschiffe immer größer wurden und Cuxhaven einfacher angelaufen werden konnte als Hamburg.
Die Hapag-Hallen zeugen von der massiven Auswanderung aus Deutschland. Seit dem 18. Jahrhundert emigrierten sieben Millionen Deutsche in die USA, alleine zwischen 1815 und 1914 rund 5,5 Millionen. In dieser Zeit wuchs die deutsche Bevölkerung von 20 Millionen auf 56 Millionen Einwohner. Nicht alle davon verließen Deutschland über Cuxhaven, aber doch viele.
Die Auswanderung erfolgte in Wellen, aus unterschiedlichen Gründen wie Missernten und Hungersnot, politischen Verwerfungen, dem zum Teil starken Wachstum der Bevölkerung, Wirtschaftskrisen und Krieg. »Wirtschaftsflüchtlinge!«, oft. Nicht wenige Menschen verließen Deutschland auch illegal, in erster Linie junge Männer, die sich der Wehrpflicht entziehen wollten. Es gab Zeiten, in denen gingen jährlich mehr als 100 000 Menschen fort aus Deutschland.
Auch heute, lese ich, wandern jedes Jahr Menschen aus Deutschland aus, in manchen Jahren 200 000 und mehr. Jetzt, um Karriere zu machen oder auf der Suche nach Glück, wie immer es auch aussehen mag. Viele bezeichnen es nicht als »Auswanderung«, sondern sehen es, wie ich, als »Umzug« an, und zwar zufälligerweise in ein anderes Land, in meinem Fall: Österreich. Ich glaube, das meinen die Leute, wenn sie sagen: Die Welt ist kleiner geworden. Früher war es eine große Sache, wenn jemand aus seinem Dorf in die nächste Großstadt zog. Heute ist es zumindest nicht ungewöhnlich, wenn Menschen auf einen anderen Kontinent übersiedeln.
Während der bevorstehenden Reisen durch Deutschland werde ich mich noch oft genug von irgendwelchen Riegeln ernähren, am ersten Abend aber soll es etwas Besonderes sein. Ich beschließe – natürlich! Cuxhaven! –, Fisch zu essen. Zufällig entdecke ich ein Lokal, das sich als »ältestes Fischrestaurant Cuxhavens« bezeichnet.
Ich schaue mir das Angebot an. Ganz schön heftige Preise. Offensichtlich sind die auch der Wirtsfamilie unangenehm, unter den Krabbengerichten steht: »Wir versuchen weitgehend die einheimische Krabbenwirtschaft zu fördern und Krabben bei hiesigen Fischern und Händlern einzukaufen. Aufgrund der extremen Situation bei den Krabbenpreisen mussten wir die Preise leider nach oben anpassen. Bei sinkenden Einkaufspreisen bei unseren Fischhändlern werden wir diese wieder nach unten korrigieren.« Preisscham. Immerhin. Viele Geschäfte hauen ja drauf, dass es kracht, völlig ungeniert.
Am nächsten Tag fahre ich erst zum Alten, dann zum Neuen Fischereihafen. Cuxhaven ist einer der größten Fischereihäfen Deutschlands, früher gab es hier sogar einen – welch bemerkenswertes Wort! – Fischversandbahnhof. Geschäftiges Treiben, an Bord der Fischkutter gibt es immer etwas zu reparieren, zu putzen, vorzubereiten. Ich mag es, den Fischern dabei zuzuschauen. Einer schleppt ein Netz von Bord, wahrscheinlich ist es gerissen und nicht mehr zu gebrauchen. Sein Schiff ist eines der kleineren, es ist alt und wirkt im Vergleich zu den modernen, großen Schiffen wie aus der Zeit gefallen.
»Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen?«, spreche ich ihn an.
»Na klar!«, antwortet er, und ich bin überrascht, weil ich eher einen wortkargen, knorrigen Charakter erwartet hätte. »Was brennt dir denn auf der Seele?«, fragt er mich fröhlich.
»Also, ich war gestern in einem Fischrestaurant, und da rechtfertigten sie ihre gestiegenen Preise und …«
Ich brauche meine Frage gar nicht zu stellen, er weiß, was ich wissen will, und fällt mir ins Wort.
»Dat kann ik di vertellen, wat dat Probleem is. Wi hebbt to wenig Fisch und to veel Minschen.«
Ich mag diese Selbstverständlichkeit, mit der er Plattdeutsch spricht und annimmt, dass ich ihn verstehe. Er scheint mir die Überraschung über seine Redefreudigkeit anzumerken.
»Dor kiekst du, wat?«
Und dann erzählt er ausführlich über die Probleme, die er sieht. Dass es immer weniger Fische gebe. Dass sie immer weniger fangen dürften. (»Dat is ok richtig so mit den Fangquoten und so.«) Aber dass gleichzeitig die Nachfrage nach Meeresfrüchten immer weiter steige. »Es gibt ja auch immer mehr Menschen auf der Welt. Früher war Seelachs der billigste Fisch. Jetzt ist er teurer als Rotbarsch. Sowas hab ich noch nie erlebt, und ich bin schon lange in diesem Beruf!«
Und was wäre seiner Meinung nach die Lösung?
Er denkt nach.
»Weniger Menschen, mehr Fisch.«
Ich glaube, es ist heilsam, sich den Orten seiner Vergangenheit zu stellen. Ich fahre deshalb am nächsten Morgen, kurz bevor ich Cuxhaven zu verlassen gedenke, zur Seefahrtschule. Das Gebäude sieht immer noch so aus, wie ich es aus meiner Kindheit in Erinnerung habe: ein brauner Klotz mit einem etwas erhöhten Bau, dessen Dachgeschoss aussieht wie eine Schiffsbrücke. Vor dem Eingang steht eine grüne Boje, darauf der Schriftzug: »Staatliche Seefahrtschule«.
Manchmal, wenn ich meinen Vater besuchte und er noch im Unterricht saß, ging ich in den Keller des Gebäudes, wo es ein Becken gab, in dem ferngesteuerte Boote und Schiffe fuhren. Verrückt, wie mit einem bestimmten Ort, einem bestimmten Geruch, einer bestimmten Geräuschkulisse, einem bestimmten Licht bestimmte Gefühle wieder hervorkommen, aus der Tiefe der Seele, wo sie Jahrzehnte vergraben waren! Es ist alles noch wie vor vierzig Jahren. Ich fühle mich in der Zeit zurückversetzt.
Geduldeter Ausländer!
Bald wirst du abgeschoben!
Du bist nur Gast in unserem Land, und dafür hast du dankbar zu sein!
Und gleichzeitig diese Faszination für die originalgetreuen Schiffsmodelle. Da unten im Keller vergaß ich meine Sorgen, mit denen ich als Kind ziemlich alleine war. Ich konnte diese Ängste, die ich ganz klar empfand, noch nicht in Worte fassen und deshalb nicht darüber sprechen.
Vor der Seefahrtschule stehen junge Männer und rauchen. Ich glaube, unter Seefahrern ist das Rauchen immer noch weit verbreitet. Im Flur des Gebäudes stehen Gruppen von Schülern, alles Männer, unterhalten sich. An den Wänden hängen Plakate, die für eine Karriere in der Seefahrerei werben.
Die Tür zum Sekretariat steht offen. Eine Frau telefoniert. Als sie fertig ist, schaut sie auf. »Wie kann ich weiterhelfen?«
Ich erzähle ihr, dass mein Vater hier vor vielen Jahren zur Schule gegangen ist. »Unten gab es damals einen Raum mit ferngesteuerten Booten und Schiffen, in einem Becken. Darf ich mir das mal anschauen?«
»Oh, das gibt es schon lange nicht mehr«, antwortet sie. »Das Becken ist zwar noch da, aber da gibt’s keine Modelle mehr. Die, die das betreut haben, sind nicht mehr an der Schule.«
Damit ist das Schöne, das ich mit diesem Ort verband, verschwunden.
Ich brauche jetzt etwas, um meine Stimmung zu heben. Mir helfen in solchen Situationen am besten Besuche in Bibliotheken oder in Buchhandlungen. Ob ein Ort lebenswert ist, steht und fällt für mich unter anderem mit dem Vorhandensein von Buchläden – je mehr, desto besser! – und Büchereien, und Cuxhaven besteht diesen Test.
Ich leide unter Tsundoku. Das ist ein japanisches Wort für die Angewohnheit, mehr Bücher zu kaufen, als man lesen kann. Wörtlich setzt sich der Begriff aus den japanischen Wörtern für »stapeln« und »lesen« zusammen: Man erwirbt Lektüre, die sich dann stapelt, ohne gelesen zu werden. Oder um später gelesen zu werden. Genau genommen, ist »leiden« das falsche Wort: Ich leide nicht darunter. Im Gegenteil. Ich liebe meine Bücherstapel. Nur habe ich zu wenig Platz. Richtiger ist: Ich habe Tsundoku. Schön, dass jede Sprache ihre eigenen, besonders ausdrucksstarken, treffenden Begriffe hat.
Kaufen kann ich jetzt ohnehin keine Bücher, in meine zwei Fahrradtaschen passt nichts mehr rein, und Lesestoff habe ich schon von zu Hause mitgenommen. Ich möchte mich für die bevorstehenden tausend Kilometer nicht überlasten. Also beschließe ich, die Stadtbibliothek aufzusuchen. Hier war ich mal zu einer Lesung eingeladen, die aber wegen der Pandemie nicht zustande kam. Ich setze mich in einen Sessel und lese ein paar Seiten in »Die schreckliche deutsche Sprache« von Mark Twain, ein wunderbar komisches Buch. Dann stehe ich auf und gehe zu der Mitarbeiterin, die am Infoschalter sitzt.
»Guten Tag, ich …«
»Sie sind doch der Autor, oder?«, fragt sie mich.
Ich sage ihr meinen Namen und erzähle von der Lesung, die nicht stattgefunden hat.
»Hab ich mir doch gedacht, dass Sie das sind! Das ist ja schön, dass Sie uns jetzt besuchen!«
Sie zeigt mir die Bibliothek, und ich erzähle ihr von meinen bevorstehenden Reisen durch Deutschland und warum ich jetzt in Cuxhaven bin.
»Schönes Vorhaben!«, sagt sie. »Vielleicht mögen Sie ja daraus hier lesen, irgendwann?«
Es ist eisig kalt, unter null Grad, der Himmel ist strahlend blau. Ich bin warm gekleidet, aber nicht zu warm, sonst fängt man beim Fahrradfahren an zu schwitzen. Die alte Radfahrerregel, dass man richtig angezogen ist, wenn man beim Losfahren leicht fröstelt, passt. Ich radele jetzt Richtung Osten, von der Elbe ist noch nichts zu sehen, dafür riesige Hallen, in denen unterschiedliche Firmen Fisch verarbeiten. Geschäftiges Treiben, Lastwagen, Gabelstapler, Leute, die hin und her laufen. Zwischen den Hallen Fischrestaurants und Geschäfte, in denen man Fisch kaufen kann. Fisch, Fisch, Fisch. Dann kommt man an die Elbe. Der Elberadweg führt an Salzwiesen vorbei, einem Lebensraum, der hier an der niedersächsischen Nordsee- beziehungsweise Elbküste auf natürliche Weise entsteht: Ebbe und Flut prägen die Landschaft, und bei jeder Flut werden verschiedene Stoffe angeschwemmt und abgelagert, sodass das Marschland aus dem Meer herauswächst. Sturmfluten wiederum reißen Land mit sich. Die hiesige Landschaft ist nicht beständig, alles ist vergänglich, ihre Form, ihre Beschaffenheit, ihre Existenz. Die Flächen sind dem Salzwasser ausgesetzt, nur bestimmte Pflanzen überleben hier, wie Strandaster, Strandgrasnelke, Strandbeifuß. Auf der einen Seite sind die Grünflächen von der Elbe begrenzt, auf der anderen Seite vom Deich. Immer wieder begegne ich Schafherden, die dort grasen und den Deich durch ihr Getrampel festigen. Hunde halten die Herden zusammen und beobachten mich genau, dass ich mit dem Fahrrad ja nicht zu nahe vorbeiradele an ihren Schützlingen.
Hochwasserschutz, denke ich, ist ganz schön lowtech, so simpel und doch ziemlich effektiv. Archäologische Untersuchungen in den Jahren 2008 und 2009 haben hier eine kontinuierliche Deichentwicklung von rund 800 Jahren nachweisen können. Sie ist an der regelmäßig vorgenommenen Erhöhung der Deichkrone zu erkennen. Solch nahezu ungestörte Deichbauschichten über einen Zeitraum von acht Jahrhunderten konnten entlang der deutschen Nordseeküste an keiner anderen Stelle aufgedeckt werden, was den »Alten Hadler Seebandsdeich« zu einer archäologischen Besonderheit macht, lese ich auf einem Schild.
Auf den Sandbänken da draußen, sagen mir Leute, die hier mit Ferngläsern unterwegs sind, kann man manchmal Seehunde sehen, mit viel Glück auch mal Schweinswale, die zum Luftholen an die Wasseroberfläche kommen. Ich sehe an diesem Tag: nichts.
Man kann, zumindest im Herbst und im Winter, von Cuxhaven beginnend die Elbe entlangradeln und einen ganzen Tag lang keiner Menschenseele begegnen. Ich fahre auf der niedersächsischen Seite der Elbe. Drüben ist Schleswig-Holstein – terra incognita, so nah und doch so fern. Die Elbe als Grenzfluss, sie ist hier ziemlich breit, noch immer spürt man die Nordsee, den Atlantik, die große Welt. Ein Wechsel der Uferseiten ist daher nicht so einfach möglich. Keine Ahnung, wo die nächste Fähre fährt, wo der nächste Tunnel ist oder die nächste Brücke. Wahrscheinlich sehr weit weg.
Auf der anderen Seite sehe ich innerhalb kurzer Zeit zwei kuppelförmige Gebäude: die Atomkraftwerke Brunsbüttel und Brokdorf – oder das, was von ihnen noch übrig ist. Brunsbüttel liegt an der Mündung zur Nordsee, das Kraftwerk wurde in den Siebzigerjahren gebaut, ging 1977 in Betrieb, galt als eines der störanfälligsten in Deutschland und wurde 2007 abgeschaltet. Brokdorf wurde erst 1986 in Betrieb genommen und lief bis 2021, es war eines der leistungsstärksten Kernkraftwerke Deutschlands und hatte, so lese ich es im Netz, 2005 mit knapp 12 000 Gigawattstunden die größte Strommenge weltweit produziert.
Ich weiß, dass innerhalb der nächsten Kilometer zwei weitere Atomkraftwerke zu sehen sein werden: Stade, denn da bin ich aufgewachsen, und das Kernkraftwerk Krümmel in Geesthacht. Ich schreibe hier bewusst mal Atomkraftwerk, mal Kernkraftwerk, denn irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass Gegner dieser Form der Energieerzeugung Atomkraftwerk sagen und Befürworter Kernkraftwerk, und ich möchte mich auf keine Seite schlagen. Das Thema wird mich aber an der Elbe noch ziemlich beschäftigen.
Jetzt jedenfalls habe ich ein Ziel vor Augen: Kehdingen, im Landkreis Stade. Ich komme an einem Restaurant vorbei, das am Deich steht. Auf einer riesigen Plane, so breit wie das gesamte Gebäude, steht: »Feuer unterm Arsch? Wir suchen: Verstärkung in Voll- und Teilzeit. Köche (m/w/d), Jungköche (m/w/d), Servicepersonal (m/w/d), Serviceleitung (m/w/d), Küchenhilfen (m/w/d), 450-Euro-Kräfte (m/w/d), Barmit-arbeiter (m/w/d). Bewirb dich jetzt!«
Schon in Cuxhaven hatte ich den Eindruck, dass es überall an Personal fehlt. An jedem dritten Laden hing ein Zettel, dass Arbeitskräfte gesucht werden. In dieser Dimension sehe ich es nun zum ersten Mal.
Ich fahre durch das Örtchen Otterndorf. An der Kirche liegen zwei Kränze unter einem Kreuz, links neben dem Kreuz die Zahlen 1914 und 1918, rechts davon 1939 und 1945. Die Kriege wirken nach. Man gedenkt seiner Vorfahren, die ihr Leben lassen mussten.
Als ich die Grenze von Cuxhaven nach Stade überquere, bekomme ich ein Gefühl dafür, wie groß Deutschland eigentlich ist. Im amtlichen Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamtes habe ich gelesen, dass es 294 Kreise beziehungsweise Landkreise und 107 kreisfreie Städte gibt. Nicht alle sind so riesig wie die Landkreise Cuxhaven und Stade, manche dafür noch größer, man kann also auf jeden Fall viel Fahrrad fahren in Deutschland und hat noch immer nicht alles gesehen. Ich googele: Der größte Landkreis in Deutschland ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit knapp 5500 Quadratkilometer Fläche (und damit übrigens größer als der Staat Brunei und siebenmal so groß wie Bahrain), der kleinste der Main-Taunus-Kreis in Hessen mit 222 Quadratkilometern (und damit etwa so groß wie Amerikanisch-Samoa).
Bis zu meinem heutigen Ziel ist es jedenfalls noch weit, denn der Landkreis Stade ist, gefühlt, ein ganzes Reich. Ich weiß aus meiner Kindheit, dass man, wenn man von einem Rand zum anderen fahren möchte, mit dem Auto eine halbe Ewigkeit unterwegs ist und früher, zu Pferde oder mit der Kutsche, tagelang auf Reisen gewesen sein muss. Also strampele ich und strampele, und natürlich kommt an diesem ersten Tag der Wind nicht von hinten, wie mir alle versichert haben, die mir dazu geraten haben, stromaufwärts zu fahren, sondern er bläst mir eiskalt ins Gesicht und macht das Fahren mühsam. Ich muss aufpassen, dass ich nicht stürze, denn auf dem Radweg hinterm Deich haben sich Eisflächen gebildet.
Kehdingen, heißt es auf Wikipedia, ist ein »Naturraum in Norddeutschland. (…) Die Landschaft Kehdingens wird bestimmt durch Marsch- und Moorländereien.« Ich möchte zur Elbinsel Krautsand fahren, in der Gemeinde Drochtersen, im Herzen von Kehdingen. Wie eine Insel kommt mir Krautsand nicht vor. Mal höre ich, sie soll vor langer Zeit »in der Mitte der Elbe gelegen« haben, dann wieder erklären mir Leute, das sei »immer noch eine Insel«, und verweisen auf die Elbe auf der einen Seite und auf irgendwelche Flüsschen, die eher Wasser führenden Gräben gleichen, auf den anderen Seiten.
Einer der bekanntesten, nun ja, Inselbewohner ist Jonas Kötz, Illustrator und Bildhauer. Ich kenne ihn nicht persönlich, habe aber von ihm gehört, seine Bilder gesehen – er hat mehrere Kinderbücher und viele Pixibücher gestaltet. Außerdem ist er bekannt für seine Knollnasenfiguren, kleine dicke Männer und, seltener, Frauen, die er aus alten Dalben aus dem Hamburger und Bremer Hafen sowie aus alten Balken von Fachwerkhäusern schnitzt, aus Bongossi oder Eiche. (Unter Dalben versteht man in den Hafengrund gerammte Pfähle, die als Markierungen und Abgrenzungen dienen.)
Auch Jonas’ Frau Ami ist Künstlerin. Beide kommen aus Hamburg-Blankenese, leben aber seit vielen Jahren in, nein, pardon: auf Krautsand. Jonas nennt es »am Ende der Welt«. Sie wohnen in einem alten Reetdachhaus mit dazugehöriger, zum Atelier und zur Werkstatt umgebauter Scheune. In einer »Lifestyle«-Zeitschrift würde es wahrscheinlich als »ländliches Idyll« beschrieben werden.
Wieso zieht man hierher, in eine Gegend, wo der nächste Nachbar weit entfernt ist, wenn man in Hamburg groß geworden ist? Beide lachen bei dieser Frage.
»Zufall«, sagt Jonas.
»Ja, Zufall«, sagt Ami.
Mitte der Neunzigerjahre begleiteten sie einen Freund, der sich ein Haus in der Nähe anschauen wollte. In einer Broschüre des Maklers war auf der Rückseite dieses Haus abgebildet. Eher aus Spaß schauten sie es sich an – und so nahm die Geschichte ihren Lauf, 1995 zogen sie von Hamburg nach Krautsand.
»An so einem Haus gibt’s eigentlich immer was zu tun«, sagt Jonas. »Das ist nie fertig.« Und was so etwas koste! »Also, da darf man gar nicht so genau drüber nachdenken«, sagt er.
Jonas hat in Hamburg Kommunikationsdesign studiert. »Gezeichnet hab ich schon in der Schule, weil mir oft so langweilig war.« Er wurde Illustrator, und mit dem Umzug nach Krautsand begann er auch mit der Bildhauerei: eben jenem kleinen dicken Mann, den er vorher schon gezeichnet hatte. »Diese Figur mochte ich irgendwie.«
Jonas hat nicht gezählt, wie viele dieser Skulpturen er schon geschnitzt hat. Manche sind nur ein paar Zentimeter groß, andere mehrere Meter. Jedenfalls kaufen die Leute die Figuren wie verrückt: Privatleute, Promis, Firmen, Gemeinden. Man sieht sie auf öffentlichen Plätzen, auf Pfählen stehend in Gewässern, in Galerien und in Häusern von Kunstsammlern oder von Leuten, die damit einfach ihr Zuhause schmücken. Besser kann es für einen Künstler kaum laufen: Man macht, was einem gefällt, und die Leute bezahlen dafür. Jonas kommt den Aufträgen kaum hinterher.
Welch ein Glück, oder?
»Ist schon irre, ich würde fast sagen: ein Wunder, dass ich davon leben und eine Familie ernähren kann«, sagt Jonas. »Und das schon ganz schön lange mittlerweile.« Wenn er etwas kauft oder eine Reparatur am Haus bezahlen muss, rechnet er inzwischen in Figuren. »Ich frage mich dann: Wie viele Figuren muss ich dafür schnitzen?« Das Schöne sei ja, dass er »quasi ein Monopol« habe. »Und je mehr Leute diese Figuren wollen, desto teurer werden sie.« Er lacht. Ganz schön kapitalistisch, könnte man meinen, aber Jonas ist, das ist mein Eindruck, einfach nur pragmatisch. Und er arbeitet hart für seinen Erfolg. »Es ist nicht so, dass ich hier im Nachthemd stehe und nur was mache, wenn mich die Muse küsst.« An seiner Arbeit schätze er die Freiheit, die er habe. »Ich kann machen, was ich will. Und ich arbeite hier alleine, ohne dass mir jemand reinredet.«
Jonas sagt, er würde sich als »politisch links« bezeichnen. »Ich war nach dem Abi ein Jahr zum Schafescheren in Australien und hab Zivildienst gemacht, was soll ich noch sagen?«
Seine Kunst ist unpolitisch. Dem politischen Menschen Jonas Kötz, der in allen möglichen Vereinen aktiv ist, zu vielen Dingen ziemlich deutlich seine Meinung sagt (was ihn im Ort nicht nur beliebt macht) und sich für eine Fahrradfähre einsetzt (womit er sich bislang jedenfalls nicht durchgesetzt hat, weshalb ich auf dem Weg zu ihm einen elendig langen Umweg fahren musste), macht das nichts. »Mich macht es immer noch glücklich, wenn ich diese Figuren aus dem Holz hole. Für mich sind die da schon drin. Ich muss sie da nur rausholen.«
Manchmal denke ich: Ich sollte vielleicht unpolitischere Texte schreiben. Dann verärgert man nicht ständig Leute und macht sich nicht so viele Feinde. Jonas hat kürzlich auch politische Figuren geschnitzt, sie stehen in seiner Werkstatt: ein Trump, dem man den hölzernen Skalp mit der Frisur wegklappen kann; da, wo das Gehirn hingehört, befindet sich eine Erbse. Und ein Erdogˇan, samt Ziege. Wunderbare Figuren! Sie schmücken seinen Arbeitsplatz, es sind, glaube ich, therapeutische Stücke, mit denen er sich mit Lust und Freude den Frust von der Seele kloppte.
Auch Ami macht Kunst, eine, die einerseits sehr in die Region passt und andererseits so gar nicht von hier ist: gyotaku. Gyotaku ist die traditionelle japanische Kunst des Fischdrucks. Ursprünglich, als es noch keine Fotos gab, machten Fischer einen schnellen Abdruck von ihrem Fang, um den potentiellen Kunden zeigen zu können, was sie da auf Lager hatten: Entstanden sein soll diese Form der Gebrauchskunst vor etwa 200 Jahren in einem Fischerdorf im Süden Japans, wo die Fischer Reispapier, Pinsel und ungiftige Tinte auf ihre Touren mitnahmen, um die Fische mit Farbe zu bestreichen, sie aufs Papier zu drücken und die Tinte anschließend wieder abzuspülen. Daraus ist eine Kunst entstanden, die Ami Kötz begeistert. Im oberen Geschoss ihres Bauernhauses haben die Kötzens ein Atelier, in dem Jonas zeichnet und Ami Gyotaku betreibt.
»Natürlich verwende auch ich ungiftige Tinte, die man wieder abwaschen kann. Dann gibt’s Fisch«, sagt sie.
»Bei uns gibt’s oft Fisch«, sagt Jonas.
Gyotaku, erzählt Ami, erfordere eine gewisse Übung: das richtige Papier, im richtigen Maß befeuchtet, der richtige Druck, die richtige Menge Farbe auf dem Fisch. »Mittlerweile hab ich’s raus«, sagt sie. Die Bilder sind, wenn sie gelingen, naturgemäß originalgetreue Abbildungen der Fische.
Auch irre, dass diese urjapanische Kunst jetzt auf Krautsand entsteht, an der Elbe. Es ist »kulturelle Aneignung« im besten Sinne: Jemand sieht etwas, das ihm gefällt, lernt, macht nach, entwickelt weiter, betreibt selbst, gibt wiederum weiter. Kunst ist Kultur ist Veränderung ist Leben. Vielleicht schnitzt irgendwann jemand in einem japanischen Dorf kleine, dicke, knollnasige Holzmänner?
»Habt ihr eigentlich Angst vor Sturmfluten?«, frage ich Ami und Jonas. Bis zum Deich sind es von ihrem Haus nur ein paar Meter, ein paar Meter weiter dahinter: die Elbe.
»Angst nicht, aber man macht sich seine Gedanken«, sagt Ami.
»Wir kennen das ja schon«, sagt Jonas. »Für mich gehört das zum Leben an der Elbe dazu.« Der Elbe, die er »meinen Fluss« nennt.
Sturmfluten spielten hier tatsächlich schon immer eine Rolle. Sie bedeuteten zerstörte Häuser, ertrunkenes Vieh, oft auch Todesopfer unter der Bevölkerung. Überflutete Äcker und Felder bedeuteten, dass die Ernte ausfiel und die Menschen hungern mussten. Fluten brachten Insektenplagen und damit das Marschenfieber, eine Form der Malaria, die die Menschen entlang der Küste dahinraffte.
Die Wassermassen, die vom 24. auf den 25. Dezember 1717 über die Nordseeküste hereinbrachen, stellten alle vorhergegangenen Fluten in den Schatten. Das Wasser schlug über die Deiche und verwüstete die Region bis tief ins Landesinnere hinein. Mehr als hundert Menschen ertranken.
Die Flut von 1825 wiederum gilt als die folgenreichste Naturkatastrophe des 19. Jahrhunderts, sie betraf die gesamte Nordseeküste von Holland bis nach Jütland. Zum Glück hatte man vorher die Deiche erhöht, sodass ein größerer Schaden ausblieb. Allerdings hungerten viele Menschen in der Folge, weil es an Süßwasser mangelte und auch an Futter für das Vieh.
Ich erinnere mich, dass während meiner Kindheit die Erwachsenen oft von der Sturmflut von 1962 erzählten. Dieses Ereignis hatte sich in der Region im kollektiven Gedächtnis verankert: wie Sturm aufkam in der Nordsee; wie diese Information in einer Zeit, als es noch keine Wettersatelliten gab, zu spät eintraf; wie der Orkan Vincinette in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962, von Freitag auf Samstag, über Norddeutschland hinwegfegte und die Wasserpegel an Elbe und Weser steigen ließ; wie die Deiche, die noch nicht so hoch und so fest waren wie heute, dem Druck der Wassermassen nicht standhielten und an Dutzenden Stellen brachen. Vor allem das Gebiet entlang der Unterelbe, von Cuxhaven bis Hamburg, war betroffen: Häuser standen unter Wasser, Menschen wurden fortgerissen, ertranken in den Fluten oder starben in einstürzenden Gebäuden. Insgesamt 340 Menschen fanden den Tod. Besonders schlimm traf es Hamburg, allein dort starben 315 Menschen. Tausende verloren ihre Wohnungen und Häuser.
Der damalige Innensenator Hamburgs, der SPD-Politiker Helmut Schmidt, beorderte nicht nur die Polizei zu den Rettungsaktionen, sondern bat auch die Bundeswehr und die Nato um Hilfe. Als Bundestagsabgeordneter und Verteidigungsexperte hatte er gute Kontakte zu den Generälen. »Ich habe die alle einfach selbst angerufen oder mit Funksprüchen oder Fernschreiben in Bewegung gesetzt. Ich habe gesagt: ›Sie müssen Hubschrauber schicken, Sie müssen Pioniere schicken, die mit Sturmbooten die Menschen von den Dächern runterholen‹«, erzählte Schmidt einmal dem NDR. »Die haben zunächst geglaubt, ich sei verrückt geworden. Weil sie mich aber gut kannten, haben sie auf mein Insistieren hin schließlich sehr schnell funktioniert.«
Was bemerkenswert ist: Der Einsatz der Bundeswehr im Inneren war nach damaliger Gesetzeslage rechtswidrig. Schmidt wusste das. »Wir haben uns nicht an Gesetz und Vorschriften gehalten, wir haben möglicherweise die Hamburger Verfassung verletzt, wir haben sicherlich am Grundgesetz vorbei operiert. Es war ein übergesetzlicher Notstand«, begründete Schmidt sein Vorgehen später. Mit anderen Worten: Was Schmidt tat, war zwar nicht Recht, aber richtig. Das brachte ihm damals weit über Hamburg und Norddeutschland hinaus Anerkennung ein, und wie wir wissen, wurde er später noch Bundeskanzler. Ich frage mich, wie man heute mit einem Politiker oder einer Politikerin umgehen würde, der oder die zwar nicht rechtens, aber richtig handelt. Würde man den Notstand sehen, das umsichtige Handeln und die Entschlossenheit belohnen und den mutigen Krisenmanager feiern? Oder würde man ihn oder sie mit Kritik überziehen und im Internet an den Pranger stellen? Wenn Letzteres zuträfe, wer traute sich dann noch, im Krisenfall richtig zu handeln? Und ab wann gilt der Notstand?
Und dann frage ich mich: Wie müssen wir handeln angesichts des Klimawandels? Genügt es, die Symptome einfach einzuhegen, also einfach weitere Deiche zu bauen? Höhere, festere Schutzwälle, um gewappnet zu sein gegen einen steigenden Meeresspiegel? Man kann nicht behaupten, dass das wirkungslos sei: Ohne Deiche wären die Regionen um Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven heute schon überflutet. An der Elbe, kurz nach dem Verlassen von Cuxhaven, habe ich eine Tafel entdeckt, auf der steht: »Areale, die bei einem Meeresspiegelanstieg von 0,2 bis 2 Metern zusätzlich überschwemmt würden, wirken im Vergleich zu den bereits geschützten Flächen recht klein.« Eine Landkarte zeigt ein Norddeutschland, in dem Oldenburg, Bremen und Stade an der Nordseeküste liegen. Tatsächlich ziemlich beeindruckend. Und dann ist die Rede vom unaufhaltsam steigenden Meeresspiegel, von der zunehmenden Verschmutzung und dem Aufheizen der Atmosphäre, die das Schmelzen des Gletschereises beschleunigen, und es wird die Frage gestellt, wie lange Küstenschutz und Deichhöhe noch reichen werden und was wir tun können, um den Anstieg der Meere zu stoppen.
Man merkt dem Text an, dass er versucht, möglichst sachlich, möglichst neutral zu sein, ohne das Problem kleinzureden, aber auch ohne es zu ideologisieren. Ich finde das gut, gerade weil das Thema Klimawandel emotional so aufgeladen ist.