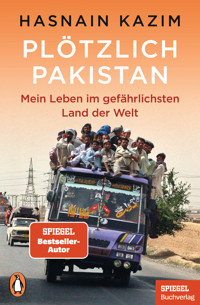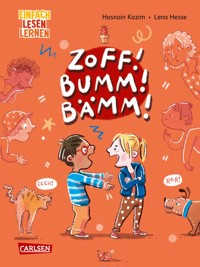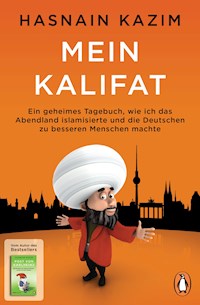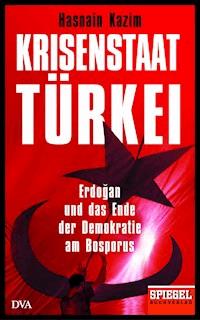
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Krisenstaat Türkei: Wie ein Land in die Diktatur driftet
Vor kurzem noch galt die Türkei als Staat, der West und Ost, Islam und Demokratie vereint, der Vorbild sein kann für die gesamte Region. Heute ist die Türkei ein Krisenstaat, der sich von inneren und äußeren Feinden bedroht sieht und in dem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erheblich unter Druck geraten sind. Rücksichtslos lässt Präsident Recep Tayyip Erdogan Andersgläubige und Andersdenkende verfolgen, immer heftiger provoziert er Konflikte mit Nachbarn und außenpolitischen Partnern, nicht zuletzt mit Deutschland. SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Hasnain Kazim hat miterlebt, wie sich die Türkei in den vergangenen Jahren radikalisierte. Er zeigt, wie explosiv die Situation im Land ist und was das Ende der Demokratie am Bosporus bedeutet – für die Türkei, für die Region und für Europa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zum Buch
Vor kurzem noch galt die Türkei als Staat, der West und Ost, Islam und Demokratie vereint, der Vorbild sein kann für die gesamte Region. Heute ist die Türkei ein Krisenstaat, der sich von inneren und äußeren Feinden bedroht sieht und in dem Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erheblich unter Druck geraten sind. Rücksichtslos lässt Präsident Recep Tayyip Erdoğan Andersgläubige und Andersdenkende verfolgen, immer heftiger provoziert er Konflikte mit Nachbarn und außenpolitischen Partnern, nicht zuletzt mit Deutschland. SPIEGEL-Korrespondent Hasnain Kazim hat miterlebt, wie sich die Türkei in den vergangenen Jahren radikalisierte. Er zeigt, wie explosiv die Situation im Land ist und was das Ende der Demokratie am Bosporus bedeutet – für die Türkei, für die Region und für Europa.
Zum Autor
Hasnain Kazim, 1974 als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer in Oldenburg geboren, schreibt seit 2004 für SPIEGEL ONLINE und den SPIEGEL. Seit 2009 lebt er als Korrespondent im Ausland, von 2013 bis 2016 berichtete er aus Istanbul. Nachdem er die Türkei verlassen musste, ist er heute Korrespondent in Wien. Bei allem politischen und religiösen Extremismus, dem Kazim bei seiner Arbeit begegnet, versucht er, auch das Schöne und Alltägliche zu beschreiben. Für seine Berichterstattung wurde er als „Politikjournalist des Jahres“ geehrt und mit dem „CNN Journalist Award“ ausgezeichnet. Zuletzt veröffentlichte er unter dem Titel „Plötzlich Pakistan“ seine Erfahrungen als Auslandskorrespondent (2015).
Hasnain Kazim
KRISENSTAAT TÜRKEI
Erdoğan und das Ende der Demokratie am Bosporus
Deutsche Verlags-Anstalt
Das Mottozitat ist mit freundlicher Genehmigung des Verlags dem Band Istanbul: Erinnerungen an eine Stadt von Orhan Pamuk entnommen (Carl Hanser Verlag, München, 2006).
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Halil Sağırkaya / Anadolu Agency / Getty Images
ISBN 978-3-641-21444-9V003
www.dva.de
Meinen Kolleginnen und Kollegen in der Türkei. Denen, die Tag für Tag mutig ihrem Beruf nachgehen. Denen, die ihre Arbeit verloren haben, nur weil sie sie gemacht haben. Und denen, die deswegen im Gefängnis sitzen.
Inhalt
Ankunft: Ein Land in Aufruhr
Anfänge: Atatürk und sein Erbe
Erdoğan: Vom Islamisten zum Demokraten und zurück
Glaubensfragen: Der Islam und die Frauen
Neue Gefahren: Die Türkei und der Terror
Alte Konflikte: Türken und Kurden
Freund und Feind: Die ganze Welt gegen uns
Schwierige Partner: Türken und Deutsche
Neo-osmanische Träume: Die Türkei und die Welt
Abschied: Tod einer Demokratie
Dank
Bibliografie
Register
»Die Freude an Fahrten auf dem Bosporus rührt daher, dass man, inmitten einer geschichtsträchtigen, verwahrlosten Großstadt, in sich die unbändige Energie des Meeres fühlt. Wer sich auf den schnellen Wassern des Bosporus dahinbewegt, der spürt, wie in der lauten, schmutzigen Stadt die Meereskraft auf ihn übergeht und dass es inmitten von Menschenmengen, übermächtiger Geschichte und Architektur immer noch möglich ist, allein und frei zu bleiben.«
Orhan Pamuk, Istanbul
Ankunft: Ein Land in Aufruhr
Rote Fähnchen mit weißem Halbmond und weißem Stern überall. Hunderte, nein, Tausende. An jeder Straßenkreuzung, an Zäunen und Brückengeländern. An Gebäuden wehte die »Rote Flagge mit dem Mondstern«, wie die Flagge der Republik Türkei genannt wird, meist in großem Format. Ein schönes, kräftiges Rot, im Kontrast zum reinen Weiß des Halbmondes und des Sterns, eine Flagge, über deren Herkunft es viele Legenden gibt. In nicht wenigen ist vom Blut gefallener osmanischer Soldaten die Rede. In einer Erzählung soll ein Sultan nach einer gewonnenen Schlacht in einem von Blut gefärbten See die Spiegelung des Mondes und eines Sterns gesehen haben und so von diesem Anblick berührt worden sein, dass er ihn auf der Flagge verewigte. Andere Interpretationen betonen, dass Halbmond und Stern auf der Flagge zu sehen seien, weil sie islamische Symbole sind.
An den Brücken der Schnellstraße hingen im Mai 2012 Porträts von Recep Tayyip Erdoğan, damals Premierminister der Türkei und heute Staatspräsident, daneben auch immer wieder das Gesicht von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der Republik Türkei. »Welcome, Mr. Prime Minister Erdoğan!« stand auf einem Banner. »Turkey is our best friend« auf einem anderen. Und: »Pakistan-Turkey Friendship Zindabad!« – »Lang lebe die Freundschaft zwischen Pakistan und der Türkei!«
Islamabad, die Hauptstadt Pakistans, hatte sich über Nacht in Little Ankara verwandelt. Man erwartete Staatsbesuch aus der Türkei. Eine befreundete türkische Diplomatin hatte mir erzählt, sie habe in den kommenden Tagen kaum Zeit, da sie den Besuch von »Erdoğan und ein paar Ministern« vorbereiten müsse.
»Ein paar Minister?«, fragte ich verwundert. Während der Jahre, in denen ich als Korrespondent in Pakistan lebte, von 2009 bis 2013, war Außenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle der ranghöchste deutsche Besucher gewesen. Er kam mit einer kleinen Delegation. Und aus der Türkei reiste der Premierminister gleich mit mehreren Ministern an?
»Ja, er bringt sein halbes Kabinett mit«, antwortete die türkische Diplomatin. Sie sah mein Erstaunen. »Und etwa tausend Geschäftsleute.« Erdoğan komme »relativ oft« nach Pakistan, ergänzte sie noch, bevor sie sich mit dem Hinweis entschuldigte, sie habe nun einiges zu tun.
Die Türkei genießt in manchen Teilen der Welt ein viel höheres Ansehen als in Deutschland. Pakistanische Politiker zum Beispiel bemühen das Land oft als Vorbild. Der frühere Militärdiktator Pervez Musharraf hatte sieben Jahre seiner Kindheit in Ankara verbracht, wo sein Vater einen Posten an der pakistanischen Botschaft innehatte und wo auch seine Mutter Arbeit als Schreibkraft fand. Diese Zeit sollte, wie Musharraf mir später erzählte, einen großen Einfluss auf seine Weltsicht haben: »Von der Türkei habe ich viel gelernt, was ich für Pakistan wollte.« Die Tatsache, dass ein islamisches Land existierte, das wirtschaftlich prosperierte, das die Demokratie vorantrieb, das nicht nur im Nahen und Mittleren Osten politischen Einfluss besaß, sondern auch im Westen, beeindruckte ihn. Er war fasziniert von dem Umstand, dass der Islam in der Türkei zwar die Gesellschaft prägte, aber nicht auf eine so dogmatische, erdrückende Art wie in anderen Teilen der Welt, einschließlich seines eigenen Landes.
Im Westen weitgehend unbemerkt hat die Türkei sich für Pakistan zu einem wichtigen Partner entwickelt. So half die türkische Regierung etwa im Jahr 2005 bei der Annäherung zwischen Pakistan und Israel. Beide Staaten erkennen sich bis heute diplomatisch nicht an, doch weil Israel damals Bereitschaft zeigte, einen Staat Palästina zuzulassen, und der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon als Signal in diese Richtung tatsächlich jüdische Siedlungen in Gaza räumen ließ, trafen sich am 1. September 2005 erstmals der pakistanische und der israelische Außenminister zu Gesprächen – dank Vermittlung der türkischen Regierung. Das Treffen in Istanbul war ein historisches Ereignis, wurde in der westlichen Welt jedoch kaum wahrgenommen.
Wenige Wochen später, am 8. Oktober 2005, bebte in Kaschmir, im Norden Pakistans, die Erde. Das Epizentrum lag in der von Pakistan verwalteten Region Asad Kaschmir. Schätzungsweise neunzigtausend Menschen starben in Pakistan, bis zu zweitausend im benachbarten Indien. Es war eine Naturkatastrophe von unvorstellbarem Ausmaß, das schwerste Erdbeben in der Geschichte Pakistans, mit Hunderten zerstörten Dörfern und Städten.
Wer heute im pakistanischen Kaschmir durch die Regionalhauptstadt Muzaffarabad fährt, fühlt sich wie in Anatolien: Viele Häuser sind rosa- oder türkisfarben, die Moscheen haben, wie in der Türkei üblich, zwei Minarette, eine in Pakistan eher untypische Architektur. Die Erklärung dafür ist simpel: Es waren türkische Bauunternehmen, die die völlig zerstörten Orte wiederaufgebaut haben – mit türkischen und internationalen Hilfsgeldern. Die Menschen in Kaschmir fanden den Baustil, die Farben, die Architektur zunächst zwar gewöhnungsbedürftig, aber sie waren dankbar, dass ihre Heimat so schnell wiederhergerichtet wurde, und das auch noch moderner als zuvor. Für die Betroffenen war die Türkei nun: ein selbstloser Helfer, ein großartiges Land, ein Freund der Pakistaner, ein Partner, auf den Verlass ist. Die Türkei war das, was man sich idealerweise unter einem islamischen Bruderland vorstellte.
Meine Frau Janna und ich kannten die Türkei bis 2013 kaum. Bei Reisen zwischen unserer Heimat in Deutschland und unserem Wohnort in Pakistan waren wir oft in Istanbul umgestiegen. Von oben, nur so viel konnten wir beurteilen, sah die Stadt mit dem Bosporus, der sich zwischen den Hügeln entlangschlängelte, dem Marmarameer, den vielen alten Moscheen verheißungsvoll aus. Einmal, als ich alleine unterwegs war, blieben mir in Istanbul mehrere Stunden bis zum Anschlussflug. Ich nahm mir ein Taxi und absolvierte das Touristenprogramm: Hagia Sophia und Blaue Moschee, ein Blick auf den Bosporus – und zurück zum Flughafen. Von da an wusste ich: Istanbul ist wirklich so aufregend und so vielfältig, wie es aus dem Flugzeug aussieht. Dabei hatte ich die Stadt noch gar nicht von ihrer besten Seite gesehen, denn es war ein kalter, regnerischer Tag.
Aber auch wenn wir nur wenig von der Türkei kannten, nahmen wir wahr, wie viel positiver das Türkei-Bild in Pakistan war im Vergleich zu Deutschland. Und uns wurde bewusst, welch gewichtige Rolle die Türkei in großen Teilen der islamischen Welt spielte.
Ganz plastisch wurde mir das einmal in Kabul, Afghanistan, vor Augen geführt. Die Bundeswehr, die ihr Mandat hier pflichtbewusst erfüllte, tat sich schwer, einen Draht zur Bevölkerung aufzubauen. Ich sah, wie distanziert der Umgang zwischen Soldaten und Einheimischen war, wie mühsam es für die Deutschen war, das Vertrauen der Afghanen zu gewinnen, auch weil sie die Mentalität der Afghanen kaum verstanden. Sehr viel einfacher fiel das den türkischen Truppen im Land, was sich vor allem zeigte, wenn es Probleme zwischen den Einheimischen und den internationalen Truppen gab. Als sich einmal ein Dorf beschwerte, dass Soldaten mit ihren Panzern eine Straße zerstört hatten, stapfte ein türkischer General ohne große Formalitäten zum Dorfältesten, zog vor dessen Hütte die Kampfstiefel aus und setzte sich im Schneidersitz zu ihm und einer Reihe weiterer alter Männer auf den Teppich. Der Dolmetscher des Offiziers, ein junger Afghane, setzte sich hinter ihn. Man trank gemeinsam Tee, erkundigte sich gegenseitig nach dem Wohlergehen der Kinder und Enkel, um schließlich in freundschaftlicher Atmosphäre das Problem zu besprechen. Ohne allzu viele Worte einigte man sich, dass ein paar Nato-Soldaten die Straße in den kommenden Tagen reparieren würden. Damit war die Sache erledigt.
Fragte man Afghanen, wen von den internationalen Truppen sie am liebsten mochten, fiel die Antwort eindeutig aus: die Türken! Kein Wunder, sagten mir Bundeswehrsoldaten, die türkischen Soldaten hätten ja im Gegensatz zu anderen Nato-Truppen auch keinen Kampfauftrag in Afghanistan. Gewiss. Aber sicher spielte bei der Wertschätzung durch die afghanische Bevölkerung auch die kulturelle und religiöse Nähe zu den türkischen Soldaten eine Rolle: Man konnte überzeugend vermitteln, dass man da war, um zu helfen, nicht um zu erobern.
Ich war beeindruckt von diesem Türkei-Bild. Und offensichtlich auch viele Politiker in Deutschland, in den USA und in anderen westlichen Staaten. Die Türkei war seit 1952 Mitglied der Nato, war also nur drei Jahre nach der Gründung zum westlichen Militärbündnis hinzugestoßen und bot sich jetzt zunehmend als Mittlerin zwischen den Kulturen an. Angela Merkel, damals noch Oppositionsführerin, nannte die Türkei 2004 ein »wahnsinnig erfolgreiches Land« mit »unglaublichen Wachstumsraten« und deutete an, dass sie es für denkbar halte, dass das Land die Kriterien für eine Aufnahme in die EU erfüllen könne. Doch später schien sie diese Haltung zu revidieren, immer wieder ließ sie Skepsis durchblicken, ob die Türkei wirklich Mitglied der EU werden könne. Statt von einer Mitgliedschaft sprach sie nun, sehr zur Verärgerung des türkischen Premierministers, von einer »privilegierten Partnerschaft« zwischen EU und Türkei und von einem »dritten Weg«.
In den ersten Jahren unter der Regierung der islamisch-konservativen Partei AKP, ab 2002, wurde die Türkei in Europa und Amerika gefeiert. Erdoğan hatte sein Land mit hochfliegenden Plänen modernisiert und gleichzeitig mit seiner osmanischen Vergangenheit versöhnt. Er rettete die Türkei vor dem Staatsbankrott, brachte ihr wirtschaftlichen Aufschwung und soziale Stabilität. Und die Welt entdeckte Istanbul, jene Metropole, die sich als einzige Stadt der Welt über zwei Kontinente erstreckt und nicht nur rein geografisch, sondern auch kulturell eine Brücke zwischen Europa und Asien, zwischen West und Ost bildet. Plötzlich wurde Istanbul zu »Istancool«.
Janna und ich hatten mehrere Jahre in Pakistan gelebt, in einer Zeit, in der sich die Sicherheitslage dort dramatisch verschlechtert hatte. Tag für Tag gab es im Land Terroranschläge. Die Checkpoints auf der Straße, die Stacheldrahtzäune und Mauern, die allgegenwärtige Waffenpräsenz, die Sicherheitskontrollen vor Hotels, Restaurants, Geschäften und Banken begannen, uns zunehmend zu belasten. Außerdem hatten wir nun einen kleinen Sohn, der Waffen nicht für etwas ganz Alltägliches halten sollte. Wir sehnten uns nach einem ruhigeren Wohnort, ohne Terror, ohne gewalttätige Demonstrationen, ohne Ausnahmezustände, bei denen man am besten keinen Fuß vor die Tür setzte.
Fast ebenso zermürbend wie die Sicherheitslage waren die täglichen Stromausfälle. Pakistan war nicht in der Lage, genug Strom für seine Bevölkerung zu produzieren, manchmal gab es bis zu zwanzig Stunden am Tag keinen Strom, und das im Sommer bei fünfundvierzig Grad Celsius, wenn man dringend auf die Klimaanlage oder zumindest auf Ventilatoren angewiesen war, vor allem mit einem Kleinkind. Mitte 2012 waren wir uns einig, dass wir höchstens noch ein Jahr bleiben wollten.
Als neuer Posten erschien uns Istanbul immer attraktiver. Nach Pakistan, einem islamischen Land mit gewaltigen Problemen, könnten wir nun ein islamisches Land erleben, das vielen als Musterbeispiel galt. Zudem liegt Istanbul strategisch günstig, von dort aus ließe sich problemlos die gesamte Region bereisen, auch weil von kaum einer anderen Stadt so viele internationale Ziele angeflogen werden. Istanbul klang wie eine Verheißung. Zu unserer Freude stimmte meine Chefredaktion zu, sie hielt den Standort Istanbul für eine gute Idee. Wir sollten im Juli 2013 umziehen.
Doch die Hoffnung auf einen ruhigeren Wohnort zerschlug sich, noch bevor die Kartons gepackt waren: Ende Mai 2013 brachen in Istanbul die Gezi-Proteste aus. Diese Demonstrationen stellen einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der Türkei dar, die sich fortan in ein »vor Gezi« und »nach Gezi« teilen sollte. Die Proteste von einer Handvoll Stadtplanern und Umweltschützern richteten sich zunächst gegen den Bau eines Einkaufszentrums im Istanbuler Gezi-Park. Die Demonstranten wollten diesen kleinen Park neben dem Taksim-Platz, im Zentrum des europäischen Teils der Stadt, vor der Zerstörung retten. Im Zuge des wirtschaftlichen Aufstiegs war in der Türkei ein Bauboom ausgebrochen: Shoppingmalls, Wohntürme, mehrspurige Schnellstraßen pflasterten das Land, vor allem im Herzen Istanbuls drohten die Grünflächen zu verschwinden. Infrastrukturprojekte waren ein wesentliches politisches Instrument der türkischen Regierung, jedes vollendete Großbauwerk verstand sie als Beweis ihrer erfolgreichen Politik, als ein in Beton gegossenes Zeichen ihrer Macht.
Anstatt das Gespräch mit den Gezi-Demonstranten zu suchen und den Konflikt zu entschärfen, ignorierte Premierminister Erdoğan die Proteste zunächst ein paar Tage lang und ließ dann die Polizei gewaltsam gegen sie vorgehen. Mit Tränengas und Knüppeln glaubte er, die Protestierenden vertreiben zu können.
Entsetzt über die Gewaltbereitschaft der Regierung schlossen sich Studenten, Angestellte, Junge und Alte, Arme und Reiche den Demonstrationen an. Der kleine, auf Istanbul begrenzte Protest zum Erhalt eines unscheinbaren, nicht einmal besonders schönen Parks schwoll nun an zu einer landesweiten Protestwelle gegen den autoritären Regierungsstil Erdoğans. Der hatte zwar schon seit langem mit harter Hand regiert, wie Oppositionelle beklagten. Doch jetzt wurden seine aufbrausende Art und seine unerbittliche Haltung für die ganze Welt sichtbar.
Die Proteste ließen die türkische Zivilgesellschaft erwachen, man begann, sich gegen den Autoritarismus der Regierungspartei zu wehren. Endlich brachen, so nahm man es von außen wahr, viele Türken mit ihrer Untertanenmentalität und entdeckten, dass man zu seiner Regierung auch nein sagen konnte. Nicht von ungefähr wirkten die Gezi-Proteste mitunter wie ein landesweites Freiheitsfest. Wann immer sich die Polizei zurückzog, feierten Tausende im Gezi-Park und auf dem angrenzenden Taksim-Platz eine Party.
Erdoğan zeigte kein Verständnis für die immer lauter werdende Kritik an ihm, im Gegenteil: kein ausgleichendes Wort an die Demonstranten, keine beschwichtigende Geste, stattdessen beschimpfte er die Protestierenden als »Terroristen« und »Plünderer«. Gewiss mischten sich unter die Demonstranten auch Randalierer, suchten manche die gewaltsame Auseinandersetzung mit der Staatsmacht. Doch es waren vor allem die Sicherheitskräfte, die mit unverhältnismäßiger Brutalität gegen meist friedlich demonstrierende Menschen vorgingen und die Situation so eskalieren ließen.
In dieser hitzigen Atmosphäre kamen wir Ende Juli 2013 in der Türkei an. Bereits einige Wochen vor unserem Umzug waren wir für ein paar Tage in Istanbul gewesen und hatten eine Wohnung im Stadtteil Galata gefunden, nur ein paar Meter vom Galataturm entfernt. Bis zum Taksim-Platz, wo es immer noch brodelte, waren es nur etwa fünfzehn Minuten Fußweg.
Es war Ramadan, was in Pakistan bedeutete, dass die Menschen strikt fasteten. Selbst Wasser konnte man nicht in der Öffentlichkeit trinken, ohne tadelnde Blicke auf sich zu ziehen – trotz der unerträglichen Sommerhitze. Der Abschied von Islamabad war uns schwergefallen, auch wenn wir die Bedeutung der Religion in der Gesellschaft als immer erdrückender empfanden. Kurz vor unserem Umzug war unser Lieblingscafé von der Polizei gestürmt und geschlossen worden, weil es trotz Ramadan tagsüber geöffnet hatte und Speisen und Getränke anbot. Der Cafébesitzer hatte die Fenster zur Straßenseite vorsorglich mit Strohmatten zugehängt, um kein Aufsehen zu erregen und die draußen vorbeilaufenden Fastenden nicht zu stören und um den Gästen drinnen eine geschützte Atmosphäre zu bieten, in der sie sich frei entscheiden könnten, trotz Ramadan tagsüber etwas zu essen und zu trinken. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen musste sich jemand beschwert haben, denn nun war der Laden plötzlich geschlossen. Wenigstens dieser Art der religiösen Bevormundung würden wir nun entkommen, glaubten wir.
Und tatsächlich, in Istanbul angekommen, trauten wir unseren Augen nicht: Die Leute saßen in Straßencafés – und tranken Bier und Wein! Sie kamen uns geradezu hemmungslos vor. Alkohol am helllichten Tag, mitten im Ramadan! Und das in einem islamischen Land! In manchen Bars hatten die Gäste eine meterhohe Biersäule vor sich und zapften sich selbst nach, wenn das Glas leer war – man konnte hier Efes, das türkische Bier, im Meter bestellen. Wir stellten uns vor, was wohl passiert wäre, wenn das jemand in Pakistan gewagt hätte.
Für Janna und mich war Istanbul eine Befreiung. Nicht nur beim Fasten sprangen uns die Unterschiede sofort ins Auge, auch bei der Kleiderwahl erwies sich die Bevölkerung Istanbuls als bunt und tolerant. Frauen trugen Kopftücher oder auch nicht, waren voll verschleiert oder in Miniröcken. In Pakistan hatte Janna nie T-Shirts oder kurze Röcke in der Öffentlichkeit getragen, sondern immer darauf geachtet, dass Arme und Beine bedeckt waren. Jetzt war es für sie zunächst schwer, sich an die neue Offenheit zu gewöhnen. Wir spürten, wie sehr uns die Jahre in Pakistan geprägt hatten – und wie sehr der Blick auf ein Land von den Vergleichsmöglichkeiten abhängt. Aus deutscher Perspektive war Istanbul alles in allem sicher konservativ, aus pakistanischer Sicht aber sehr, sehr liberal. Für uns war die Stadt eine ideale Mischung aus Hamburg und Islamabad, unseren beiden vorangegangenen Wohnorten. Sie hatte das Beste aus beiden Welten. Wir waren begeistert!
»Wartet’s ab!«, warnte uns ein Freund mit türkischen Wurzeln, der viele Jahre in Istanbul verbracht hatte. »An der Oberfläche sieht in diesem Land alles toll aus. Aber darunter brodelt es.« In Wahrheit sei die türkische Gesellschaft viel mehr Islamabad als Hamburg, entgegnete er auf meinen Vergleich. »Ihr werdet euch noch wundern!«
Nicht einmal ein Jahr später, im Mai 2014, sollte ich das am eigenen Leib erfahren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Gezi-Proteste abgeflaut, im ganzen Land hatte Erdoğan die Demonstranten von der Polizei wegprügeln lassen. Wann immer sich in den Wochen und Monaten darauf eine Gruppe von Protestierenden auf die Straße traute, waren die Sicherheitskräfte innerhalb von Minuten zur Stelle. Auf dem Taksim-Platz wimmelte es dauerhaft von Polizisten und seltsamen Gestalten in schlecht sitzenden Anzügen, die ihr Dasein als Aufpasser über die öffentliche Ordnung kaum verbergen konnten.
Mehrere Male erlebte ich, wie in der Istiklal Caddesi, der Haupteinkaufsstraße und Fußgängermeile, die von unserem Viertel Galata zum Taksim-Platz führte, plötzlich Wasserwerfer auftauchten und Polizisten Tränengas in die Menge schossen, weil eine kleine Gruppe von Demonstranten Slogans gegen die Regierung skandierte oder ein Transparent mit einem Erdoğan-kritischen Spruch entrollte. Ohne Rücksicht auf Passanten und Touristen schossen die Sicherheitskräfte in die Menge. Auch ich musste mich mehr als einmal in das nächstbeste Geschäft flüchten, um mich vor dem Tränengas in Sicherheit zu bringen.
Einmal geriet ich auch mit meiner Familie in eine brenzlige Situation. Wir waren mit dem Kinderwagen beim Einkaufen, als wir plötzlich Glas klirren hörten und sahen, dass Steine flogen und Tränengas eingesetzt wurde. Wir harrten in einem Laden in einem Einkaufszentrum aus und überlegten, wie wir möglichst unbeschadet nach Hause gelangen konnten. In einer Feuerpause liefen wir aus dem Gebäude und so schnell wie möglich in eine parallel verlaufende Gasse, in der keine Demonstranten waren und damit auch keine Sicherheitskräfte. Wir hatten rasch gemerkt, dass die Polizei bei solchen Auseinandersetzungen nicht Freund und Helfer war, sondern Partei in einem Konflikt – auch für unbeteiligte Passanten. Manchmal wurde jemand willkürlich festgenommen und abgeführt, vermutlich zum nächsten Polizeibus oder gleich zur Polizeistation. Bei solchen Verhaftungen kamen gelegentlich auch Gummiknüppel zum Einsatz, und oft traf es Menschen, die ich selbst ein paar Minuten zuvor durch die Läden bummeln gesehen hatte und die nun plötzlich im Verdacht standen, Demonstranten und damit Staatsfeinde zu sein. Aber diese Brutalität gegenüber unbescholtenen Bürgern schien Erdoğan, der türkischen Regierung und der Polizei egal zu sein. Was hatten diese Leute auch in der Nähe der Demonstranten verloren? Sie waren selbst schuld, wenn sie verhaftet wurden. Auch dass dieses Vorgehen eine verheerende Wirkung auf das Image der ansonsten so gast- und touristenfreundlichen Türkei hatte, bekümmerte anscheinend niemanden.
Auch wenn ich Istanbul weiterhin für einen sichereren Ort als Islamabad hielt, wurde mir jedoch schnell klar, dass es auch hier Ressentiments gegenüber dem Westen gab und dass man ausländische Journalisten nicht unbedingt willkommen hieß, sondern sie als Spione und Handlanger ihrer jeweiligen Regierung misstrauisch beäugte – ähnlich wie in Pakistan. Mein Vorteil war, dass ich äußerlich als Araber, Afghane oder Pakistaner durchging und jedenfalls als Muslim wahrgenommen wurde. Das half, um Vertrauen zu gewinnen. Ich war nicht so leicht in eine Schublade zu stecken, und man konnte mich innerhalb des komplizierten türkischen Politik- und Gesellschaftsgefüges in keinem Lager verorten – nicht bei den Islamisten, nicht bei den Säkularen, nicht bei den Nationalisten, nicht bei den Kurden. Eines machten mir meine Gesprächspartner, insbesondere regierungsnahe, jedoch durch die Bank weg schnell klar: Man erwartete von mir Verständnis für ihre Sichtweise, ein größeres als von einem Deutschen, für den man mich ja nicht hielt, jedenfalls nicht für einen richtigen.
Ich begann, die türkische Sprache zu lernen, wobei mir viele Begriffe bekannt vorkamen, da es sie auch in Urdu gibt. Urdu, die Amtssprache in Pakistan, kennt viele türkische Begriffe. Ich hatte diese Sprache als Kind gelernt. Muss man als Korrespondent die Sprache des Landes, aus dem man berichtet, beherrschen? Nicht unbedingt, aber es ist von großem Vorteil. Man bekommt viel mehr mit, nicht nur bei offiziellen Terminen und in Pressekonferenzen, sondern auch in der U-Bahn, auf dem Markt, in alltäglichen Situationen. Allerdings ist es für einen Korrespondenten, der in unterschiedlichen Ländern arbeitet, unmöglich, alle Landessprachen zu beherrschen. Während ich in Pakistan mit meinen Urdu-Kenntnissen gut zurechtkam, musste ich in der Türkei bei null beginnen. Erschwerend kam hinzu, dass Englischkenntnisse in der Türkei weit weniger verbreitet sind als in Pakistan, das Teil des Britischen Empire gewesen war. Ich belegte einen Türkischkurs an einer Sprachschule und lernte in meiner Freizeit Vokabeln. Auch wenn mir klar war, dass ich die Sprache nie so gut beherrschen würde, dass ich ein Interview auf Türkisch führen könnte, konnte ich immerhin bald die Überschriften und den Inhalt von Zeitungsartikeln erfassen und Alltagsunterhaltungen folgen. Außerdem arbeitete ich mit sehr guten Übersetzern und Dolmetschern zusammen und konnte mich auf ein Netz von Kontakten verlassen, das mir weiterhalf, wenn ich etwas nicht verstand.
Es waren jedoch nicht Sprachschwierigkeiten, die sehr bald und für mich überraschend zu Problemen führen sollten, sondern es war meine Berichterstattung, die der Regierung nicht passte.
Im Mai 2014, wir waren noch nicht einmal ein Jahr in der Türkei, erzürnte ein Artikel von mir die Fans von Erdoğan so sehr, dass ich mit Drohungen überschüttet wurde. Auf Facebook und Twitter wurde ich plötzlich als Staatsfeind gebrandmarkt, Hunderte drohten, mich umzubringen. Auch mehrere regierungstreue türkische Zeitungen berichteten über mich und bezeichneten mich als Feind der Türkei. Meine Familie und ich sahen uns gezwungen, zu unserer eigenen Sicherheit das Land zu verlassen. Als die Lage sich beruhigte, entschieden meine Frau und ich uns dafür, nach Istanbul zurückzukehren. Wir wollten uns nicht einschüchtern lassen, und trotz dieser bedrohlichen Erfahrung gab es vieles, was uns in der Türkei gefiel.
Doch nach unserer Rückkehr nahm das Land eine dramatische Entwicklung. Immer unverhohlener beanspruchte Erdoğan die Macht für sich alleine, immer härter ging er gegen Kritiker vor. Die Angriffe auf Presse- und Meinungsfreiheit nahmen zu, bis diese Grundpfeiler einer Demokratie fast völlig zerstört waren. Oppositionelle wurden festgenommen. Die Religion musste immer stärker als prägende Kraft herhalten, die Islamisierung schritt voran. Das Verhältnis zu Europa und Amerika verschlechterte sich. Ich erlebte, wie die Annäherung zwischen türkischer Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, zum Stillstand kam, wie die Friedensgespräche scheiterten und stattdessen ein Bürgerkrieg im Südosten des Landes, in den überwiegend von Kurden bewohnten Gebieten, begann. Ich erlebte, wie die Regierung ihre Ziele immer stärker mit Gewalt durchsetzte, während sich Erdoğan als einziger Garant von Sicherheit und Stabilität darstellte. Und ich erlebte, wie die PKK wieder zum Terror zurückkehrte und das Land einmal mehr mit Anschlägen erschütterte.
Gefahr drohte der Türkei auch von anderer Seite. Die Terrororganisation »Islamischer Staat« (IS) eroberte 2014 Teile des Irak und Syriens und setzte sich in der Grenzregion zur Türkei fest. Zu meinem Erstaunen gab es nicht wenige Menschen in der Türkei, die Sympathien für diese Extremisten zeigten, nicht nur in Städten entlang der Grenze zu Syrien, auch im weltoffenen Istanbul.
Ganz offen rekrutierte der IS in der Türkei neue Kämpfer für seinen Dschihad. Sie kamen aus aller Welt, aus Europa, Amerika, Afrika und Asien. Die meisten reisten legal über Istanbul ein, von dort an die türkisch-syrische Grenze und weiter ins Kampfgebiet. In einem Geschäft in Istanbul, im Stadtteil Güngören, sah ich, wie IS – Devotionalien – Flaggen, Banner, T-Shirts, Aufkleber – verkauft wurden, ganz offen, nicht heimlich unter der Ladentheke.
Immer wieder gab es Anzeichen, dass die türkische Regierung den IS heimlich unterstützte, weil die Terrororganisation in Syrien den Machthaber Baschar al-Assad bekämpfte. Ihn hatte Erdoğan nach Jahren der Freundschaft plötzlich zum Feind erklärt. Als in Syrien im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings Proteste ausbrachen und das Land im Bürgerkrieg versank, sah Erdoğan eine Chance, seine Macht auszubauen. Der IS, so seine Überzeugung, könnte dazu beitragen, den Alawiten Assad zu stürzen und eine sunnitische Führung an die Macht zu bringen, die sich der Türkei unterordnen und damit den Einfluss der Türkei in der Region stärken würde.
Beweise für eine tatsächliche Unterstützung des IS durch die Türkei gab es nicht, doch hielt sich die türkische Regierung mit Kritik an der Terrormiliz auffällig zurück. Dem Vorwurf, verletzte IS – Terroristen würden in türkische Krankenhäuser entlang der Grenze zu Syrien gebracht und dort behandelt, entgegneten türkische Regierungspolitiker, in der Türkei würde jeder behandelt, unabhängig davon, wer er sei – man frage auch nicht nach. Als über Waffenlieferungen der Türkei an Extremisten in Syrien – darunter womöglich auch an den IS – berichtet wurde, gerieten wir Journalisten wieder als »Volksverräter« und »Feinde« ins Fadenkreuz der Regierung. Anders als türkische Kollegen wurde ich nicht verhaftet oder angeklagt, doch abermals erhielt ich Hunderte von Drohmails. Diesmal versuchte ich, sie so gut wie möglich zu ignorieren.
Irgendwann verschwanden die Läden mit den IS – Fanartikeln. Es war auch nicht mehr möglich, Mitglieder des »Islamischen Staats« auf türkischem Boden zu treffen. Der öffentliche Druck, vor allem aus dem Ausland, hatte die Türkei offensichtlich zum Umdenken bewogen. Doch dadurch wuchs die Gefahr für die Türkei selbst. Erstmals drohte die Terrororganisation der Türkei offen mit Racheakten. Nachdem türkische Kampfjets IS – Stellungen in Syrien bombardiert hatten, veröffentlichten die Dschihadisten ein Video, in dem sie Erdoğan den Krieg erklärten. Er sei ein »Verbündeter des Westens«, sagte ein junger Mann in die Kamera.
Seither hat es mehrere Terroranschläge des IS in der Türkei gegeben, einige davon in Istanbul, an öffentlichkeitswirksamen Stellen wie nahe der Hagia Sophia, auf der Istiklal Caddesi und am Atatürk-Flughafen. Anfang 2017, das neue Jahr war noch keine zwei Stunden alt, erschoss ein IS – Terrorist in einem Nachtclub neununddreißig Menschen, die dort Silvester feierten. Das Video der Terrororganisation war keine leere Drohung gewesen.
Im Frühjahr 2016 habe ich die Türkei verlassen müssen, unfreiwillig. Meine Akkreditierung als Korrespondent wurde nicht verlängert, und damit hatten meine Familie und ich keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Stattdessen wurde mir zugetragen, ich würde möglicherweise wegen »Unterstützung einer terroristischen Organisation« angeklagt werden. Ich hatte, wie nahezu jeder Korrespondent in der Türkei, mit PKK – Anhängern gesprochen, ohne für sie Sympathien zu hegen oder mich gar mit ihnen gemeinzumachen, wie mir von Erdoğan-Anhängern unterstellt wurde. Es ist journalistische Pflicht, möglichst alle Seiten zu hören. Dass ich auch Kontakte zu IS – Leuten hatte, störte dagegen niemanden. Angesichts der Gefahr, angeklagt, mit einer Ausreisesperre belegt und einen womöglich langen Prozess über mich ergehen lassen zu müssen, entschied ich mich, mit meiner Familie das Land zu verlassen.
Wenn wir gewusst hätten, was in der Türkei auf uns zukommt, wären wir trotzdem dorthin gezogen? Ist Istanbul, diese stadtgewordene Schönheit, es wert, all die Wut, den Hass, die Gewalt zu ertragen? Darf man sich als Journalist, der vor Ort sein will, wenn eine Geschichte passiert, diese Frage überhaupt stellen? Oder muss man es sogar, weil man nicht alleine, sondern mit der ganzen Familie dort lebt und eine Verantwortung nicht nur für sich selbst hat?
Über all das schreibe ich in diesem Buch. Es ist die jüngste Geschichte der Türkei, und es ist meine Geschichte in der Türkei.
Anfänge: Atatürk und sein Erbe
Die Geschichte prägt die Gegenwart. In kaum einem anderen Land wird das so spürbar wie in der Türkei. Manche politische Entscheidung, mancher Komplex, manche Irrationalität lässt sich erklären, wenn man bedenkt, dass die Türkei einmal Herzland eines großen Reichs war, eine beeindruckende Weltmacht, deren Staatsgebiet von Nordafrika über Europa bis nach Asien reichte. Obwohl der Zusammenbruch des Osmanischen Reichs nun ein Jahrhundert zurückliegt, scheint er bis heute nicht verwunden.
Um die heutige Türkei zu verstehen, ist ein Rückblick auf die Geschichte unerlässlich – auf eine große, traditionsreiche Historie. Von diesem historischen Erbe zehrt die Türkei bis heute. In seinem Selbstverständnis, seiner Politik, seinem Auftreten beruft Erdoğan sich auf diese einstige Bedeutung und Größe. Oft nennen ihn Kritiker einen »Sultan«, aber im Kern trifft das sein Gebaren. Die vielen prächtigen Moscheen, von vielen Touristen bewundert, sind architektonische Erinnerungen an die Macht der Sultane, und so verwundert es nicht, dass Erdoğan noch heute Moscheen bauen lässt, die sich im Stil an den alten Bauten orientieren. Einen wichtigen Teil der Geschichte blendet die aktuelle Politik der Türkei aber aus: dass das Osmanische Reich ein Vielvölkerstaat war, mit unterschiedlichen Sprachen, Religionen, Kulturen und Anschauungen. Wenn man die Lage der Minderheiten in der Türkei heute betrachtet, wenn man sieht, wie sehr Nationalismus und die Stärkung des »Türkentums« die Politik prägen, ist von dieser früheren Vielfalt nicht mehr viel zu spüren.
Dass die Vorfahren der heutigen Türken aus dem Osten kamen, aus Zentralasien bis hin zur Mongolei, und zum Teil Nomaden waren, sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Erste Hinweise auf diese Ahnen finden sich in chinesischen Quellen aus dem zweiten Jahrhundert. Ab 1040 regierten eineinhalb Jahrhunderte lang die Seldschuken, eine Fürstendynastie, die im neunten Jahrhundert zum sunnitischen Islam konvertiert war und diese Religion nun in die Region brachte. Bis etwa zum elften Jahrhundert hatte sich die Islamisierung der hier lebenden Menschen vollzogen. Mit ihrem Sieg in der Schlacht von Manzikert, dem heutigen Malazgirt im Osten der Türkei, im Jahr 1071, hatten die Muslime in Anatolien ihren Machtanspruch manifestiert. Die Region war ethnisch und kulturell heterogen, hier lebten Araber, Armenier, Griechen, Juden, Kurden. Mit dem Sieg der Seldschuken in Manzikert begann der allmähliche Niedergang des Byzantinischen Reichs.
Die Seldschuken wiederum wurden 1243 von den Mongolen geschlagen. Fünfzehn Jahre später, 1258, in einer Situation der politischen Instabilität, kam in der Kleinstadt Söğüt, zweihundert Kilometer südöstlich von Istanbul, ein Junge zur Welt, der als Osman I. in die Geschichte eingehen sollte. Nach ihm ist das Osmanische Reich benannt. Osman I., Sohn des Clanführers Ertuğrul, war der erste Sultan und Begründer einer Dynastie, die über sechs Jahrhunderte die wechselhaften Geschicke des Landes bestimmen sollte. Osman I. wird von osmanischen Geschichtsschreibern als gazi dargestellt, als islamischer Rechtsgelehrter, der den Islam in einer Art heiligem Krieg gegen das Christentum behaupten wollte. Die Christianisierung war in diesem Teil der Welt, ausgehend von Europa, weit fortgeschritten. Die Missionierung war oft gewaltsam erzwungen worden, wie etwa bei den Kreuzzügen.
Osman I. begann, Ländereien in der Umgebung von Söğüt zu erobern. Aus dem Fürstentum Osman entstand das Osmanische Reich – zunächst ein kleines Land, das im Südosten die Stadt Eskişehir umfasste, im Westen aber nicht bis zum Marmarameer und im Norden nicht bis zum Schwarzen Meer reichte. Historische Quellen beschreiben, dass der Herrscher die Christen in den von ihm eroberten Gebieten nicht verfolgte, ihnen sogar mit Respekt begegnete, weil der Islam Achtung vor Andersgläubigen verlangte. Diese tolerante Haltung habe zum Erfolg der Eroberungen beigetragen, denn die Christen sahen anscheinend keinen Grund, allzu großen Widerstand zu leisten.
Die Jahreszahl, die jedes Kind in der Türkei kennt, ist 1453. Am 29. Mai jenes Jahres durchbrachen osmanische Truppen unter Sultan Mehmed II. erstmals die Stadtmauern von Konstantinopel, der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs. Schon seit Anfang April hatte das osmanische Heer die Stadt belagert, sie am 7. April gar vollends umzingelt. Der Kaiser des Byzantinischen Reichs verfügte aber über nicht einmal siebentausend Soldaten – knapp fünftausend Griechen und zweitausend Ausländer – zur Verteidigung und hielt die Größe seiner Truppen deshalb geheim. Die osmanischen Streitkräfte wuchsen hingegen stetig an, Mitte April trafen auch die letzten Schiffe aus dem Schwarzen Meer ein. Ein erster Angriff auf die Stadt am 18. April wurde noch abgewehrt, aber am 29. Mai 1453 fiel die Stadt. Es war das Ende des Byzantinischen Reichs, die islamische Eroberung einer christlichen Bastion. Der offizielle Name der Stadt blieb für die folgenden Jahrhunderte weiter Konstantinopel, aber die Türken nannten sie im Alltag Istanbul.
In den folgenden Jahrzehnten wuchs das Reich, bis es sich Mitte des sechzehnten Jahrhunderts von Nordafrika bis in den Kaukasus, von Osteuropa bis zur Arabischen Halbinsel erstreckte. Es war ein Vielvölkerstaat, in dem der Islam dominierte. Wer kein Türke war und kein Sunnit, wurde zwar toleriert, aber nicht als Gleicher unter Gleichen akzeptiert. Die Eroberung von Kairo, Damaskus und den beiden wichtigsten heiligen Städten des Islam, Mekka und Medina, trug dem osmanischen Herrscher zusätzlich den Titel Kalif zu. Er war damit das geistliche Oberhaupt der Muslime in der ganzen Welt.
Diese Blütezeit des Osmanischen Reichs kann man heute noch in der Türkei sehen und spüren. Vor allem in Istanbul, dem »nach Lage und Bauten wohl märchenhaftesten Platz der Welt«, wie der deutsche Architekt Paul Bonatz (1877 bis 1956) einmal sagte. Einen großen Anteil daran hat Mimar (»Architekt«) Sinan, der von 1490 bis 1588 lebte und als Großbaumeister und Konstrukteur das Stadtbild von Istanbul, aber auch anderer Orte in der Türkei geprägt hat wie kein anderer vor oder nach ihm. Mehr als dreihundert Bauten werden dem Sohn eines Steinmetzen zugeschrieben, davon über achtzig Moscheen wie die Süleymaniye-Moschee in Istanbul und die Selimiye-Moschee in Edirne. Letztere bezeichnete Sinan als sein »Meisterstück«, in die er all seine Erfahrungen und sein Wissen einbrachte. Alleine ihretwegen lohnt sich ein Besuch im etwa zweihundert Kilometer westlich von Istanbul gelegenen Edirne, das einst Hauptstadt des Osmanischen Reichs gewesen war. Sinan diente als Generalbaumeister insgesamt vier Sultanen: Selim I., Süleyman I., Selim II. und Murad III. Seine Werke, nicht nur Sakralbauten, sondern auch Villen, Paläste, Badehäuser, Armenküchen und Aquädukte, geben den Städten ihr unverwechselbares Gesicht und sind Vorbild für viele Architekten – bis heute.
Der langsame Niedergang des Osmanischen Reichs begann im Jahr 1774 mit der Niederlage im Krieg gegen Russland. Hatten die osmanischen Truppen sich bis dahin immer gegen ihre Feinde behaupten können, führte die Bezwingung durch die Russen zu einem neuen Machtgefüge in der Welt und innerhalb des Osmanischen Reichs. Andere Großmächte jener Zeit – Großbritannien, Frankreich und Österreich – witterten ihre Chance, das Osmanische Reich besiegen und unter sich aufteilen zu können. Die Angst vor einer Aufspaltung des Reiches durch fremde Mächte saß tief in Istanbul. In mehreren Teilen des Reichs kam es zu Aufständen und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Griechen, Serben, Ägypter, Wahabiten erhoben sich gegen die osmanische Zentralmacht, manche wollten sich gegen die Bevormundung wehren, andere witterten eine Chance, die eigene Macht zu vergrößern.
Kriegerische Niederlagen, Rebellionen im Inneren – mit zum Teil brutalem Vorgehen gegen Teile der eigenen Bevölkerung –, kostspielige Militärreformen sowie wirtschaftliche Probleme trugen zum Niedergang des Reichs bei. Ab dem neunzehnten Jahrhundert wurde es daher oft »der kranke Mann am Bosporus« genannt – ein Bild, das sich bis heute stark festgesetzt hat, weil man im deutschen Geschichtsunterricht meist erst dann das erste Mal vom Osmanischen Reich hört, wenn es um sein Ende geht. Bei zwei Balkankriegen 1912 und 1913 büßte das Osmanische Reich erneut große Teile seines Gebietes ein. Die Bewegung der Jungtürken, die auf Absolventen der Militärschulen und Verwaltungsakademien basierte, versuchte, eine Art konstitutionelle Monarchie einzuführen und die Schwäche des Sultans auf diese Weise auszugleichen. Am 23. Januar 1913 putschten sie sich an die Macht. Bis 1918 regierte ein »Triumvirat« aus Kriegsminister Ismail Enver Pascha, Marineminister Ahmed Cemal Pascha und Innenminister Mehmed Talaat Pascha diktatorisch. Unter ihnen kam es zum Völkermord an den Armeniern, den die Türkei bis heute nicht so bezeichnet wissen will, und sie führten das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg. Die Türken traten dem Bündnis der Mittelmächte bei und kämpften an der Seite des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns gegen die Entente-Mächte Großbritannien, Frankreich und Russland.
Für das Osmanische Reich bedeutete der Ausgang des Ersten Weltkriegs das Ende: Im Vertrag von Sèvres wurde 1920 die komplette Zerstückelung des Territoriums beschlossen, darunter die Gründung eines armenischen und eines kurdischen Staates und die Aufteilung weiter Gebiete unter den Siegermächten sowie Italien und Griechenland.
Für die Türken war das eine Schmach und begründete ein Misstrauen gegenüber dem Westen, das bis heute anhält. Schon im Jahr vor dem Vertrag von Sèvres hatte sich eine türkische Nationalbewegung formiert, die sich mit Waffengewalt gegen die geplante Besatzung und Bevormundung durch die Siegermächte zur Wehr setzte – ein Anführer dieser Bewegung war der Offizier Mustafa Kemal Pascha, später Atatürk genannt. Sein Ziel war die Errichtung eines türkischen Nationalstaats, den Vertrag von Sèvres lehnte er ab, weil er ihn als Friedensdiktat empfand, als einseitige Festlegung der Bedingungen durch die Siegermächte. Erste Verdienste hatte sich Atatürk als junger Truppenführer bei der Verteidigung der Halbinsel Gallipoli 1915 erworben, als unter anderem britische, französische, australische und neuseeländische Truppen die Dardanellen unter ihre Kontrolle bringen wollten und türkische Einheiten die Meerenge erfolgreich verteidigten. Es war eine der blutigsten und brutalsten Auseinandersetzungen im Ersten Weltkrieg. Viele der Deutschen, die in dieser Schlacht ihr Leben verloren, liegen auf dem Soldatenfriedhof in Tarabya, einem Stadtteil von Istanbul.
Etliche der Gespräche und Verhandlungen, die zum Entstehen der Republik Türkei auf den Trümmern des untergegangenen Reichs führten, fanden im Istanbuler Hotel Pera Palace statt. Wer dort heute übernachten und der Geschichte nahe sein will, muss tief in die Tasche greifen. Für weniger als zweihundertfünfzig Dollar pro Nacht gibt es kein Zimmer – und das ist dann klein, mit einem winzigen Bad, in dem ein Aufenthalt »selbst für eine Person grenzwertig ist«, wie ein Gast in einem Bewertungsportal anmerkt. Aber solch eine Kritik ist natürlich kleinlich, denn immerhin handelt es sich um das älteste und traditionsreichste Hotel Istanbuls. Hier schrieb Agatha Christie ihren Bestseller »Mord im Orientexpress«, hier nächtigte die Hollywood-Ikone Greta Garbo mehrere Wochen während Dreharbeiten, hier soll die legendäre Spionin Mata Hari untergekommen sein. Auch dem James-Bond-Film »Liebesgrüße aus Moskau« diente das Pera Palace als Kulisse.
Das Hotel hat eine einzigartige Vergangenheit. Es war das erste öffentliche Gebäude in Istanbul, das einen Stromanschluss hatte, und das erste Hotel der Stadt, in dem warmes Wasser aus den Leitungen kam. Man kann hier im zweitältesten elektrisch angetriebenen Aufzug Europas fahren, älter ist nur der im Eiffelturm. Das Hotel ist eine bewohnbare Ausstellung, ein »Museumshotel« – ein Status, der zur Folge hat, dass es keine Sterne führen darf.
Der Bau des Pera Palace war ein gewagtes Unterfangen in einer Zeit, in der das Osmanische Reich vor seinem Ende stand. Die belgische Firma Compagnie Internationale des Wagons-Lits begann Ende des neunzehnten Jahrhunderts mit dem Betrieb von Luxuszügen. Ab 1883 verkehrte der Orientexpress zwischen Paris und Konstantinopel. Eine solche Reise konnten sich nur die reichsten Europäer leisten. Manche wollten sich die exotische Hauptstadt des Osmanischen Reichs anschauen, andere stiegen hier um in die Bagdadbahn. Doch weil es in Istanbul an standesgemäßer Unterbringung für die feinen Damen und Herren fehlte, beschloss das Unternehmen, im Stadtteil Pera, dem heutigen Beyoğlu, ein Hotel zu errichten. 1892 begann der Bau des Pera Palace, drei Jahre später wurde es offiziell eröffnet.
»Das Pera Palace war gleichsam als letzter Gruß des Abendlandes entlang der Route in den Orient gedacht, das denkbar glanzvollste Hotel westlicher Art in der Hauptstadt des größten islamischen Reichs der Erde«, schreibt der US – amerikanische Historiker Charles King. »Wie Istanbul selbst war auch das Hotel die erste größere Anlaufstelle für Europäer, die sich ihren Traum von einer Reise ins Fabelreich der Sultane, Harems und Derwische erfüllen wollten.«
Nachdem die Siegermächte des Ersten Weltkriegs dem Osmanischen Reich den Todesstoß versetzt hatten, war auch die Zeit der reichen Touristen vorbei, die das Pera Palace aufsuchten. Wagon-Lits stieß das Hotel 1919 ab, Käufer war ein griechischer Geschäftsmann. Ein Memoirenschreiber notierte, das Pera Palace habe sich den Ruf erworben, ein Hotel zu sein, in dem »ausländische Offiziere und Geschäftsleute von skrupellosen levantinischen Abenteurern unterhalten werden und mit gefallenen russischen Fürstinnen oder griechischen und armenischen Mädchen trinken und tanzen, deren Moral, milde ausgedrückt, so fadenscheinig ist wie ihre Gewänder«.
Reporter wie Ernest Hemingway und alliierte wie türkische Politiker, Diplomaten und Offiziere fanden sich in der Orientexpress-Bar zum Drink ein. Es war in dieser Bar, dass die Repräsentanten der Siegermächte auf den jungen, aufstrebenden Mustafa Kemal Pascha aufmerksam wurden. Ihn störte, dass plötzlich Fremde das Sagen in seinem Land hatten. Eine Anekdote erzählt, dass eine Gruppe britischer Offiziere ihn auf einen Drink an ihren Tisch einlud. Er lehnte dankend ab – es gehöre sich für einen Gastgeber nicht, sich an den Tisch seiner Gäste zu setzen. Vielmehr könnten die britischen Offiziere zu ihm kommen, wenn sie mit ihm etwas trinken wollten.
Die Türken wollten sich nicht geschlagen geben und sich den Siegermächten gar unterwerfen, sie wehrten sich gegen die Aufteilung ihres Landes und kämpften um ihre Souveränität. Dabei half ihnen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit der Europäer. Als am 29. Oktober 1923 die Republik ausgerufen wurde, hatten die Türken ihr Ziel erreicht. Wenige Wochen zuvor, im Juli, hatte man sich auf ein neues Abkommen geeinigt, das den Vertrag von Sèvres ersetzen sollte. Im Vertrag von Lausanne wurde die Türkei in ihren heutigen Grenzen anerkannt – zwar nur ein Bruchteil des einst riesigen Osmanischen Reichs, aber doch dessen Herzland. Mustafa Kemal Pascha wurde zum ersten Präsidenten des neu gegründeten Staates. Einige Jahre später erhielt er deshalb den Beinamen Atatürk – »Vater der Türken«.
Seine Vorstellungen von der Modernisierung des Landes hatte der Gründervater der Republik Türkei in einem Zimmer des Pera Palace formuliert. Sie waren ein bewusster Bruch mit der osmanischen Vergangenheit, geradezu eine Revolution, allerdings eine von oben – und damit war fraglich, wie nachhaltig diese Modernisierung der Türkei sein würde. Bereits 1922, ein Jahr vor Gründung der Republik, war das Sultanat abgeschafft worden. 1924 traf dieses Schicksal auch das Kalifat, also die religiöse Führung der islamischen Welt. Die Vertreter der alten osmanischen Herrscherfamilie wurden des Landes verwiesen. Das Modell eines islamisch dominierten, aber doch multireligiösen Reichs wurde ersetzt durch eine säkulare Republik mit einem – zumindest in der Vorstellung – homogenen Staatsvolk. Atatürk begründete damit einen türkischen Nationalismus, der bis heute propagiert wird. Am 20. April 1924 wurde die erste Verfassung der Republik verabschiedet, die ganz zugeschnitten war auf Atatürk. Ihm sicherte sie die größte Macht zu.
Atatürk, der Modernisierer, die allgegenwärtige Überfigur, geboren 1881 im heutigen Thessaloniki als Sohn eines Zollbeamten und Holzhändlers, gestorben 1938 in Istanbul. Sein Porträt hängt in der Türkei in Schulen, in Ämtern, Firmen, Hotels, auch in vielen Privathäusern. Seine Statue findet man in vielen Städten und Dörfern. Er war zunächst der heldenhafte Offizier, unter dessen Kommando die Soldaten jene Gebiete erfolgreich für die Türkei beanspruchten, die die heutige Republik bilden. Und er war der Politiker, der das Land in die Moderne führte, Richtung Westen, hin zu Europa. Seine Politik war ein bewusster Bruch mit dem Osmanischen Reich, mit einer zuletzt demütigenden Vergangenheit, derer man sich offensichtlich schämte. Zu fern waren die glanzvollen Zeiten, als dass man sich an sie noch erinnern wollte. Ein sichtbares Zeichen dieses Bruchs mit der Vergangenheit war die Verlegung der Hauptstadt von Istanbul ins vierhundert Kilometer ostwärts gelegene Ankara.