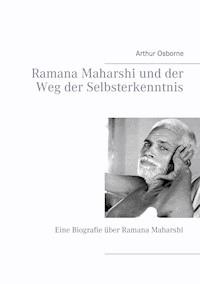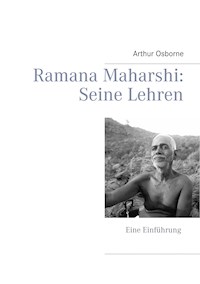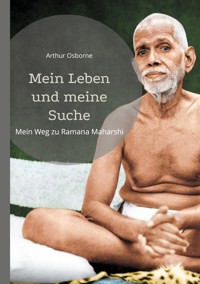
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Engländer Arthur Osborne (1906-1970), der mehrere Bücher über Ramana Maharshis Leben und Lehre verfasst hat und eine bekannte Gestalt im Ramanashram war, schildert in seiner Autobiografie sein bewegtes Leben, das er von Jugend an der spirituellen Suche widmete. Sie führte ihn zu Réne Guénon und schließlich zu Ramana Maharshi nach Südindien, wo er seine Erfüllung fand. Arthur Osborne berichtet von seinem persönlichen Übungsweg der Selbstergründung mit der Suchfrage "Wer bin ich?", wie der Maharshi sie gelehrt hat, den er in aller Konsequenz verfolgte, und von seinen jeweiligen Erfahrungen. Er reflektiert und erklärt vieles, was diesen Weg betrifft. Zudem erzählt er lebhaft von seinem Leben in verschiedenen Ländern, von seinen wechselnden Berufen, seiner Lagerhaft in Thailand, seiner Familie und natürlich von seinem Meister Ramana Maharshi. Jeder spirituell Suchende wird in diesem Buch viel Nützliches finden und zahlreiche hilfreiche Anregungen, v.a. was den Weg der Selbstergründung betrifft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sri Ramana Maharshi (1879-1950)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Ramanashram
Vorwort von Katya Douglas
1. Anfänge
2. Eine weitere Station
3. Kursänderung
4. Die Abkehr von Oxford
5. Am Tiefpunkt
6. Hochzeit
7. Die Suche beginnt
8. Abenteuer auf dem Weg
9. Kummer
10. Bhagavan Sri Ramana Maharshi
11. Wie ich ein Schriftsteller wurde und aufhörte, einer zu sein
12. Kurze Ewigkeit
13. Ruhestand
14. Fortdauernde Suche
Gedichte
Ein Testament
Der Guru
An Arunachala
An Bhagavan
Kurze Ewigkeit
Der Tiger
Der Bewohner
Der initiatische Tod
Die dunkle Nacht
Verlassenheit
Die Dame von Shallot
Beende dein Werk!
Die schlafende Schönheit
Das Nicht-Selbst (Anatta)
Die zwei Fenster
Wem?
Die Welt
Die Welt II
Die Shakti
Deshalb bin ich nicht
Das Traum-Selbst
Die Anderen II
Die Ausdehnung
Fantastische Dinge
An die Christen
Was bleibt übrig?
Das Lied
Der Traum
Der Dichter
Tag und Nacht
Der abnehmende Mond
Das Elixier der Jugend
Andersheit
Der Wind
Literaturverzeichnis
Vorwort des Ramanashram
Arthur Osborne, einer der ernsthaftesten und bekanntesten Devotees von Sri Bhagavan, gründete The Mountain Path, die spirituelle Zeitschrift des Ashrams, und gab sie heraus. Er ist bekannt als der Herausgeber der Collected Works of Ramana Maharshi (Ramana Maharshi: Die Gesammelten Werke) sowie als Verfasser von Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge (Ramana Maharshi und der Weg der Selbsterkenntnis) und anderer Werke.
Wir sind glücklich, diesen autobiografischen Bericht von Arthur Osborne herauszubringen, der für den ersthaften Sucher von großem Wert sein wird, da er viele Informationen über den spirituellen Weg enthält. Die Darstellung des Autors über den spirituellen Dienst von Sri Bhagavan ist besonders bewegend.
Wir danken Katya Douglas, der Tochter des Autors, für ihre Freundlichkeit, uns das Manuskript und die Erlaubnis zu geben, es als Ashram-Veröffentlichung herauszubringen.
31. Dezember 2001, Bhagavans 122. Geburtstag
Sri Ramanashram (Herausgeber)
Vorwort von Katya Douglas
Viele Jahre nachdem mein Vater 1970 gestorben war, öffnete ich einen alten Koffer und fand darin mehrere unveröffentlichte Manuskripte. Es ist seltsam, dass sie so lange Zeit verborgen und unbekannt geblieben waren, aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, diese Geschichte zu erzählen. Wenn man sie liest, ist es faszinierend zu sehen, wie wahrhaftig seine Stimme war und die Jahre überdauerte. Eines der Dokumente war seine Autobiographie, die er The Mountain Path, My Quest betitelt hatte. Als er später die Zeitschrift des Ramanashram unter dem Titel The Mountain Path herausbrachte, beschlossen wir, ihn nicht für den Titel seines Buches zu verwenden, um eine Verwechslung zu vermeiden.
Es ist ein geeigneter Titel für die Geschichte seines Lebens, das vor allem der Suche nach dem Weg gewidmet war. Als er sich sicher war, den richtigen Weg gefunden zu haben, verpflichtete er sich zu ihm. Seine Dichtung wie auch seine Prosaschriften zeigen, was für ein Kampf das für ihn manchmal war, wie er mit Dunkelheit und Verzweiflung rang, aber, wie er sich ausdrückt, macht ein Mann, der den Mount Everest erklimmt, keinen Halt, um Geige zu spielen. Durch alle Wechselfälle blieb sein Vertrauen in Bhagavan unerschütterlich, und Bhagavan erkannte seine Demut und Hingabe. Manchmal, wenn er mit geschlossenen Augen in Meditation versunken in der Halle saß, sah Bhagavan ihn mit solcher Liebe an, dass sie einen zum Weinen bringen konnte. Sogar als Kind erkannte ich manchmal, dass das etwas ganz Besonderes war.
Er war eine besondere Person und ein besonderer Vater, aber da er der einzige Vater war, den ich jemals kannte, habe ich seine Einmaligkeit erst später verstanden. Natürlich war einiges an ihm auffallend, selbst für mich. Er schreibt, dass er als junger Mann sehr gesellig war. Das mag sein wie es will. Als er ein älterer Mann und mein Vater war, war er sehr still und das Gegenteil davon. Er sprach, aber er schwatzte nie. Ich konnte ihn alles fragen, was ich wollte, und erhielt eine prägnante Antwort. Aber er sprach nie wahllos oder nur, um die Stille zu füllen. Er war ein stiller Mann, und er trug die Stille wie einen Umhang.
Ich erinnere mich an einige Geschichten, die dieses Merkmal unterstreichen. Einmal kamen zwei Männer von Delhi nach Tiruvannamalai, nur um meinen Vater zu treffen. Meine Mutter ließ sie auf der Veranda Platz nehmen und machte mit ihrer Arbeit weiter. Nach etwa einer Stunde, als sie draußen nichts hörte, vermutete sie, dass die Männer gegangen waren, und ging hinaus. Sie stutzte, als sie sah, dass alle drei schweigend zusammensaßen, und beeilte sich, ein Gespräch zu beginnen. Sie wollten ihn vieles fragen, waren aber zu aufgeregt oder schüchtern, um ein Gespräch zu beginnen. Als sie schließlich gegangen waren, fragte meine Mutter ihn, warum er nicht mit ihnen gesprochen habe, warum er sie so lange habe schweigend dasitzen lassen. Er wusste nicht, was sie so aufbrachte. Er sagte, dass er gedacht habe, sie wollten schweigen, und wenn sie etwas zu ihm sagen wollten, so hätten sie es nur zu tun brauchen.
Einige Zeit nachdem ich von Zuhause ausgezogen war und mit meinem Mann in Pakistan lebte, kam ich zu Besuch. Ich hatte auf dem Bazar in Peshawar einige alte Münzen gekauft und zeigte sie ihm. Ich erzählte ihm, dass man mir gesagt habe, dass sie aus der Regierungszeit eines alten Königs stammen würden. Er sah sie sich an und sagte, dass eine der Münzen noch viel älter sei. „Woher weißt du das“, fragte ich ihn. „Ich habe nicht gewusst, dass du dich für alte Münzen interessierst.“ „Das tu ich auch nicht“, erwiderte er, „aber auf der Münze steht das Jahr.“ „Es ist arabisch“, rief ich aus. „Ich wusste nicht, dass du Arabisch kannst. Warum hast du es mir nie erzählt?“ „Weil du mich nie danach gefragt hast“, lautete seine Antwort. Er hatte die Sprache vor vielen Jahren gelernt, sie aber seit langem nicht mehr angewandt. In all den Jahren war es ihm nie in den Sinn gekommen, zu erzählen, dass er außer Polnisch und Französisch noch eine weitere Sprache beherrschte, und wie ich inzwischen weiß, noch weitere, nach denen ich ihn nicht gefragt hatte. Wie ich bereits gesagt habe, war er kein Mann vieler Worte, aber was er sagte, war wert, gehört zu werden.
Auch meine Mutter war Bhagavan sehr zugetan, obwohl ihre Verehrung mehr intuitiv war. Ihr Instinkt war zuverlässig. Als mein Vater zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in Bangkok interniert war, erhielt sie von ihm zwei Jahre lang keine Nachricht. Dann kam ein Telegramm vom Kriegsministerium, in dem stand, dass er ermordet worden sei. Wir lebten damals bei unseren Freunden, den Sharmas in Madras. Frau Sharma war furchtbar durcheinander wegen meiner Mutter und versuchte, sie zu trösten. Meine Mutter war ziemlich ruhig. Sie sagte immer wieder: „Sorg dich nicht, es ist ein Irrtum. Wenn Arthur tot wäre, wüsste ich es. Ich weiß, dass er nicht tot ist. Es ist ein Versehen.“
Natürlich glaubten alle, dass sie vor Kummer das innere Gleichgewicht verloren hätte, und Frau Sharma war durch ihr scheinbar so irrationales Benehmen so verstört, dass meine Mutter sie trösten musste, während sie selbst ihrem Empfinden treu blieb, dass ihr Mann lebte. Einige Tage später traf ein weiteres Telegramm ein, in dem stand, dass es der falsche Osborne war. Ihre Intuition hat sie geleitet und ihr Vertrauen in Bhagavan, der zustimmte, als mein kleine Bruder Adam ihn bat, seinen Daddy zu beschützen. Dies und ihr eigener Instinkt gaben ihr die Erkenntnis und die Tapferkeit, die Wahrheit zu spüren und den Irrtum zu bemerken. Später erhielten wir alle seine Briefe auf einmal, und anscheinend hatte auch er von uns erst zwei Jahre später Nachricht erhalten.
Da ich die Älteste von uns drei Kindern war und die Einzige, die damals schreiben konnte und die sich tatsächlich an den Vater erinnerte, durfte ich ihm meinen eigenen Brief schreiben, obwohl er nicht länger als 25 Worte sein durfte. Ich brauchte lange, alles, was ich ihm zu sagen hatte, darin unterzubringen, und versuchte, es in wenigen Worten zusammenzufassen. Für mich war das nicht so schwierig, wie es nachträglich aussieht, da Kinder die Fähigkeit haben, anzunehmen, was immer das Leben ihnen bietet, und es als gegeben hinnehmen. Wir verlieren diese Gabe, wenn wir groß werden, und müssen hart daran arbeiten, sie wiederzuerlangen. Jetzt spüre ich, wie leidvoll es für meine Eltern gewesen sein musste, angesichts eines so langen Schweigens weiterzumachen. Glücklicherweise hatten sie Bhagavan.
Die Jahre, nachdem er aus dem Krieg zurück war, waren für uns Kinder eine große Freude. Unser fast mythischer Daddy war wieder bei uns, und wir schwelgten darin. Er brachte eine neue Sichtweise in unser Leben. Meine Mutter hatte sich während des Krieges alleine mit drei kleinen Kindern und einer unsicheren Zukunft durchgekämpft. Sie war für uns die einzige Autoritätsperson, und es war für sie manchmal schwierig, mit unserem ständigen Sinn für Unfug klarzukommen. Mit der Ankunft meines Vaters erweiterte sich unser Horizont. Wir liebten seine Weisheit und seinen angeborenen Gerechtigkeitssinn. Wir liebten seinen feinsinnigen Humor und die Art, wie er mit einem völlig ernsten Gesicht unsere Mutter neckte, bis wir alle in Lachen ausbrachen, auch sie. Wenn ich zurückblicke, erkenne ich, dass die Freude über das Ende der langen Trennung Lachen in unser aller Leben brachte. Mein Vater war ein begeisterter Gärtner, und ich liebte es, mit ihm am Morgen durch den Garten zu gehen, wenn er alles Grüne begutachtete und pflegte. Er wusste genau, was jede Pflanze brauchte, und prägte meine Liebe zu Gärten, die ich nie verloren habe.
Manchmal saß er nachts draußen und zeigte uns die verschiedenen Sterne und Sternbilder. Er erzählte mir auch Geschichten aus der Mythologie, die mich so sehr faszinierten, wie sie auch ihn als Kind begeistert hatten. Als wir klein waren, erzählte er uns die wunderbarsten Gutenachtgeschichten wie die Sage von einer Fee, die in einer Magnolie lebte und auf den Mond-strahlen reiste. Es mag erstaunen, aber wir drei freuten uns auf die Schlafenszeit. Er war ein begabter Geschichtenerzähler.
Viele Jahre später, als ich mit meiner kleinen Tochter Aruna zu einem längeren Besuch heimkam, sorgten wir uns, dass sie zu viel Unterricht versäumen würde. Da erklärte sich mein Vater dazu bereit, sie in Englisch und Geschichte zu unterrichten. Sie saßen draußen auf der Veranda. In seiner tiefen Stimme erzählte er ihr Geschichten, und ihre kindlich hohe Stimme unterbrach ihn gelegentlich, um etwas zu fragen. Er machte alles so spannend, dass ich selbst außer Sichtweite drinnen am Eingang saß, um ihm zuzuhören. Meine Mutter saß ebenso im anderen Zimmer. Sie sah mich an, lächelte, legte ihren Finger auf die Lippen, und so saßen wir wie Verschworene schweigend da.
In der Zeit, als meine Eltern nach einem spirituellen Weg suchten, war das kein sehr gängiges Unterfangen. Heutzutage sind immer mehr Menschen daran interessiert, eine tiefere Wahrheit zu finden, obwohl oder vielleicht weil wir in einer gefährlichen und materialistischen Welt leben. Ungeeignete Gurus oder betrügerische Sekten führen leider viele in die Irre. Bhagavan hat oft betont, dass wir nicht der Körper sind. Seine Lehre ist heute so wirksam und lebendig wie damals, als er in der Halle saß und einen Körper hatte, den alle sehen konnten.
Für meinen Vater war sein Kommen nach Tiruvannamalai die Bestätigung seiner Suche und auch die Bestätigung, dass Bhagavan sein Guru war. Deshalb blickte er nie zurück. Nachdem er nach seiner Arbeit in Kalkutta in den Ruhestand gegangen war, gab er die Zeitschrift The Mountain Path heraus, bis seine Gesundheit es nicht mehr erlaubte. Als er spürte, dass er damit nicht weitermachen konnte, bereitete er zehn Editorials vor, die sein Nachfolger benutzen konnte. Meine Mutter übernahm schließlich diese Aufgabe einige Zeit lang, was für sie sehr schwierig war, da Englisch nicht ihre Muttersprache war. Sie tat es aus Liebe und Loyalität, bis auch sie dazu gesundheitlich nicht mehr in der Lage war. Ihre Beziehung, eine Verbindung von Gegensätzen, war für sie beide entscheidend, und die letzten Worte meines Vaters, die er zu ihr sagte, waren: „Danke.“ Dann starb er wie er gelebt hatte, ohne viel Aufhebens, und er wurde in seinem Garten beerdigt, den er angelegt und geliebt hat. Er war erst vierundsechzig.
Die Kriegsjahre hatten von ihm ihren Tribut verlangt, und auch die Intensität der inneren Suche hat seinen Körper sehr belastet, weil er keine Kompromisse duldete. Das wertvolle Erbe, das er uns hinterlassen hat, waren seine Schriften. Wir können mit ihm reisen und erfahren, wie er mit den Schwierigkeiten umging, die uns alle bedrängen. Wenn ich wiederum von seinem inneren Leben und Kampf lese, ermutigt es mich, dass ein gewöhnlicher Mensch in sich solche Standhaftigkeit und Fähigkeit finden konnte, trotz aller Hindernisse entschlossen zu bleiben. Er ist ein Beispiel für jeden, der sich auf dem Bergpfad befindet.
Katya Douglas
Tiruvannamalai, 31.12.2001
1. Anfänge
Als ich ein kleiner Junge war, gab es drei Bücher, die ich immer wieder las: The Knights of King Arthur (König Arthur und die Ritter der Tafelrunde), Asgard and the Gods (eine Sammlung nordischer Mythologie) and The Arabian Nights (Abenteuer aus 1001 Nacht).
König Arthur war mein Lieblingsbuch. Meine Mutter besaß ein in Leder gebundenes Exemplar, das sie einmal als Schulpreis erhalten hatte, und keine Seite darin trug nicht meine schmutzigen Fingerabdrücke. Mein nächstes Lieblingsbuch waren die nordischen Legenden. Die anspruchsvollere griechische Mythologie sagte mir nie zu, aber die wilde Größe der Normannen (Wikinger) wühlte mich so sehr auf, dass sie mir in Erinnerung blieb – die arrogante Maßlosigkeit der Giganten in der Zeit ihres Aufstiegs, sodass selbst ein Schlag von Thors Hammer nicht mehr gefühlt wurde, als eine Eichel, die einem auf die Stirn fällt. Und dann das Erstarken der Macht Thors. Wie die Giganten seinen Hammer Mjolnir stahlen, ihn tief in der Erde verbargen und ihn nur zurückgeben wollten, wenn einer von ihnen Odins Tochter zur Braut erhielt, wie die Götter sie austricksten, indem sie Thor in Brautkleider steckten und ihn verschleiert in ihren Palast schickten. Selbst durch den Schleier konnte man das Blitzen seiner Augen sehen. Dann wird die Geschichte spannend. Der Bräutigam bat die Braut, ihren Schleier zu lüften, aber die angebliche Braut bestand darauf, dass er zuerst Mjolnir in ihren Schoß legen sollte. Als er dies getan hatte, lachte Thor laut, zog den Schleier vom Gesicht und erhob sich, indem er Mjolnir schwang und den ganzen Ort in rauchenden Ruinen zurückließ. Diese Geschichte und die tragischere Geschichte der Ermordung Baldurs, des Schönen, der Verrat durch Loki, der Aufstieg seiner furchterregenden Söhne aus der Unterwelt und das Ende im letzten schrecklichen Kampf von Ragnorak faszinierten mich sehr.
Als ich älter wurde, begann ich undeutlich das Geheimnis der Symbole hinter den Geschichten zu verstehen. Es ist tatsächlich bemerkenswert, dass alle drei Bücher Allegorien des Gesetzes des Universums sein könnten. Ich las nicht nur diese Geschichten, sondern machte auch meine eigenen, besonders über König Arthur und seine Ritter, die ich mir erzählte, wenn ich ging oder beschäftigt war. Das war mein Geheimnis. Ich habe nie jemandem davon erzählt. Ich muss mir diese Geschichten in Versen erzählt haben, denn ich erinnere mich daran, dass ich darüber rätselte, warum der Satz falsch klang, wenn ich ein Wort, d.h. eine Silbe hinzufügte, und richtig, wenn ich zwei hinzufügte.
Es kam die Zeit, als ich diese Vorstellungen als Sünde betrachtete und beschloss, damit aufzuhören, aber so sehr ich es auch versuchte, ich kam doch immer wieder darauf zurück. Einmal beschloss ich, zur Strafe und zur Erinnerung eine Kordel mit Knoten um meine Hüfte zu tragen, da ich gelesen hatte, dass Mönche im Mittelalter das taten. Ich fand ein altes Stück Gartenschnur, machte Knoten hinein und band sie mir fest um die Hüfte. Doch ich bekam davon Bauchweh, und ich konnte die Kordel nicht anders festmachen, damit sie auch hielt. Also ließ ich die Idee wieder fallen.
Damals hatte ich einen beliebten Tagtraum von einem mächtigen König in einem zeitlich und örtlich weit entfernten Land. Viele Leute kamen zu ihm und brachten alle erdenklichen Güter und Vergnügungen mit, und dann kam ich im Habit eines Mönchs zu ihm und bot ihm Verzicht und Härte an. Später entdeckte ich, dass der König das Ego war, das inmitten der Vergnügungen dieser Welt thronte und dann gebeten wurde, ihr zu entsagen und sich auf die einsame Suche zu begeben.
Das alles bedeutete nicht, dass ich ein missmutiges oder bedrücktes Kind war. Im Gegenteil, ich war ausgelassen, wie ein Schütze es sein sollte. Ich liebte Spaß und freute mich, wenn Besucher kamen oder wenn wir irgendwohin gingen. Nur war da auch der innere Lebensstrom, und das war etwas, worüber ich nicht sprach. Extrovertiert oder introvertiert? Ich glaube nicht, dass diese Begriffe so weit angewendet werden können, wie allgemein angenommen wird. Ein lebhafter Mensch ist oft beides, ein weniger lebhafter Mensch keines von beidem. Ich war beides in einem hohen Ausmaß.
2. Eine weitere Station
Was mich als nächstes sehr beeinflusste, waren die Yorkshire-Moore. Vielleich können sie als eine Vision der Schönheit beschrieben werden – die lange Reihe der Hügel, das Heidekraut, das violett in der Ferne leuchtete und federnd unter den Füßen war, der Überfluss an Wildblumen – Sumpforchideen und vieles andere – die wilden Erdbeeren, die am Wegesrand wuchsen, und über allem der düstere Kiefernwald mit dem Wind, der stöhnend durch die Bäume strich. Ich hatte auch schon zuvor schöne Landschaften gesehen und sah sie auch danach, aber sie übten nie eine solche Gewalt über mich aus wie diese. Ich liebte sie im Regen, im Nebel und im Sonnenschein. Sie verband sich in meinem Geist mit den nordischen Legenden und die lebendige Kraft der Nordländer. Sie schien mir zu heilig zu sein, um darüber zu sprechen, und ich sprach nie darüber.
Als wir das letzte Mal unsere Sommerferien dort verbrachten, war ich etwa fünfzehn. Der Zauber war so stark wie immer. Damals schrieb ich mein erstes Sonnet. Ich saß allein auf einem Hügel, nahm ein neues Notizbuch aus meiner Brusttasche und schrieb auf die erste Seite ein Sonnet über das Moor. Ich beschloss, auf jeder Seite eines zu schreiben und es meiner Mutter als Geburtstagsgeschenk zu geben, wenn es voll war. Ich weiß nicht, ob ich nochmals ein Gedicht hineingeschrieben habe. Ich ließ es jedenfalls nie jemanden sehen. In denselben Sommerferien schrieb ich ein Gedicht über das Moor und die Kiefern, das ich lange für ein gutes Gedicht hielt. Jung, wie ich war, war es mit wirklicher Inspiration geschrieben. Doch inzwischen habe ich es längst vergessen.
In denselben Ferien freundeten wir uns mit einem örtlichen Bauer an, den ich Bob Thorpe nennen will. Er sah ungehobelt aus, war unrasiert und hatte einen breiten nordischen Akzent. Trotzdem liebte er die Schönheit und las Gedichte. Als er neben mir auf dem Hügel saß, rezitierte er Tennyson und Milton, und sein Akzent war kaum noch zu hören. Auch er liebte das Moor. Anstatt ein zusammenhängendes Stück Land im Tal um seinen Bauernhof zu haben, waren seine Felder auf mehrere Hügel verstreut, weil er gerne von Hügel zu Hügel ging. Einige sagten, das sei so, weil es ihm eine Ausrede verschaffte, um über das Grundstück des Gutsherrn zu gehen, und dass er dabei Hasenfallen aufstellte, denn die Wilderei war für ihn ebenso ein Geschäft wie die Landwirtschaft.
Ich habe nie Spiele gemocht, weder Cricket noch Fußball, noch die leichteren Spiele wie Tennis und Badminton. Ich spielte so viel wie ich in der Schule musste, nicht mehr. Andererseits liebte ich das Gärtnern. Wir hatten hinter unserem Haus einen Obstgarten und einen Blumen- und Gemüsegarten. Mein Vater und ich machten die ganze Gartenarbeit. Ob es sich um anstrengende Arbeit wie graben, düngen oder sähen handelte, das Beschneiden der Obstbäume oder auch Unkraut jäten, ich liebte jeden Kontakt mit der Erde und den Pflanzen. Als es Zeit für die Ernte war und Bob Thorpe mich für sich umsonst arbeiten ließ, war er es, der mir damit einen Gefallen tat. Wir arbeiteten von Tagesanbruch bis in die Dämmerung, machten um die Mittagszeit Rast im Schatten und aßen das kalte Fleisch, das die Frauen uns aufs Feld brachten. Wir hatten eine altmodische Erntemaschine, bündelten die Garben von Hand und ordneten sie in Heustöcken an. Ich hatte nie wieder so schöne Ferien.
Die landwirtschaftliche Arbeit sagte mir zu und hätte mich auch erfüllt, aber mein Vater hatte andere Pläne für mich und zog diese Möglichkeit nicht in Betracht.
Wenn ich sage, dass dies, wäre es möglich gewesen, die einzige Erfüllung in meinem Leben hätte sein können, will ich damit nicht sagen, dass ich es bedaure, dass es nicht eingetroffen ist. Vielmehr ist es ein Anlass zur Freude. Das einzige wirkliche Maß des Erfolgs im Leben ist der Zustand des Geistes und der Charakter, den man erlangt hat, wenn es Zeit ist, die Welt zu verlassen. Der einzige völlige Erfolg ist die spirituelle Erleuchtung, die Verwirklichung des Selbst. Das Leben des Menschen kehrt unweigerlich zu seiner Quelle zurück, zur Einheit mit dem Selbst, wie ein Fluss zum Meer. Dieses Leben ist eine Episode auf dem Weg, und das Einzige, was zählt, ist die Entfernung vom Ziel, wenn diese Episode endet. Das hängt von zwei Dingen ab: zuerst von der Position, aus der dieses Leben beginnt, also die Etappe, die man bereits in seinem letzten Leben erreicht hat, sei es menschlich gewesen oder nicht – zweitens von der Weisheit und Entschlossenheit, mit der man in diesem Leben vorwärtsgeht. Die verschiedenen Etappen, auf denen der Mensch sein Leben beginnt, oder die verschiedenen Grade des Verstehens und der Entschlossenheit, mit denen er ausgestattet ist, sind nicht ungerecht, denn damit ist nur die Schnelligkeit betroffen, und Ungeduld ist eine rein menschliche Krankheit. Der Unterschied betrifft nicht das universale Gesetz oder das endgültige Ergebnis.
Aus der Sicht eines universalen Gesetzes kann der Verlauf, dem der Mensch folgt, eher mit dem Fluss, der ins Meer fließt, verglichen werden als mit einer Pilgerreise – wobei eine Lebensspanne nicht den ganzen Verlauf des Flusses repräsentiert, sondern nur eine bestimmte Strecke. Selbst wenn einige Flüsse sich schlängeln oder stagnieren oder sich sogar rückwärts wenden, während andere schnell und kraftvoll dahinfließen, münden doch alle schließlich in dasselbe Meer. Es gibt nicht einmal die Frage, ob früher oder später, da die Zeit keine Rolle spielt, wenn der Lauf des Flusses als Ganzes aus der Luft betrachtet wird. Aber für das Individuum macht die Zeit einen Unterschied. Solange der Mensch sich für ein Individuum hält, ist das Bestreben wirklich, und das Symbol der Pilgerschaft trifft es besser als das des Flusses. Für einen Pilger bedeutet verlorene Zeit eine verlorene Gelegenheit. Eine ganze Lebenszeit, ein ganzer Tag auf der Pilgerschaft mag verloren sein, wenn man am Straßenrand faulenzt, über ein Feld wandert oder sogar zurückgeht. Dann wird der nächste Tag anstrengender sein und der Ausgangspunkt weniger vorteilhaft.
Es ist wahr, dass keinesfalls alle das Leben als eine zweckvolle Reise betrachten. Glücklich sind jene, die das tun und an ihrer Erkenntnis arbeiten, selbst jene, die keinen Fortschritt oder sogar Rückschritte machen, je nachdem, ob sie den Griff des Egos schwächen oder stärken, einige seiner Tentakel abtrennen oder neue entwickeln. Grundsätzlich ist die Schwächung und die endgültige Vernichtung des Egos der Zweck aller Religionen. Und am wirksamsten ist die Religion, die für die Bewältigung dieser Aufgabe am geeignetsten ist, wobei auch der selbstlose Dienst am anderen, Tiere und Pflanzen mit eingeschlossen, ebenfalls bis zu einem gewissen Grad wirksam sein können. Alles, was das Ego schwächt, ist gut, alles, was es stärkt, ist schlecht. Deshalb kann es für einen Menschen vorteilhafter sein, entwurzelt zu werden anstatt Wurzeln zu schlagen. Das traf auch auf mich zu. Wenn das Schicksal den Kreis geschlossen und mich dazu geführt hätte, auf einem Bauernhof in Yorkshire zufrieden zu sein, hätte meine Reise dort geendet, und diese Lebenszeit wäre verschwendet worden. So war diese Episode wie ein Bahnhof, an dem der Zug lang genug hält, um aus dem Fenster zu sehen und dann weiterzureisen.
3. Kursänderung
Ich kehrte nie wieder ins Moor zurück. Das Leben verlief auf einem anderen Kurs. Das Leuchtfeuer vor mir, auf das ich zusteuerte, war ein Stipendium in Oxford. Ich verfüge über die methodische Beharrlichkeit, ein Ziel zu verfolgen, was man von einem Steinbock verlangen kann. Gegenwärtig war das Ziel ein idealisiertes Oxford. Später war es das höchste Ziel von Nirvana. Zwischen beiden gab es eine Zeit mit vorgestellten Zielen, als ich auf dem stürmischen Meer dahintrieb. Im Moment erschien mir Oxford wie eine Alabasterstadt der Träume im Nebel vor mir, und ich strebte beständig darauf zu. Es war nicht das Tor für eine gute Karriere, sondern eine Oase der Kultur im trostlosen Geld-Kult des Westens. In der Tat arbeitete die Ablehnung einer materialistischen Welt bereits in mir, wobei ich die wahre Alternative dazu noch nicht festgelegt hatte. Das idealisierte Oxford diente als vorgestellter Ersatz dafür.
Meine Schule bildete die Jungen in den klassischen Fächern, Naturwissenschaft und Mathematik aus, aber ein enthusiastischer Geschichtslehrer interessierte sich für mich und erhielt vom Schulleiter die Erlaubnis, mich auf ein Geschichtsstipendium vorzubereiten. Das war noch vor dem Wohlfahrtsstaat, als alle von selbst ein Stipendium erhielten, die eine Zulassung zur Universität hatten. Für mich war ein Stipendium nötig, oder es ging nicht.
Neben dem ausdauernden Studium fand ich noch Zeit zum Lesen anderer Bücher. Ich las Philosophen wie Ruskin und Carlyle. Doch ich las auch theologische Bücher wie etwa die Werke von Dean Inge, der damals in Mode war, und auch viele Gedichte. Ich genoss es, besonders wenn ich alleine Zuhause war, laut Gedichte zu lesen. Ich genoss auch alle humorvolle Literatur, die ich in die Finger bekam – Pickwick, die Theaterstücke von W.S. Gilbert und The Ingoldsby Legends. Abgesehen von gelegentlichen humorvollen Romanen las ich keine Romane. Es erschien mir als Zeitverschwendung, mit so viel Wissen, das ich erwerben wollte, und Nachdenken über Philosophie. Obwohl ich wenig Geld hatte, baute ich mir doch eine kleine Bibliothek auf.
Ich hielt mich für einen zukünftigen Schriftsteller. Als ich eines Abends den Sonnenuntergang von einem windigen Hügel aus betrachtet, war ich mit der Intensität einer Offenbarung plötzlich davon überzeugt: „Ich könnte Gedichte schreiben, wenn es ein Thema gäbe, das wichtig genug ist, um darüber zu schreiben.“ Im Laufe meines Lebens habe ich mich oft daran erinnert und mir gesagt: „Ist das, was ich jetzt fühle, wichtig genug?“ Aber das war es nie.
Ein andermal spazierte ich über die Felder in die Stadt. Ich hatte den seltsamen Traum, dass ich eines Tages ein Buch schreiben würde, das in Prosa beginnen und dann in einer für die Prosa zu hohen Schwingung in Dichtung übergehen und schließlich alle Sprache überwinden und im Schweigen enden würde.
Es gab damals noch keine Busse auf den Straßen, und mein Schulweg war zwei Meilen lang, morgens hin und abends zurück, manchmal auch viermal am Tag, wenn ich zum Mittagessen nach Hause ging. Ich muss etwa sechzehn gewesen sein, als mich auf dem Heimweg ein lebhaftes und intensives Gefühl der Wirklichkeit des Todes überkam. Wozu sollte ich mir eine Bibliothek aufbauen? Wozu sollte ich überhaupt etwas sammeln, wenn der Tod unausweichlich war? An diesem Gedanken war nichts Trauriges oder Tragisches, und ich hatte keine Angst. Es war kein Gefühl der Mutlosigkeit oder der Rebellion, sondern einfach der Unausweichlichkeit des Todes. Es ging vorüber und bewirkte keine dauerhafte Veränderung, aber es hinterließ wenigstens einen Eindruck, der zu lebhaft war, als dass er wieder verblassen würde. Ich war im selben Alter, in dem die Todeserfahrung Ramana überwältigte, der dann zum Maharshi werden sollte und sein Ego ein für alle Mal vernichtete, wobei er von da an unveränderlich im Selbst gegründet war (s. mein Buch Ramana Maharshi und der Weg der Selbsterkenntnis).
Es kommt sehr selten vor, dass der Weg auf solche Weise in einem einzigen Schritt vollendet werden kann. Nur in seltenen Fällen, wenn Hindernisse bereits in einem früheren Leben überwunden wurden, liegt die endgültige Verwirklichung in Reichweite. Öfter wird der Weg ein Leben lang verfolgt und selten vor dem Lebensende zum Abschluss gebracht. Doch es mag normal sein, dass die erste Intuition in diesem Alter erfolgt, wenn der Geist bereits voll aktiv ist und die weltliche Unwissenheit noch nicht wie eine dichte Wolke die Wirklichkeit verhüllt.
Religion war für mich bereits von großer Bedeutung. Zu dieser Zeit kam ich unter den Einfluss eines walisischen Geistlichen namens Morgan, ein spartanischer Mann, aber von mächtiger Statur, dominant und kampfeslustig, völlig hingebungsvoll und voller unruhiger Energie. Dass er ein Boxer und eine Autorität in Rugby war, beeindruckte mich nicht im Geringsten, dass er Scharfsinn besaß, umso mehr. Er erzeugte Widerstand, indem er Schönheit in seine Kirche und den Gottesdienst brachte. Es war typisch für ihn, dass er die Kirchenbänke hellgrün strich, anstatt in langweiligem Braun wie üblich. Er sagte, er wolle die Leute aufwecken, wenn sie in die Kirche kamen, und nicht schläfrig machen. Um uns Mut zu machen, führte er Straßenprozessionen und kleine Gebetstreffen ein, die Laien leiteten, und ich nahm an beidem teil. Ich las Gitanjali [eine Gedichtsammlung von Rabindranath Tagore] und die Fortsetzung, Tagores Prosagedichte, und war fasziniert von ihnen, da sie meinem mystischen Wissen, das ich bereits gefunden hatte, am nächsten kamen. (Doch wie weit weg davon war ich später, sie zu verstehen.) Es war eine Vorahnung der Dinge, die noch kommen sollten. Bei einem solchen Gebetstreffen, das ich leitete, las ich ein Gedicht von Tagore vor und erklärte, dass er zwar kein Christ gewesen sei, er aber denselben Glauben und dasselbe Verständnis gehabt habe. Die Anwesenden stimmten mir zu.
Den zweitstärksten Einfluss auf mich in jener Zeit hatte Herr Lance, mein Geschichtslehrer. Er war ein loyaler Anhänger von Christ Church [eines der bedeutendsten Colleges in Oxford] und wollte, dass auch ich es besuchte. Die Colleges in Oxford waren in drei Gruppen aufgeteilt, was mit den Stipendien zu tun hatte. In meinem Jahrgang war die Christ Church-Gruppe die letzte der dreien. Es wäre offensichtlich zu unbesonnen gewesen, darauf zu warten. Deshalb schlug er vor, ich solle ein Jahr früher ein Stipendium beantragen. Der Schulleiter war damit einverstanden, da er glaubte, diese Erfahrung würde mir nützen, nicht aber, dass ich eine Chance gehabt hätte, aufgenommen zu werden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es für einen Jungen von einem Gymnasium wie dem unseren nicht klug sei, Christ Church zuoberst auf seine Präferenzliste zu setzen. Er würde sowieso keine Chance haben, und das würden die Colleges, die er weiter unten angeführt hatte, weniger geneigt machen, ihn anzunehmen. Doch ich blieb beharrlich, oder vielmehr Herr Lance blieb beharrlich. Im Herbst 1921 ging ich ein Jahr früher als üblich als Student von Christ Church nach Oxford. Ich war soeben achtzehn geworden.
4. Die Abkehr von Oxford
Meine Tutoren ließen mich wissen, dass sie mich auf eine Mitgliedschaft für All Souls und eine Karriere als Professor in Oxford vorbereiteten. Zwei Jahre lang ging ich diesen Weg, und dann, im dritten Jahr, hörte ich fast zu studieren auf und trennte mich vom College, dem Universitätsleben und machte mich untragbar. Ich war so arrogant zu glauben, dass ich mir leicht als Schriftsteller meinen Unterhalt verdienen konnte, ob ich nun einen Beruf hatte oder nicht. Ich wurde Oxford bezüglich immer desillusionierter und passte immer weniger dazu. Ich hatte deshalb kein Ziel, auf das ich hinarbeiten konnte. Nach Oxford zu gehen, hatte ich erreicht. Die geplante akademische Karriere sagte mich nicht mehr zu. Und mein wahres Ziel im Leben war mir noch nicht offenbart worden.
Ich hatte mir mehr von Oxford erwartet, als es mir geben konnte: die Heimat einer Kultur, in der die Menschen an allem interessiert waren, was nicht für Geld gekauft werden konnte. Ich hatte mich mit Enthusiasmus in das neue Leben gestürzt. Ich besuchte eifrig die Vorlesungen, studierte in der Bibliothek und in meinem Zimmer und verfasste Essays für mein Tutorial, das alle zwei Wochen stattfand. Ich stürzte mich auch ins neue soziale Leben. Es verging kaum ein Tag, an dem ich nicht eingeladen wurde oder andere in mein Zimmer einlud. Doch noch bevor das erste Semester endete, hatte ich das frostige Gefühl der Ernüchterung. Wo ich auf Verständnis gehofft hatte, fand ich Belanglosigkeit. Allmählich zog ich mich zurück, und am Ende meines dritten Jahres gab es nicht mal mehr ein halbes Dutzend Leute an der Universität, die ich gut genug kannte, um ohne Einladung bei ihnen hereinzuschneien. Ich kehrte dem Leben in Oxford den Rücken. Ich sprach nie in der Versammlung, obwohl ich es liebte zu debattieren. Ich engagierte mich nicht im OUDS [Oxford University Dramatic Society], obwohl ich mich zur Bühne hingezogen fühlte. Ich schrieb nie für den Isis oder den Cherwell, die wöchentliche Universitätszeitschrift, obwohl ich mich für einen Schriftsteller hielt.
Die innere Abwehr bezog sich sowohl auf das Studieren als auch auf die Leute. Geschichte hatte in der Schule mein Interesse geweckt, teils wegen des Prunks großer Menschen und Ereignisse und teils wegen des Studiums langer Entwicklungen. Aber als es mir in Gestalt einer Forschungsarbeit dargeboten wurde, bei der man Monate lang die Urbarmachung eines Dorfes im 12. Jahrhundert entschlüsselte, um eine These über die wirtschaftliche Grundlage eines mittelalterlichen Landlehens zu schreiben, indem man alle Quellen zu einem viertklassigen Politiker der Tudors aufspürte, den ich nicht treffen wollte, würde er heute leben – und wenn dies mir als eine Lebensbeschäftigung vorgeschlagen wurde, ließ mich das zurückschrecken. Zweimal in späteren Jahren ist es geschehen, dass ich ein Wissensfeld von wesentlichem Wert vor mir sah und ich hungrig las und sorgfältig studierte, aber keine Recherche um ihrer selbst willen, nicht um Details zu irgendwelchen Fragen anzuhäufen, die ich für unwichtig hielt und die mich nicht interessierten.
Ich verstehe natürlich vollkommen, dass in Geschichte oder einem anderen Fach der modernen Wissenschaft – in Soziologie, Astronomie, Meeresbiologie, was immer es auch sein mag – ein Fortschritt erzielt wird durch endlose geduldige Recherchen oft unbekannter Wissenschaftler, die entweder in Gruppen oder einzeln zu strategischen Punkten forschen. Viel davon ist fruchtlos, manches aber bringt Ergebnisse hervor, die eine ganze Theorie verändern oder eine neue Hypothese hervorbringen können. Würde man die Bedeutung dieser Recherchen anzweifeln, würde man damit die Grundlage der modernen Zivilisation zurückweisen. Ich weise sie nicht zurück. Ich bin nicht dafür, handgewebte Kleidung zu tragen, bei Kerzenlicht zu arbeiten oder andere solche Kindereien. Solange man in der modernen Welt lebt, macht es keinen Sinn, sich nicht an ihre äußeren Bedingungen zu halten. Was aber zurückgewiesen werden muss, ist der Sinn der Werte, die Überzeugung ihrer eigenen Überlegenheit und ihres Glaubens an den spezifischen Wert der Wissenschaften, auf denen sie gründen, also diese ganze Weltanschauung. Wäre diese Zurückweisung ausreichend verbreitet, würde sie dazu führen, dass auch ihre äußeren Formen zurückgewiesen würden, aber das geschieht nicht so leicht und friedvoll.
In der sozialen Ordnung, die auf wirklichem Respekt für die menschliche Natur basiert (was auch die Anerkennung der spirituellen Potenziale des Menschen mit einschließt), beinhaltet die Arbeit eines Menschen für die Gemeinschaft auch seine innere Entwicklung. Wenn er ein Handwerker ist, der Möbel herstellt oder Häuser baut, ist seine Arbeit eine Kunst, und er ist stolz darauf, wenn sie beendet ist. Sie enthält symbolisch auch die Reflexion über seine eigene Entwicklung. Ist er ein Student, unterstützt sein Studium sein Verständnis und die Bildung seines Charakters, indem sie krumme oder verkümmerte Neigungen berichtigen. Aber die moderne mechanische Zivilisation gebraucht die Menschen als Instrumente, seien es Arbeiter oder Gelehrte. Wie ein Arbeiter sich um seine Maschinen kümmert, ohne auf seine eigene Entwicklung zu achten, so trägt der Gelehrte, dem Weisheit und Selbsterkenntnis völlig fremd sind, sein Forschungs-Fragment bei. Es stimmt nicht, dass die Gesellschaft größer als der einzelne Mensch ist, noch ist es nützlich, wenn ein Mensch zum Wohl der Leute stirbt. Ein Ameisenhaufen ist größer als eine einzelne Ameise, die ihn mit erstellt hat, aber der Mensch hat in seinem Wesen eine Göttlichkeit, die möglicherweise die ganze Welt enthält und überschreitet, und eine Gesellschaft, die das verleugnet, indem sie die Menschen als Instrumente behandelt, ohne Mittel für ihre spirituelle Entwicklung bereitzuhalten, saugt ihre eigene Lebenskraft aus und lässt nur eine leere Schale zurück. In der Tradition wurde immer daran festgehalten, dass die Suche nach der Wahrheit oder Erkenntnis heilig ist und weder ein Motiv noch eine Rechtfertigung braucht, d.h. sie ist ein geeignetes Ziel, um ihm sein Leben zu widmen. Das stimmt, bezieht sich aber auf Erkenntnis von direkter oder indirekter spiritueller Bedeutung, Erkenntnis, die allmählich den Sucher erleuchtet oder transformiert. Wenn man auf dieselbe Weise von der reinen Anhäufung faktischen Wissens spricht, ist das eine Parodie. Und genau das geschieht.