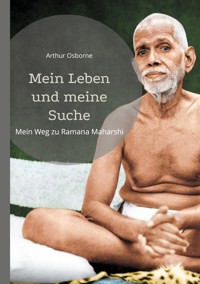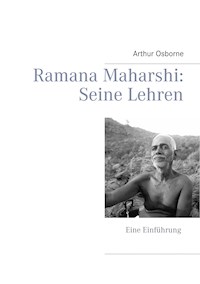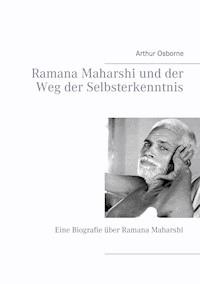
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ramana Maharshi wurde 1879 in einem kleinen Dorf in Südindien geboren. Mit siebzehn Jahren verwirklichte er das Selbst, ausgelöst von einer ungewöhnlichen Todeserfahrung. Daraufhin ging er von Zuhause fort und ließ sich auf bzw. am Berg Arunachala in Tiruvannamalai nieder, zu dem er sich unwiderstehlich hingezogen fühlte und wo er bis zu seinem Tod 1950 blieb. Er lehrte die reinste Form von Advaita (Nicht-Zweiheit) durch die einfache Methode der Selbstergründung. Er führte seine Schüler sehr persönlich, obwohl er sich selbst nie einem Guru nannte und von ihnen nie als seinen Schülern sprach. Der Engländer Arthur Osborne kam 1945 nach Tiruvannamalai und lebte bis Ende 1948 mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe von Ramana Maharshi. Als er anschließend in Madras eine Anstellung erhielt, besuchte er seinen Meister so oft er es ermöglichen konnte. Ramana Maharshi starb 1950 an einem Krebsgeschwür. Vier Jahre später veröffentlichte Arthur Osborne die erste vollständige Biografie ›Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge‹, in der er nicht nur das biografische Material, das er vorfand, verarbeitete, sondern auch seine eigene Erfahrung mit seinem Meister schilderte. Das Buch wurde 1959 unter dem Titel ›Ramana Maharshi und der Weg der Selbsterkenntnis‹ ins Deutsche übersetzt. Es gehört zu den unsterblichen Klassikern der Literatur über Ramana Maharshi. Da es längst vergriffen ist, wurde es hiermit mit Genehmigung des Ramanashram neu übersetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Übersetzerin
Vorwort von Dr. S. Radhakrishnan
Die frühen Jahre
Das Erwachen
Die Reise
Entsagung
Die Frage nach der Rückkehr
Arunachala
Widerstandslosigkeit
Die Mutter
Advaita
Die ersten Schüler
Die Tiere
Sri Ramanashram
Das Leben mit Sri Bhagavan
Spirituelle Unterweisung (Upadesa)
Die Schüler
Die Schriften Sri Bhagavans
Mahasamadhi
Beständige Gegenwart
Glossar
Literaturverzeichnis
Vorwort der Übersetzerin
Ramana Maharshi wurde 1879 in einem kleinen Dorf in Südindien geboren. Mit siebzehn Jahren verwirklichte er das Selbst, ausgelöst von einer ungewöhnlichen Todeserfahrung. Daraufhin ging er von Zuhause fort und ließ sich auf bzw. am Berg Arunachala in Tiruvannamalai nieder, zu dem er sich unwiderstehlich hingezogen fühlte und wo er bis zu seinem Tod 1950 blieb. Er lehrte die reinste Form von Advaita (Nicht-Zweiheit) durch die einfache Methode der Selbstergründung. Er führte seine Schüler sehr persönlich, obwohl er sich selbst nie ein Guru nannte und von ihnen nie als seinen Schülern sprach.
Der Engländer Arthur Osborne1 kam 1945 nach Tiruvannamalai und lebte bis Ende 1948 mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe von Ramana Maharshi. Als er anschließend in Madras eine Anstellung erhielt, besuchte er seinen Meister so oft er es ermöglichen konnte. Ramana Maharshi starb 1950 an einem Krebsgeschwür. Vier Jahre später veröffentlichte Arthur Osborne die erste vollständige Ramana-Biografie ›Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge‹, in der er nicht nur das biografische Material, das er vorfand, verarbeitete (u.a. die erste, aber unvollständige Ramana-Biografie von Narasimha Swami ›Self Realization‹, die bereits 1931 in 1. Auflage erschienen ist), sondern auch seine eigenen Erfahrungen mit seinem Meister schilderte. Das Buch wurde 1959 etwas gekürzt unter dem Titel ›Ramana Maharshi und der Weg der Selbsterkenntnis‹ ins Deutsche übersetzt. Es gehört zu den unsterblichen Klassikern der Literatur über Ramana Maharshi. Da es längst vergriffen ist, fand ich es an der Zeit, es neu und ohne Auslassungen zu übersetzen.
Das Wort ›Devotee‹ habe ich durchgängig mit Schüler übersetzt, obwohl es auch mit Verehrer oder Anhänger übersetzt werden könnte. Bei den Schülern Ramanas vermisch(t)en sich in der Regel beide Aspekte. Das englische ›mind‹ (Gedanken und Gefühle) wurde, wie auch das Wort ›Spirit‹ (der höhere Geist, die Seele, Atman), mit Geist übersetzt. Der Unterschied wird im jeweiligen Zusammenhang klar.
Mein besonderer Dank geht an den Ramanashram für die Erlaubnis zur Neuübersetzung und für den Gebrauch des Bildmaterials. Die Quellen anderweitigen Bildmaterials sind angegeben. Alle Texte in eckigen Klammern sind eigene Einfügungen.
Gabriele Ebert
1 s.a. Arthur Osborne in: Ebert: Ramana Maharshi und seine Schüler, Bd. 1, S. 141-152
Vorwort von Dr. S. Radhakrishnan
(Vizepräsident Indiens von 1952-1962)
Gerne bin ich bereit, ein kurzes Vorwort zu Herrn Osbornes Buch über das Leben und die Lehre Sri Ramana Maharshis zu schreiben. In unserer Zeit des Skeptizismus kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Hier wird uns eine Religion des Geistes vorgestellt, die uns befähigt, uns von Dogmen und Aberglaube, Ritualen und Zeremonien zu befreien und als freie Menschen zu leben. Die Essenz aller Religionen ist eine innere, persönliche Erfahrung, eine persönliche Beziehung zum Göttlichen. Sie besteht weniger in der Verehrung, als in der Suche. Es ist ein Weg des Werdens, der Befreiung.
Der bekannte griechische Lehrspruch: »Erkenne dich selbst« bedeutet dasselbe wie der Grundsatz der Upanishaden: »Kenne das Selbst« (Atmanam Viddhi). Durch einen Prozess der Abstraktion gelangen wir hinter die Schichten des Körpers, Geistes und Intellekts und erreichen das universale Selbst. »Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.« Plotin schreibt in seinen Enneaden (I, VI,7): »Um das Gute zu erlangen, müssen wir zur höchsten Stufe aufsteigen und unseren Blick darauf richten. Wir müssen die irdischen Gewänder ablegen, die wir angelegt haben, als wir in diese Welt hinabgestiegen sind, wie die in die Mysterien Eingeweihten, die in den inneren Bereich des Heiligtums zugelassen sind, sich reinigen, alle Gewänder ablegen und in völliger Nacktheit weiterschreiten.« Wir sinken in das unermessliche Sein, das ohne Grenzen und ohne Bestimmung ist. Es ist reines Sein ohne jeden Gegensatz. Es gibt kein Sein, dem der Mensch gegenübersteht. Er identifiziert sich mit allem, was es gibt und was geschieht. Die Wirklichkeit erfüllt ihn, da sie nicht länger von Vorlieben und Abneigungen abgehalten wird. So können sie nicht mehr verzerrend wirken.
Das Kind ist der Schau des Selbst viel näher. Wir müssen wieder wie die Kinder werden, bevor wir das Reich der Wahrheit betreten können. Deshalb müssen wir alle Raffinesse der Gelehrten aufgeben und wiedergeboren werden. Es heißt, dass die Weisheit des Kindes größer ist als die des Schülers.
Sri Ramana Maharshi zeigt uns in Umrissen eine rein geistige Religion, die auf den indischen Schriften gründet, ohne das Vernünftige und Ethische außer Acht zu lassen.
Die frühen Jahre
Sundarams Haus in Tiruchuli (Foto: Richard Clarke)
Arudra Darshan, der Tag des Erscheinens von Shiva, wird von den Shiva-Anhängern voller Hingabe gefeiert, denn er erinnert an das Ereignis der Offenbarung Shivas als Nataraja, der den kosmischen Tanz der Schöpfung und Zerstörung des Universums tanzt. In der Morgendämmerung an diesem Tag des Jahres 1879 gingen die Anhänger Shivas in Tiruchuli, einer Kleinstadt in Tamil Nadu, barfuß auf den dunklen Straßen zum Wasserspeicher des Tempels, um bei Tagesanbruch darin zu baden, wie es die Tradition vorschreibt. Die roten Strahlen der aufgehenden Sonne fielen auf die braunen Gestalten, die nur mit einem Dhoti, einem weißen Baumwolltuch, das sie um die Hüften geschlungen trugen, bekleidet waren und auf die goldroten Saris der Frauen, als sie die Steinstufen zu dem großen, viereckigen Wassertank hinabstiegen und ins Wasser untertauchten. Die Luft war beißend kalt, denn das Fest fiel auf den Dezember. Aber sie waren abgehärtet. Einige zogen sich unter den Bäumen oder in den Häusern in der Nähe um, aber die meisten warteten, bis die Sonne sie trocknete, und gingen, triefend nass wie sie waren, in den alten Tempel der kleinen Stadt, den schon Sundaramurti, einer der 63 Shiva-Heiligen und Dichter in Tamil Nadu in seinen Lobgesängen gepriesen hat.
Shiva Natarajan (Foto: Wikimedia Commons, Thomas Ruedas)
Das Bildnis Shivas im Tempel war mit Blumen geschmückt und wurde in feierlicher Prozession während des ganzen Tages und der kommenden Nacht unter den Klängen der Trommeln und Muschelhörner und heiligen Gesängen umhergetragen. Um ein Uhr nachts endete die Prozession, aber es war immer noch Arudra Darshan, denn für die Hindus dauert ein Tag von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang und nicht von Mitternacht zu Mitternacht. Genau zu dem Zeitpunkt, als das Götterbild Shivas wieder in den Tempel zurückgebracht wurde, wurde Venkataraman, in dem sich Shiva als Sri Ramana offenbaren sollte, im Haus des Sundaram Iyer und seiner Frau Alagammal geboren. Da Hindu-Feste nach den Mondphasen berechnet werden wie Ostern im Westen, fiel Arudra Darshan in diesem Jahr auf den 29. Dezember. So wurde Venkataraman wenig später geboren als das göttliche Kind in Bethlehem 2000 Jahre zuvor. Auch der irdische Tod der beiden traf zusammen, denn Sri Ramana starb am Abend des 14. April, einige Tage und Stunden später als Jesus am Karfreitagnachmittag. Beide Daten sind symbolisch, denn um Mitternacht und zur Wintersonnenwende ist die Zeit, in der sich das Licht von neuem der Welt schenkt, und nach der Tagundnachtgleiche im Frühjahr beginnt der Tag die Nacht zu überholen.
Sundaram Iyer
Sundaram Iyer war zunächst Schreiber bei einem lächerlich kleinen Monatsgehalt von zwei Rupien. Später wurde er Schreiber von Bittschriften und erhielt schließlich die Erlaubnis, als ungeprüfter ländlicher Anwalt zu praktizieren. Er war erfolgreich und baute sich ein Haus, in dem Venkataramam geboren wurde.2 Es war so geräumig, dass er einen Teil davon Gästen zur Verfügung stellen konnte. Sundaram war gesellig und gastfreundlich und machte es sich zur Aufgabe, Beamte und Neuankömmlinge in der Stadt zu beherbergen. Auf diese Weise wurde er zu einer bedeutenden Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, was sich zweifellos günstig auf seinen Beruf auswirkte.
Obwohl Sundaram erfolgreich war, hing doch ein seltsames Schicksal über seiner Familie. Man erzählte, dass ein wandernder Asket einmal an der Haustür seiner Vorfahren um Nahrung bat. Als er abgewiesen wurde, drohte er, dass von nun an einer der Nachkommen in jeder Generation sich auf Wanderschaft begeben und um seine Nahrung betteln würde. Segen oder Fluch, die Prophezeiung erfüllte sich. Ein Onkel Sundarams väterlicherseits nahm das ockerfarbene Gewand eines Wandermönchs und ging mit Wanderstab und Wasserkrug fort. Auch sein älterer Bruder hatte sich angeblich auf den Weg zu einem Nachbarort gemacht und war daraufhin verschwunden. Er hatte als Sannyasin der Welt entsagt. In Sundaram Iyers eigener Familie wurde nichts Auffälliges bemerkt. Venkataramam wuchs als gesundes, normales Kind heran. Für eine Weile besuchte er die Schule am Ort und mit elf Jahren die Schule in Dindigul. Sein Bruder Nagaswami war zwei Jahre älter als er, sein Bruder Nagasundaram sechs Jahre jünger. Dann folgte noch seine Schwester Alamelu, die zwei Jahre nach Nagasundaram geboren wurde. Es war eine glückliche, wohlhabende, bürgerliche Familie der Mittelschicht.
Als Venkataraman zwölf war, starb Sundaram Iyer, und die Familie löste sich auf. Die Kinder kamen zu Subba Iyier, ihrem Onkel väterlicherseits, der ein Haus in der nahen Stadt Madurai besaß.3 Venkataraman besuchte die Scott's Mittelschule und anschließend die höhere amerikanische Missionsschule. Es sah nicht danach aus, dass er jemals ein Gelehrter werden würde. Er war sportlich, trieb sich gern im Freien herum und interessierte sich für Fußball, Ringen und Schwimmen. Allerdings besaß er ein überaus gutes Gedächtnis, das seine Faulheit verdeckte, denn eine Lektion, die er einmal gehört hatte, konnte er auswendig hersagen. Das einzig Ungewöhnliche an ihm war, dass er außergewöhnlich tief schlief. Devaraja Mudaliar, einer seiner Schüler, berichtet in seinem Tagebuch, wie Sri Ramana viele Jahre später beim Besuch eines Verwandten in seinem Ashram auf diesen ungewöhnlich tiefen Schlaf zu sprechen kam:
»Du erinnerst mich daran, was in Dindigul geschah, als ich ein Junge war. Dein Onkel Periappa Seshaiyar lebte damals auch dort. In seinem Haus fand eine Feier statt. Alle gingen hin und besuchten anschließend abends noch den Tempel. Ich blieb alleine zurück. Ich saß lesend im vorderen Zimmer, aber nach einer Weile schloss ich Tür und Fenster und legte mich schlafen. Als sie vom Tempel zurückkamen, konnten mich weder Rufe noch das Hämmern an der Tür und am Fenster wecken. Schließlich gelang es ihnen, die Tür mit einem Schlüssel vom Nachbarhaus zu öffnen. Dann versuchten sie, mich durch Schläge aufzuwecken. Alle Jungen schlugen mich nach Herzenslust, und dein Onkel beteiligte sich auch, aber ohne Erfolg. Ich wusste nichts davon, bis man es mir am nächsten Morgen erzählte. … Dasselbe geschah auch in Madurai. Die Jungen wagten nicht mich anzurühren, wenn ich wach war. Aber wenn sie etwas gegen mich hatten, kamen sie, wenn ich schlief, schleppten mich wohin sie wollten, schlugen mich nach Herzenslust und brachten mich dann ins Bett zurück. Ich wusste nichts davon, bis sie es mir am Morgen erzählten.«4
Sri Bhagavan gab seinem ungewöhnlich tiefen Schlaf keine besondere Bedeutung, außer einer guten Gesundheit. Manchmal lag er nachts auch in einer Art Halbschlaf. Es mag sein, dass beide Zustände Vorzeichen seiner geistigen Erweckung waren: der tiefe Schlaf als die dunkle und negative Fähigkeit, den Geist fallen zu lassen und in tiefere Schichten einzutauchen, und der Halbschlaf als die Fähigkeit, sich selbst objektiv wie ein Zeuge zu beobachten.
Wir besitzen kein Foto, das Sri Bhagavan als Junge zeigt. Er erzählte uns auf seine anschauliche Art und herzhaft lachend, wie einmal ein Gruppenfoto gemacht wurde, wobei er einen dicken Schmöker halten musste, um lernbegierig auszusehen. Aber eine Fliege hatte sich auf ihn gesetzt, und in dem Moment, als das Foto gemacht wurde, hob er den Arm, um sie zu verjagen. Es war nicht möglich, einen Abzug von diesem Foto aufzutreiben. Vermutlich gibt es keinen mehr.
Das erste Anzeichen seiner Erweckung kam von Arunachala. Der Schuljunge Venkataraman hatte von der religiösen Bedeutung des Arunachala keine Ahnung. Er wusste nur, dass der Berg ein überaus heiliger Ort war. Plötzlich hatte er ein Vorgefühl seiner Bestimmung. Eines Tages traf er einen älteren Verwandten, den er von Tiruchuli her kannte, und fragte ihn, woher er käme. Der alte Mann antwortete: »Vom Arunachala.« Da wurde Venkataraman plötzlich klar, dass der heilige Berg wirklich existierte, dass es ein Ort war, wohin man gehen konnte. Er war davon so überwältigt, dass er nur stammeln konnte: »Was? Vom Arunachala? Wo ist der Berg zu finden?« Der Verwandte, der sich über die Unwissenheit des Jungen wunderte, erklärte ihm, dass der Arunachala in Tiruvannamalai sei. Sri Bhagavan erwähnte diese Geschichte später im ersten der ›Acht Verse an Arunachala‹:
»Höre! Als empfindungsloser Berg steht er da! Sein Handeln ist geheimnisvoll und übersteigt das menschliche Begreifen. Von Kindheit an bedeutete der Arunachala für mich etwas unvorstellbar Großes. Aber selbst als ich von jemandem erfuhr, dass er dasselbe wie Tiruvannamalai ist, verstand ich seine Bedeutung nicht. Als er mich an sich zog, meinen Geist beruhigte und ich ihm nahe kam, sah ich, dass er reglos dasteht.«
Das geschah im November 1895, kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag nach europäischer, dem siebzehnten nach indischer Berechnung. Bald darauf ereignete sich die zweite Vorahnung. Diesmal war ein Buch der Auslöser. Wiederum überkam ihn eine überwältigende Freude, als ihm klar wurde, dass das Göttliche auf Erden offenbar werden kann. Sein Onkel hatte sich das Periyapuranam, die Lebensgeschichte der 63 Tamil-Heiligen, ausgeliehen. Venkataraman las es und wurde dabei von einer ekstatischen Freude darüber ergriffen, dass solcher Glaube, solche Liebe, solch göttlicher Eifer möglich waren, dass es so etwas Großartiges im menschlichen Dasein gegeben hatte. Die Erzählungen der Entsagung, die zur Vereinigung mit dem Göttlichen führte, inspirierten ihn zu Ehrfurcht und Nachahmung. Das Buch sprach von etwas, das größer war als alle Träume, alles Streben, von etwas, das wirklich und möglich war. Und diese Offenbarung ließ ihn dankbar erschauern.
In jener Zeit erwachte in ihm dieser Bewusstseinsstrom, den er und seine Schüler später als ›Meditation‹ bezeichneten. Es war kein Gewahrsein eines Objekts durch ein Subjekt, da es jenseits der Dualität von Subjekt und Objekt lag, vielmehr war es der Zustand einer seligen Bewusstheit, die sowohl die körperliche als auch die geistige Ebene überschritt und doch mit dem vollen Gebrauch der physischen und geistigen Fähigkeiten vereinbar war.
Sri Bhagavan hat in seiner charakteristischen Einfachheit erzählt, wie dieses Bewusstsein bei seinen Besuchen im Meenakshi-Tempel in Madurai in ihm erwachte. »Zuerst glaubte ich, es sei eine Art fiebriger Erregung. Aber immerhin war es ein angenehmer fiebriger Zustand, und deshalb akzeptierte ich ihn.«
2 Dieses Haus wurde inzwischen vom Ashram erworben. Dort wird täglich die Puja gefeiert, und es steht den Verehrern als Pilgerort offen.
3 Dort erlangte Sri Bhagavan Selbstverwirklichung. Der Ashram hat dieses Haus ebenfalls erworben. Auch es dient als Pilgerort.
4 Mudaliar: Tagebuch, Eintrag vom 31.05.1946
Das Erwachen
Meenakshi-Tempel in Madurai (Foto: Wikimedia Commons, fraboof)
Dieser Bewusstseinsstrom wurde durch sein beständiges Bemühen stärker und beständiger und führte schließlich zur Selbstverwirklichung, zu Sahaja Samadhi, zu einem Zustand reinen und seligen Bewusstseins, das beständig und ohne Unterbrechung vorherrscht, wobei es die normalen Wahrnehmungen und Tätigkeiten des Lebens nicht behindert. Es ist selten, dass jemand diese Vollendung im irdischen Leben erreicht. Sri Bhagavan erlangte sie wenige Monate später, ohne dass er sie erstrebt, sich darum bemüht oder sich bewusst darauf vorbereitet hatte. Er beschreibt sein Erlebnis wie folgt:
»Es war etwa sechs Wochen bevor ich Madurai für immer verließ, als sich die große Wandlung in meinem Leben ereignete. Das geschah ganz plötzlich. Ich saß allein im ersten Stock des Hauses meines Onkels. Ich war selten krank. Auch an diesem Tag fühlte ich mich ganz gesund. Dennoch überkam mich eine plötzliche und unmissverständliche Todesangst. Kein körperliches Empfinden war dafür die Ursache, und ich versuchte nicht, es mir zu erklären oder herauszufinden, ob die Angst überhaupt begründet war. Ich spürte einfach: ›Ich sterbe jetzt‹. Sofort fing ich an, darüber nachzudenken, was ich nun tun sollte. Es kam mir nicht in den Sinn, Ärzte, Erwachsene oder Freunde um Rat zu fragen. Ich spürte, dass ich das Problem selber lösen musste, hier und jetzt.
Der Schock der Todesangst lenkte meine Aufmerksamkeit sofort nach innen. Ich sagte zu mir im Geist, ohne die Worte wirklich zu formulieren: ›Jetzt ist der Tod gekommen. Was bedeutet das? Was ist es, das stirbt? Dieser Körper stirbt.‹ Sofort spielte ich die Todesszene. Ich streckte meine Glieder aus und hielt sie steif, als hätte die Totenstarre eingesetzt. Um meine weitere Untersuchung möglichst realistisch zu machen, spielte ich eine Leiche. Ich hielt den Atem an und presste die Lippen fest zusammen, sodass ihnen kein Laut, weder das Wort ›ich‹, noch irgendein anderes Wort entweichen konnte. ›Nun gut‹, sagte ich zu mir, ›dieser Körper ist tot. Er wird in diesem starren Zustand zum Verbrennungsplatz getragen und dort zu Asche verbrannt. Aber bin auch »ich« mit dem Tod des Körpers gestorben? Ist dieser Körper »ich«? Dieser Körper ist still und unbeweglich, aber unabhängig von ihm spüre ich die ganze Kraft meiner Person und sogar die Stimme des »Ich« in mir. Also bin »ich« der Geist, der den Körper transzendiert. Der Körper stirbt, aber der ihn transzendierende Geist kann vom Tod nicht berührt werden. Deshalb bin ich unsterblicher Geist.‹
All das waren keine müßigen Gedanken, sondern traf mich wie ein Blitz als lebendige Wahrheit und war etwas, das ich sofort und fast ohne Denkvorgang erkannte. ›Ich‹ war etwas überaus Wirkliches, im gegenwärtigen Zustand das einzig Wirkliche überhaupt, und die gesamte bewusste Aktivität, die mit meinem Körper verbunden war, war auf dieses ›Ich‹ hin zentriert. Von diesem Zeitpunkt an hielt das ›Ich‹ oder Selbst durch eine machtvolle Faszination seine Aufmerksamkeit auf sich selbst gerichtet. Die Todesangst war ein für alle Mal verschwunden. Das Versunkensein im Selbst hat von diesem Moment an bis heute fortbestanden. Andere Gedanken mögen kommen und gehen wie die Noten in einem Musikstück, aber das ›Ich‹ ist beständig wie die Grundnote (Sruti-Note)5, die alle anderen Noten begleitet und sich mit ihnen vermischt. Mochte der Körper mit Sprechen, Lesen oder etwas anderem beschäftigt sein, ich war immer auf das ›Ich‹ konzentriert. Vor dieser Krise hatte ich keine klare Wahrnehmung meines Selbst und wurde nicht bewusst zu ihm hingezogen. Ich hatte auch kein spürbares Interesse daran, noch weniger irgendeine Neigung, beständig in ihm zu verweilen.«6
Diese einfache Beschreibung mag nach einer Ich-Bezogenheit klingen. Doch das liegt an der zweifachen Bedeutung der Wörter ›ich‹ und ›selbst‹. Der Unterschied zeigt sich in der Haltung zum Tod. Denn bei demjenigen, der nur am Ego interessiert ist, hat das ›Ich‹ als ein getrenntes Individuum Angst vor dem Tod, der es vernichtet. Dagegen ist die Todesangst für immer überwunden, wenn man versteht, dass das ›Ich‹ mit dem universalen, unsterblichen Selbst eins ist. Es ist der Geist und das Selbst eines jeden Menschen. Doch selbst wenn man sagt: er wusste, dass er mit dem Geist eins war, ist das eine ungenügende Beschreibung, da dabei von einem separaten ›Ich‹ ausgegangen wird, das sich dessen bewusst ist, während dieses ›Ich‹ in ihm in Wirklichkeit bewusster Geist war.
Viele Jahre später erläuterte Sri Bhagavan Paul Brunton, einem Sucher aus dem Westen, diesen Unterschied.
Brunton: »Was genau ist dieses Selbst, von dem du sprichst? Wenn es wahr ist, was du sagst, muss es im Menschen noch ein weiteres Selbst geben.«
Sri Ramana: »Kann denn der Mensch zwei Identitäten, zwei Selbste besitzen? Um dies zu verstehen, muss der Mensch sich zunächst selbst analysieren. Da er schon lange gewöhnt ist zu denken wie die anderen, ist er seinem ›Ich‹ nie auf die richtige Weise begegnet. Er hat von sich selbst kein richtiges Bild. Er hat sich zu lange mit dem Körper und dem Verstand identifiziert. Deshalb rate ich dir, der Frage ›Wer bin ich?‹ nachzugehen.
Du hast mich gebeten, dieses wahre Selbst zu beschreiben. Was kann ich darüber sagen? Es ist Das, aus dem sich das persönliche ›Ich‹-Empfinden erheben und in das es wieder verschwinden muss.«
Brunton: »Verschwinden? Wie kann man das Gefühl seiner Persönlichkeit verlieren?«
Sri Ramana: »Der erste und führende Gedanke beim Menschen, der Ur-Gedanke, ist der ›Ich‹-Gedanke. Erst wenn dieser Gedanke entstanden ist, können auch alle anderen Gedanken entstehen. Erst wenn das erste Personalpronomen ›ich‹ im Geist entstanden ist, kann das zweite Personalpronomen ›du‹ auftauchen. Wenn du geistig dem ›Ich‹-Strang bis zu seiner Quelle folgen kannst, wirst du entdecken, dass dieser Ich-Gedanke sowohl der erste Gedanke ist, der auftaucht, als auch der letzte, der verschwindet. Das kann man erfahren.«
Brunton: »Du meinst also, dass es möglich ist, solch eine geistige Erforschung seiner selbst auszuführen?«
Sri Ramana: »Gewiss! Es ist möglich, nach innen zu gehen, bis der letzte Gedanke ›ich‹ allmählich verschwindet.«
Brunton: »Was bleibt dann übrig? Verliert der Mensch dann das Bewusstsein oder wird er ein Idiot?«
Sri Ramana: »Nein, im Gegenteil. Er erlangt das unsterbliche Bewusstsein und wird wirklich weise, wenn er zu seinem wahren Selbst erwacht, das die wirkliche Natur des Menschen ist.«
Brunton: »Aber das ›Ich‹-Empfinden muss doch auch zum Selbst gehören.«
Sri Ramana: »Das ›Ich‹-Empfinden gehört zur Person, zum Körper und Verstand. Wenn ein Mensch zum ersten Mal sein wahres Ich erkennt, erhebt sich etwas anderes aus der Tiefe seines Seins und nimmt von ihm Besitz. Dieses Etwas ist hinter dem Geist. Es ist unendlich, göttlich und ewig. Manche Menschen nennen es das Reich Gottes, andere nennen es die Seele und wieder andere Nirvana. Die Hindus nennen es Befreiung. Du kannst es nennen wie du willst. Wenn sich das ereignet, hat der Mensch sich nicht wirklich verloren. Er hat sich vielmehr gefunden.
Solange ein Mensch sich nicht auf diese Frage nach dem wahren Selbst einlässt, werden ihn Zweifel und Ungewissheit ein Leben lang begleiten. Die größten Könige und Staatsmänner versuchen, andere zu regieren, obwohl sie im Grund ihres Herzens wissen, dass sie sich selbst nicht regieren können. Doch am machtvollsten ist der Befehl eines Menschen, der in seine innerste Tiefe vorgedrungen ist. … Was nützt es, über alles Bescheid zu wissen, wenn du nicht weißt, wer du selbst bist? Die Menschen vermeiden diese Erforschung ihres wahren Selbst, aber was ist derart wert, getan zu werden?«7
Diese geistige Erforschung Sri Bhagavans, sein Sadhana, dauerte kaum eine halbe Stunde. Und doch ist es äußerst bedeutungsvoll, dass es ein Sadhana (eine geistige Übung) war, ein Streben nach Licht und kein müheloses Erwachen. Denn ein Meister führt seine Schüler normalerweise denselben Weg, den er gegangen ist. Dass Sri Bhagavan innerhalb einer halben Stunde nicht nur das Sadhana eines ganzen Lebens, sondern mehrerer Leben – wie es für die meisten Sadhakas der Fall ist – vollendet hat, ändert nichts an der Tatsache, dass es ein Streben durch Selbstergründung war, wie er sie später auch von seinen Schülern verlangte. Er warnte sie, dass die Vollendung, zu der dieser Weg führt, normalerweise nicht schnell erlangt werden kann, sondern erst nach langen Kämpfen. Aber er sagte auch, es sei der einzig unfehlbare und direkte Weg, das bedingungslose, absolute Sein, das der Mensch in Wirklichkeit ist, zu erkennen. Die Selbstergründung leitet unmittelbar den Umwandlungsprozess ein, auch wenn es noch lange dauern mag, bis dieser vollendet ist. »In dem Augenblick, in dem das Ego-Ich versucht, sich selbst zu erkennen, beginnt es, immer weniger am Körper teilzuhaben, an den es gebunden ist, und immer mehr am Bewusstsein des Selbst.«
Es ist auch bedeutsam, dass Sri Bhagavan Atemkontrolle (Pranayama) als Konzentrationshilfe übte, obwohl er nichts von der Theorie und Praxis dieses Sadhanas wusste. Er betrachtete sie als ein geeignetes Hilfsmittel zur Gedankenkontrolle, aber nur dazu, und hat sie nie ausdrücklich gelehrt.
»Atemkontrolle ist eine der Methoden, die uns helfen, den Geist auf Eines zu richten. Sie kann helfen, den wandernden Geist zu kontrollieren und dieses Auf-Eins-Gerichtet-Sein zu erreichen. Dazu kann man sie verwenden. Aber man sollte nicht dabei stehen bleiben. Wenn man den Geist mithilfe von Atemübungen unter Kontrolle gebracht hat, sollte man sich nicht mit irgendeiner Erfahrung, die daraus entsteht, zufrieden geben, sondern sich den kontrollierten Geist für die Frage ›Wer bin ich?‹ zunutze machen, bis er im Selbst versinkt.«
Venkataramans neuer Geisteszustand veränderte natürlich auch seine Einstellung zu den Werten und Gewohnheiten des Lebens. Dinge, die ihm vorher wichtig waren, verloren ihre Anziehungskraft, konventionelle Lebensziele wurden unwirklich, und das Vernachlässigte erhielt eine große Bedeutung. Es konnte nicht leicht gewesen sein, sein Leben an diesen neuen Bewusstseinszustand anzupassen, denn er war ja noch ein Schuljunge, und ihm fehlte jede theoretische Schulung im spirituellen Leben. Er sprach mit niemandem darüber. Vorläufig blieb er im Kreise seiner Familie, ging weiterhin zur Schule und behielt sein äußeres Leben so gut wie möglich bei. Trotzdem war es unvermeidlich, dass seine Familie sein verändertes Verhalten bemerkte und einiges daran kritisierte. Auch das hat er beschrieben.
»Die Folgen meines neuen Bewusstseins wurden bald bemerkt. Ich verlor das Interesse an Freunden und Verwandten und lernte nur noch mechanisch. Ich hielt ein offenes Buch vor mich hin, damit meine Verwandten glaubten, ich würde lesen, während meine Aufmerksamkeit weit weg von diesem oberflächlichen Lesestoff war. Im Umgang mit Menschen wurde ich bescheiden und fügsam. Wenn mir früher mehr Arbeit zugeteilt wurde als den anderen Jungen, beschwerte ich mich. Wenn ein Junge mich ärgerte, übte ich Vergeltung. Keiner von ihnen wagte, sich über mich lustig zu machen oder sich Freiheiten herauszunehmen. Jetzt war das alles anders. Wie viel Arbeit man mir auch auftrug, wie sehr ich auch geneckt oder geärgert wurde, ich ließ es still über mich ergehen. Das frühere Ego, das etwas übelnahm und zurückschlug, war verschwunden. Ich spielte nicht mehr mit meinen Freunden, sondern suchte die Stille. Oft saß ich allein, nahm eine geeignete Meditationshaltung ein und war ins Selbst, den Geist, die Kraft, den Strom vertieft, der mich ausmachte. Ich machte damit weiter, obwohl mich mein älterer Bruder verspottete und mich sarkastisch einen Weisen oder Yogi nannte und meinte, ich möge mich doch wie die alten Rishis in einen Dschungel zurückziehen. Auch hatte ich beim Essen keine Vorlieben und Abneigungen mehr. Was immer man mir vorsetzte, schmackhaft oder fad, gut oder schlecht, ich schluckte alles gleichmütig hinunter.
Ein weiteres Merkmal meiner neuen Verfassung war meine veränderte Beziehung zum Meenakshi-Tempel.8 Früher besuchte ich ihn nur gelegentlich mit Freunden, um mir die Götterstatuen anzusehen, zeichnete meine Stirn mit heiliger Asche und Zinnober und kehrte ohne große Rührung nach Hause zurück. Aber nach meiner Erweckung besuchte ich ihn fast jeden Abend. Ich ging alleine hin und stand lange bewegungslos und von Gefühlen überwältigt vor den Bildern Shivas, Meenakshis, Natarajas und den 63 Heiligen. Meine Seele hatte ihren Halt am Körper verloren, als sie das Empfinden, der Körper zu sein, aufgegeben hatte, und suchte nun einen neuen Halt, daher die häufigen Tempelbesuche und die Tränenausbrüche. Dies war Gottes Spiel mit der Seele. Ich stand vor Ishwara, dem Herrn des Weltalls und der Geschicke aller Lebewesen, dem Allmächtigen und Allgegenwärtigen, und betete manchmal, seine Gnade möge auf mich herabkommen, damit meine Hingabe wachsen und beständig werden möge wie die der 63 Heiligen. Aber meist betete ich überhaupt nicht, sondern ließ schweigend mein Innerstes überfließen und verströmen. Die Tränen, die dieses Überfließen der Seele anzeigten, bedeuteten weder Freude noch Schmerz. Ich war kein Pessimist. Ich wusste noch nichts vom Leben und dass es voller Sorgen war. Ich hatte weder den Wunsch, eine Wiedergeburt zu vermeiden und Befreiung zu suchen noch Leidenschaftslosigkeit und Erlösung zu erlangen. Außer dem Periyapuranam, der Bibel und Teilen aus dem Tayumanavar und Tevaram hatte ich keine heiligen Schriften gelesen. Ich stellte mir Ishwara so vor, wie die Puranas ihn beschreiben. Ich hatte nichts von Brahman, Samsara und ähnlichem gehört. Ich wusste noch nicht, dass allem eine Essenz oder unpersönliche Wirklichkeit zugrunde liegt und dass sowohl Ishwara als auch ich mit ihr identisch sind. Als ich später in Tiruvannamalai der Lesung der Ribhu-Gita und anderer heiliger Schriften zuhörte, erfuhr ich das alles und erkannte, dass die Schriften das untersuchten und beschrieben, was ich intuitiv ohne Untersuchung und Beschreibung erfahren hatte. In der Sprache der Schriften könnte ich den Zustand nach meiner Erweckung als Suddha Manas, Vijnana oder die Intuition des Erleuchteten beschreiben.«9
Sri Bhagavans Erfahrung unterschied sich von der des Mystikers, der für eine kurze Weile in Ekstase versetzt wird, wonach sich aber wieder die düsteren Mauern des Geistes um ihn herum aufbauen. Sri Bhagavan besaß bereits das beständige Gewahrsein des Selbst und betonte ausdrücklich, dass es für ihn danach keines Sadhanas, keiner spirituellen Anstrengung mehr bedurfte. Er musste sich nicht mehr um das Versunkensein im Selbst bemühen, da das Ego, dessen Widerstand den Kampf verursacht hatte, vernichtet worden war und es somit keinen mehr gab, mit dem noch zu kämpfen gewesen wäre. In der Folge erreichte Sri Bhagavan mühelos und auf natürliche Weise die bewusste Identität mit dem Selbst, die im alltäglichen Leben völlig gefestigt war, und von ihm ging Gnade aus, die alle, die zu ihm kamen, empfingen. Dennoch wies er darauf hin, dass es eine Entwicklung gegeben hatte, wenn er davon spricht, dass die Seele einen neuen Halt suchte. Er wollte den Heiligen nacheifern, und es kümmerte ihn, was seine Verwandten dachten. Also war in ihm noch ein Rest von Dualismus vorhanden, der später verschwand. Es gab auch ein physisches Zeichen eines Prozesses. Seit seinem Erwachen verspürte er ein beständiges Brennen in seinem Körper, das erst verschwand, als er den inneren Schrein des Tempels in Tiruvannamalai betrat.
5 Das Monotone durchzieht ein indisches Musikstück wie der Faden, auf den die Perlen aufgezogen sind. Auf dieselbe Weise durchzieht das Selbst alle Seinsformen.
6 [nach Narasimha Swami: Self Realization, S. 23f]
7 Die Zitate stammen aus Paul Bruntons Buch ›A Search in Secret India‹.
8 [der große Tempel in Madurai]
9 [nach Narasimha Swami, S. 22-24]
Die Reise
Die Reiseroute
Venkataramans veränderte Lebensweise verursachte Spannungen. Er vernachlässigte immer mehr seine Hausaufgaben. Tat er das auch nicht, um zu spielen, sondern um zu meditieren, so kritisierten ihn sein Onkel und sein älterer Bruder doch zunehmend für seine Unvernunft. In ihren Augen war Venkataraman der heranwachsende Sohn einer bürgerlichen Familie, der seine Fähigkeiten einzusetzen hatte, um Geld zu verdienen und sich um andere zu kümmern.
Die Krise ereignete sich am 29. August, etwa zwei Monate nach seinem Erwachen. Venkataraman musste als Strafarbeit eine Lektion aus Bains Englisch-Grammatik abschreiben, da er sie nicht gelernt hatte. Es war Vormittag, und er saß mit seinem älteren Bruder im selben Zimmer im ersten Stock. Er hatte die Lektion bereits zweimal abgeschrieben und war bei der dritten Abschrift angelangt, als ihm die Sinnlosigkeit dieser Tätigkeit derart eindringlich zu Bewusstsein kam, dass er seine Arbeit beiseiteschob, die Beine überkreuzte und meditierte.10
Verärgert bemerkte Nagaswami in bissigem Ton: »Was bringt das alles für einen wie dich?« Damit meinte er, dass einer, der wie ein Sadhu leben will, kein Anrecht mehr auf die Annehmlichkeiten des häuslichen Lebens hat. Venkataraman erkannte die Wahrheit, die in diesen Worten steckte, und fand sich unerbittlich damit ab, was charakteristisch für ihn war. Er stand auf, um sein Zuhause auf der Stelle zu verlassen und allem zu entsagen. Für ihn hieß das, nach Tiruvannamalai zu gehen, zum heiligen Berg Arunachala.
Doch er wusste, dass er sich einer List bedienen musste, da in einer Hindu-Familie Autorität eine große Rolle spielt und weder sein Onkel noch sein älterer Bruder ihn fortlassen würden, wenn er ihnen von seinem Plan erzählte. Deshalb sagte er, er hätte noch eine Schulstunde in Elektrizitätslehre. Ahnungslos versorgte ihn sein Bruder mit dem nötigen Reisegeld, indem er sagte: »Dann nimm fünf Rupien aus der Kasse unten und bezahle auf dem Weg meine College-Gebühr.«
Weder seine Familie noch sonst jemand erkannte seinen Zustand, denn er war noch verborgen. Sein Schulfreund Ranga Iyer besuchte ihn wenige Jahre später in Tiruvannamalai und wurde von solcher Ehrfurcht ergriffen, dass er sich vor ihm niederwarf. Jetzt aber sah er auch nur den Venkataraman, den er kannte. Er fragte Sri Bhagavan später nach dem Grund. Sri Bhagavan antwortete, dass keiner den Wandel bemerkt habe. Ranga Iyer fragte: »Warum hast du nicht wenigstens mir erzählt, dass du weggehen würdest?« Er antwortete: »Wie konnte ich? Ich wusste es ja selber nicht.«
Der Abschiedsbrief
Venkataramans Tante war im Erdgeschoss. Sie gab ihm die fünf Rupien und eine Mahlzeit, die er hastig verschlang. Im Haus gab es einen Atlas, in dem Tindivanam als die Tiruvannamalai am nächsten gelegene Bahnstation verzeichnet war. Inzwischen war eine neue Bahnstrecke gebaut worden mit einem Bahnhof in Tiruvannamalai, aber da der Atlas veraltet war, war sie darin noch nicht verzeichnet. Venkataraman schätzte, dass drei Rupien für die Reise ausreichen würden, und deshalb nahm er nur so viel. Dann schrieb er einen Brief an seinen Bruder, um ihn zu beruhigen und eine Nachforschung zu vermeiden, und legte ihm die übrigen zwei Rupien dazu. Der Brief lautet: »Ich bin fortgegangen, um meinen Vater zu suchen, wie er befohlen hat. Dieser [sich selbst meinend] hat nur ein tugendhaftes Vorhaben begonnen. Deshalb soll sich niemand um ihn sorgen. Es soll kein Geld ausgegeben werden, um ihn ausfindig zu machen. Deine College-Gebühr ist noch nicht bezahlt. Zwei Rupien anbei.«
Dieses Ereignis illustriert Sri Bhagavans Bemerkung, dass seine Seele, die sich nun vom Körper gelöst hatte, immer noch einen bleibenden Halt im Selbst suchte, mit dem er eins geworden war. Die Ausrede mit der Schulstunde in Elektrizitätslehre, so harmlos sie auch war, wäre ihm später nicht mehr möglich gewesen. Auch wäre ihm der Gedanke an eine Suche nicht mehr in den Sinn gekommen, denn wer gefunden hat, sucht nicht mehr. Sri Bhagavan, vor dem sich später seine Schüler niederwarfen, war eins mit dem Vater und nicht mehr auf der Suche nach ihm. Der Brief bezeugt den Übergang von einer noch in der Dualität befindlichen Liebe und Verehrung zur seligen Gelassenheit der Einheit. Er beginnt mit der Zweiheit von »ich« und »mein Vater«, mit der Erklärung eines Befehls und einer Suche. Im zweiten Satz bezeichnet sich der Schreiber schon nicht mehr als »ich«, sondern als »dieser«, und wo am Schluss eine Unterschrift folgen sollte, war kein Ego mehr da und deshalb auch kein Name, mit dem er hätte unterschreiben können. Deshalb beendete er seinen Brief mit einem Strich anstatt der Unterschrift. Er schrieb fortan keinen Brief mehr und, abgesehen von zwei Ausnahmen, auch nicht mehr seinen Namen. Als Jahre später ein chinesischer Ashram-Besucher ein Exemplar seines Buches ›Wer bin ich?‹ erhalten hatte und ihn in der für die Chinesen höflichen, aber hartnäckigen Art bat, es zu signieren, schrieb er das Sanskritzeichen für OM hinein, die heilige Ur-Silbe, die für den ursprünglichen Klang steht, der aller Schöpfung zugrunde liegt.
Venkataraman nahm drei Rupien und ließ die restlichen zwei zurück. Es ist für ihn bezeichnend, dass er nicht mehr nahm als das, was er für die Reise nach Tiruvannamalai benötigte. Es war um die Mittagszeit, als er fortging. Die Bahnstation lag eine halbe Meile entfernt, und er beeilte sich, denn der Zug sollte bereits um zwölf abfahren. Doch obwohl er sich verspätet hatte, war der Zug noch nicht eingefahren. Die Fahrpreise waren angeschlagen, und er sah, dass eine Fahrt dritter Klasse nach Tindivanam zwei Rupien, 13 Annas kostete. Er kaufte eine Fahrkarte und bekam drei Annas Rückgeld. Etwas weiter unten hätte er Tiruvannamalai mit einem Fahrpreis von genau drei Rupien gefunden.
Die Ereignisse der Reise sind symbolisch für die mühsame Reise eines Sadhaka zu seinem Ziel. Zuerst erwies ihm die Vorsehung einen Gefallen, indem sie ihm das Geld für die Reise in die Hände spielte und ihn den Zug erreichen ließ, obwohl er sich zu spät auf den Weg gemacht hatte. Er hatte genau den Betrag zur Verfügung, den er brauchte, um sein Ziel zu erreichen. Aber seine Kopflosigkeit zog seine Reise in die Länge, brachte ihn in Bedrängnis und machte sie zu einem Abenteuer.
Venkataraman saß schweigend unter den Mitreisenden, versunken im Hochgefühl seiner Ergründung. Auf diese Weise hatte er bereits mehrere Stationen durchfahren. Ein weißbärtiger Maulvi fragte ihn:
»Swami, wohin reist du?«
»Nach Tiruvannamalai.«
»Ich auch.«
»Was, du reist nach Tiruvannamalai?«
»Nicht direkt. Ich steige eine Station später aus.«
»Welcher Bahnhof ist das?«
»Tirukoilur.«
Da erkannte Venkataraman, dass ihm ein Irrtum unterlaufen war, und verwundert rief er aus: »Fährt der Zug denn nach Tiruvannamalai?«
»Du bist vielleicht ein seltsamer Reisender!«, erwiderte der Maulvi. »Bis wohin hast du denn deine Fahrkarte gelöst?«
»Bis nach Tindivanam.«
»Meine Güte! Du brauchst gar nicht so weit zu fahren. Wir müssen in Villupuram in den Zug nach Tiruvannamalai und Tirukoilur umsteigen.«
Die Vorsehung hatte Venkataraman die benötigte Information gegeben, und er versank wiederum in der Seligkeit des Samadhi. Bei Sonnenuntergang traf der Zug in Tiruchirapalli ein. Da er Hunger hatte, kaufte er sich für eine halbe Annas zwei Landbirnen, eine große, aber recht holzige Birnensorte, die in der südlichen Berggegend wächst. Zu seinem Erstaunen war er bereits nach dem ersten Bissen satt, obwohl er bisher immer einen ordentlichen Appetit gehabt hatte. Er versank wiederum in die Seligkeit des Wachschlafes, bis der Zug um drei Uhr nachts Villupuram erreichte.
Bis Tagesanbruch blieb er am Bahnhof und wanderte dann in die Stadt hinein, um die Straße nach Tiruvannamalai zu suchen. Er hatte beschlossen, den Rest zu Fuß zu gehen. Aber nirgends entdeckte er einen Wegweiser nach Tiruvannamalai. Fragen mochte er nicht. Vom Umherirren müde und hungrig ging er in einen Gasthof und bat um Essen. Der Gastwirt sagte ihm, er könne erst zur Mittagszeit eine Mahlzeit bekommen. So setzte er sich hin, um zu warten, und versank sofort in Meditation. Als das Essen kam, bot er zwei Annas als Bezahlung an. Der Gastwirt war beeindruckt vom Anblick des jungen Brahmanen mit den langen Haaren und goldenen Ohrringen, der wie ein Sadhu dasaß. Er fragte Venkataraman, wie viel Geld er denn habe, doch als er hörte, dass er nur noch 2 ½ Annas besaß, weigerte er sich, eine Bezahlung anzunehmen. Er erklärte ihm, dass Mambalapattu, das Venkataraman bereits auf einem Wegweiser gesehen hatte, auf dem Weg nach Tiruvannamalai liegt. Venkataraman kehrte zum Bahnhof zurück und kaufte sich für sein restliches Geld eine Fahrkarte dorthin.
Am Nachmittag kam er in Mambalapattu an, von wo er zu Fuß weiterging. Etwa 16 Kilometer hatte er zurückgelegt, als es dunkel wurde. Vor ihm lag der Tempel von Arayaninallur auf einem steilen Felsen. Der lange Fußmarsch in der Hitze hatte ihn ermüdet, und er setzte sich vor den Tempel, um sich auszuruhen. Kurz darauf schloss jemand den Tempel auf, damit der Tempelpriester und die Gläubigen die Puja feiern konnten. Venkataraman trat ein und setzte sich in die Säulenhalle, der einzige Bereich, der nicht völlig im Dunkeln lag. Plötzlich erblickte er ein strahlendes Licht, das den ganzen Tempel durchflutete. Da er dachte, es käme vom Götterbildnis im inneren Schrein, ging er nachsehen, aber dort war nichts. Es war auch kein natürliches Licht. Es verschwand wieder, und er versank erneut in Meditation.
Bald wurde er vom Tempelkoch gestört, der rief, der Tempel würde nun geschlossen, da die Puja beendet sei. Er ging zum Priester und fragte, ob er etwas zu essen bekommen könne, doch sie hatten nichts. Dann bat er, ob er die Nacht im Tempel verbringen dürfe, aber auch das wurde im verweigert. Die Gläubigen sagten, sie würden auch noch im Tempel von Kilur, das einen guten Kilometer entfernt liegt, die Puja feiern. Anschließend könne er etwas zu essen bekommen. Also begleitete er sie. Kaum hatten sie den dortigen Tempel betreten, versank er erneut in Samadhi. Um neun Uhr war die Puja vorüber, und alle setzten sich zum Abendessen hin. Wiederum bat Venkataram um etwas zu essen, und wieder schien es, als wolle man ihm nichts geben. Aber der Tempeltrommler war von seiner Erscheinung und Demut derart beeindruckt, dass er ihm seinen Anteil gab. Da Venkataraman auch durstig war, verwies man ihn zum Haus eines Sastri, der in der Nähe wohnte, wohin er mit seinem Blatt Reis ging. Während er vor dem Haus auf Wasser wartete, stolperte er und wurde ohnmächtig oder schlief ein. Als er einige Minuten später wieder zu sich kam, stand eine kleine, neugierige Menge um ihn herum. Er trank das Wasser, aß ein wenig von dem Reis, den er verschüttet hatte, legte sich dann wieder auf den Boden und schlief ein.
Am nächsten Morgen – es war Montag, der 31. August – war Gokulashtami, Krishnas Geburtstag, für Hindus einer der größten Feiertage, der Glück verheißt. Bis Tiruvannamalai waren es noch 32 Kilometer. Venkataraman suchte wiederum die richtige Straße und war nach einiger Zeit müde und hungrig. Wie die meisten Brahmanen damals trug er goldene Ohrringe. Die seinen waren mit Rubinen besetzt. Er nahm sie ab, um sie zu versetzen und den Rest der Reise mit dem Zug fahren zu können. Aber wo und bei wem? Wahllos blieb er vor einem Haus stehen, das einem gewissen Muthukrishna Bhagavatar gehörte, und bat um Essen. Die Hausfrau musste von der Gestalt an ihrer Tür sehr beeindruckt gewesen sein: ein junger Brahmane mit einem schönen Antlitz und strahlenden Augen an Krishnas Geburtstag! Sie gab ihm eine reichliche kalte Mahlzeit. Obwohl er, wie schon zwei Tage zuvor im Zug, wieder nach dem ersten Bissen satt war, bestand sie mütterlich darauf, dass er alles aufaß.