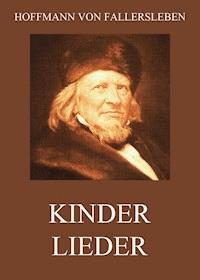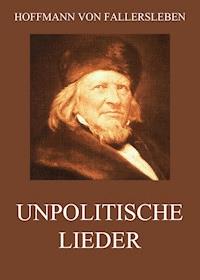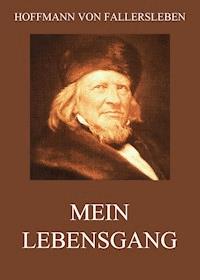
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben war Hochschullehrer für Germanistik, Dichter sowie Sammler und Herausgeber alter Schriften aus verschiedenen Sprachen. Dies ist seine Autobiographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 990
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Leben
Hoffmann von Fallersleben
Inhalt:
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben – Biografie und Bibliografie
Mein Leben
Erster Teil
Erster Band. 1798 bis Frühling 1823.
Zweiter Band. Breslau, Frühling 1823 bis Ende 1836.
Dritter Band. Breslau, 1837 bis 1842.
Vierter Band. 1843 bis 1847.
Zweiter Teil
Fünfter Band. (1848 bis Frühling 1854.)
Sechster Band. Weimar, Frühling 1854 bis Frühling 1860.
Mein Leben, H. von Fallersleben
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638368
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben – Biografie und Bibliografie
Sprachforscher und Dichter, geb. 2. April 1798 in Fallersleben, wonach er sich H. von Fallersleben nannte, gest. 19. Jan. 1874 in Korvei, besuchte 1816 die Universität Göttingen, um Theologie zu studieren, widmete sich aber, von Benecke angeregt, mit Vorliebe dem Studium der vaterländischen Literatur, dem er auch in Bonn, wohin er sich 1819 wandte, treu blieb. Nachdem er 1821 in Leiden ein halbes Jahr lang Forschungen über die altniederländische Literatur angestellt, privatisierte er in Berlin, wurde 1823 Kustos an der Universitätsbibliothek in Breslau, 1830 außerordentlicher und 1835 ordentlicher Professor der deutschen Sprache daselbst. Wiederholte Reisen nach Österreich (1827 und 1834), Dänemark (1836), Holland und Belgien (1837), in die Schweiz (1839) hingen mit seinen wissenschaftlichen Bestrebungen eng zusammen. Sein Amt bei der Bibliothek hatte er bereits 1838 freiwillig niedergelegt, als er durch Dekret vom 20. Dez. 1842 wegen politisch anstößiger Grundsätze und Tendenzen, die er in den »Unpolitischen Liedern« (Hamb. 1840–1841, 2 Bde.; 2. Aufl. des 1. Bandes 1840) ausgesprochen haben sollte, ohne Pension seiner Professur enthoben wurde. In der Folge aus mehreren deutschen Bundesstaaten polizeilich ausgewiesen (vgl. »Zehn Aktenstücke über die Amtsentsetzung des Professors H.«, Mannh. 1843), führte er nun jahrelang ein unstetes Wanderleben, bis er sich 1845 in Mecklenburg Heimatsrecht erwarb. 1848 auch in Preußen rehabilitiert, bezog er seitdem das gesetzliche Wartegeld als Pension und ließ sich 1853 in Weimar nieder, wo er mit Oskar Schade das »Weimarische Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst« herausgab, von dem 6 Bände erschienen sind (Hannov. 1854–57). In Weimar entstanden noch »Theophilus«, die Ausgabe eines niederdeutschen Schauspiels aus der Mitte des 15. Jahrh. in zwei verschiedenen Fassungen (Hannover 1853 u. 1854), und eine »Geschichte der deutschlateinischen Mischpoesie«. 1860 wurde H. vom Herzog von Ratibor zum Bibliothekar auf Schloß Korvei ernannt. In seinem Geburtsort wurde ihm 1883 ein Denkmal (Obelisk) errichtet, ein andres, von Schaper, 1892 auf der Insel Helgoland, ein drittes 1903 in Höxter. – Außer den bleibenden Verdiensten, die sich H. durch Veröffentlichung älterer deutscher Literaturdenkmäler erworben hat, gewann er durch seine heitern, leicht singbaren Lieder einen allgemein anerkannten Dichternamen. Ohne besondere Tiefe, fasste er die Ansichten der überwiegenden Anzahl seiner Zeitgenossen in kurze, meist epigrammatische Gedichte, die allerdings oft keck. mitunter selbst scharf und verletzend gehalten sind, im allgemeinen jedoch mehr auf das Possenhafte und Kindlich-Spielende als auf das Sarkastische hinauslaufen. Er traf, wie kaum ein andrer Dichter der Neuzeit, durch Einfalt und Innigkeit den Ton des echten Volksliedes, und nicht wenige seiner Lieder sind Eigentum des Volkes geworden (»Deutschland, Deutschland über alles«, auf Helgoland 26. Aug. 1841 gedichtet). Obgleich nicht musikalisch gebildet, gab er doch dazu die anmutigsten Melodien an, die nur künstlerisch verarbeitet zu werden brauchten. Gleichzeitig mit seinen »Liedern und Romanzen« (Köln 1821) erschienen die »Bonner Bruchstücke von Otfried« (Bonn 1822). Ihnen folgten die »Althochdeutschen Glossen« (Bresl. 1826), die »Alemannischen Lieder« (das. 1827; 5. Aufl., Mannh. 1843), eine Sammlung von »Gedichten« (Bresl. 1827), »Willirams Übersetzung und Auslegung des Hohenliedes« (das. 1827), »Jägerlieder« (das. 1828), die »Fundgruben für Geschichte deutscher Sprache und Literatur« (das. 1830–37, 2 Bde.), »Reineke Vos« (das. 1834), eine neue Sammlung von »Gedichten« (Leipz. 1834, 2 Bde.; vermehrte Ausg. 1843), die »Sumerlaten, mittelhochdeutsche Glossen aus den Handschriften der Hofbibliothek zu Wien« (Wien 1834), die mit Endlicher aufgefundenen und herausgegebenen »Fragmenta theotisca« (das. 1834, 2. Aufl. 1841), die »Monumenta Elnoneusia« (Gent 1837, 2. Aufl. 1845), das »Buch der Liebe« (Bresl. 1836) und eine dritte Sammlung von »Gedichten« (das. 1837). Für die altniederländische Literatur sind besonders wertvoll die u. d. T.: »Horae belgicae« (Berl. u. Leipz. 1830–62, 12 Tle.) herausgegebenen Abhandlungen und Literaturdenkmäler. Mit M. Haupt veröffentlichte er »Altdeutsche Blätter« (Leipz. 1835–40, 2 Bde.), eine reiche Sammlung kleinerer Quellen und Abhandlungen. Literarhistorische Monographien von Wert sind seine Biographien Joh. Chr. Günthers (Bresl. 1832) und Barth. Ringwaldts und Benj. Schmolcks (das. 1833) sowie seine reichhaltige »Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit« (das. 1832, 3. Aufl. 1861). Er veröffentlichte ferner: »Michael Vehes Gesangbüchlein vom Jahr 1537«, das älteste katholische Gesangbuch (Hannov. 1853); »Hannoversches Namenbüchlein« (das. 1852); »Kasseler Namenbüchlein« (Kaff. 1863); »Braunschweiger Namenbüchlein« (Braunschw. 1866); »Lieder der Landsknechte unter Georg und Kaspar von Frundsberg« (Hannov. 1868); »Henneke Knecht, ein altes niederdeutsches Volkslied« (Berl. 1872); »Unsre volkstümlichen Lieder« (Leipz. 1859, 4. Aufl. von Prahl 1900). Eine bibliographische Übersicht des Gebiets der deutschen Philologie gab er in dem Werk »Die deutsche Philologie im Grundriß« (Bresl. 1836); auch lieferte er ein »Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in der Hofbibliothek zu Wien« (Leipz. 1841) und »Spenden zur deutschen Literaturgeschichte« (das. 1844, 2 Tle.). Er gab die »Monatsschrift von und für Schlesien« (Bresl. 1829, 2 Bde.) heraus, ferner »Schlesische Volkslieder mit Melodien« (mit E. Richter, Leipz. 1842), »Politische Gedichte aus Deutschlands Vorzeit« (das. 1843), »Die deutschen Gesellschaftslieder des 16. und 17. Jahrhunderts« (das. 1844, 2. Aufl. 1860) und »Ruda. Polnische Volkslieder der Oberschlesier« (Kassel 1865). Den »Unpolitischen Liedern« schließen sich von eignen Dichtungen an: »Deutsche Lieder aus der Schweiz« (Zürich 1843 u. 1845); »Deutsche Gassenlieder« (2. Aufl., das. 1845); »Diavolini« (2. Aufl., Darmst. 1847); »Hoffmannsche Tropfen« (Zürich 1844). In andrer Richtung bewegten sich: »Fünfzig Kinderlieder« (Leipz. 1843, mit Klavierbegleitung von Ernst Richter; 4. Aufl., Hamb. 1866); »Maitrank« (Par. 1844); »Deutsche Salonlieder« (Zürich 1844); »Fünfzig neue Kinderlieder« (Mannh. 1845; 3. Aufl., Stuttg. 1874); »Vierzig Kinderlieder« (Leipz. 1847); »Hundert Schullieder« (mit Volksweisen versehen von L. Erk, das. 1848); »Deutsches Volksgesangbuch« (das. 1848); »Liebeslieder« (Mainz 1851); »Heimatklänge« (das. 1850); »Rheinleben« (das. 1851); »Soldatenlieder« (das. 1851); »Kinderwelt in Liedern« (das. 1853); »Lieder aus Weimar« (3. Aufl., Hannov. 1857) und seine letzten politischen Gedichte, die »Streiflichter« (Berl. 1871). 1858 begann er seine »Findlinge« (Leipz. 1859–60, 4 Hefte), ein Sammelwerk von seltenem oder unbekannt gebliebenem Material zur Geschichte deutscher Sprache und Dichtung. Eine Auswahl seiner »Gedichte« erschien unmittelbar nach des Dichters Tod als 8. Auflage (Berl. 1875, 10. Aufl. 1904); eine Sammlung seiner sämtlichen Kinderlieder veranstaltete L. v. Donop (das. 1877). Eine nicht durchgehend erfreuliche, aber inhaltreiche Autobiographie veröffentlichte H. in dem sechsbändigen Werk »Mein Leben« (Hannov. 1868–70; in verkürzter Form hrsg. von Gerstenberg, Berl. 1894, 2 Bde.). Eine Gesamtausgabe seiner Werke veranstaltete H. Gerstenberg in 8 Bänden (Berl. 1890–93). Nach seinem Tod erschienen »Briefe von H. von Fallersleben und M. Haupt an Ferdinand Wolf« (Wien 1874). Vgl. J. M. Wagner, H. von Fallersleben 1818–1868 (Wien 1869; Nachtrag, Dresd. 1870); Gottschall, Porträts und Studien, Bd. 5 (Leipz. 1876); Kreyenberg, H. von Fallersleben (»Preußische Jahrbücher«, Bd. 68, 1891); Gerstenberg, Henriette von Schwechenberg und H. von Fallersleben (Berl. 1903).
Mein Leben
Erster Teil
Erster Band. 1798 bis Frühling 1823.
Ich bin geboren den 2. April 1798 zu Fallersleben, dem Hauptorte des gleichnamigen Amtes im ehemaligen Churfürstenthum Hannover. Mein Vater war Heinrich Wilhelm Hoffmann, Kaufmann und Bürgermeister († 23. April 1819), meine Mutter Dorothea geb. Balthasar († 3. December 1842), sie stammte aus Wittingen. In der Taufe erhielt ich die Namen August Heinrich. Meine Pathen waren Heinrich August Hoffmann, nachheriger Pastor zu Mühlhausen im Waldeckschen und Frau Maria Wolff zu Havelberg. Mein elterliches Haus, jetzt im Besitze meines Schwagers Georg Friedrich Boes, ist noch vorhanden. Auf dem Querbalken über der Hausthür steht die Inschrift:
BESSER NEIDEN DEN BECLAGEN
WEN ES GOTT THVT BEHAGEN
WER AFV GOTT THRAWT
HAT WOWL GEBAWT
ER WIRT MIR GEBEN
WAS MICH DIENT ZVM LEBEN
In meiner frühesten Kindheit war ich körperlich sehr schwach und krankte in Einem fort. Außer den damals gewöhnlichen Kinderkrankheiten, Pocken und Masern, bekam ich auch hinterdrein noch das Friesel. Ich mußte viel ausstehen und nahm geduldig ein und that Alles was der Arzt und die Eltern für gut hielten. Ich erinnere mich, daß ich an einem bösartigen Ausschlage über den ganzen Körper litt und eine Zeit lang fast blind war, so daß ich das Tageslicht nicht vertragen konnte und mich gerne in einen dunkelen Gang zwischen zwei Thüren einsperren ließ, aber auch da noch jammerte, wenn der Widerschein der Sonne durch die kleinen Spalten der vorderen Thüre drang. Eine leichte Reizbarkeit der Nerven habe ich seit dieser Zeit immer behalten, namentlich in den Augen, obschon ich noch heute keine Brille brauche.
Unter der sorgsamen, oft ängstlichen Pflege meiner Großmutter, deren Liebling ich war, wuchs ich auf und wurde, wie es bei schwächlichen Kindern in ähnlichen Verhältnissen immer der Fall ist, sehr verzogen, und bald launisch und eigensinnig.
Obschon ich täglich wenn ich aufwachte und wenn ich Abends zu Bette gegangen war und vor dem Einschlafen mit meiner Großmutter betete, so hatte doch diese Andacht, weil sie gewöhnlich geworden, keinen Antheil weiter an dem was ich des Tages that und trieb. Mehr wirkte ihr frommer liebevoller Sinn und die Wahrheit in ihren Worten und Werken, wodurch sie mehr als durch ihr Alter bei Jung und Alt sich hoher Ehrfurcht erfreute. Sie verstand es vortrefflich, jedem die Meinung zu sagen. Nur in Bezug auf mich, ihren Liebling, war sie zu nachsichtsvoll, ja zu schwach.
Gegen den Willen der Eltern setzte ich Vieles durch: wenn mir eine Speise zuwider war oder auch nur nicht schmeckte, ließ ich sie stehen; erhielt ich nichts nach Wunsch, so hungerte ich lieber. Da ereignete es sich denn wol, daß die Großmama noch spät Abends zu mir in die Kammer kam und mir mit einer angenehmen Speise den Hunger zu stillen suchte. Wurden ihr dann darüber Vorwürfe gemacht, so wußte sie sich zu entschuldigen: ›Dem armen Jungen schrumpft ja der Magen zusammen.‹ Innig dagegen konnte sie sich freuen, wenn ich bei Tische einen guten Appetit entwickelte. Da pflegte sie denn wol zu sagen: ›et schînt als ob't dem Jungen smeckt‹ – was nachher sprichwörtlich bei uns wurde.
Auch in Bezug auf Kleidung war ich eigen und eigensinnig. Es kostete immer große Kämpfe, ehe ich ein neues Kleidungsstück anlegte, sobald mir die Farbe oder der Schnitt nicht gefiel. Einmal erhielt ich eine Jacke mit drei Reihen dicht an einander gesetzter blanker runder Knöpfe. Des Sonntags mußte ich die Jacke anziehen. Man glaubte wunder welche Freude man mir damit machen würde. Ich ärgerte mich und weigerte mich, sie anzuziehen – half nichts. Ich ging den ganzen Tag darin umher und dachte nur an meine Narrenjacke. Alles Auffallende in meinem Aeußern verdroß mich.
Ich konnte sogar keinen Fleck leiden, keine Dunen, keine Fädchen an meinem Rocke. Wenn wir ausfuhren und ich neben dem Knechte auf dem Bocke saß und der Wind übersäete mich mit den Haaren unserer Schecken, so war mir schon dadurch die ganze Fahrt verleidet. So ärgerte ich mich auch, daß ich weißes Haar hatte, weil das den Kindern Anlaß gab, mir nachzurufen: ›Wittkopp!‹
Wenn ich mit anderen Kindern spielte, so konnte ich es nie vertragen, wenn meinem ein anderer Eigenwille entgegentrat. Dagegen konnte ich allein stundenlang mit mir zufrieden sitzen und spielen. Ich untersuchte gewöhnlich mein Spielzeug so lange von außen und innen, bis es kurz und klein war. Die Spielsachen, die mir im Sommer von der Braunschweiger Messe und die mir zu Weihnachten beschert wurden, erfreuten sich nie einer langen Lebensdauer. Es war nicht eigentlich die Lust am Zerstören, sondern kindische Neugier, wie dies und jenes gemacht war und sich in seinen einzelnen Theilen ausnähme.
Nicht immer war meine Selbstunterhaltung eine so billige. Eines schönen Morgens saß ich mitten in der Stube auf dem großen Homannschen Atlas und riß nach und nach die Bilder mit ihren glänzenden Farben aus den Ecken, um sie mir näher zu betrachten. Am Tische saß der Herr Pastor Hantelmann von Wettmarshagen bei seinem Cafe, rauchte seiner lange irdene Pfeife und sah mir wohlgefällig zu, ohne ein Wort zu sagen. Da trat meine Mutter ein: ›aber, Herr Pastor, und das haben Sie dem Jungen nicht verboten?‹ – ›Nun, er hatte ja seine Freude daran.‹
Von den Erinnerungen aus so früher Zeit ist mir die schmerzlichste der Tod meiner jüngsten Schwester (4. Januar 1803). Sie war zwei Jahre älter als ich und starb an den Pocken. Ich sehe sie noch wie sie in ihrem kleinen Sarge ruhte, das zarte Gesicht durch eine schwarze Pockenbeule entstellt. Dies Bild ist mir mein ganzes Leben hindurch nie wieder verschwunden. Als ich zu dichten anfing, war eins der ersten Gedichte unserer früh geschiedenen Dorothea gewidmet. Von dieser Zeit an ist es mir nie möglich gewesen, Leichen zu sehen. Ich wollte mir das Bild des blühenden Lebens nicht durch den Tod verkümmern lassen. So oft andere Kinder an den Sarg ihrer todten Gespielen mit Blumen und Kränzen traten, ging ich trauernd unter den Blumen in unserm Garten umher.
Der Sinn und die Liebe für die Natur erwachte sehr früh in mir. Im Garten zwischen Blumen war mein liebster Aufenthalt. Wie freute ich mich, wenn die zarten Pflanzen, die ich selbst gesäet hatte, gediehen und unter meiner Pflege zur Blüthe kamen! Jeden Morgen wurde Heerschau gehalten und wenn eine Blume aufgebrochen war, so ward es sofort den Eltern gemeldet. Wo es anderswo schöne und seltnere Blumen gab, wurde hinspaziert, und wenn ich Samen oder einen Ableger erbetteln konnte, so zog ich beglückt heim. Besonders prachtvoll war unser langes Tulpen- und Hyacinthenbeet; auch hatten wir einige Jahre die herrlichsten Nelken, schönere an Farben und Gestalt als die jetzigen verkünstelten. Als ich unter dem Pfeffer Ricinuskörner gefunden hatte, pflanzte ich sie und erlebte die Freude, sie noch im Sommer groß aufgeschossen und in Blüthe stehen zu sehn. Auch Citronenkerne legten wir in Töpfe und erzielten wenigstens zierliche, wenn auch winzige Bäumchen. Wir waren jedenfalls glücklicher damit als bei den früheren Versuchen mit Rosinenkernen.
Aber auch an das Nützliche wurde gedacht. Wie meine Gespielen so legte auch ich eine Baumschule an. Bei dem Ueberfluß an Obst gab es den Winter hindurch Gelegenheit genug Kerne zu sammeln, die dann im Frühjahr gesäet wurden. Auch suchten wir überall in Gärten und Baumhöfen aufgelaufene Obstsprößlinge und vermehrten damit unsere Baumschule. Es war eine große Freude für mich, daß ich nach einigen Jahren, als ich Student war, eine hübsche Anzahl veredelter Stämmchen meinem Vetter verkaufen konnte.
Wie der Garten so wurden bald Haus und Hof, Wiesen und Felder ein unermeßliches Feld kindlicher Freude und Thätigkeit. Das Leben im Freien bei nahrhafter Kost hatte mich gekräftigt, ich fühlte mich meinen Gespielen ebenbürtig und konnte mit ihnen Stich halten. Jede Liebhaberei der anderen Kinder wurde meinerseits mitgemacht. Auch ich mußte Tauben haben, und bald hatte ich Feldflüchter, Trommel- und Pfauentauben, die ich täglich fütterte. Daneben hielt ich mir Kaninchen von verschiedenen Farben, die mir besonders wenn ich sie fütterte ergötzliche Unterhaltung gewährten. Sie hatten aber bald den Stall so unterwühlt, daß ich sie abschaffen mußte. Fast noch mehr Spaß hatte ich an einem Häschen in einer leeren Tabakstonne. Anfangs mußte man ihm die Kohlblätter an einem langen Bindfaden hinabreichen; später als es größer wurde, mußte der Bindfaden immer kürzer werden. Als das Häschen ein Hase geworden, was nun? Da meinte der Vater: ›der Hase muß auf weidmännisch getödtet werden.‹ Die Tonne mit dem Hasen wurde in den Garten gebracht, der Vater stand mit geladener Flinte, den Hahn gespannt, daneben. Da ward die Tonne umgekippt; der Hase sprang hinaus, der Vater schoß hinterdrein und Leporello suchte das Weite.
Im Winter war außer den gewöhnlichen Kindervergnügungen, als Schlittenfahren, Schneebällen, Glandern und Schlittschuhlaufen der Vogelfang eine angenehme Unterhaltung. Wir machten uns Sprenkel, worin wir Rothkehlchen, und Kasten von Fliederstäben, worin wir Meisen fingen. Sobald Schnee lag, spannten wir Fallnetze auf, oder legten einen mit Bindfäden überzogenen Tonnenreif voll Schlingen auf den Schnee und bestreuten die Stelle mit Kaff. Die Rothkehlchen und Meisen setzten wir in die Stube, nach einiger Zeit waren sie ziemlich zahm und wurden dann unsere Wintergesellschaft. Die Finken, Goldammern und Sperlinge, welche sich nicht an die Stube gewöhnen können, ließen wir fliegen, den letzteren aber, den Spatzen, klebten wir zuvor Hahnenkämme von rothem Tuch auf den Kopf, wodurch sie ein recht kriegerisches Ansehn bekamen.
Sobald der Schnee verschwunden und die Sonne länger und wärmer wieder schien, eilten wir in die Gärten und Wiesen und suchten Veilchen, Schneeglöckchen, Erdrauch und Himmelschlüssel, und flogen den ersten Schmetterlingen nach, dem Citronenvogel und der Aurora, denn von den verschiedenen Sammlungen, die wir uns anlegten, war mir die Schmetterlingssammlung die liebste. Nach den Schulstunden war meist der Kirchhof unser Spiel- und Tummelplatz: wir schlugen Ball, liefen bar, spielten haschen, Häselein, Eisermännchen in Eisen, ließen den Drachen steigen und den Brummkreisel brummen.
Eine der lieblichsten Erinnerungen aus so früher Zeit ist mir das Kinderfeft in dem benachbarten Sülfeld. Dorthin zogen am zweiten Pfingsttage die Fallersleber, Alt und Jung, damals noch jedes Jahr. Während die Großen nur an Cafetrinken, Kuchen und Tanz dachten, war zunächst uns Kindern die größte Freude, wenn der Laubfrosch und die Maibraut nach einander ihren Aufzug hielten.
Eine Gesellschaft von zwölf Knaben, jeder mit einem hölzernen Säbel, woran unten bunte Bänder flatterten, kam auf die Scheundiele und bildete einen Kreis; in der Mitte stand der Laubfrosch, so benannt weil er ganz in grüne Zweige eingehüllt war. Sowie der Gesang begann, singen alle an um den Laubfrosch herum zu springen und schlugen mit ihren Säbeln gegen die Wände. Das dauerte bis zu der Stelle: Ein Ei, twei Ei etc., dann machten sie alle wie auch der Laubfrosch bei jeder Zahl einen tiefen Diener. Bei den Worten: Dat sebente is dat Pingestei, sprangen alle wieder wie vorher. Sie sangen:
Guden Dach, guden Dach!
Geben se user Lôfföschje wat,
Se hat lange nist ehat,
Sau geben se'r wat,
Sau hat se wat.
Drei halbe Schock Ei, kein fûl Ei,
Dat fule Ei smît wi vor de Dör oppen Stein entwei.
Ein Ei, twei Ei, drei Ei, veir Ei, fîf Ei, ses Ei,
Dat sebente is dat Pingestei.
Boben in der Vöste
Hanget de langen Wöste.
Gebet üsch de langen,
Latet de korten hangen
Bet opt andere Jâr,
Dan wilwi de korten nahâln.
Einen freundlichen Gegensatz zu diesen wilden Burschen bildete die Maibraut. Zwölf kleine Mädchen, alle hübsch geputzt, freundlichen, bescheidenen Wesens, kamen mit ihrer Königin, die eine Krone von Flittergold und künstlichen Blumen trug, und tanzten wie im Ringelrosenkranze um sie herum und sangen:
Guden Dach, guden Dach!
Gebet user Maibrût wat,
Sau hat se wat,
Sau lecht jue Heuneken opt Jâr brav wat.
Klappe klappe ringelken,
Hîr sind de kleinen Kinderkens.
Lât se gân, lât se stân,
Lât se nich tau lange stân,
Dat se könt'n betjen wider gân.
Stücke von'n Schinken,
Könt se brav op drinken.
Stücke von'n Kauken,
Könt se brav op raupen.
Stücke von'n Luffen,
Könnt se brav op buffen.
Stücke von'n Kese,
Könt se lange na lében.
Von dem Hauswirth mit Wurst, Semmel, Kuchen von den Fremden mit Geld beschenkt gingen die Laubfrosch- und Maibrautkinder weiter und hielten dann, jede Gesellschaft für sich, einen Abendschmaus. Dies fröhliche Kinderfest ist heutiges Tages spurlos verschwunden, wie der Anteich, worin sich einst der Sürfelder Kirchthurm spiegelte.
Zu Anfange des Sommers suchten wir Erdbeeren und Brombeeren in den Wäldern. Im Herbste holten wir die von den Hecken abgeschnittenen Dornen zusammen, auch das trockene Kartoffelkraut, Halme und Bohnenranken, und zündeten sie an; je dicker der Rausch emporstieg, desto größer war unsre Freude. Nebenbei waren wir auch noch sehr empfindungsreich und machten ohne weitere Anweisung uns viele von den Dingen, welche Hermann Wagner in seinem ›illustrierten Spielbuch für Knaben‹ abbildet und beschreibt; wir machten Wind- und Wassermühlen, Klappbüchsen, Blasröhre, Sprützbüchsen (›Strenjen‹), Schlüsselbüchsen, Flitzbogen, Schleudern, Weidenpfeifen, Petermännchen und Schwärmer.
Als meine Eltern glaubten, daß es Zeit sei, etwas zu lernen, schickten sie mich zur Frau Dreyer in die Schule. Es dauerte einige Wochen ehe ich ohne Sträuben hinging. Ich weinte jedesmal, und selbst die Tute mit Rosinen, die ich mit auf den Weg bekam, konnte mich nicht umstimmen. Ich mußte immer hingeführt werden, allein wäre ich nicht gegangen. Nachdem ich aber mich an die vielen fremden Kinder gewöhnt und das Abc überwunden hatte, war mir die Schule kein Ort der Angst und des Schreckens mehr.
Nach Jahr und Tag muß ich wohl so weit gediehen sein, daß ich die Bürgerschule besuchen konnte. Ich erinnere mich wenigstens noch, daß eines Tags der ehrwürdige Superintendent Ziegler uns besuchte und tüchtig abkanzelte: ›Ihr Heiden, ihr Hottentotten –‹ begann er seine Anrede. Dann kam er zu mir, legte seine Hand sanft auf meinen Kopf und sprach: ›Du mein Kind bist artig und fleißig.‹ – Der Unterricht in dieser zweiten Abtheilung der Bürgerschule war sehr dürftig. Meine Eltern und mehrere Familien wollten deshalb ihren Kindern einen besseren geben lassen. Sie einigten sich und fanden in dem Herrn Stolberg einen passenden Lehrer. Es wurde ihm ein Gehalt festgesetzt, eine Wohnung gemiethet und etwa unser acht wurden seine Schüler. So bekamen wir denn zum Lehrer einen Gelehrten, der eben nicht zu viel gelernt hatte und vor der Candidatur des Predigtamtes stehen geblieben war. Obschon diese Schule von kurzer Dauer war, so hatte sie auf mich doch vortheilhaft gewirkt; ich wurde mit manchen Dingen bekannt, von denen ich früher keine Ahndung hatte: ich erfuhr etwas von den Naturreichen und der Länder- und Völkerkunde, und machte den Anfang mit dem Französischen. Nachdem das Verhältniß mit Stolberg gelöst war, besuchte ich wieder die Bürgerschule, nebenbei aber ging ich wöchentlich mehrere Stunden zum Schreiben und Rechnen bei Herrn Harms.
Unser Nachbar Harms, ein Kaufmann, der seinen Handel hatte aufgeben müssen, war Schreiblehrer geworden. Er schrieb eine hübsche Hand und ertheilte guten Unterricht im Schreiben und Rechnen. Er war mit mir recht zufrieden und ich schrieb seine Vorschriften ziemlich gut nach, aber, aber den krummen Finger beim Schreiben konnte er mir nicht abgewöhnen und ich habe ihn mein ganzes Leben behalten. Im Rechnen hatte ich es ziemlich weit gebracht, setzte es leider später nicht fort. Hätte ich nur behalten was ich damals konnte, – ich hatte den alten Hemeling bis über die Mitte durchgerechnet! – es wäre mir in manchen Lagen des Lebens von großem Vortheile gewesen.
Für Musik hatte ich viel Sinn, vielleicht auch Anlage, aber keine Gelegenheit, Singen und Spielen zu lernen. Ich freuete mich an Musik und Gesang, und was ich singen hörte, wußte ich schnell auswendig und sang es nach. Ich machte mir selbst musicalische Instrumente, überzog Schachteldeckel mit Drahtsaiten, suchte aus ungleichen Rohrstangen eine Papagenopfeife zusammenzufügen und aus Wallnußschalen kleine Klappern zu bereiten. Unser oberster Boden war die eigentliche Polterkammer. Unter allerlei Gerümpel befand sich dort eine alte Drehorgel. Manche Stunde spielte ich mir hier alle Stücke nach einander vor und oft mehrmals. Der Gesang in der Schule beschränkte sich meist auf Kirchenlieder. Jeder sang, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Als ich später mit zu den Neujahrssängern gehören sollte, handelte es sich nur um zweistimmigen Gesang, oder um ›grob und fein‹, wie wir es bequemer nannten. Wer ein gutes Gehör und eine gute Stimme hatte, genügte vollkommen den mäßigen Anfoderungen.
Zum Zeichnen hatte ich große Lust, aber es fehlte mir auch dazu an Anweisung. Ich begnügte mich, Häuser und Bäume aus dem Kopfe zu zeichnen oder nach Bilderbogen und sie nachher auszumalen. Um ein ziemlich treues Bild zu erlangen, hielt ich an eine Glasscheibe das Original mit darüber gelegtem feinen Papiere und zog nun darauf mit einem Bleistift die Umrisse nach und malte diese dann aus. Da sich aber so etwas nur bei Tage veranstalten ließ und die Winterabende sehr lang waren, so machten wir uns Papier mit Fett und Kienruß schwarz, legten dies mit der schwarzen Seite auf weißes Papier und oben drauf das Original, das dann durchgezeichnet wurde. So gab es denn Tag- und Nachtbilder.
So ergötzlich diese Beschäftigung und jedesmal mit jedem neuen Tuschkasten gar eifrig unternommen wurde, so hielt sie doch nicht lange an, wir kehrten immer wieder zu unseren alten lieb gewordenen Bilderbüchern zurück. Daneben mußte der alte Guckkasten uns noch manche Stunde ausfüllen. Er enthielt einige alte Ansichten von Versailles, tapetenartig gemalt. Sie machten sich aber gar hübsch, wenn sie hinten mit zwei Lichtern beleuchtet wurden. Daß aber dieser Kasten noch zu etwas anderem dienen könnte, ahndeten wir nicht. Später machten wir eine Camera obscura daraus, stellten ihn mitten in den Garten zu Ende des langen Ganges, gerade dem Kirchthurme gegenüber. Da sahen wir denn zu unserer großen Freude eine liebliche Landschaft auf das weiße Papier hingezaubert mit allen Blumen und Bäumen, von bunten Schmetterlingen und Vögeln durchflogen. Bei jeder anderen Stellung des Kastens gewannen wir natürlich immer ein anderes Bild. Mancher heitere Sommertag lud uns zu dieser mühelosen und genußreichen Landschaftsmalerei ein.
Während dieser meiner friedlichen Zeit des Spielens und Lernens daheim sah es draußen sehr kriegerisch aus. Zu Anfange des Jahres 1803 hatte zwar Frankreich England den Krieg noch nicht erklärt, benahm sich aber schon längst sehr feindselig. Endlich wurde denn auch dem Kurstaat die Pflicht sehr nahe gelegt, sich zu rüsten und zu wehren. Am 16. Mai kam ein Regierungserlaß, jeder Unterthan solle sich zur Vertheidigung und Befreiung des Vaterlandes der Regierung zur Verfügung stellen, eine bis dahin in Hannover nie gekannte Maßregel. Es wurden denn auch im Amte Fallersleben sofort Recruten ausgehoben. Wie es dabei herging, weiß ich nur vom Hörensagen. Die jungen Bauerkerle wurden Nachts aus ihren Betten geholt und wenn sie nicht willig folgten, mit Gewalt fortgeschleppt. Mein Vater erhielt den Befehl mit dem Amtschreiber von Blum diese gepreßten Vaterlandsvertheidiger nach Hannover zu geleiten, ein trauriges Geschäft! Nachdem sie auf dem Rathhause eingesperrt und bewirthet und dann theils gutwillig, theils mit Gewalt auf die Wagen gebracht waren, setzte sich der Zug unter dem Geheule der alten Weiber und Bräute in Bewegung und wurde eine weite Strecke dann von diesen begleitet. Als sie in der List dicht vor Hannover ankamen, hieß es denn: ›et is te late, gân se man wedder na Hûs, de Herzog flüchtet eben tom Dore henût.‹ Schnell wie der Blitz sprang Alles von den Wagen herunter und bediente sich der Abwesenheit. Mein Vater aber ging nach Hannover hinein. Es war ihm eine willkommene Gelegenheit, sich die Hauptstadt, die er noch nicht kannte, anzusehen, und er sah sie sich gehörig an.
Schon in den letzten Tagen des Mais rückte Mortier von Holland aus ins Hannoversche ein, unterzeichnete den 3. Juni die Convention von Sulingen und hielt den 4. seinen Einzug in Hannover. Der Sulinger Convention folgte die noch schmählichere von Artlenburg am 5. Juli. Hannover war in den Händen der Franzosen, die sich durch das ganze Land vertheilten.
Auch Fallersleben blieb nicht verschont: eine Schwadron reitender Artillerie rückte ein und nahm auf lange Zeit Standquartier. Wir Kinder freuten uns über die schönen Uniformen und rothen Federbüsche, und zogen überall mit, wenn es Uebungen und Paraden gab. Wir konnten uns nur wundern, wenn wir zu Hause hörten: ›das sind unsere Feinde – wenn wir sie nur bald wieder los wären!‹ Als mein Bruder sich eines Tages sehr freute, daß der Trompeter so schön bliese, sagte der alte Bürgermeister Krüger: ›theuere Musik, lieber Herr Vetter, theuere Musik!‹
Unsere Feinde betrugen sich recht gut; sie waren leicht zufrieden zu stellen, sobald man ihnen nur freundlich entgegen kam und guten Willen zeigte. Unter einander waren sie brüderlich einträchtig. Knechtischen Dienstgehorsam und rohe Behandlung von Seiten der Obern nahm man niemals wahr. Wir hatten so oft gehört, wenn ein Junge unartig war: ›wart! du sollst dem Kalbfelle folgen!‹ Das schien uns gar keine Strafe. Freilich hatte man uns früher das Soldatenleben als etwas Schreckliches geschildert: Prügel, Spießruthen, Gefängniß bei Wasser und Commißbrot. Wir spielten jetzt selbst Soldaten, und wenn einer nicht that was er sollte, so sperrten wir ihn ein: das kam auch bei den Franzosen vor und ging dort eben so lustig ab wie bei uns.
Das Jahr 1804 war angebrochen, eine Aenderung unserer Lage schien in weite Ferne gerückt, vorläufig blieb Alles beim Alten. Seit dem 19. Juni war Bernadotte Oberbefehlshaber. Die Lasten blieben dieselben. Im September (1805) schien es sich für uns besser zu gestalten: die Franzosen zogen ab und am 28. October rückten Preußen in Hannover ein, die hannoversche Regierung wurde hergestellt. Als aber am 2. December die Schlacht von Austerlitz für Oesterreich verloren ging, da gestaltete sich plötzlich Alles anders.
Einige Wochen nach dem Beginn des neuen Jahres 1806 rückten preußische Truppen unter dem Grafen Schuleuburg-Kehnert in Hannover ein. Der König von Preußen erklärte, die französischen Völker würden von nun an das Kurfürstenthum räumen und Preußen bis zum Frieden in Verwaltung und Obhut nehmen.
Wir in unserem entlegenen Winkel erfuhren nur wenig von diesem großen Ereignisse. Die Landeshoheits- und Grenzpfähle mit dem preußischen Adler erinnerten uns jedoch bald, daß wir nicht mehr königlich großbritannisch-hannoverisch waren. Die Stimmung war sehr gegen den neuen Landesherren und hie und da hörte man viel vom preußischen Pfiff und preußischen Kuckuck. Man fürchtete eine größere Steuerlast. Mit Wohlgefallen erzählte man sich, ein Bauer habe vor einem Pfahle, woran der Adler, gestanden, diesen immer angesehen und sich die Taschen zugehalten. Endlich sei die Wache gekommen und habe gefragt, warum er doch immer den Adler so ansehe? ›Ik mach mik dreien wohen ik wil, hei kickt mik immer in mine Taschen.‹
Im Sommer blieb es still, wir waren von Einquartierung verschont. Im Herbste wurde es unruhiger als je. Viele tausend Preußen kamen durch unsere Gegend, lauter Fußvolk. Der Zug eines Regiments dauerte sehr lange, es war groß Gewühl und Getümmel, hinterher viele Packwagen mit Zelten und Stangen. Wir hatten oft bis spät Abends zu sehen. Sehr ergötzlich waren für uns die großen Wagen mit Truthühnern und sonstigem Federvieh; den Thieren bekam die Reise ganz wohl, sie sprangen munter ans Gitter und pickten uns die Brotkrumen aus der Hand. Es sah gar nicht aus, als ob es in Krieg ginge, und alle Welt sagte doch: ›es geht in den Krieg.‹
Manches ereignete sich auch was selbst uns Kindern gar zu spaßhaft vorkam. Eines Morgens hörten wir plötzlich trommeln. Wir laufen vor die Thür. Da kommen mehrere Trommelschläger vom Amthofe herab und schlagen den Generalmarsch. Wir fragen sie was das solle? ›Nun, sagen sie, uns ist befohlen, jetzt zum Abmarsch zu trommeln.‹ Wir bedeuteten ihnen, es sei ja am frühen Morgen Alles schon abmarschiert. Sie hingen die Trommeln auf den Rücken und zogen ihres Weges. Da kommt endlich der alte General hinterdrein geritten; er wundert sich, seine Leute nicht mehr zu sehen. ›Wo ist mein Regiment hinmarschiert?‹ fragt er und wir ertheilen ihm die nöthige Auskunft.
Die Durchmärsche der preußischen Truppen hatten aufgehört. Bald aber wurde die Stille aufs Neue unterbrochen. Hatten wir bisher nur Soldaten gesehen, die siegesgewiß, stattlich mit Wehr und Waffen in geordneten Zügen kamen und gingen, so sollten wir nun auch Soldaten sehen, die einzeln oder truppweise ohne Gepäck und Waffen, traurigen Blicks einherzogen und nach kurzer Rast als Flüchtlinge weiter eilten.
Es war eines Sonntags (den 19. October) gegen 1 Uhr, wir hatten uns eben zu Tische gesetzt, da sprengten drei preußische Cürassiere vor unser Haus. Wir eilten vor die Thür. Wie erschraken wir, als das erste Wort aus ihrem Munde kam: ›es ist Alles verloren!‹ Wir suchten sie auszufragen, aber sie wußten auf alle unsere Fragen nur immer dasselbe zu erwiedern: ›es ist Alles verloren, Alles!‹ Sie erkundigten sich nach dem Wege, den sie einschlagen wollten, näher und machten sich bald auf und davon. Wir sahen uns erstaunt an. Mein Vater schüttelte zweifelnd den Kopf, er hielt es für unmöglich, daß ein Krieg, dessen Anfang wir ja noch kaum wußten, bereits einen so unglücklichen Ausgang für Preußen genommen habe; er konnte an die schreckliche Kunde, die erste vom Kriegsschauplatze, nicht glauben und hielt lieber die drei Reiter für Ausreißer, die ihre Feigheit nur hätten beschönigen wollen.
Leider bestätigte sich das Unglaubliche nur zu früh. Schon die nächsten Tage kam Fußvolk truppweise, alle niedergeschlagen und im erbärmlichsten Aufzuge, sie hatten nichts weiter gerettet als das Leben und den Brotbeutel. Sie gehörten verschiedenen Heeresabtheilungen an, und wußten nicht woher, wohin. Durch ihren traurigen Anblick und die Erzählungen von ihren ausgestandenen Leiden und Strapazen erregten sie allgemein großes Mitleid, sie fanden überall Unterstützung. Die Durchzüge der Flüchtlinge und Versprengten dauerten noch mehrere Tage fort.
Es wurde nun wieder still. Der Krieg berührte uns nicht weiter unmittelbar. Der Winter hatte begonnen und wir Kinder gingen zu unseren alten Spielen über. Nach dem Schlusse der Schulstunden eilten wir auf das Eis, wir glanderten oder liefen Schrittschuh, und wenn es Schnee gab, fuhren wir auf dem Handschlitten eine steile Schneebahn hinab, und bei eintretendem Thauwetter schneebällten wir uns, machten Schneefestungen oder errichteten große Schneemänner auf wegsamen Straßen, zuweilen sogar heimlich dicht vor den Hausthüren. Da die Arbeiten für die Schule bald gemacht waren, so gewährte der lange Abend Zeit genug zum Spielen. Wir machten uns von Kartenblättern Soldaten eigenthümlicher Art: das Blättchen wurde der Länge nach gefaltet und hinten schräg eingeschnitten, der Einschnitt umgeklappt und mit einer Feder versehen, und der Soldat war fertig. Da in unserm Hause viel kartengespielt wurde, so eigneten wir uns die schlecht gewordenen Spiele zu, unser Heer war immer vollzählig.
An zwei Abenden in der Woche kam der Hamburger unparteiische Correspondent. Ich mußte dann die Blätter vorlesen. Die Stammgäste saßen um den großen Tisch herum, rauchten zu ihrem Glas Bier ihr Pfeifchen und hörten aufmerksam zu. Ich las und las in aufgeregter Stimmung, denn die Tagesbegebenheiten hatten auch für mich ein großes Interesse.
Schon in den ersten Tagen des Novembers erfuhren wir Näheres über die unglückliche Schlacht von Jena und auch von ihren Folgen eine auch für uns höchst wichtige: Bertier war wieder in Hannover und erklärte am 12. November, daß er im Namen seines Kaisers das Land in Besitz nehme. Der preußische Adler wurde mit dem französischen vertauscht. Zwei Tage später erlag in Ottensen seinen Schmerzen der todtwunde Herzog Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, fern von seinem Lande, das glücklich durch ihn und mit ihm gewesen war. So folgten sich rasch hinter einander die großen traurigen Tagesereignisse.
Noch Einmal, ehe das Jahr zu Ende ging, wurden wir daran erinnert, daß wir in Kriegszeiten lebten. In der Abenddämmerung hielten zwei Bauerwagen vor unserem Hause still. Mehrere Männer stiegen ab, sie schienen durchnäßt und angegriffen von der Reise. Mein Vater hieß sie freundlich willkommen. Es waren preußische Officiere von der Besatzung Hamelns. Nachdem sie sich umgekleidet und gespeist hatten, wurden sie gesprächig. Sie sprachen sich alle unumwunden und sittlich entrüstet aus über die niederträchtige Capitulation des Commandanten von Schöler. Es war eine männliche würdige Sprache, die uns mit Achtung für die jungen Männer erfüllte und mir unvergeßlich geblieben ist. Der Haß gegen Preußen, der im Kurstaate Hannover ein ziemlich allgemeiner gewesen, war jetzt ziemlich verschwunden, das große Unglück hatte große Theilnahme erweckt. Es wurde wieder viel in unserem Hause politisiert; wir hörten das Alles mit an und ließen unser Spiel ruhen. Wenn man von dem traurigen Ende des Herzogs von Braunschweig sprach, so weinten wir, denn wir hatten nur immer Züge der Liebe und Güte von ihm vernommen. So oft man auf Blücher's Niederlage in Lübeck und die dortigen Gräuel zu sprechen kam, wurden wir über die Franzosen empört. Die preußische Ruhmredigkeit war hart gestraft, aber niemand konnte sich denken, daß ein so mächtiger Staat so schnell in die tiefste Schmach sinken würde. ›Ja, rief dann eine Stimme, es ist mit uns Deutschen vorläufig vorbei!‹ und eine andere meinte dagegen: ›laß nur! die Preußen werden die Franzosen ins Land locken und ihnen den Garaus machen.‹ Leider hatte jene erste Stimme, ich glaube die meines Vaters, Recht: es war vorläufig mit uns vorbei, es folgte ein schmachvoller Friede.
Mit dem Beginne des Jahres 1807 hatte die Aufregung der Gemüther ziemlich nachgelassen. Es wurde zwar noch viel in unserem Hause politisiert, man beschäftigte sich aber mehr mit den großen Kriegsereignissen der letzten Monate als mit denen die noch kommen könnten; niemand dachte mehr an einen Sieg der Preußen und ihrer Verbündeten, der Russen, niemand hegte die Hoffnung, daß wir so bald von der Franzosenherrschaft erlöst werden würden. Der Friede von Tilsit ließ voraussehen, daß auch wir von den Folgen desselben nicht unberührt bleiben würden. Schon im August wurde der südliche Theil des Kurstaates dem neuen Königreich Westfalen einverleibt. Wir blieben vorläufig noch unter französischer Botmäßigkeit.
In der Kinderwelt ward es lebendiger als früher. Wir sannen immer auf neue Kurzweil und Narrenspossen. So pflegten wir uns in den Winterabenden zu verkleiden und dann auf den Kirchhofsgräbern umherzuwandeln. Einer mußte den Geist machen, vor dem wir anderen erschraken und flohen. Dieser Geist hatte sich in einen alten weißen Pudermantel gehüllt und konnte nur langsam fortschreiten. Zuweilen legten wir ihm dicke Steine auf die Schleppe, ohne daß er es merkte, so daß ihm dann selbst bange wurde, als ob ein Geist aus dem Grabe ihn fest hielte.
Zu Ende des Jahres entstand in unserm kleinen Orte ein recht reges Leben. Mehrere junge Leute waren von der Universität zurückgekehrt, alle recht gesellig und lebenslustig; ihnen schlossen sich andere gleichgesinnte, wie mein Bruder, an. Es wurde das alte flotte Burschenleben neu wieder aufgelegt, es wurde gespielt und commersiert. Endlich kam man auf den Gedanken, Schiller's Räuber aufzuführen. Die Rollen wurden ausgeschrieben und passend vertheilt, Proben abgehalten und es erfolgte nach kurzem Zwischenraume eine zweimalige öffentliche Aufführung unter dem freudigsten Beifalle der Zuschauer. Ich war jedesmal zugegen und bin mir noch heute des gewaltigen Eindrucks bewußt, den das Stück auf mich machte. Ich las es später selbst in dem Exemplare, wonach es gegeben wurde; es war die erste Mannheimer Ausgabe von 1781. Ich wußte bald ganze Scenen auswendig. Die jungen Schauspieler, von Haus aus lauter prosaische Naturen, waren durch diese Kunstübungen zu neuen Menschen geworden, sie bewegten sich von jetzt an in freieren geselligen Formen und hatten einen gewissen poetischen Anstrich bekommen. Die Art und Weise ihres Verkehrs in der Gesellschaft blieb nicht ohne Einfluß auf uns Kinder; wir nahmen manche Redensarten und Manieren dieser erwachsenen Jugend an und waren seitdem für alle Freiheitsideen empfänglicher.
Um diese Zeit pflegte ich gern Gedichte zu lesen, auch wol mit lauter Stimme herzusagen. Zuweilen wenn ich ganz allein im Zimmer war, band ich mir ein Tuch um den Leib, setzte mir einen Hut auf, stellte mich auf den Tisch und declamierte feierlich: ›Begraben will ich Cäsar, nicht ihn loben‹ etc. – Ohne mich weiter mit Poesie zu befassen, schrieb ich eines Tages mit rother Dinte, bloß aus Narrenspossen, zum 2. April in ›von Bogatzky, Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes für jeden Tag‹:
Am 2. Aprilis ist geboren
Unser Heinerich August
Und zu hoher Sangeslust
Von den Göttern auserkoren
Auch das neue Jahr 1808 brachte uns keine Gewißheit über unser Schicksal, ob wir noch länger französisch bleiben oder nächstens dem neuen Königreich Westfalen einverleibt werden sollten. Vorläufig schien es, als ob wir für die Zwecke des Kaisers noch nicht genug ausgebeutet wären: Kriegssteuern und Einquartierungen dauerten fort.
Im Februar rückten zwei Schwadronen Cürassiere ein vom 11. Regimente und nahmen auf längere Zeit Standquartier. Trotzdem daß niemand von ihnen deutsch verstand, so gestaltete sich doch bald ein traulicher Verkehr zwischen Soldat und Bürger. Wenn es Streitigkeiten gab, so machte mein Vater mit Hülfe meines Bruders den glücklichen Schlichter. Meinem Bruder fiel der größte Theil der Bürgermeistereigeschäfte zu; er war sehr geschäftsgewandt und der einzige der des Französischen mächtig. Jung und lebenslustig wie die Officiere wurde er bald ihr Freund und durfte bei ihren Zusammenkünften nie fehlen. Ich erinnere mich noch, wie er mit ihnen kegelte, mit ihnen trank und sang, scherzte und lachte.
Die Gemeinen hielten unter einander gute Kameradschaft. Selbst bei ihren Trinkgelagen ging es heiter und friedlich zu. Wer singen konnte, sang, die auderen hörten mit Wohlgefallen zu, dann stimmten auch wol mal alle einen Rundgesang an:
Battons le fer, tandis qu'il est rouge,
Battons le fer, tandis qu'il est chaud!
Haut le marteau! bas le marteau!
Sie hielten das Glas hoch empor, senkten es dann und tranken es schließlich aus.
Ihnen gegenüber erfreuete sich Monsieur le bourguemestre, mein Vater, eines hohen Ansehens, weil er sich vor niemandem fürchtete, und im Bewußtsein, nur das Rechte zu wollen, sich auch vor niemandem zu fürchten brauchte. Schon seine stattliche Gestalt, seine Körperstärke und Gewandtheit, mehr aber noch seine ganze Art und Weise, wie er auftrat, waren achtunggebietend. Kein anderer hätte das wagen dürfen was er wagte. Eines Tages sahen wir zwei Cürassiere mit ihren langen Degen unter dem Arme in einen Garten laufen. Wir blieben von ferne stehen. Sie zogen sich aus bis auf die Unterkleider und wollten eben mit einander duellieren. Da kam mein Vater, der von der Geschichte benachrichtigt war, eilig dazu, suchte sie zu beschwichtigen, und als das nicht gelingen wollte, wand er ihnen die Degen aus den Händen. Sie ließen sich das ruhig gefallen, mein Vater gab ihnen die Waffen zurück, und der Kampf war vorläufig beendet.
So ernst die Weltlage, so traurig die staatlichen Verhältnisse, so drückend fortwährend die Abgaben waren, die deutsche Gemüthlichkeit feierte doch nicht länger und wußte sich endlich wieder geltend zu machen, freilich mit einem starken Anfluge französischer Leichtfertigkeit. Wie man dachte und fühlte, sprach sich in allen Vergnügungen aus: bonne mine à mauvais jeu wurde der leitende Grundsatz. Damit stimmten denn auch die Gesellschaftslieder, welche man zu singen pflegte, wenn man lustig wurde:
Es kann ja nicht immer so bleiben
hier unter dem wechselnden Mond –
Freut euch des Lebens,
weil noch das Lämpchen glüht! –
Wir sind die Könige der Welt! –
Dem Teufel verschreib' ich mich nicht,
das wär' wider G'wissen und Pflicht –
Hört zu, ich will euch Weisheit singen! –
Schön wie Florens Grazien, wie die Rose,
ist mein schlankes Mädchen schön, jung und lose! –
Als ich noch im Flügelkleide
in die Mädchenschule ging –
Es hat die Schöpferin der Liebe
zur Lust die Mädchen aufgestellt –
Selten hörte man Abends im Freien noch bei der Arbeit oder in den Spinnstuben ein wehmüthiges Lied:
Noch einmal, Robert, eh' wir scheiden –
Hier ruhst du, Karl, hier werd' ich ruh'n
mit dir in Einem Grabe! –
Willkommen, o seliger Abend! –
Guter Mond, du gehst so stille! –
Weine nicht, es ist vergebens! –
Unsere Wäscherinnen pflegten gewöhnlich schon früh Morgens anzustimmen:
Laßt euch einmal einen Spaß erzählen! –
In des Waldes tiefsten Gründen! –
Heinrich schlief bei seiner Neuvermählten –
Die meisten dieser Melodien sangen wir den Alten nach, wußten freilich oft vom Texte nur selten mehr als die erste Strophe. Dagegen sangen wir bei unseren Spielen und Märschen:
Ein freies Leben führen wir –
Wol auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs Pferd! –
Frisch auf, zum fröhlichen Jagen! –
Alle diese Lieder stammten aus einer früheren Zeit, waren aber recht zeitgemäß geworden; dagegen waren neue entstanden, die der Gefühlsrichtung der Gegenwart noch mehr entsprachen und deshalb in anständigen Gesellschaften beliebt waren und oft und gern gesungen wurden. So die beiden Lieder:
Die Welt ist nichts als ein Orchester –
Freunde, laßt uns nicht so thöricht sein,
das Leben im Galopp hindurch zu fliegen.
Solchen Liedern konnte keine Censur etwas anhaben, noch weniger aber jenen Liedern, welche ›Gedruckt in diesem Jahr‹ zu den Drehorgeln gesungen wurden:
Unter den Akazien
wandeln gern die Grazien –
Ik bin ein Franzose, Mesdames –
Ich liebe das Incognito:
hat man in dem Kopf kein Stroh,
kann man vieles sehen.
(Jede Strophe schloß mit dem wiederholten: Aber nur incognito!)
Solche Leichtfertigkeit ward damals gedichtet und gesungen und fand ein dankbares Publicum.
Eine schönere Erinnerung ist es für mich, wenn die Schüler ihren Neujahrsumgang hielten. Sie sangen jedem Hauswirth und Hausgenossen ein Lied und bekamen dann in die eine Büchse eine Gabe für den Rector, in die andere eine für sich. Bei uns mußten sie sich einfinden, wenn wir uns eben zu Tische gesetzt hatten, und jedesmal singen meines Vaters beide Lieblingslieder:
Gesund und frohes Muthes
genießen wir des Gutes,
das uns der große Vater schenkt –
Hoffnung, Hoffnung, immer grün!
So war denn das Jahr 1809 herangekommen. Die gesellige Fröhlichkeit verstummte allmählich, die Tagesbegebenheiten beschäftigten wieder alle Gemüther. In unserm Hause wurde wieder viel politisiert, ich mußte die Zeitungen vorlesen und auf der Landkarte den Kriegsschauplatz aufsuchen. Der Krieg in Spanien gewann immer größere Bedeutung; der Name Saragossa erfüllte uns mit Begeisterung; aber mit Wehmuth vernahmen wir, daß auf der Halbinsel Deutsche gegen Deutsche fechten mußten. Der Marsch nach Spanien galt für den sicheren Weg ins offene Grab. Wie viele Westfalen gingen hin, wie wenige kehrten heim. Ein Bauerjunge nahm sich ein Taschentuch voll Erde mit, um noch eine Nacht auf dem Boden leiner Heimat zu schlafen. Manche Mutter starb vor Gram über den Verlust ihres Sohnes, manche Braut vertrauerte ihr Leben. Herzzerreißend war der Gesang, wenn die Soldaten beim Ausmarsch anstimmten:
Ach du Deutschland, ich muß marschieren,
ach du Deutschland, lebe wohl!
In Süddeutschland war der Krieg in vollem Gange. Alle Gemüther waren aufgeregt, jedes hoffte, endlich würde Napoleon erliegen. In Hessen brach ein Aufstand aus unter Dörnberg, und etwas später zog Schill mit seiner Schaar heran und beunruhigte Sachsen und Westfalen. Alles scheiterte. Anfangs Mai fanden Dörnbergsche Flüchtlinge in unserm Hause einen Zufluchtsort. Später brachte man durch unsere Nachbarschaft Schillsche Officiere, die in Braunschweig erschossen wurden. Wir Kinder waren begeistert für Schill, wir kannten ihn schon aus dem letzten unglücklichen Kriege, wir waren betrübt und zugleich empört, daß ein so tapferer Soldat und entschiedener Franzosenfeind ein so schreckliches Ende nehmen mußte. Noch lange nachher lebte er in ehrendem Andenken fort, in mancher Bauernstube war sein Bild an der Thür zu sehen.
Aller Augen waren nach Süddeutschland gerichtet immer noch hegten die Vaterlandsfreunde einige Hoffnung. Mit Begier wurde der Hamburger Correspondent gelesen. Da die Botenpost nur zweimal nach Gifhorn ging, so wurde oft Geld zusammengeschossen, um ihn durch einen eigenen Boten holen zu lassen. Wir Kinder hörten viel vom Kriegsschauplatze und wollten durchaus, daß der deutsche Kaiser den Sieg davon trage über den neuen Franzosenkaiser. Wir hatten damals neue graue Jacken bekommen; bei unserm Soldatenspiel wendeten wir sie um und schrieben mit Röthel ein großes F. II. (Franz der Zweite) darauf, obschon der deutsche Kaiser schon längst nur noch ein österreichischer war und sich F. I. schrieb. Welch ein Jubel, als die erste Siegesnachricht eintraf! Erzherzog Karl ward der Held des Tages – Aspern und Eßlingen, Jubel und Freudenthränen überall! Aber unsere Freude wurde bald getrübt: das Kriegesglück wendete sich, Napoleon ging auch aus diesem Kampfe als Sieger hervor.
Noch Einmal blinkte ein Schimmer von Hoffnung an unserem Himmel. Der geschworene Feind Napoleons, der seines Landes beraubte Herzog Friedrich Wilhelm, damals meist Braunschweig-Öls genannt, machte einen kühnen Streifzug durch halb Deutschland und so durch sein väterliches Erbe. Er traf den 31. Juli in Braunschweig ein. Wir hatten mit Angst und Beben die Kunde vernommen. Den 1. August kam es bei Ölper zum Treffen mit seinen Gegnern. Des Abends gingen wir ins Freie, hielten das Ohr an den Erdboden gelehnt und hörten deutlich jeden Kanonenschuß und das Rottenfeuer. Des anderen Tages kam die Kunde, daß sich der Herzog durch eine bedeutende Uebermacht von Feinden siegreich durchgeschlagen habe. Lange Zeit noch sprach man von dem abenteuerlichen Zuge des Herzogs und seinen schwarzen Husaren mit dem Todtenkopfe. In vieler Händen war sein Bildniß. Aus dem nahen Braunschweig erfuhren wir Alles genau was sich dort während der Anwesenheit des Herzogs begeben hatte, was und mit wem der unglückliche Fürstensohn gesprochen, nichts aber wurde öfter wiederholt, als daß dort wirklich Brüder gegen Brüder gefochten. Der Herzog hatte sich längst schon eingeschifft, lebte aber in unserem Andenken noch fort. Bei unseren Soldatenspielen trugen wir Papiermützen mit gemalten Todtenköpfen.
Der Friede war abgeschlossen, Napoleon abermals Sieger, nur in Tirol dauerte der Kampf noch fort. Wir hörten viel vom Sandwirth Hofer, sahen ihn auch auf den Bilderbogen, aber diese letzte muthige Auflehnung gegen die Franzosenherrschaft war endlich auch gebrochen. Es schien als ob ganz Deutschland französisch werden sollte, als wir in das neue Jahr 1810 eintraten. Schon im Januar ward Alt-Hannover mit Westfalen vereinigt und im Herbste auch das Schicksal Fallerslebens entschieden: es bildete von nun an einen eigenen Canton des Okerdepartements. Mein Vater wurde am 1. October Canton-Maire, mein Bruder Mairie-Secretär (11. November). Beide Stellungen waren nur bedeutend durch die Ehre und die Gelegenheit, amtlich viel Schlimmes abzuwenden und viel Gutes zu veranlassen und zu fördern.
Plötzlich war nun Alles anders geworden. Das öffentliche Politisieren hörte auf. Von Braunschweig wußten wir, wie gefährlich es war und werden konnte. Mancher büßte für eine unbefangene Äußerung in den Gefängnissen zu Cassel. Die geheime Polizei nämlich, diese saubere Napoleonische Einrichtung, war auch in Westfalen eingerichtet und zählte mehr Eingeborene als Fremde unter ihren Helfern und Helfershelfern – ewige Schmach für den deutschen Namen! Der westfälische Moniteur, die einzige westfälische Zeitung, halb französisch halb deutsch, ging von der Regierung aus; alle Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter und Anzeigen standen unter der strengsten Censur. Fremde Zeitungen waren zu theuer und durften sich ebenfalls nicht frei äußern. Der Hamburger Correspondent hatte für uns aufgehört. Hamburg war französisch geworden, der Correspondent mußte eine bedeutende Stempelsteuer bezahlen, das war den Fallerslebern zu theuer und niemand hielt ihn mehr.
Geheime Polizei und Censur hatte bis jetzt keiner bei uns eigentlich gekannt, jetzt lernten wir sie in ihrer ganzen Bedeutung kennen: beide waren die besten Mittel zur gänzlichen Unterdrückung der Wahrheit und jeder vaterländischen und freisinnigen Regung. Die geheime Polizei verbreitete Furcht und Schrecken in allen Kreisen der Gesellschaft und brachte jene trübe Stimmung hervor, die sich auch im Jahre 1819 bei den Demagogenuntersuchungen ebenfalls aller Gemüther bemächtigte. Doch blieb es nicht bei dem geistigen Drucke und der geistigen Bevormundung. Die Continentalsperre hemmte allen Handel und Verkehr und vertheuerte eine Menge Lebensbedürfnisse, an die man sich in unseren Gegenden seit mehr als hundert Jahren gewöhnt hatte. Alles das traf jedoch mehr die Gebildeten, Wohlhabenden und Vornehmen. Zwei Dinge aber erstreckten sich über das ganze Volk: die unbarmherzige Conscription und die fast unerschwinglichen Abgaben. Wer die althannoversche Soldatenaushebung kannte, mußte das jetzige Conscriptionssystem grausam finden, und es war es auch, nur wenige Fälle konnten davon befreien. Mein Vater half auch hier wo er nur helfen konnte; er hat mancher Familie ihre Stütze, mancher kranken Mutter ihren einzigen Trost auf Erden gerettet. Aber oft reichte auch seine Fürsprache nicht aus und nebenbei mußte er noch die ärgsten Vorwürfe des Unterpräfecten sich gefallen lassen. Ebenso drückend waren die Abgaben. Gegen ihre Vertheilung wäre weniger einzuwenden gewesen, aber sie waren zu hoch und zu mannigfaltig und wurden mit unerbittlicher Strenge eingetrieben.
Das waren die Hauptschattenseiten der westfälischen Regierung, und darum glaubte man, es müsse als Wohlthat betrachtet werden, wenn man dem Volke, als es wieder hannoverisch geworden, alles Alte, was es einst hatte, so schnell als möglich wiedergäbe. Und das geschah. So wurde denn von der neuen Junker- und Zopfregierung vieles Gute beseitigt, was alle vernünftigen Vaterlandsfreunde für heilsam und nothwendig hielten und halten.
Das junge Königreich Westfalen hatte Gleichheit vor dem Gesetz, mündliches und öffentliches Gerichtsverfahren, Schwurgerichte, allgemeine Conscriptions- und Steuerpflichtigkeit, freie Ausübung des Gottesdienstes der verschiedenen Religionsgesellschaften, gleiche Berechtigung zu öffentlichen Aemtern, Trennung der Justiz und Verwaltung, und hatte – keine Hörigkeit, keine Frohnden und Zehnten, keine Privilegien und keinen Adel. Bürger und Bauern hatten das Schlechte schnell kennen gelernt, aber das Gute noch viel schneller. Sie wußten, daß sie sich überall einer anständigen Begegnung von Seiten der Behörden zu versehen hatten, daß ihre Klagen und Beschwerden gehört werden mußten, daß ihre Prozesse schnell und billig entschieden wurden, daß sie mit einem weiland bevorrechteten Stande in gleichen Rechten und Verpflichtungen standen. So lernten sie allmählich ihre Würde als Menschen fühlen und ihre Stellung als Staatsbürger begreifen. Die hannoversche Junker- und Beamtenherrschaft war verschwunden mitsamt ihren langstieligen, groben, halblateinischen und eben deshalb unverständlichen Erlassen, ihren Bütteln und Hundelöchern, ihren Schandpfählen, Folterkammern, Galgen und Rad. In den amtlichen Schreiben gab es keine Abstufungen vom Edelgeborenen Schneider und Schuster bis zum Hochgeborenen Grafen. Alles wurde mit ›mein Herr‹ abgemacht.
Seit dem Beginne des Jahres 1811 schien die Umgestaltung der Dinge bei uns immer festeren Fuß zu fassen. Trotzdem war kein rechter Glaube daran im Volke. Als der große prachtvolle Comet im Frühjahr sich blicken ließ, da war mancher erfüllt von Angst und Schrecken und prophezeihte einen blutigen gräuelvollen Krieg, dem der Umsturz alles Bestehenden folgte. Wir Kinder freuten uns jeden Abend an seinem herrlichen Glanzlicht und sahen in ihm mehr den Verkünder eines warmen Sommers, der uns lange heitere Tage für unsere Spiele brächte.
Im Sommer fühlte mein Vater eine unaussprechliche Sehnsucht nach seinem jüngsten Bruder, seit 1807 Pfarrer zu Mühlhausen im Waldeckschen. Die beiden Brüder hatten sich seit 15 Jahren nicht gesehen. Mein Vater beschloß eine Reise dahin, woran meine Mutter, meine älteste Schwester und ich theilnahmen. Ich freute mich gar sehr darauf und zeichnete mir eine Landkarte mit allen den Orten, die wir berühren mußten. Wir reisten mit eigenem Wagen und Pferden. In Göttingen erkrankte unser eine Pferd und starb. Wir wurden dadurch einige Tage aufgehalten und sahen den botanischen Garten, die Bibliothek, das Museum u. dergl. Die Bibliothek war eben damals durch den historischen Saal, den ganzen oberen Raum einer alten Kirche erweitert. Solche Menge Bücher hatte ich noch nie gesehen. In einem Saale hing das lebensgroße Bild des Königs von Westfalen. Noch anziehender war für mich eine Sitzung des Tribunalgerichts. Hier sah ich zuerst das öffentliche und mündliche Verfahren.
In Cassel fanden wir viel Leben und alles was eine Stadt zur Residenz macht: Lakaien, Beamte und Soldaten. Den letzteren schenkte ich besondere Aufmerksamkeit; sie waren nach meiner Ansicht die schönsten die man bis dahin gesehen hatte: geschmackvoll und zweckmäßig gekleidet, vortrefflich eingeübt, und leicht, frisch und munter in ihren Bewegungen. Ich stahl mich weg von Vater und Mutter und trieb mich stundenlang auf den öffentlichen Plätzen umher, wo es immer etwas zu sehen und zu hören gab. So lustig die Musik klang, so schrecklich tönte das Kettengeklirre der Gefangenen, welche die Straßen reinigen mußten; es waren viele politische Verbrecher darunter, die erst zwei Jahre später ihre Erlösung fanden. Nach einigen Tagen verließen wir Cassel.
Eines Morgens in aller Frühe trafen wir in Mühlhausen ein. Mein Vater hatte sich seinen Amtshut tief ins Gesicht gedrückt. Der Oheim kam an den Wagen, sehr verlegen, er glaubte, ein französischer Commissär wolle Conscribierte holen. ›Kennst Du mich nicht, August?‹ rief die Mutter. Es war eine rührende Ueberraschung. Wir blieben mehrere Tage bei dem guten Oheim, der nun seinerseits Alles aufbot, uns für den weiten Weg zu belohnen. Eines Tages besuchten wir das Arolser Schloß. Als wir schon die innere Treppe hinaufgegangen waren, kam unten der Fürst vorbei. Mein Oheim eilte die letzten Stufen wieder hinab und stellte die Mutter vor. Vater und ich blieben oben. Ich war gar nicht weiter bewegt von dieser hohen Bewillkommnung. Ich fragte meinen Oheim: ›Wie groß ist denn das waldecksche Land?‹ ›Dreiundzwanzig Quadratmeilen‹, war die Antwort. ›Nun, meinte ich, da lohnt es sich ja gar nicht einmal ein Fürst zu sein.‹ Diese unüberlegte Äußerung wurde mir nie verziehen.
Auf dem Rückwege hatten wir in Cassel einen unangenehmen Auftritt. Meiner Mutter wareu zu Haus viele Briefe an Soldaten von ihren armen Eltern und Verwandten eingehändigt worden. Jetzt wußte sie nicht, was damit machen. Der Vater saß in der Gaststube am Tische neben einem unbekannten Manne, der sich mit ihm in ein Gespräch eingelassen. Die Mutter überreichte dem Vater die Briefe. ›Ach, sagte dieser, was geht's mich an!‹ und warf das ganze Paket auf den Tisch. Sofort nahm der Fremde sie in Beschlag ›Halt! mein Herr, was soll das?‹ entgegnete mein Vater. Jener aber bemerkte, daß er ein Recht darauf habe, holte ein Papier aus der Tasche und rechtfertigte sich: der Mann gehörte zur geheimen Polizei. Beide gingen zum Minister des Innern, und ich glaube, die Folge davon war, daß auch späterhin die Mitnahme von dergleichen Briefen nicht mehr verpönt war. Die Geschichte hatte einen so bösen Eindruck auf mich gemacht, daß ich von dieser Zeit an einen unauslöschlichen Haß gegen jede geheime Polizei behalten habe. Mein Vater war auch in seiner Stellung verdammt, eine gewisse geheime Polizei auszuüben, aber daß er dadurch jemanden in Unannehmlichkeiten oder gar ins Unglück hätte bringen können, gehörte nach meiner Ansicht zu den Unmöglichkeiten.
Nach meiner Rückkehr besuchte ich wieder die Bürgerschule, welcher seit 1809 der Rector F. zum Berge, mein nachheriger Schwager und später Schwiegervater, vorstand. Es wurde wenig gelernt, weil nur wenig gelehrt werden konnte: Religion nach dem hannoverschen Katechismus, biblische und Reformationsgeschichte, etwas Erdkunde – an der Wand hingen auf Pappe geklebt die beiden Halbkugeln der Erde –, Auswendiglernen von Gesangbuchversen, Bibelstellen und Gedichten zum Declamieren, Rechnen und Schreiben. Viele Eltern meinten, das genüge auch, da ja doch jeder Soldat werden müsse und zu einem Staatsamte keine gelehrte Bildung, höchstens nur noch Französisch erforderlich sei. Mein Vater dachte nicht so, er wünschte daß ich viel lernte und ließ mir durch den Rector Privatstunden geben. Das Französische, welches ich schon früher begonnen, setzte ich fort und das Lateinische fing ich mit großem Eifer an. In letzterem konnte ich es aber nicht weit mehr bringen, ich hatte bis zu meinem Abgange nur 40 Stunden darin gehabt.
Ich war in diesem halben Jahre recht fleißig: ich lernte den ganzen hannoverschen Katechismus mit allen seinen Bibelstellen und Gesangbuchversen auswendig, las viel in der Bibel, schrieb viel Gedichte ab, um sie öffentlich herzusagen. Außer den Schulstunden besuchte ich regelmäßig den Confirmandenunterricht. Am grünen Donnerstage (26. März) wurde ich confirmiert. Es war mir zu Muthe als ob ich ein ganzes Leben abgeschlossen hätte und ein neues beginnen müßte. Am Nachmittage spazierten wir Confirmanden zusammen ins Freie und nahmen dann Abschied von einander. Die meisten sahen sich im Leben nie wieder.
Am 7. April geleitete mich mein Bruder nach Helmstedt. Herr Hofrath Wiedeburg empfing uns sehr freundlich, wir speisten bei ihm zu Mittag und nachdem Wohnung und Kost für mich ausgemacht war, reiste mein Bruder wieder heim. Die erste Zeit war für mich eine sehr traurige: gleich nach der Abreise meines Bruders bekam ich ein heftiges Heimweh. Daneben wirkte sehr niederschlagend, daß ich, der größte von allen und auch einer der ältesten, in der untersten Classe als der dritte von unten zu sitzen kam.
Der Hofrath war ein sehr guter und gelehrter Mann, ein braver Hausvater, aber ein schwacher Director, der bei dem besten Willen weder in Bezug auf Lehrer noch auf Schüler das durchzusetzen vermochte was eigentlich zum Gedeihen der Anstalt nothwendig war. Die Stunden fielen oft aus oder wurden mit anderen Lehrgegenständen ausgefüllt, auch war nicht immer die rechte Gründlichkeit im Unterrichtertheilen noch die gehörige Aufsicht über die Schüler vorhanden. Wer übrigens lernen wollte, hatte Gelegenheit genug und fand auch bei einigen Lehrern Ermunterung, guten Rath und Nachhülfe.
Wir Kostgänger konnten uns über Zwang durchaus nicht beklagen. Der Hofrath hatte keine Zeit, sich viel um uns zu bekümmern, und hätte er auch eine stete strenge Aufsicht führen wollen, er würde nur selten erfolgreich gewirkt haben. Sein Äußeres war durchaus nicht dazu angethan, sich Ansehn zu verschaffen und Liebe und Gehorsam zu gewinnen; schon die Vernachlässigung in seinem Anzuge konnte einen abschrecken, sein unbeholfenes Wesen erregte mitunter bei uns ein verstohlenes Lachen. Er sah aus wie ein Mann, der mehr in der Stube unter Büchern als im lebendigen Verkehre mit allerlei Menschen gelebt hatte, ohne Lebensfrische, ohne Fähigkeit, die Wünsche und Bedürfnisse der Jugend zu erkennen und zum Guten zu leiten.
Das Essen ließ viel zu wünschen übrig; wir konnten wol darüber klagen, während sich über unser Zuspätkommen und unsern Appetit nie klagen ließ. Die in allen Pensionaten vorkommenden Geschichten fehlten auch bei uns nicht: hatte man zu viel Brot, so bat man sich noch etwas Butter aus; behielt man dann von dieser Butter etwas übrig, so bat man wieder um etwas Brot. Wir gehörten noch ehe die Mäßigkeitsvereine aufkamen schon zu denselben, den Magen haben wir uns so viel ich mich erinnere nie verdorben. Nach und nach hatte ich mich an die Menschen, an die Schule und ihre Arbeiten, an Essen und Trinken und Alles gewöhnt.
Von den Lehrern lernte ich zunächst nur den Dr.