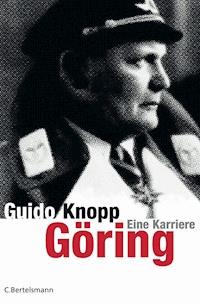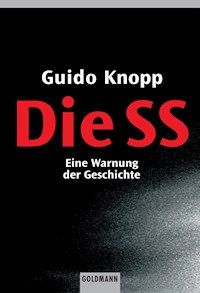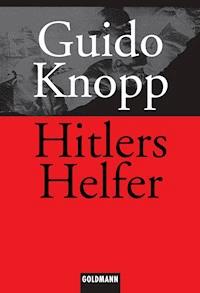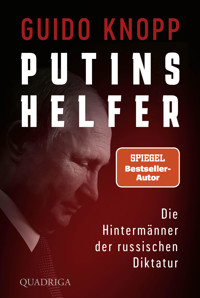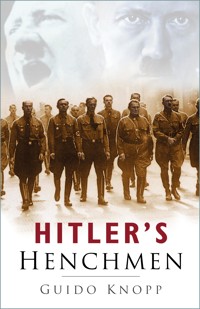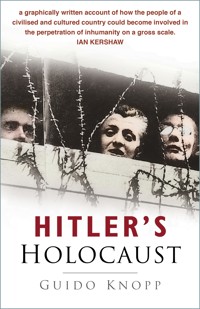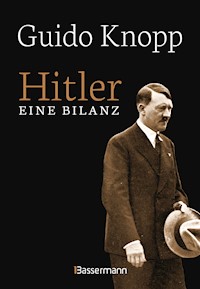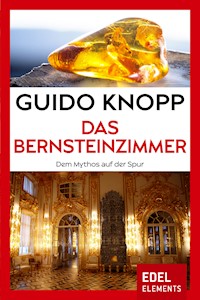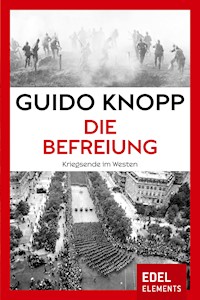5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mister History blickt zurück: Guido Knopp verknüpft autobiografische Stationen und persönliche Erlebnisse mit zentralen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen sechs Jahrzehnte. Er erinnert sich an Begegnungen mit bedeutenden historischen Persönlichkeiten genauso wie mit unbekannten Zeitzeugen. Immer vor dem Hintergrund seines Lebensthemas, der deutschen Geschichte. Ihr verhalf er mit seinen Geschichtssendungen im ZDF zu nie dagewesenen Einschaltquoten, die zugehörigen Begleitbücher wurden zu großen Erfolgen. Er prägte das neue Geschichtsfernsehen und wurde damit für Millionen Zuschauer zum wichtigsten Geschichtslehrer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Mister History blickt zurück: Guido Knopp verknüpft autobiografische Stationen und persönliche Erlebnisse mit zentralen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen sechs Jahrzehnte. Er erinnert sich an Begegnungen mit bedeutenden historischen Persönlichkeiten genauso wie mit unbekannten Zeitzeugen. Immer vor dem Hintergrund seines Lebensthemas, der deutschen Geschichte. Ihr verhalf er mit seinen historischen Sendungen zu nie dagewesenen Einschaltquoten, die zugehörigen Begleitbücher wurden zu großen Erfolgen. Er prägte das neue Geschichtsfernsehen und wurde damit für Millionen Zuschauer zum wichtigsten Geschichtslehrer.
Autor
Guido Knopp war Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und anschließend Auslandschef der Welt am Sonntag. Ab 1984 leitete er die ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, mit der er viel beachtete Fernsehserien wie »Hitlers Helfer« und die Serie »History« produzierte. Knopp hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Zuletzt erschienen von ihm bei C. Bertelsmann die Bücher zur ZDF-Serie »Die Deutschen« sowie »Geheimnisse des ›Dritten Reichs‹«.
GUIDO KNOPP
MeineGeschichte
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage 2017
© C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Bildredaktion: Bele Engels, Anka Hartenstein, Susanne Maier, Tanja Zielezniak
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20304-7V001www.cbertelsmann.de
Inhalt
Meine Geschichte, meine Geschichten
»Hüte dich vor den Katholiken!«
Kindheit und Jugend im zerstörten Wirtschaftswunderland
»Du musst dich bei uns einreihen!«
1968 und die Folgen
»Haben Sie denn keine Socken?«
Meine Lehr- und Wanderjahre
»Für Golo Mann und Lieschen Müller«
Meine ersten Schritte beim Fernsehen
»Bundes oder unser?«
Die Russen und ich
»In Stalins Armen«
Moskauer Begegnungen
»Keine Angst vor Hitler«
Der Diktator und die Folgen
»Ganz normale Deutsche?«
»Hitlers Helfer« in der Primetime
»Remmidemmi oder atemberaubend?«
Die Schlacht um »Hitlers Helfer II«
»Alle Deutschen waren schuldig«
Hitlers Helfer und die Goldhagen-Debatte
»Aufklärung braucht Reichweite!«
Das Märchen vom »Knoppismus«
»Das ist ein knochenharter Job!«
Meine deutschen Bundeskanzler
»Hier keine besonderen Vorkommnisse!«
Meine deutsche Revolution
»Deutschland, eilig Vaterland!«
Meine deutsche Einheit
»Dann werden wir halt weniger!«
Ein Protestant im Vatikan
»Das Vermächtnis von Millionen Opfern …«
Der Holokaust und seine Zeugen
»O Gott, schon wieder Schlesienabend!«
Wir Nachkriegskinder und die große Flucht
»War Stauffenberg ein Held?«
Wir atmen freier, weil es ihn gegeben hat
»Who is the kissing sailor?«
Bilder, die Geschichte machten
»Der Schwager möge Geduld haben!«
Meine Aschaffenburger Gespräche
»Da hat der liebe Gott mit eingegriffen!«
Das »Gedächtnis der Nation«
»Morning, sausage!«
Der Charme des blauen Blutes
»Wer bist du, woher kommst du?«
»Die Deutschen« und ihr Weg
»Hier geht’s nach Süden«
Otto und die anderen
Dank
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Bildteil
Meine Geschichte, meine Geschichten
Dies ist ein Buch für meine Zuschauer, die mir über all die Jahre treu geblieben sind, kein Fachbuch für Historiker und Feuilletonisten.
War ich ein Glückskind? Der allzeit mutige Historiker Arnulf Baring hat mich in einer Rede einmal so genannt. Tatsächlich habe ich verdammt viel Glück gehabt.
Ich wurde geboren, als die bislang beste Phase der deutschen Geschichte begann.
Ich konnte studieren, was ich wollte. Ich konnte einen Beruf ergreifen, der mir gefiel. Und ich hatte Erfolg.
Ich hatte viele Freunde und manche Feinde. Ersteren danke ich für ihre Hilfe, Letzteren für ihren Hass. Beides hat mich wachsen lassen.
Ich habe Schönes und Spannendes erleben dürfen. Und natürlich auch Absurdes und Skurriles.
Ich habe im alten Berner Wankdorf-Stadion an der Stelle, wo Helmut Rahn 1954 ins ungarische Tor traf, eine Schaufel Rasen mitgenommen und ihn jahrelang begießen lassen – bis wir wieder Weltmeister wurden.
Ich habe mir nur ein paar Stunden nach Günter Schabowskis legendärem Satz einen Brocken Mauer selbst herausgemeißelt – und ich halte ihn in Ehren.
Ich stand beim Fall der Mauer neben unserem Bundespräsidenten Weizsäcker, als ein Offizier der DDR-Grenztruppen ihn erblickte, auf ihn zumarschierte, salutierte und erklärte: »Melde gehorsamst, Herr Bundespräsident, hier keine besonderen Vorkommnisse!«
Ich habe in Buenos Aires gesehen, wie Goebbels’ vormaliger Referent Wilfred von Oven das ihm handschriftlich gewidmete Hitler-Foto küsste – das tue er allmorgendlich.
Ich habe auf dem Times Square in New York den berühmten Siegerkuss von 1945 mit dem originalen Seemann und der Zahnarzthelferin von damals nachgestellt.
Ich habe sieben Ehen meiner Mitarbeiter stiften dürfen – und die meisten haben gehalten.
Ich wurde Thema von vier Rocksongs: Zwei sind kritisch, zwei sind schmeichelhaft. Meine Kinder finden alle krass.
Ich habe im Pentagon bei Washington im Büro eines Staatssekretärs eine volle Stunde auf den Herrn gewartet – und hätte in der Zwischenzeit seinen ganzen Schreibtisch filzen können.
Ich habe im siebten Stock von Stuttgart-Stammheim in der Zelle von Andreas Baader gesessen und gespürt, wie liberal die Bundesrepublik mit ihren Gegnern umgegangen ist.
Ich bin in russischen Archiven ein- und ausgegangen und hatte eine Zeit lang exklusiven Zutritt. Ich fand vieles – aber nicht den einen ominösen Film, den ich gesucht hatte.
Ich habe zwanzig Staubsauger der Marke Kärcher persönlich in den Kreml transferiert, um eine Diskussionssendung im legendären Katharinensaal genehmigt zu bekommen.
Ich habe 1972 bei den Olympischen Spielen in München die sechzehnjährige Ulrike Meyfarth zur Goldmedaille springen sehen – und bin vor Freude fast genauso hoch gesprungen.
Ich habe an den Traditionsstätten deutscher Demokratie Reden über Deutschland halten dürfen – auf der Wartburg, auf dem Hambacher Schloss, in der Paulskirche, im Nationaltheater Weimar, im alten und im neuen Bonner Bundestag und auch im Reichstag. Mir fehlt nur noch das Alte Schloss auf Herrenchiemsee, wo das Grundgesetz beschlossen wurde.
Ich habe mit Helmut Kohl Wein getrunken, mit Michail Gorbatschow Wodka, mit Fidel Castro Rum, mit Viktor Orbán Pálinka und mit Simon Wiesenthal Bier. Am schönsten war es eigentlich mit Helmut Kohl.
Ich habe mit den großen Frauen unseres Landes tafeln dürfen: Marion Gräfin Dönhoff, Annemarie Renger, Elisabeth Noelle-Neumann, Hildegard Hamm-Brücher, Gertrud Höhler, Gesine Schwan. Sie alle brauchten keine Frauenquote.
Ich habe in den Trattorien um den Vatikan mit hochrangigen Monsignori achtgängige Mittagessen absolviert. Die Freuden der Tafel sind ja die einzigen Sünden, die ein Diener Gottes offiziell begehen darf.
Ich habe mich in einer eisig kalten Winternacht in einer schneebedeckten Datscha in den Wäldern rings um Moskau zwischen Störplatten mit Kaviar und Wodka in die »russische Seele« verliebt – wohl wissend, dass dies nur die eine Seite eines manchmal rätselhaften Landes war.
Ich habe Hunderte von Zeitzeugen befragen dürfen: Überlebende des Holokaust, Terroristen der RAF, Augenzeugen des Olympia-Attentats von München und der Geiselbefreiung in Mogadischu, Flüchtlinge aus Ostpreußen und Schlesien, russische und deutsche Veteranen des »verdammten Krieges« – und handelnde Politiker, die sich zu Wendepunkten der Geschichte geäußert haben.
Was habe ich gelernt aus alledem? Geschichte wird von Menschen gemacht. Und Menschen machen manchmal Fehler, die den Lauf der Geschichte verändern.
Ich habe gelernt, dass der Weg der Deutschen in den Untergang im 20. Jahrhundert nicht zwangsläufig war. Vieles hat so kommen können, aber nicht so kommen müssen. Das galt schon für 1914, als noch in den letzten Julitagen der Erhalt des Friedens möglich war. Das galt auch für 1933 und die Machterschleichung Hitlers. Und es galt für 1944, als das Attentat auf den Diktator nur gescheitert ist, weil Stauffenberg die zweite ungeschärfte Bombe nicht mit in den Konferenzraum nahm.
Ich habe außerdem gelernt, dass auch das schönste und gelungenste Ereignis unseres 20. Jahrhunderts, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, nicht zwangsläufig war. Es hätte anders kommen können – etwa, wenn ein Putsch in Russland schon im Sommer 1990 stattgefunden hätte.
Ich habe gelernt, dass der Mensch des Menschen Wolf ist – wenn ein krimineller Staat dazu ermutigt. Einen solchen Staat zu verhindern, ist das wichtigste von allen Zielen.
Ich habe aber auch gelernt, dass die Handelnden in der Geschichte manchmal pures Glück benötigen, um Gutes zu schaffen.
Zu vielen meiner Themen in den letzten dreißig Jahren habe ich schon Bücher veröffentlicht. Und natürlich habe ich für dieses Buch aus ihnen dann und wann zitiert, wenn es sich anbot.
Das Wichtigste aber: Ich hatte die Chance, eine zauberhafte Frau zu heiraten, die mich noch immer glücklich macht. Dieses Buch ist ihr gewidmet.
Guido Knopp
»Hüte dich vor den Katholiken!«
Kindheit und Jugend im zerstörten Wirtschaftswunderland
Ich bin ein Nachkriegskind, Jahrgang 1948. Damit ein Jahr älter als die Bundesrepublik und genauso alt wie die D-Mark. Mit dem einen Unterschied: Mich gibt es noch.
Vom Sommer meiner Zeugung 1947 habe ich mir später einiges erzählen lassen: dass die Wirtschaft im zerstörten Land am Boden lag, die Währung auch. Es gab zwar noch die Reichsmark, aber keinen Gegenwert an Waren. Dafür Zwangsbewirtschaftung und Rationierung, Lebensmittelkarten, Schwarzmarkt: Schuhe gegen Schokolade, Pelze gegen Butter. Was regierte, war der Mangel: 1500 Kalorien standen dem »Normalverbraucher« zu. Rund 59 Kilo wog der Durchschnittsdeutsche, männlich, über fünfundzwanzig, damals. Herzkrankheiten, Diabetes? Fehlanzeige. Aber satt zu werden, war ein schwieriges Geschäft.
So ist es zu erklären, dass der Neugeborene von seinen Eltern vorsorglich gemästet wurde. Auf den ersten Bildern meines Lebens blickt mich da ein kleiner Buddha an, mit dicken Backen fröhlich lächelnd.
Die Ressourcen für die Vollverpflegung hatten meine Großeltern aus Oberhessen. Sie, die Eltern meiner Mutter, hatten in Neustadt bei Marburg einen riesengroßen Garten mit Gemüse aller Art, mit Hühnern, Schweinen, Ziegen – beste Möglichkeiten einer autonomen Selbstversorgung. Vor dem Haus wuchs ein märchenhafter Lindenbaum, auf dem man sich verstecken konnte. Es war das viel gerühmte Paradies der Kindheit, aus dem man nicht vertrieben werden kann. In den Wäldern rund um Neustadt stundenlang umherzustreifen, war ein prägendes Glück. War es da ein Wunder, dass ich Förster werden wollte?
Es ist seltsam, welche Erinnerungen an die Kindheit haften bleiben und welche verfliegen. Manchmal denke ich an den Käsekuchen, den wir »Mattekuchen« nannten, meiner Großmutter zurück. Sie buk ihn samstags, wenn wir sie besuchten, ließ ihn auf dem Schrank im Schlafzimmer, dem kühlsten Raum, erkalten. Wenn ich ankam, stieg ich rasch auf einen Stuhl, ein großes Messer in der Hand, und säbelte an dieser Köstlichkeit.
Und natürlich erinnere ich mich an das »Wunder von Bern«, 1954: »Schäfer nach innen geflankt, Rahn müsste schießen, Rahn schießt: T-O-R!« Heute heißt es oft, dieses Fußballspiel sei der eigentliche innere Gründungsakt der alten Bundesrepublik gewesen.
Wie 99 Prozent der Deutschen hatten auch meine Eltern damals keinen Fernseher. Die Nachbarn hatten einen. Und da drängte sich dann die gesamte Hausgemeinschaft. Doch in unserer Wohnung lief das Radio mit dem wunderbaren Herbert Zimmermann: »Sechs Minuten im Wankdorf-Stadion noch zu spielen. Keiner wankt …« Und weil der Fernsehkommentar um Längen langweiliger war, lief der kleine Guido zwischen dem Bild der Nachbarn und dem spannenderen Radioton immer wieder hin und her. Das war ein Zeichen: Jahrzehnte später haben wir im ZDF in unserem Film »Das Wunder von Bern – Die wahre Geschichte« diese unmögliche Diskrepanz aufzuheben versucht und die Bilder mit dem Radioton unterlegt. Es ist gelungen. Und so zähle ich zur aussterbenden Schicht von Zeitgenossen, die die Aufstellung der deutschen Mannschaft immer noch im Schlaf aufsagen können: Turek, Posipal, Kohlmeyer, Eckel, Liebrich, Mai, Rahn, Fritz Walter, Ottmar Walter, Schäfer, Morlock. Welche andere deutsche Nationalmannschaft hat sich so tief in das Gedächtnis der Nation eingebrannt?
1954 war das Jahr des Aufschwungs, nicht nur auf dem grünen Rasen. Ich kam in die Schule, und das Stimmungsbarometer in der alten Bundesrepublik stand zum ersten Mal auf Zuversicht. Die weitaus meisten Westdeutschen sahen ihre Zukunft optimistisch, und der Wohlstand wuchs nun unaufhaltsam. Der Export schwoll mächtig an, Exportgut Nr. 1 war das deutsche Auto, wieder einmal, diesmal allerdings unter friedlichen Vorzeichen: Kraftwagen aus Wolfsburg, Untertürkheim oder München waren die Zugpferde der neuen Wirtschaftsblüte. Und bezeichnenderweise fiel in diesem Jahr erstmals auch das Wort vom »Wirtschaftswunder«, das in Wahrheit keines war. Denn die Wirtschaft Westdeutschlands, sie konnte produzieren, was sie wollte. Alles wurde gebraucht.
Die Familie meines Vaters stammt aus Oberschlesien. Freitags sind wir immer zu den Großeltern gegangen. Da war Schlesienabend. Es gab schlesische Gerichte und Erinnerungen an die alte Heimat. Für ein Kind mag das in Ordnung sein. Aber wenn man in die Pubertät kommt und der Freitagabend droht, dann sagt man innerlich: »O Gott, schon wieder Schlesienabend!« Es hat jahrzehntelang gedauert, bis ich die Großeltern verstanden habe. Sie brauchten diese familiären Treffen, um ihre oft traumatischen Erinnerungen zu verarbeiten. Für meine Großmutter war das Schlimmste gar nicht das, was ihr während der Flucht widerfahren ist. Es war die Tatsache, dass sie einige Wochen nach dem Krieg noch einmal aus dem Fluchtziel Görlitz in ihr Haus nach Rydultau zurückkehrte, um sich andere Schuhe zu holen, weil die einzigen, die sie auf der Flucht dabeihatte, kaputt getreten waren. Sie durfte nicht mehr hinein. In ihrem Haus wohnte mittlerweile eine polnische Familie, die selbst ebenfalls vertrieben worden war, aus dem schon von Stalin annektierten Lemberg. Also auch ein Opfer der Geschichte.
Meinem Vater blieb die Flucht erspart, denn er befand sich 1945 längst in Kriegsgefangenschaft. Er hatte Glück gehabt: Er war Soldat im Afrikakorps bei Rommel, wurde im November 1942 nach der Schlacht von El Alamein auf den afrikanischen Kriegsschauplatz geflogen und hatte die Ehre, den gesamten Rückzug vom Nildelta bis nach Tunesien mitzumachen. Manche sagen, dieser Rückzug sei Rommels größte Leistung gewesen, weil er ohne größere Verluste ablief. Mein Vater jedenfalls kam Mitte 1943 in amerikanische Kriegsgefangenschaft und verbrachte diese bis zum Jahr 1946 in so wahrhaft fürchterlichen Gegenden wie Florida und Kalifornien. Zugenommen hatte er in dieser Zeit zwölf Kilo. Die waren allerdings im ersten deutschen Hungerwinter 1946/47 sehr schnell wieder runter. In seine alte Heimat Oberschlesien konnte er nicht mehr entlassen werden. Und so ging er dann nach Neustadt, wo er beim Manöver 1942 ein überaus hübsches Mädchen kennengelernt hatte. Das war meine Mutter, das Ergebnis von all dem bin ich. Mein Vater wollte eigentlich Medizin studieren, aber da er nun Familie hatte, musste er stattdessen Geld verdienen und ging in den Außendienst bei einer Pharmafirma.
Aufgewachsen bin ich in Aschaffenburg. Die Kriegszerstörungen in dieser Stadt waren einerseits das Resultat von Bombardierungen der Alliierten, andererseits die Folge jener Idiotie, dortselbst im März des Jahres 1945 unbedingt noch einmal eine Front aufmachen zu wollen. Ausgerechnet das wunderschöne Renaissanceschloss geriet zur Kampfkommandantur der letzten Fanatiker – und wurde entsprechend zerstört. Der Wiederaufbau dauerte bis in die Achtzigerjahre.
Kindheit in Ruinen – das war damals selbstverständlich, denn man kannte ja nichts anderes. Die vielen Kriegsversehrten auf ihren Krücken prägten ebenso das Straßenbild wie die sechstausend GIs der US-Armee, die in den alten Wehrmachtskasernen anfangs als Besatzer über unsere zarten demokratischen Wurzeln wachten und uns später vor einem »Angriff aus dem Osten« schützen sollten.
Im Ortsteil Damm, wo wir anfangs wohnten, ging es ziemlich kernig zu. Heutzutage heißen seine Buben Pascal oder Kevin, damals hießen sie Karl, Franz, Max und Kurt. Und als ich Neuankömmling auf die Frage »Ei, wie heißt’n du?« wahrheitsgemäß antwortete »Guido«, hatte ich noch wochenlang ein schweres Los. Denn so hieß ein Dämmer Junge einfach nicht.
Vier Jahre später zogen wir in einen anderen Ortsteil. Weil ein Junge ja so sein will wie die anderen, dachte ich mir jetzt: »Das ist die Chance!« Mein Mittelname ist »Friedrich«, nach dem Namen meines Onkels. Als erneut die Frage kam: »Wie heißt’n du?«, sagte ich nun: »Friedrich. Ihr könnt aber Fritz zu mir sagen.« Zwei köstliche Wochen lang war ich der Fritz – bis meine Mutter eines Tags von einem Fenster ihren Sohn lauthals zum Abendessen rief: »Guido!« Das Komplott war aufgedeckt.
Aschaffenburg war damals eine sehr katholische Stadt – zu 90 Prozent. Ich bin evangelisch. In Bayern gab es damals unter der CSU-Regierung noch die Konfessionsschule. Das hieß, ich musste mit dem Bus durch die halbe Stadt, mit Umsteigen am Hauptbahnhof, um am anderen Ende von Aschaffenburg eine Klasse zu besuchen, die rein evangelisch war. Und man mag es glauben oder nicht: Wir hatten damals in der Volksschule, so hieß sie noch, nicht nur getrennte Klassen, wir hatten sogar getrennte Toiletten. Apartheid auf Bayerisch.
Ich wäre damals lieber Katholik gewesen. Barocke Pracht und Weihrauch – das war einfach die bessere Show! Wer mich vor all dem Prunk warnte, war meine Oma mütterlicherseits, eine fromme Protestantin. Als ich ihr erzählte, was mir durch den Kopf ging, hob sie ihre Hand und sagte: »Bub, hüte dich vor den Katholiken – die lügen!« Meine katholischen Freunde, denen ich das heute erzähle, sagen dazu: »Die Oma hatte recht. Natürlich lügen wir. Wir können es ja beichten!«
Im Gymnasium habe ich mich nahezu ausschließlich für Geschichte interessiert. Das lag vor allem an dem Lehrer – und sein Name sei genannt: Dr. Lothar Häusler, der heute hochbetagt in Würzburg lebt. Viele aus meiner Generation erzählen mir, dass ihr Geschichtsunterricht pottlangweilig gewesen sei, ein stupides Auswendiglernen von Zahlen und Fakten. Bei mir war es anders: Dr. Häusler machte damals etwas, was die anderen auch hätten tun können, aber nicht taten. Er würzte seinen Unterricht mit den Medien der damaligen Zeit – mit Tonbändern, Schallplatten und Filmen, die man von den Landesfilmbildstellen ausleihen konnte. Das war ungeheuer spannend – und hat meinen stillen Wunsch, später selbst einmal Geschichte zu studieren, sehr beflügelt.
Am anderen Ende der Beliebtheitsskala stand für mich Chemie. Und das war kein Wunder. Denn dieser Unterricht fand am Samstagmittag statt – nach der Pause. Samstagsunterricht? Das gab es damals. Vor der Pause war ja noch in Ordnung. Aber nach der Pause? Nein. Um rechtzeitig zu den Heimspielen meines Lieblingsvereins Eintracht Frankfurt (mit dem genialen Rechtsaußen Grabowski) zu gelangen, musste ich mich spätestens um zwölf Uhr mittags zur Autobahnauffahrt begeben und dann den Daumen heben. Jahre später bin ich zu den Offenbacher Kickers übergelaufen, weil die Atmosphäre dort noch besser war.
Doch als die Zeit des Abiturs anbrach, stand das Chemiedilemma wie ein Menetekel über mir. In Griechisch hatte es gerade noch für eine Drei gereicht. Aber auch nur, weil ich mit fast krimineller Energie dafür gesorgt hatte. Wir wussten vorher, dass ein Platon-Text zur Übersetzung anstand. Also besorgte ich mir die gesammelten zwölf Bände der Platon-Gesamtausgabe auf Deutsch und deponierte sie in den verwinkelten Toiletten des Humanistischen Gymnasiums zu Aschaffenburg. Als dann tatsächlich Platon anstand, meldete ich mich nach gefühlten zwanzig Minuten zum Toilettengang, wo ich den deponierten Text rasch fand, herausriss und unter meinem Hemd versteckte. Leider war die Übersetzung äußerst frei und nützte nur bedingt.
Das Matheabitur hatte ich bereits im Jahr zuvor mit Ach und Krach, das hieß mit einer Vier, bestanden. Wenn ich bis heute einen Albtraum habe, dann vor allem den: Ich stehe vor dem Matheabitur, bin jedoch schon über dreißig, von jedem Wissen unbeleckt und habe mich im Unterricht nie blicken lassen. Und so irre ich dann durch die Gänge meiner alten Schule und hoffe, dass kein Lehrer mich entdeckt. Dann wache ich schweißbedeckt auf.
Und so kam es, wie es kommen musste: In Naturwissenschaften – Chemie, Physik und Biologie – stand ich auf 4,5, musste ins Mündliche, und weil ich mich leichtfertigerweise darauf nicht vorbereitet hatte, bekam ich eine Sechs – und das hieß Ehrenrunde! Meine Mutter war natürlich außer sich: »Was für eine Schande!« Weil ich damals ganz gut Cello spielte, war ich als Solist für die musikalische Gestaltung der Abiturfeier vorgesehen. Das hätte mir ja gerade noch gefehlt: Die anderen kriegen ihr Zeugnis, und ich spiele dazu Cello! Ich sagte ab und wurde deshalb auf der Abschlussfeier in absentia durch den zornigen Direktordiffamiert. Also wiederholte ich das Jahr, nicht in der alten Schule – denn man war ja stolz –, sondern ging nach Neustadt an der Aisch in eine neue. Und siehe da: Der junge Knopp hatte gelernt, machte Abitur mit 1,4 und – das ist die Pointe – musste nicht zur Bundeswehr, die damals noch in achtzehn Monaten zu absolvieren war. Ich ließ mich nachmustern, hatte vorher – das war ein Geheimrezept – bei »Tchibo« sieben Tassen Kaffee getrunken und in der »Nordsee« nebenan fünf Matjesheringe gegessen, und als der Musterungsarzt besorgt fragte: »Wo sind Sie in Behandlung?«, war die Angelegenheit geklärt. Ich hatte somit insgesamt sechs Monate gespart. Ein weiterer Beweis, dass auch aus etwas Schlechtem etwas Gutes werden kann.
Und nicht nur das: Mein Jahr in Neustadt an der Aisch war wunderbar – auch weil es von den ersten erotischen Erfahrungen geprägt war. Mein Freund Hans-Jürgen, der aus Bamberg stammte, war in vielen Dingen hochbegabt, aber hatte, wie fast alle Franken, nicht die Fähigkeit, bestimmte Konsonanten hochdeutsch auszusprechen: Aus P und T wurden B und D. Wenn er auf die Frage »Was hast du gestern Abend gemacht?« erwiderte: »Bedding«, dann hatte das nichts mit Bettgehen zu tun, sondern war die fränkische Version von »Petting«. Und da wir ja die letzte brave Generation vor den Achtundsechzigern waren, erschöpften sich die ersten Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht auf diese Weise. So empfanden wir »All you need is love« zwar als kategorischen Imperativ, aber letztlich stand doch über uns der ewig gültige Lehrsatz meines weisen Neustädter Biologielehrers: »Jungs, merkt euch vor allem eines: Alkohol stärkt die Libido, aber schwächt die Potenz.«
Als Schüler und Student habe ich mir in den Ferien immer ein Zubrot verdient. Mit fünfzehn als Wagenwäscher in einer Tankstelle, für zwei Mark fünfzig die Stunde. Mit sechzehn als Hilfsarbeiter im Straßenbau, schon für drei Mark fünfzig. Das war eindeutig der härteste Job: Aufstehen um vier Uhr morgens, dann Transport per Lastwagen zum Einsatz irgendwo im Spessart, Schippen bei 30 Grad im Schatten bis zwei Uhr mittags, dann erschöpft der Rücktransport nach Hause.
In den letzten Gymnasialjahren war ich Cellist in einem Schulquartett, mit dem wir oft auch auf Beerdigungen spielten: das »Air« von Bach, das »Largo« von Händel und weitere einschlägige Stücke. Dafür erhielten wir vierzig Mark, also zehn für jeden. Das ging so lange gut, bis irgendwann die Tante unseres zweiten Geigers starb und seine Mutter Einsicht in die Kostenrechnung nahm. Daraus ergab sich, dass das Bestattungsunternehmen für »Musik am Grab« 150 Mark berechnete. Als wir drohten, diese Ausbeutung in der örtlichen Presse zu dokumentieren, wurde unser Honorar stillschweigend erhöht.
Inzwischen hatte ich längst meine wahre Bestimmung gefunden: die Aschaffenburger Brauereien. Zunächst fungierte ich als Beifahrer für Bierauslieferung. Es war üblich, dass das Fahrerteam nach getaner Arbeit von den jeweiligen Wirten eine Halbe Bier serviert bekam. Bei zwanzig Adressen pro Tag kam da schon etwas zusammen. Die Fahrer hatten selbstverständlich mehr als die damals noch erlaubten 1,5 Promille intus. Aber sie standen, äußerlich zumindest, fest wie deutsche Eichen und fuhren noch am Abend geradeaus. Ganz im Gegenteil zu mir. Meine Mutter erzählte noch jahrzehntelang die schaurige Geschichte, wie mich mein Fahrer am ersten Abend zu Hause ablieferte: schwankend, wankend, mit dem ersten richtigen Rausch meines Lebens – wenngleich bei der Arbeit ehrlich erworben.
Ab dem nächsten Tag verlangte ich bei den Wirten Limonade – was meinem Ruf im Fahrerlager alles andere als guttat. Den Haustrunk, einen Kasten Bier pro Woche, erhielt ich trotzdem.
Es folgten in den nächsten Jahren Jobs als Bierabfüller, Kesselreiniger und wieder Ausfahrer. Später als Student verlegte ich mich auf den Ferienjob als Reiseleiter bei der Firma Klinger-Reisen Würzburg. Es begann gleich mit der Mutter aller Reisen: »Studienfahrt Italien-Rom«. Die Hälfte meines Publikums bestand aus Pilgern, die einmal im Leben den Papst sehen wollten. Die andere Hälfte aus mehr oder minder pensionierten Oberstudienräten, die sich den Winter über vorbereitet hatten und alles besser wussten. Als erste Etappe war Venedig vorgesehen: Besichtigung des Dogenpalastes. Ich rief in der Zentrale an: »Wer macht denn hier die Führung?« Antwort: »Sie machen die Führung. Hat man Ihnen das nicht gesagt?«
Da stand ich nun, ausgestattet mit einem dünnen Polyglott, um mich herum eine ständig wachsende Schar wissbegieriger Landsleute (»Ist das eine deutsche Führung? Dürfen wir uns anschließen?«). Es war der blanke Horror. Für die Etappen Rom, Florenz und Pisa kaufte ich mir anschließend einen ganzen Stapel voller Kunstführer, die ich nach Kräften auswendig lernte. Die Reise war ein schöner Albtraum. Im Anschluss verlegte ich mich auf die stressfreie Begleitung von Badereisen. Das hieß: Fahrt zum Badeort, täglich Sprechstunde um 17 Uhr, ansonsten Sonne, Strand und die Betreuung unbegleiteter Touristinnen.
Den Gipfel aller Ferienjobs erklomm ich, als ich in den Lokalredaktionen des Main-Echo in Aschaffenburg und der Frankfurter Neuen Presse tätig wurde. Von Anfang an zog es mich zur Satire. Ich schrieb ironische Betrachtungen über alles Mögliche, Konzerte etwa, Jagden und Besichtigungen. Meine Mutter hat so manchen alten Ausschnitt aufbewahrt. Mein absoluter Jugend-Stil wurde von den älteren Redakteuren lächelnd toleriert. Der Chefredakteur fand allerdings bei aller Liebe, dass der junge Knopp mal etwas Ordentliches, Handfestes schreiben sollte – etwa einen Bericht über die Zusammenkunft des Ortsvereins der SPD. Auch das geriet mir leider zur Satire. Die SPD beschwerte sich, und ich zimmerte in den restlichen Tagen weiterhin meine geliebten Satirekästen.
Wer in den späten Sechzigerjahren jung war, hatte das große Los gezogen. Der Zeitgeist war im Aufbruch, auf den Straßen wurde demonstriert, die Kanzlerschaft von Willy Brandt stand vor der Tür, musikalisch musste man sich radikal entscheiden, Beatles oder Stones, dazwischen gab es nichts. Ich war für die Beatles, schon alleine wegen »Yesterday«, das ich auf dem Cello für geneigte Interessentinnen zu spielen liebte.
Meine erste Freundin stammte aus dem Spessartdorf Waldaschaff. Dessen Männer arbeiteten damals oft bei dem längst verblichenen Frankfurter Baukonzern Philipp Holzmann und bauten im Irak und in den Golfstaaten Straßen, Staudämme und Brücken. Nach Hause, und das war die Tradition, kamen sie nicht etwa an Weihnachten, sondern schon zur Kerb – auf Hochdeutsch Kirchweih. Ihre Frauen waren den Rest des Jahres allein. Und da kam es schon mal vor, dass die eine oder andere einen Seitensprung beging. Man nannte sie, meist unter vorgehaltener Hand, die »wilden Weiber von Waloscheff«. Manch wohlmeinender Nachbar steckte dann den heimgekehrten Männern, was die Herzensdamen während ihrer Abwesenheit getrieben hatten. Und so erreichte das Drama bei der Kerb seinen zwangsläufigen Gipfelpunkt. Ich war Zeuge, als im Saalbau des »Löwen« zu vorgerückter Stunde Betrogene und Nebenbuhler aufeinander losgingen – einige auch mit Holzscheiten. Da spritzte Blut, und die Kapelle spielte zur Beruhigung der Gemüter den damals populären Hit »Aber dich gibt’s nur einmal für mich!«. Ich versprach meiner Freundin feierlich: »Ich hol dich raus aus diesem Dorf.« (Das hat nicht ganz geklappt. Sie lebt, glücklich verheiratet, aus freien Stücken gerne dort.)
Übrigens stammten die Galane der Waldaschaffer Damen nicht selten aus dem Nachbarort Rothenbuch. Damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Denn als die Gegend noch beim Kurstaat Mainz war, schickten dessen Erzbischöfe ihre Spitzbuben zur Verbannung oftmals in den Spessart. Was für Russland Sibirien war und ist, das war für Mainz der Spessart. Und dort Rothenbuch. Das geschah bereits vor einigen Jahrhunderten, seitdem hat sich in Rothenbuch eine aufsässige Tradition entwickelt. Die meisten Wilddiebe kamen von dort, so auch Johann Hasenstab, der prominenteste von allen Wilderern des Spessarts. Derweil bei Bundes- oder Landtagswahlen alle anderen Spessartdörfer brav die Schwarzen wählen, wählt das trotzige Rothenbuch rot (wie der Name schon sagt). Der Holzscheiteinsatz im Saalbau des »Löwen« hatte also auch eine politische Dimension.
Ansonsten war es die Zeit, als sich verliebte junge Leute noch Briefe schrieben. Briefe? Ja, richtige Liebesbriefe. Ich habe jüngst bei einem hausinternen Umzug eine mysteriöse Kiste geöffnet, die mich einige Jahrzehnte lang begleitet hat. Und da waren sie: Dutzende von Liebesbriefen. Die Lektüre war bewegend, manchmal lustig, manchmal traurig. Ich zitiere daraus nicht. Was privat gemeint war, muss privat bleiben.
»Du musst dich bei uns einreihen!«
1968 und die Folgen
Ab Oktober 1968 studierte ich Politik und Geschichte in Frankfurt, das ja vor der Haustür lag. Frankfurt war in diesen Jahren, neben Westberlin, das Zentrum der Studentenbewegung: »Unter den Talaren Muff von tausend Jahren!« Da lief ein echter Revolutionär herum, Daniel Cohn-Bendit, mit dem frischen Ruhm des Pariser Mai 1968, als die demonstrierenden Studenten die französische Republik fast aus den Angeln gehoben hätten. Der »rote Dany« wurde ausgewiesen und musste notgedrungen in Frankfurt auf die Barrikaden gehen. Und weil er damals wie der junge Revolutionär Danton aussah, war er stets von einer Entourage männlicher und weiblicher Studenten umgeben. Im Windschatten auch der damals noch ganz unbekannte Joschka Fischer, Danys »Schlappeschambes«, wie die Frankfurter zu sagen pflegen. Ich erinnere mich, dass diese Kamarilla immer ein gewisser Duft umwehte: »Haschu Haschisch inne Taschen, haschu immer waschu naschen.«
In diesem revolutionären Sündenpfuhl wollte der junge Knopp sein erstes Semester absolvieren. Das gelang ihm freilich nur bedingt: Denn zum einen fühlten er und seine Freunde, die ebenfalls aus Bayern kamen, sich anfangs wie die Dorfdeppen, weil sie das Soziologendeutsch, das in Frankfurt damals angesagt war, überhaupt nicht verstanden: »Repressive Toleranz« – davon hatten wir, die Absolventen strenger bayerischer humanistischer Gymnasien, nie gehört! Und außerdem konnten die Frankfurter Studenten viel besser diskutieren. Das hatten wir nicht gelernt, uns hatte man den Lehrstoff mit dem Nürnberger Trichter eingeflößt. Bis wir merkten, dass in all den leidenschaftlichen Debatten eine Menge heiße Luft war und wir eigentlich mehr wussten, gingen ein paar Monate ins Land.
Eigentlich fand mein erstes Frankfurter Semester gar nicht statt. Offiziell begann es am 15. Oktober und endete am 15. Februar. Tatsächlich aber wurden gerade meine Fächer regelrecht bestreikt, und zwar von Ende November bis Mitte Februar. Und statt in dieser Zeit auf eine Rucksack-Weltreise nach Bali zu gehen, bin ich jeden Tag treu und brav mit meinem Fiat 500 an die Uni gefahren, habe zur Kenntnis genommen, was wieder ausfiel – und bin, eher aus Langeweile, zu den einschlägigen Go-ins, Sit-ins und Teach-ins gegangen. Und so wurde ich Zeitzeuge.
Dazu zwei bezeichnende Erlebnisse: Ich bin Zeuge der berühmten letzten Vorlesung von Theodor Adorno, einem der Väter der Frankfurter Schule. Es war der 22. April 1969, Hörsaal 6, Adorno liest. Plötzlich stürmen drei Studentinnen des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) auf die Bühne, entledigen sich ihrer schwarzen Lederjacken, und darunter sind sie oberhalb des Nabels nackt. Büstenhalter galten als reaktionär. Sie fassten sich an den Händen und umtanzten den völlig verdutzten Professor, unter dem Gesang eines revolutionären Liedes: das »Busen-Attentat«.
Stellen wir uns dieses Bild vor: Adorno war recht klein, und was ihn da sechsfach ziemlich opulent umwippte, war für ihn auf Augenhöhe. Der feinsinnige Mann fühlte sich bedroht, versuchte sich mit seiner Aktentasche zu erwehren – was ihm natürlich nicht gelang. Der ganze Hörsaal brach in ein homerisches Gelächter aus. Adorno dachte, die Studenten, seine Studenten, lachten ihn aus. Das taten sie aber nicht. Sie verehrten ihn ja eigentlich – und lachten nur über das skurrile Bild, das sich ihnen da bot. Doch Adorno ließ nun seine Aktentasche sinken, schüttelte den Kopf, und auf einmal, ich habe das genau gesehen, traten ihm die Tränen in die Augen. Da kam ein Assistent und zog ihn fort. Er kam nie wieder an die Uni. Vier Monate darauf ist er an einem Herzinfarkt gestorben.
Das war lehrreich: Die Studentinnen wollten ein jugendbewegtes Happening veranstalten, doch er, ein Emigrant aus Hitler-Deutschland, fühlte sich zutiefst gekränkt. Es war ein Missverständnis erster Klasse.
Ein Autor namens Marcel Beyer (der bei der Szene nicht dabei war) hat mir letzthin unterstellt, ich hätte gesehen, wie bei Adorno »dicke Kullertränen aus den Augen herausgetropft« seien. Das ist natürlich blanker Unsinn.
Vierzig Jahre später haben wir nach den Studentinnen gefahndet – für eine Sendung über 1968. Eine haben wir gefunden. Doch sie wollte sich nicht äußern. Sie schämt sich noch immer.
Auch wenn es hier drei junge Frauen waren, die den Protest einer Generation öffentlich machten – ganz generell war 1968 eher ein Aufstand der Söhne gegen die Republik der Väter. Die Töchter durften damals meist noch nicht in der ersten Reihe stehen – aber für die Chauvis kochen, waschen und auch Sonstiges, das durften sie schon. Die Emanzipation war erst ein Phänomen der frühen Siebziger.
Zwei Welten prallten auch bei einem anderen Ereignis aufeinander: Wintersemester 68/69, Vollversammlung der Studenten. Thema war: Wir müssen raus aus dem akademischen Elfenbeinturm, müssen endlich die Aktionseinheit mit der revolutionären Arbeiterschaft bilden. Abstimmung: Wer ist dafür? 90 Prozent. Wo ist die nächste erreichbare Arbeiterschaft? VDO in Frankfurt-Bockenheim. Die stellten Armaturen her. Anderthalbtausend Studenten zogen unter dem Gesang einschlägiger Lieder zur VDO. (»Wir woll’n die volle, volle, volle Diktatur des Prole-, Prole-, Diktatur des Proletariats!«) Die Werksleitung war inzwischen gewarnt worden: Die Studenten wollen das Werk stürmen! Also alles dicht machen, Tore verrammeln, Wasserwerfer auffahren! Die Arbeiter hätten eigentlich Schichtwechsel gehabt, aber konnten nun nicht raus und standen an den Fenstern. Die Studenten kamen an, bauten sich vorm Werkstor auf, und einer griff zum Megafon: »Arbeiter, Brüder, Arbeiter, Brüder!« Da scholl es ihm von oben auf gut Hessisch entgegen: »Ihr Faulenzer! Ihr faule Säckel! Schafft erstemal was!« Es war der Aufeinanderprall zweier Kulturen und ein historischer Moment: Der erste und letzte kollektive Verbrüderungsversuch von Studentenbewegung und Arbeiterschaft ging voll in die Hose. Die wenig revolutionär gesinnten werktätigen Massen wollten sich nicht befreien lassen.
Aber um kein falsches Bild zu zeichnen: Abgesehen von manchen Irrungen und kriminellen Abwegen hat die Achtundsechziger-Bewegung der Bundesrepublik doch gutgetan. Die Pubertät war absolviert, das Land ist danach reifer und erwachsener geworden. Ich jedoch war allenfalls Beobachter, nie Aktivist.
Natürlich war ich Adressat von Mahnungen wie: »Du musst dich bei uns einreihen!« Doch danach war mir nie zumute. Einer wie ich, der abends regelmäßig heim nach Aschaffenburg fuhr und sich ansonsten gern im Spessart herumtrieb, hatte eine andere Sozialisation und konnte einfach nicht das revolutionäre Weltbild eines SDS-Studenten in sich tragen.
Die Frankfurter Heroen der Bewegung, abgesehen von Daniel Cohn-Bendit, waren außerdem meist graue Mäuse. Anders in Berlin. Rudi Dutschke, ein theoriegesättigter Charakterkopf, mischte die bräsige Westberliner Subventionsszene nach Kräften auf. Sein Endziel einer sozialistischen Gesellschaft war natürlich demokratisch nicht zu schaffen, trotzdem war er nie verbissen. Das war mir sympathisch. Er hat der Achtundsechziger-Bewegung und den Grünen, die sich damals in den Siebzigern gerade formten, sehr gefehlt. Das Attentat vom April 1968, an dessen Spätfolgen er 1979 starb, war furchtbar. Ich habe Mitte der Siebzigerjahre die Familie Dutschke im dänischen Aarhus besucht, wohin sie sich geflüchtet hatte. Gretchen, Rudis Frau, war eine gebildete Amerikanerin, die mir das Studienfach »Ernährung« ans Herz legte. Damals war das neu, und sie studierte es mit Leidenschaft. Der kleine Hosea Che umwuselte die Beine seiner Mutter, bat um ein Getränk und erhielt ernährungswissenschaftlich korrekten Früchtetee.
Nach drei Semestern hatte ich gleichwohl genug von Frankfurt, das in diesen Jahren eine unwirtliche Stadt war, und wechselte zur Uni Würzburg. Da war alles anders – als Höhepunkt der Studentenbewegung galt dort ein eingeschlagenes Fenster im Rektorat. Aber man konnte studieren. Allerdings war die Region streng konservativ. Und das begann ich bald zu spüren. Ich hatte eine Wirtin, die zwei Zimmer vermietete. Eines bewohnte ich, das andere ein absolutes Musterexemplar, der Herr Müller aus der Rhön. Herr Müller raucht nicht, sagte meine Wirtin, trinkt nicht, macht vor allem keinen Lärm. Ein wahres Vorbild! Trotzdem wagte ich es eines Nachts, meine damalige Freundin mit aufs Zimmer zu nehmen. Wir bemühten uns, leise zu sein. Am nächsten Morgen schlichen wir uns durch den Vorgarten, machten die Tür vorsichtig zu, und als wir auf dem Weg zum Auto ein paar Schritte zurückgelegt hatten, hörten wir auf einmal in der Sprechanlage hinter uns eine Stimme: »Herr Knopp! Glauben Sie nicht, ich hätte nicht gehört, was heute Nacht passiert ist! Wir sprechen uns noch!«
Am Abend hielt meine Wirtin mir einen Vortrag. Sie habe gestern Nacht der Unzucht Vorschub geleistet und sich dadurch selbst strafbar gemacht. Tatsächlich gab es damals, 1970, noch den sogenannten Kuppelparagrafen, welcher den bestrafte, der unverheiratete Menschen unter seinem Dach gemeinsam übernachten ließ. Der Unsinn wurde unter der Regierung Brandt bald abgeschafft. Doch mein Verhältnis zur besagten Wirtin war nicht mehr zu reparieren, und ich zog in ein Studentenwohnheim, wo die allgemeine Unzucht stillschweigend geduldet wurde.
Als die DDR im Jahr 1973 die Weltjugendfestspiele veranstaltete und sich für ein paar Tage ein liberales Mäntelchen umhängte, fuhr ich mit besagter Freundin nach Berlin. An der Zonengrenze hinter Hof wurden wir herausgerufen und gefilzt. Manch einer wird sich erinnern: Der Ton der DDR-Grenzer war, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig. Unserer kam wohl aus Sachsen. Als er den Toilettenbeutel meiner Freundin kontrollierte, hob er plötzlich eine Pillenschachtel hoch und fragte: »Sind das Owulazionshämmer?« Ich hatte dieses Wort noch nie gehört, dachte, er meinte den Plural von »Hammer«, und sagte: »Eigentlich nicht.« – »Aber das sind doch Owulazionshämmer«, insistierte der Grenzer. Die Freundin rettete die Lage, als sie meinte: »Das ist die Pille.« –»Ovulationshemmer«, sagte der Sachse.
Angekommen in Berlin, wollten wir uns im Ostteil der Stadt die Weltjugendspiele ansehen. Damals konnte man in Westberlin ganz offiziell eine D-Mark in sechs Ostmark umtauschen. Das taten wir auch: Für 200 Westmark hatten wir auf einmal 1200 DDR-Mark in der Tasche. Die durfte man natürlich offiziell nicht einführen, doch es gab ja Tricks. Das Problem war, dass man sich im Osten dafür kaum etwas kaufen konnte. Wir aßen ein Menü im damals teuersten Lokal, zahlten 7,40 Mark pro Person, dann kauften wir im Buchladen vierzehn Bände der Karl-Marx-Gesamtausgabe und sieben Bände Lenin – und hatten immer noch 1100 Ostmark in der Tasche. Weil wir ja auch in den nächsten Tagen immer wieder zu den Spielen fahren wollten und man vor Mitternacht die DDR verlassen musste, traute ich mich nicht, die Ostmark wieder in den Westen zurückzuschmuggeln. Wir fuhren also durch Ostberlin, es wurde langsam dunkel, leichte Panik kam auf – und plötzlich sahen wir einen Friedhof. Das war die Rettung! Wir kauften einen Blumentopf, suchten ein verlassenes Grab und deponierten das Geld auf dem Grab unter dem Topf. Das war in den nächsten Tagen unsere Bank!
Am Ende blieben immer noch 800 Ostmark übrig. Die ließen wir dann auf dem Friedhof. Ich habe mich immer wieder gefragt, was aus dem Geld geworden ist. Die beste Lösung für den potenziellen Finder wäre ja gewesen, wenn er die 800 Ostmark bei der Währungsunion im Juli 1990 eins zu eins in D-Mark hätte umtauschen können!
In diesem Sommer 1973 recherchierte ich bereits ein halbes Jahr für meine Doktorarbeit. Bei der Finanzierung hatte ich ein bisschen Glück gehabt, denn die Regierung Brandt hatte 1972 ein sogenanntes Graduiertenstipendium eingeführt: 800 D-Mark pro Monat für zwei Jahre. Das war damals eine Menge Geld. Es traf sich, dass mein Doktorvater, der mich schätzte, Vorsitzender der Förderkommision war. Als die Nachricht eintraf, dass ich zu den glücklichen Gewinnern zählte, ging ich gleich zur Universitätskasse. Der Beamte fragte mich: »Wollen Sie sich Ihr Gehalt aufs Konto überweisen lassen oder gleich mitnehmen?« Er sagte allen Ernstes »Gehalt«. Und weil ja schon Dezember war, hatte ich rückwirkend Anspruch auch auf den November. Und so sagte ich: »Ich nehme es gleich mit.« Er zahlte mir 1600 D-Mark bar auf die Hand. Ich trat vor das Portal der Uni, es war ein strahlend blauer Wintertag, ich hatte eigentlich noch nichts geleistet und fühlte mich gleichwohl so reich wie nie zuvor und nie danach in meinem Leben.
Anno 1975 habe ich dann promoviert – mit einer Arbeit über die »Einigungsdebatte in SPD und USPD 1917–1920« bei Rudolf Buchner und Eberhard Kolb. Als das Rigorosum anstand, die mündliche Prüfung, war ich unpraktischerweise ziemlich aufgeregt und konnte in der Nacht zuvor nicht schlafen, sodass ich wie ein Zombie vor die Kommission trat. Erstaunlicherweise klappte es in neuerer und mittelalterlicher Geschichte ziemlich gut, und auch in Politikwissenschaft lief die Prüfung anfangs glatt. Dann aber stellte mir der Prüfer die gar nicht mal infame Frage, wer denn der eigentliche Gegenspieler Stalins in der Nachfolge von Lenin gewesen sei. Mein Verstand blockierte. Zehn Sekunden Schweigen, zwanzig Sekunden … Der junge Protokollant, selbst schon promoviert, erbarmte sich meiner und flüsterte: »Trotzki!« Ich hörte es nicht. Die anwesenden Professoren schauten angestrengt zum Fenster hinaus. Der Protokollant Dieter Langewiesche, später namhafter Geschichtsprofessor, raunte erneut »Trotzki!« Aufatmend erklärte ich voll Inbrunst: »Das war natürlich Trotzki!« Und somit war das Rigorosum mit Gloria bestanden.
Unmittelbar danach schloss ich den ersten Ehebund in meinem Leben, wohl zu früh und etwas leichtsinnig. Meine damalige Frau war eine bodenständige Juristin. Wir hatten doch sehr unterschiedliche Lebensentwürfe, was mitunter zu Spannungen führte. Immerhin entstammten dieser Ehe zwei Söhne, die ihren Weg gemacht haben und heute gemeinsam eine IT-Firma führen.
»Haben Sie denn keine Socken?«
Meine Lehr- und Wanderjahre
Fortan begannen Lehr- und Wanderjahre durch die Republik. Ich wollte immer Fernsehen machen, hatte aber das Gefühl, ich sollte erst einmal die Printmedien durchlaufen. Also bewarb ich mich mit einem wahren Massenabwurf bei den einschlägigen Adressen zwischen Hamburg und München. Es waren wohl an die hundert Bewerbungen, und weil es damals eine klitzekleine Wirtschaftskrise gab (heute würde man darüber lachen), antworteten fünfzig Angeschriebene gar nicht, über vierzig weitere variierten den Satz »Ihre sympathische Bewerbung legen wir für eine günstigere Lage zurück« – und sieben Adressaten baten um ein Vorstellungsgespräch. Das Ergebnis war, dass ich am Ende die Qual der Wahl hatte. Diese Geschichte erzählte ich in späteren Jahren gerne jungen Leuten, die frisch von der Uni als Hospitanten zu mir kamen. Nach meinem Eindruck widerstrebte es gerade Frauen, sich dutzendfach möglichen Arbeitgebern zu präsentieren. Mein Beispiel zeigte jedoch, dass diese Methode effektiv war.
Ich selbst entschied mich für den Burda-Verlag, der mir imponierte. Der Verlag war damals streng patriarchalisch geordnet. An der Spitze stand der alte Senator Franz Burda, eine Gründergestalt der Wirtschaftswunderjahre, und unter ihm agierten die drei Söhne, Hubert, Franz und Frieder. Wenn die drei von ihrem Vater sprachen, sagten sie nicht »unser Vater«, sondern redeten in der dritten Person Singular von »dem Senator«. Franz Burda war nicht nur Senator, sondern auch Professor ehrenhalber. Den Doktor hatte er tatsächlich selbst gemacht.
Bei Burda war es üblich, dass der Seniorchef alle Jahre wieder einen jungen Mitarbeiter zu sich zum Essen einlud. Das war im Herbst 1975 zwar nicht ich, da ich nur ein Volontär war, doch mein Chef, der mir dann minutiös davon berichtete. Die beiden speisten badisch, tranken ein paar Gläsle, und am Ende klopfte der Senator h.c. und Professor h.c. seinem Gast jovial auf die Schulter und sagte: »Junger Mann, Sie gefallet mir. Lasset Se den Senator künftig weg und nennet Se mich schlicht und einfach Herr Doktor Burda.«
Das tat er dann – was den alten Herrn nicht daran hinderte, uns ein paar Monate darauf mit erhobenem Zeigefinger ins Gewissen zu reden. Bei Burda lag die Mittagspause zwischen 13 und 15 Uhr – und im heißen Sommer 1976 nutzten wir Kollegen das für Tennisspiele auf den verlagseigenen Plätzen. Weil wir unbedingt einmal ein Spiel zu Ende spielen wollten, traten wir erst gegen 15.20 Uhr in den Paternoster. Plötzlich stieg auch der Senator zu, erblickte uns in unserer etwas verschwitzten Tenniskleidung, runzelte die Stirn, schaute demonstrativ auf seine Uhr, deutete auf die verspäteten Mitarbeiter und sagte mit badischem Klang: »Sie habbet in der Dienstzeit Sport gemacht, von meinem Geld!« Das war der Geist des Wirtschaftswunders.
Apropos Tennisplätze: Als ich dort einmal ohne Socken spielte, kam Hubert Burda auf den Platz, erblickte mich und meinte: »Haben Sie denn keine Socken?« Ich schüttelte schuldbewusst den Kopf. Vier Wochen später bekam ich die erste Gehaltserhöhung meines Lebens. Es war ebendieser Hubert Burda, der den Verlag in den kommenden Jahrzehnten groß machte.
Trotzdem ging ich ein Jahr später, und das war ein nützlicher Schritt, nach Hamburg zur Welt am Sonntag. Also Springer. Da hieß es nicht mehr »der Senator«, sondern »der Verleger«. Dieser war zwar in der Redaktion nicht präsent, sein Sohn aber, Axel Springer junior, war es, weil er für die Bildgestaltung sorgte.
Chefredakteur war Claus Jacobi – und von ihm habe ich am meisten gelernt. Die WamS war eine harte Schule. Donnerstags und freitags haben wir bis drei Uhr früh am Blatt gearbeitet, am Samstag war die Aktualität dran, und am Samstagabend flog ich ziemlich groggy heim nach Frankfurt. Der Sonntag und der Montag waren frei. Der Stil der WamS war damals kurz und knackig, was mir sehr behagte. Claus Jacobi fragte mich im Sommer 1977, ob ich Chef der Auslandsredaktion werden wolle. Das wollte ich natürlich, verlangte und erhielt ein deutlich höheres Gehalt und absolvierte erst einmal einen Crashkurs in Englisch. Denn mit gerade mal zwei Jahren Schulenglisch war das meine schwache Seite. Ich ging zwei Wochen nach London, unterwarf mich einer »total immersion« – und ich muss sagen, in diesen zwei Wochen, in denen ich voll in die englische Welt eintauchte, habe ich mehr von der Sprache gelernt als in zwei Jahren Gymnasium.
Auf meinem Weg zum Fernsehen wollte ich zuvor auch unbedingt noch eine Tageszeitung absolvieren, und so ging ich dann zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da herrschte schon ein anderer Stil. War bei der WamS noch kurz und knackig angesagt, so ging es bei der FAZ um ausführliche Breite. »Schreiben Sie doch wie in Ihrer Doktorarbeit«, sagte einer der Herausgeber. Das wollte ich eigentlich nicht, aber tat es zähneknirschend doch. Der damalige FAZ-Stil klang mitunter schon nach 19. Jahrhundert. Der Wandel im Iran firmierte wochenlang unter der immer gleichen Zeile: »Die Wirren in Persien«. Und im indisch-pakistanischen Konflikt hieß eine Überschrift graziös: »Den Pakistani gebricht es an Panzern«. Freilich lernte ich bald Dieter Stolte kennen, damals ZDF-Programmdirektor, der mir sagte: »Sie müssen zu uns nach Mainz kommen.« Was ich dann auch gerne tat.
Ulkig war das offizielle Einstellungsgespräch mit dem damaligen ZDF-Kulturchef. Über den Tätigkeitsbereich wurden wir uns alsbald einig, aber dann fragte ich: »Können wir jetzt über meine Konditionen reden?« Denn ich war ja von den Printmedien gewohnt, diese direkt und frei zu verhandeln. »Da müssen wir gar nicht viel reden«, sagte der Kulturchef. »Dafür haben wir eine Vergütungstabelle.« Er zog sie gleich hervor, sie war eingeteilt nach Gruppen und Stufen – und da spürte ich ihn zum ersten Mal, den Duft der öffentlich-rechtlichen Anstalt. »Wie viele Dienstjahre haben Sie denn?«, fragte er. »Zweieinhalb«, antwortete ich. »Oh, oh«, meinte er und deutete in seiner Tabelle auf eine Zahl ganz links unten. Die gefiel mir gar nicht, aber weil ich ja zum Fernsehen wollte, sagte ich mir: »Am Anfang musst du Opfer bringen.« Und ich antwortete: »Ich bin einverstanden. Aber dann will ich wenigstens einen Dienstwagen.« Denn einen solchen hatte ich auch bei der FAZ gefahren. Der Kulturchef verschluckte sich fast: »Einen Dienstwagen? Den habe nicht mal ich!« Ich kam mir ziemlich idealistisch vor, als ich den Vertrag trotzdem unterschrieb. Auf die Dauer war es die richtige Entscheidung.
Von den knapp drei Jahren Printerfahrung habe ich sehr profitiert. Gerade weil ich unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Philosophien kennengelernt hatte – eine Tageszeitung, eine Wochenzeitung und ein Unterhaltungsmedium –, konnte ich den so erworbenen Fundus auch im ZDF nach Kräften nutzen.
Schon vor dem ZDF hatte ich meine erste Erfahrung mit dem Fernsehen gemacht. Sie betraf einen gewissen Herrn aus Braunau. Im August des Jahres 1977 bot ein selbst ernannter Hitler-Forscher namens Werner Maser der Welt am Sonntag eine ganz unglaubliche Geschichte an. Denn er versicherte: »Ich habe Hitlers Sohn gefunden. Gezeugt in Hitlers Dienstzeit an der Westfront 1917. Mit einer Französin namens Charlotte Lobjoie.« Claus Jacobi sagte: »Recherchiere das mal nach!« Er gab mir seinen cleveren Sohn Tom und seinen Vizechef Manfred Geist mit, und wir recherchierten drei Wochen lang in Frankreich und Belgien auf den Spuren des Soldaten Hitler. Ergebnis war: Es ließ sich nicht beweisen. Wir sagten ab, und der Fall war für mich abgeschlossen.
Und weil das so war, erzählte ich die ganze Story eines Abends eher als Anekdote meiner alten Freundin Gitta Sereny, die damals für die Sunday Times schrieb. Da war ich schon auf dem Absprung von der WamS zur FAZ und renovierte gerade mein Haus. Eines Sonntagmorgens rief ein völlig aufgelöster Werner Maser bei mir an: »Sie müssen sofort kommen! Die Sunday Times hat eine ganze Seite über meinen Fund gemacht!« Sereny hatte aus dem lockeren Plausch beim Wein in Pöseldorf eine Titelstory fabriziert. Da fühlte ich mich irgendwie schon mitverantwortlich und fuhr nach Speyer zu Maser. Der war ziemlich durcheinander und fragte immer wieder: »Was soll ich jetzt nur machen?« Denn ohne Pause riefen bei ihm Journalisten aus aller Herren Länder an. Ich sagte: »Wenn Sie die Geschichte exklusiv behalten wollen, dann fahren Sie nach Frankreich und holen Ihren ›Sohn‹.«
Inzwischen waren draußen vor dem Maser-Haus die Kameras von einem Dutzend Fernsehsender aufgebaut, darunter auch das brasilianische Fernsehen, das damals über Deutschland in der Regel nicht berichtete. Doch wenn es um das Thema Hitler ging, dann waren die Kollegen unterm Zuckerhut dabei. Maser fuhr nach Saint-Quentin, holte seinen Fund, einen Mann namens Jean-Marie Loret, und quartierte ihn bei sich ein. Inzwischen hatte eine Agentur namens actionpress, die es noch immer gibt, das Gebot für die Weltrechte der Fotos vom, so hieß es, Hitler-Sohn auf 750000 Mark erhöht. Und jetzt machte Maser einen entscheidenden Fehler. Statt das Angebot zu akzeptieren und die Presse abzuwimmeln, gab er, entnervt von den ständigen Anrufen, eine Pressekonferenz in seinem Haus. Da fuhr ich voller Neugier selber hin. Ein Bild für die Götter: Im großen Wohnsaal drängten sich die Kameras von mittlerweile vierzehn Fernsehsendern. Auf der metallenen Wendeltreppe zum Obergeschoss wartete oben der arme Loret. Als er dann klack, klack, klack die Treppe runterging, surrten alle Kameras, und ein paar Münder standen offen. Einen solchen »Hitler-Sohn« sah man ja nicht alle Tage. Maser fragte seinen Schützling vor der versammelten Meute: »Jean-Marie, sag jetzt, wer du bist!« Und Jean Marie erwiderte: »Je suis Jean-Marie Loret, le fils de Adolf Hitler.« – »Ja gut, das reicht«, sagte Maser und scheuchte seinen Schützling wieder hoch.
Im Anschluss habe ich zum ersten Mal gesehen, wie Fernsehprofis arbeiten. »Ein dicker Hund«, sagte der Korrespondent von NBC und tat dann für sein Publikum zu Hause so, als ob er die entscheidende Frage an Loret gestellt hätte. Vor seiner Kamera wiederholte er mit unterschiedlicher Betonung: »Monsieur Loret, who are you? Monsieur Loret, who are you? Monsieur Loret, who are you?« Erstes Ergebnis dieser weltweit ausgestrahlten Pressekonferenz war, dass der Preis für die exklusiven Bildrechte von 750000 auf 120000 D-Mark fiel. Loret erhielt davon nichts, überwarf sich bald mit seinem vermeintlichen Gönner Werner Maser und brach mit ihm. Eine lehrreiche Geschichte. Nebenbei: Er war natürlich nicht Hitlers Sohn.
Dies war nicht die einzige Beschäftigung mit Hitler, die damals Furore machte. Joachim Fest präsentierte 1977 seinen Dokumentarfilm »Hitler – Eine Karriere«, Sebastian Haffner sein vorzügliches Buch Anmerkungen zu Hitler. Die Medien sprachen schon von einer regelrechten »Hitler-Welle«. Und weil das auch politisch interessant war, organisierte ich in meiner Heimatstadt im Sommer 1978 die ersten »Aschaffenburger Gespräche«, die ich von da an dreißig Jahre lang geleitet habe.