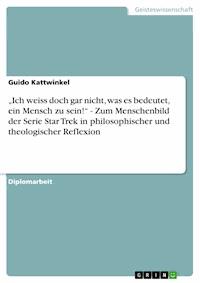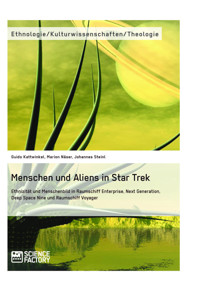
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Star Trek steht für Zukunftsvisionen, für die Erforschung des Unbekannten und doch ist diese Serie ein Spiegel unserer aktuellen Gesellschaft. Denn sie verweist auf die Ideen unseres Zusammenlebens mit anderen Menschen und somit auf das moderne Bild des Menschen. Auch der Umgang mit anderen Ethnien - hier Außerirdischen - spielt eine wichtige Rolle. Dieses Buch beschäftigt sich daher mit der Form der Darstellung von Ethnizität in den Star Trek-Serien. Darüber hinaus wird versucht, das Menschenbild zu identifizieren, das den Serien zugrunde liegt. Dies ermöglicht es dem Science Fiction begeisterten Leser über den Serientellerrand hinaus zu blicken. Aus dem Inhalt: Menschenbild, Inszenierung von Ethnizität, Funktion von Ethnizität, Rassimus, Postkolonialismus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2013 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: pixabay.com
Menschen und Aliens in Star Trek
Ethnizität und Menschenbild in Raumschiff Enterprise, Next Generation, Deep Space Nine und Raumschiff Voyager
„ICH WEIß DOCH GAR NICHT, WAS ES BEDEUTET, EIN MENSCH ZU SEIN!“ Zum Menschenbild der Star Trek Serien von Guido Kattwinkel
Vorwort
Vorklärungen
Untersuchung
Zusammenfassende Wertung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Weitere Quellen
Anhang
Die Inszenierung von Ethnizität in der Science Fiction Serie Star Trek von Marion Näser
Einleitung
Inszenierung von Ethnizität
Funktionen von Ethnizität
Abschließende Diskussion und Kritik
Literaturverzeichnis
Anhang
Glossar
A Post-Colonial Approach to Science-Fiction. Narrations of Imperialism Within Star Trek by Johannes Steinl
Introduction
Star Trek as a Form of Travelogue
Exploring Post-Colonial Space
Narrating Colonial Encounters TNG Episode, “Code of Honor”
The Controversy about Star Trek
Bibliography
Appendix
„ICH WEIß DOCH GAR NICHT, WAS ES BEDEUTET, EIN MENSCH ZU SEIN!“ Zum Menschenbild der Star Trek Serien von Guido Kattwinkel
2001
Vorwort
Die Serien mit dem Titel „Star Trek“ sind vermutlich die erfolgreichsten Science Fiction-Serien der Welt. Mit zusammen über 560 bisher gesendeten Folgen und neun Kinofilmen sind sie wohl auch die umfangreichsten. Schon in den ersten Monaten der Sendung in den sechziger Jahren des nun vergangenen Jahrhunderts, begannen erste Fantreffen und verhinderten sogar, dass die Originalserie wegen damaliger schlechter Einschaltquoten eingestellt wurde[1]. Diese Bewunderung hat auch mich ergriffen, so dass sie eine Hauptmotivation für die Erstellung dieser Arbeit war.
Im Zusammenhang mit der Qualität der Serien wird immer wieder die „Philosophie Star Treks“ erwähnt. Diese nun unter anthropologischem Blickwinkel zu untersuchen, war mir ein großes Anliegen. Denn die Menschen, die in der fiktionalen Zukunft leben, sehen sich außerirdischen Lebensformen gegenübergestellt, die viele Fragen und Anforderungen an den Menschen stellen. Diese zu beantworten, ist ein Bemühen von Star Trek. Es drängen sich fast naturgemäß viele Fragen auf: Wie wird der Mensch in diesen Serien dargestellt? Entspricht die Darstellung der Ansicht der philosophischen und theologischen Anthropologie? Können die Serien vielleicht sogar noch mehr leisten?
Diese Fragen zu beantworten ist das Hauptanliegen dieser Arbeit. Dabei ist zunächst davon auszugehen, dass nicht jeder Leser Star Trek kennt. Daher erfolgen zunächst einige wichtige Hintergrundinformationen sowie Klärungen, wie die Untersuchung formal angegangen werden soll. Die Untersuchung selbst folgt dem Schema: Inhaltsangabe der jeweiligen Folge – Analyse – Wertung/Kommentar. In der Analyse soll versucht werden, anthropologische Elemente mit den Darstellungen in den Serien zu verbinden, die Wertung gibt eine Stellungnahme zum Teilergebnis ab. Im Anschluss an die Untersuchung wird eine zusammenfassende Wertung die Teilergebnisse kommentieren.
Ich möchte darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser Diplomarbeit keine vollständige Anthropologie geleistet werden kann und soll. Vielmehr sollen einzelne Aspekte mit der Darstellung in den Serien verglichen werden. Die Reihenfolge der dargestellten Elemente des Menschen orientiert sich an der Abfolge der Episoden der untersuchten Staffel. Daher mag sie etwas ungewöhnlich erscheinen. Aber „die Themen der philosophischen Anthropologie, Ich, Verwiesenheit auf Sinn, Offenheit des Menschen, Leiblichkeit, Intersubjektivität, Geschichtlichkeit usw. lassen sich kaum, wie es der Duktus eines Buches erfordert, hintereinander darstellen. Sie gehören in der Wirklichkeit des Menschen in eins, setzen sich gegenseitig voraus und bilden gemeinsam die Seinsart des Menschen.“[2]
Der Titel der Arbeit ist ein Zitat aus der Serie Star Trek: „Raumschiff Voyager“. Der Charakter, Seven of Nine, der wieder ein Mensch werden soll, „weiß doch gar nicht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“[3] Sie weiß nicht, was einem Lebewesen gegeben sein muss, um von einem Menschen sprechen zu können. Das herauszufinden, einige Elemente des Menschen aufzuzeigen, widmet sich die vorliegende Arbeit.
Vorklärungen
Das Anliegen
Das Anliegen dieser Diplomarbeit ist es, einen Überblick darüber zu geben, welche anthropologischen Elemente des Menschen in den Serien Star Trek dargestellt werden. Bei dem Aufweis sollen sowohl verbale Äußerungen wie auch aussagerelevante Handlungen berücksichtigt werden. Es kommt dem Verfasser dabei nicht auf Vollständigkeit und Detailtreue an, da diese den Rahmen der Arbeit sprengen würden. Vielmehr soll auf einzelne Aspekte aufmerksam gemacht werden, eine vollständige Anthropologie kann nicht geleistet werden. Die Leitfrage lautet: Was sagen die Serien über den Menschen und seine Grunderfahrungen aus? Und: Können die Aussagen im Lichte einer philosophischen bzw. theologischen Anthropologie gedeutet werden? Die Qualität der Aussagen ist dann noch zu prüfen.
Die Methode
Ausgehend von der vierten Staffel der Serie Star Trek: „Raumschiff Voyager“, werden zunächst diejenigen Folgen untersucht, deren Inhalt ein Ergebnis verspricht. Die Auswahl ist im Anhang dokumentiert. Dann wird näher auf die Aussagen der Folge eingegangen, bereits mit anthropologischer Reflexion. Zur Ergänzung eines Themas werden schließlich einzelne Folgen der Serie Star Trek: „Das nächste Jahrhundert“ hinzugezogen. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Reihenfolge der Elemente sich aus der Reihenfolge ergibt, in denen sie in der Serie vorkommen. Der logische Aufbau ergibt sich also nicht aus den wesentlichsten Elementen des Menschen, sondern aus deren Erscheinen in den Episoden.
Im Vorfeld wurden Szenen der Folgen der vierten Staffel der Serie Star Trek: „Voyager“ und einige der Serie Star Trek: „Das nächste Jahrhundert“ transkribiert. Die Untersuchung beschränkt sich auf diese Folgen, weil sie zum einen durch den Charakter Seven of Nine, der zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal in Erscheinung tritt, das Thema Mensch im besonderen thematisieren, zum anderen, weil eine Bearbeitung der Folgen aller Serien innerhalb der Grenzen einer Diplomarbeit nicht möglich ist. Außer der ersten Serie mit 80 Folgen bestehen die drei anderen Serien aus über 160 Folgen, wobei die derzeit aktuelle Serie, Star Trek: „Raumschiff Voyager“, zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig ausgestrahlt wurde.
Über Star Trek
Zur Entstehung der Serie Star Trek
Das Konzept von Gene Roddenberry, dem „Schöpfer“ von Star Trek, das er Anfang der 60er Jahre bei dem amerikanischen Fernsehsender MGM einreichte, sah „eine Art Verlagerung des Pionierwesens aus den Gründerjahren der vereinigten Staaten in die Zukunft und in den Weltraum“[4] vor. „Die letzte Grenze, die es zu erforschen galt, sollte nicht mehr ein unbekanntes Land, sondern das All sein.“[5] Es geht um ein Raumschiff mit dem Namen „Enterprise“, das mit seiner Besatzung für eine Sternenflotte fliegt, die „von der Föderation der vereinten Planeten aufgebaut worden war, um den Weltraum friedlich zu erforschen. Die Föderation war von Roddenberry als ein Verbund aller Planeten angelegt, die die Raumfahrt entwickelt hatten oder die zumindest in der Lage waren, mit anderen Intelligenzen in Kontakt zu treten.“[6]
MGM lehnte dieses Konzept allerdings ab, weil zu jener Zeit eher Action-Serien gefragt waren. 1964 legte Roddenberry das Konzept dem Sender NBC vor, der zu einer Produktion eines Pilotfilms bereit war.[7]
„Die Tatsache, dass Roddenberry verschiedene Rassen (Farbige, Asiaten etc.) nebeneinander agieren ließ, führte trotz aller Zuversicht in seine Idee zu Bedenken von höherer Stelle, zumal die Integration der Farbigen in den USA noch lange keine Selbstverständlichkeit war.“[8]
Nach dem Dreh des ersten Pilotfilms ergab sich eine Schwierigkeit: Die Verantwortlichen des Fernsehsenders hielten die Handlung für zu anspruchsvoll. Sie hatten die Befürchtung, das Publikum würde der Handlung nicht folgen können, da unter anderem die „Feinde“ nicht einfach nur „Feinde“ waren, wie in dieser Zeit üblich, sondern aus verständlichen und nachvollziehbaren Motiven handelten. Daher wurde 1965/66 ein zweiter Pilotfilm gedreht, der einige Änderungen des Konzeptes, vor allem die Crew betreffend, aufwies.[9]
Von der Originalserie zu den neuen Serien
Obwohl im Vergleich zu den neuen Serien nur wenige Folgen (80 im Gegensatz zu etwa 180) produziert wurden, war die Originalserie so erfolgreich, dass sie nicht nur mehr als dreißig Jahre lang ständig in vielen Ländern wiederholt wurde, es entstanden auch sieben Kinofilme mit der alten Besetzung (und bisher drei mit der Besetzung aus Star Trek: „The Next Generation“).
Da das aber nicht ausreichte, um der Nachfrage der Fans Genüge zu tun, überlegte man, Anfang der achtziger Jahre, eine weitere Serie, die ähnlich angelegt war, zu realisieren. Es entstand Star Trek: „The Next Generation“ (deutscher Titel: „Das nächste Jahrhundert“), in der es ebenfalls um ein Raumschiff namens Enterprise geht, das aus einer Besatzung besteht, die nicht nur verschiedene menschliche „Rassen“ beherbergt, sondern auch verschiedene Außerirdische.
Auch diese Serie war erfolgreich, und so startete man, noch während diese lief, eine weitere mit dem Namen Star Trek: „Deep Space Nine“, deren Handlung auf einer Raumstation spielt.
Die aktuelle Serie heißt Star Trek: „Voyager“ (deutscher Titel: Star Trek: „Raumschiff Voyager“). Es geht um ein Raumschiff, das von einer fremden Macht in einen anderen Bereich unserer Galaxie gezogen wurde und seitdem versucht, nach Hause zu kommen. Eine Reise, die normalerweise siebzig Jahre dauern würde, durch verschiedene Ereignisse aber verkürzt wird. Es steht in Aussicht, dass die Voyager sogar am Ende der Serie die Erde erreichen wird.[10]
Gemeinsam ist allen Serien, dass sie im gleichen „Universum“ spielen, d.h. dass die Grundidee gleich ist. Ein gemeinsames Element ist der Verbund der Vereinten Planeten, dessen Hauptsitz auf der Erde ist, und dessen Präsenz im Weltraum durch die Sternenflotte, der die Schiffe der Serien angehören, gewährleistet ist. Die Sternenflotte hat auch ethische Grundprinzipien, die in den Serien (verstärkt aber erst in den neuen) zur Sprache kommen.
Hinweise zum metaphorischen Charakter der Serien
Eine der wichtigsten Grundideen von Star Trek ist es, bestimmte Szenarien oder gesellschaftliche Fragen, die hier und heute interessant bzw. fraglich sind, in den Weltraum der Zukunft zu verlagern, um sie dort, in einer anderen Umgebung, zu diskutieren bzw. dazu Stellung zu nehmen (oder manchmal auch nicht). Es wird darauf hingewiesen, weil der Prozess der „Vermenschlichung“ des Charakters Seven of Nine in der Serie Star Trek: „Raumschiff Voyager“ nicht bloß rein fiktional innerhalb der Serie zu suchen ist, sondern die Autoren durchaus in diesen Charakterstudien einen Bezug zur realen Welt implizieren, und sei es nur dergestalt, dass sie sich auf elementare Erfahrungen der Menschen heute berufen. Die These wird unterstützt durch ein Zitat aus der Biographie Gene Roddenberrys, in welcher der Autor von verschiedenen Elementen spricht, die in der Originalserie vorkommen. Er spricht davon, dass „der dritte Handlungstyp, der nach wie vor mit diesem Land und den Geschehnissen zusammenhängt, [der ist,] dass das Raumschiff Planeten besucht, die der Erde sehr ähnlich sind.“[11]
Ein weiterer Beleg dafür findet sich in einem Interview mit dem Produzenten der aktuellen Serie Star Trek: „Voyager“, Rick Bermann: „Ich denke, dass alle Star Trek-Serien moralische Geschichten waren, zum Teil, aber nur zum Teil, versuchen wir Episoden zu erstellen, die provokant sind, die die Leute zum Nachdenken bringen und die versuchen, das zu tun, worin Science Fiction am besten ist: Geschichten zu erzählen, die momentane Ereignisse in die Zukunft versetzen, so dass die Menschen sie anders betrachten können.“[12]
In Der Folge N8: „Das Gesetz der Edo“ fällt ein Besatzungsmitglied auf einem unbekannten Planeten ungeschickterweise in ein Blumenbeet. Es stellt sich heraus, dass das Gesetz vorsieht, auch solche „Bagatelldelikte“ mit dem Tode zu bestrafen. Im Folgenden versucht der Captain der Enterprise dies zu verhindern. Der Autor der Episode, Black, „versuchte, mit dieser Geschichte die Zuschauer zum Nachdenken zu bewegen, da die Diskussion über die Abschaffung oder Beibehaltung der Todesstrafe (in den USA) immer wieder aufflammte. Sie sollten sich mit der Problematik dieser drastischsten Form von Bestrafung auseinandersetzen.“[13]
Zum Serientod einer Hauptdarstellerin sagt der Autor des Buches, dass „Roddenberry [ihren Tod] so sinnlos erscheinen lassen wollte, wie er dann auch zu sehen war, weil er daran erinnern wollte, dass auch im tatsächlichen Leben Menschen einen sinnlosen Tod sterben und nicht stets noch eine Heldentat vollbringen“.[14]
Die Folge N27: „Das Kind“ „war eine versteckte Behandlung des Themas Abtreibung“[15], die aber eine konkrete Stellungnahme der Serie vermied.
Auch in der vierten Staffel der aktuellen Serie „Voyager“ behandelt die Folge V89: „Die Omega-Direktive“ ein Thema, das einen deutlichen Bezug zu aktuellen ethischen Fragestellungen hat.
Die erzählten Geschichten sind also nicht immer rein fiktiv. Vielmehr haben sie einen Bezug zur heutigen Realität und wollen Realitäten oder Ansichten aufzeigen, die es nun zu untersuchen gilt. Aufgrund dessen bewegt sich die Interpretation ebenfalls hin und wieder auf dieser fiktiven Ebene, ohne das aber im Einzelnen zu betonen.
Das Problem der fiktiven außerirdischen Charaktere
Die außerirdischen Charaktere werden in dieser Untersuchung in zwei Funktionen gesehen. Zum einen stehen sie im Blickwinkel des kritischen Beobachters. Sie stellen verschiedene Elemente des menschlichen Daseinsvollzugs in Frage und somit in den Mittelpunkt so manchen Gesprächs. Aber auch sie selbst haben viele menschliche Züge. Das liegt zum einen daran, dass sie natürlich von realen Schauspielern gespielt werden, zum anderen daran, dass die Serie in den meisten Fällen auf sogenannte „humanoide Lebensformen“ trifft, die die meisten anthropologischen Elemente besitzen. Daher kann man auch vereinzelt auf Dialoge oder Erfahrungen eingehen, die die Außerirdischen selbst betreffen.
Das Problem der Einheit der Serien
Die Serien Star Trek sind in erster Linie Serien, die für den amerikanischen Markt produziert werden. Infolgedessen unterliegen sie gewissen Richtlinien und Beschränkungen. So werden die einzelnen Folgen von unterschiedlichen Autoren geschrieben. Eine Einheit in den Anschauungen des Menschenbildes scheint auf den ersten Blick also nicht gegeben. Eine gewisse Einheit zeigt sich aber darin, dass viele Autoren mehrere Episoden schreiben und ein oder zwei Produzenten meist für eine ganze Serie Verantwortung tragen. Als zweiter Hinweis auf eine Einheitlichkeit der Aussagen ist die dauernde Bindung an die Intention Gene Roddenberrys, der die Originalserie entwarf. Seinem Bild von der Zukunft und seinen Absichten, was das Verhalten der Menschen angeht, muss immer noch entsprochen werden. Es wird in diesem Zusammenhang auch von der „Philosophie Star Treks“ gesprochen, der sich die Autoren verpflichten müssen.
Begrifflichkeiten
Da im Verlauf des Textes Worte verwendet werden, deren Bedeutung dem nicht science-fiktional interessierten Leser weniger geläufig sind, werden an dieser Stelle einige wichtige Begriffe kurz erläutert.
Beamen
Das Beamen ist ein Vorgang, der es ermöglicht, ohne Zeitverlust eine Strecke von bis zu 40.000 km zurückzulegen. Dabei wird der Mensch oder der Gegenstand durch Energiezufuhr in seine Atome zerlegt und am Bestimmungsort wieder zusammengesetzt.
Holodeck/mobiler Emitter
Die Erfindung des Holodecks ermöglicht dem Benutzer, eine virtuelle Welt zu erleben, die wie die echte Realität wirkt. Man betritt dazu einen Raum, in dem die Bilder, die man sieht, nicht nur an die Wand projiziert, sondern auch die Gegenstände, denen man näherkommt, in Materie umgewandelt werden, so dass man sie auch berühren kann. Dadurch wirkt das Holodeck so real wie die Wirklichkeit. Es kann nicht nur Gegenstände und Landschaften erzeugen, sondern auch Menschen und Tiere. Sollen die sich außerhalb des Holodecks bewegen, benötigen sie einen mobilen Emitter, der allerdings erst in der Serie Star Trek: „Voyager“ entwickelt wurde. Der mobile Emitter wird an den Arm der Figur geheftet – in der Serie ist es der holographische Schiffsarzt – und sie emittiert die benötigte Materie auch Außerhalb des Holodecks.
Die Borg/Borg-Kollektiv
Die Borg sind ein außerirdisches Volk, deren Mitglieder sich nicht als Individuen verstehen. Sie leben in einem Kollektiv, das ihnen maximalen Gedankenaustausch ermöglicht und betreiben keine Forschung, sondern assimilieren ganze Spezies, um an ihr Wissen zu gelangen.
Borg-Implantate
Die Borg bestehen zu einem großen Teil aus Technik. Diese wird den einzelnen Borg implantiert, wenn sie dem Kollektiv hinzugefügt werden. Als Beispiel kann ein Auge genannt werden, das durch ein künstliches Okular ersetzt wird, um die Sehkraft zu erhöhen.
Assimilieren
Die Borg entwickeln sich weiter, indem sie andere Spezies assimilieren. Sie machen keine eigenen Erfindungen und forschen nicht. Sie fügen Eigenschaften, die sie für wertvoll genug erachten, den eigenen hinzu, indem sie die gesamte Spezies zu Borg machen.
Warpgeschwindigkeit
Damit sich die Schiffe in den Serien auch durch die Galaxie bewegen und andere Planeten in einer Zeitspanne erreichen können, die nicht zu lang ist, hat Gene Roddenberry die Warpgeschwindigkeit, die im ersten Pilotfilm noch Sol-Geschwindigkeit hieß, erfunden. Sie basiert auf einer Verzerrung des Raum/Zeit-Kontinuums, das die Raumschiffe erzeugen, um mit Überlichtgeschwindigkeit zu fliegen. Die tatsächlich schnellste Geschwindigkeit, die ein Schiff erreichen kann, ist begrenzt, so dass die Raumschiffe nicht zu schnell die Galaxie durchqueren können. Daher benötigt die Voyager auch relativ lange für ihren Heimweg.
Untersuchung
Untersuchung des Prozesses der „Vermenschlichung“ des Charakters Seven of Nine in der Serie Star Trek: „Voyager“
Das Hauptaugenmerk der Untersuchung soll auf den Charakter Seven of Nine gelegt werden, da sie als einzige Figur der Serien bewusst einen Weg der Menschwerdung geht, gleichzeitig dieses Ziel theoretisch auch erreichen kann, da sie selbst ursprünglich ein Mensch ist. Es folgt eine Beschreibung des Charakters sowie die Beschreibung seiner Entwicklung innerhalb der Serie.
Seven of Nine begegnet der Crew des Raumschiffs Voyager zunächst als assimilierte Borg. Man kann sagen, dass die Borg im übertragenen Sinne Nicht-Menschen sind, da Seven, die ja Mensch werden möchte, Elemente des Menschlichen zunächst neu kennenlernen und erlernen muss.
Die Borg kommt aufgrund einer Allianz zwischen den Borg und dem Raumschiff Voyager an Bord. Als die Borg diese Allianz jedoch nicht einhalten und zu einer Gefahr für das Schiff werden, beschließt der Captain, Kathryn Janeway, sie ins All hinauszuschießen. Seven überlebt als einzige und muss nun an Bord bleiben, da die Voyager inzwischen einen zu großen Abstand zu den Borg hinter sich bringen konnte. Das hat auch zur Folge, dass Sevens Kontakt zum Kollektiv abgerissen ist, was es notwendig macht, dass der Schiffsarzt sie operiert und die meisten ihrer Borg-Implantate entfernt, die von ihrem Körper langsam abgestoßen werden. Gleichzeitig gibt er ihr ihr menschliches Aussehen wieder, da man erkannt hat, dass Seven of Nine ursprünglich ein Mensch, und als Kind assimiliert worden war.
Sie muss nun akzeptieren, dass sie fortan keine reine Borg mehr ist und sich zu einem Weg entschließen, den man innerhalb der Serie als „Vermenschlichung“ bezeichnet. Diese Entscheidung fällt ihr keineswegs leicht. Anfangs möchte sie dies nicht akzeptieren und lehnt sich gegen das Kommende auf. Schließlich akzeptiert sie ihren Weg aber doch und erforscht im Folgenden, „was es bedeutet, ein Mensch zu sein“.[16]
Skorpion (V71)
Der erste Teil der Folge V68/69: „Skorpion“ zählt noch zur dritten Staffel. Weil sie aber als Zweiteiler, als sogenannter „Cliffhanger“ konzipiert ist, kann man sie ebenfalls der vierten Staffel zuordnen.
Der Inhalt
Die Besatzung der Voyager geht eine Allianz mit den Borg ein, um gegen einen gemeinsamen Feind vorzugehen, der beide Parteien zu vernichten droht. Es geht darum, eine Waffe zu entwickeln. Da die Borg sehr gefährlich sind und die Crew zu assimilieren drohen, enthält Captain Janeway ihnen einen wichtigen Bestandteil vor, ohne den die Waffe ineffektiv ist. Dennoch wird auf dem Borg-Raumschiff mit der Entwicklung begonnen. Die Borg stellen einen Repräsentanten, Seven of Nine, der mit Captain Janeway und Lieutenant Tuvok zusammenarbeiten soll. Es entstehen erste Unstimmigkeiten, die Wirkung der Waffe betreffend. Die Borg wollen eine große Zerstörungskraft, die ein ganzes Sternensystem vernichten könnte, was Janeway und Tuvok nicht gefällt.
Im Verlauf der Episode kommt es zu einem Kampf mit der feindlichen Spezies, in dessen Verlauf das Borg-Raumschiff zerstört wird. Es gelingt allerdings, den Raum, in dem die Waffe entwickelt wird, zusammen mit den darin befindlichen Borg und Menschen auf die Voyager zu beamen. Als die Borg versuchen, das Schiff zu übernehmen, werden sie durch eine Öffnungsluke in den Weltraum hinausgeworfen. Seven of Nine kann sich als Einzige im Raumschiff festhalten und überlebt.
Auch sie allein versucht später, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen, was allerdings misslingt. Abgetrennt vom Borg-Kollektiv beginnt ihr Körper, die Borg-Implantate abzustoßen, ihre menschliche Physiologie setzt sich langsam durch.
Analyse
Der sprechende Mensch
Als Tuvok und Janeway beginnen, mit den Borg zusammenzuarbeiten, ergeben sich erste Unstimmigkeiten. Da die Borg zu einem Teil aus Technologie bestehen, die sie als „ein Verstand“ arbeiten lässt, verlangen sie von den Offizieren, sich an ein Gerät anschließen zu lassen, das ihnen ermöglicht, mit den Borg ohne Sprache zu kommunizieren. Dies sei maximale Kommunikation. Die Art dieser Kommunikation wird nicht genannt. Ohne auf die Realisierbarkeit der Technik einzugehen, kann man aber sagen, dass der Austausch rein informativer Art ist. Informationen werden mit allen Borg-Drohnen ausgetauscht. Wie das genau vor sich geht, ist nicht bekannt. Es wird aber gesagt, dass die Borg die „Stimmen“ der anderen hören. Seven of Nine selbst „hört“ in dieser Folge eine Stimme, die ihr einen Befehl gibt. Es ist zwar so, dass ausschließlich Seven sie hört, aber für den Zuschauer, der diese Stimme ebenfalls hört, bleibt es dennoch Sprache. Somit gibt die Serie, obwohl sie es leugnet, einen Hinweis darauf, dass es ausschließlich nichtsprachliche Kommunikation zwischen Menschen nicht geben kann. Sie stellt diese These auf, indem sie behauptet, die Borg können mit den Menschen auf diese andere Weise kommunizieren. Sie kann sie aber nicht halten und widerspricht sich selbst. Wenn die Borg gedanklich miteinander kommunizieren, äußert sich dies für den Zuschauer dennoch in sprachlichen Lauten. Seven of Nine erhält zwar an einer Stelle einen Befehl, der ihr nicht von einem anderen Borg gesagt wird, sie, und ebenfalls der Zuschauer, hört aber eine Stimme, die den Befehl spricht.
So wird schon in der Serie klar, dass Sprache ein „Grundphänomen menschlichen Daseins“[17] ist. Der Mensch kommt aus einer sprachlich ausgelegten Welt, in der der Gedanke die Sprache, der Begriff nach dem Wort verlangt[18]. Da Sinngehalte im einzelnen nur durch Sprache vermittelt werden können, kommt Coreth zu dem Schluss, dass es „keine menschliche Verständigungswelt ohne Sprache“[19] gibt, was die Serie einerseits zu leugnen versucht, indem sie die Borg auf diese Weise kommunizieren lassen will, andererseits betont sie aber immerhin die Wichtigkeit dieser Art der Kommunikation, wenn Janeway die „verbale Kommunikation“[20] vorzieht.
Der Mensch als Individuum
Im Gegensatz zu den Borg wird immer wieder die Individualität des Menschen hervorgehoben. Das geschieht aber in vielen Variationen. Im Folgenden werden die Elemente, die in dieser Episode dargestellt werden, genannt.
Vorweg sei erwähnt, dass die Serie Individualität als sehr wichtig zu erachten scheint. Ein Hinweis darauf kann man in Janeways Äußerung erkennen, die Crew würde lieber sterben, als von den Borg assimiliert zu werden und damit ihre Individualität zu verlieren.[21]
Teilhabe
Zunächst wird die Effizienz der Arbeit, die sich aus der Individualität ergibt, angeführt. Lieutennant Tuvok argumentiert gegen eine gedankliche Verbindung mit den Borg mit der Erklärung, mit „intakter Individualität“[22] besser arbeiten zu können. Gemeint ist hier die Produktivität von Arbeit im Sinne einer schöpferischen Kreativität, da ja an einer neuen Lösungsmöglichkeit gearbeitet wird. Tuvok vertritt die Meinung, durch die individuellen Anregungen des Einzelnen zur Entwicklung einer einheitlichen Idee beizutragen, in diesem Falle die Waffe. Auf diesen Aspekt macht auch Kipfer aufmerksam, indem er auf ein Kriterium von Individualität hinweist, dass die „Produktion von Vielheit und Buntheit als Vermögen der Individualität“[23] zum Motiv hat. Danach geht aus der Teilung der Einheit der Exemplare einer Spezies durch die Individuen eine Vielheit hervor. Sie „teilen durch Teilhabe die Einheit der Idee, an der sie partizipieren“[24].
Größe/Kleinheit des Menschen
Die Tatsache, dass sich die Borg als eine der Perfektion nahe Wesenheit verstehen, lässt die Menschen aus ihrem Blick als nicht-perfekte, winzige, „in winzigen Dimensionen“[25] denkende Wesen erscheinen. Die Welt des einzelnen Menschen ist klein. Jeder Mensch hat, anders als die Borg, seine eigene Meinung und kann sich frei und individuell zu seiner Welt verhalten. Seven of Nine spricht ein Grundphänomen menschlicher Selbsterfahrung radikal aus, indem sie sagt: „Sie sind Individuen. Sie sind winzig und denken in winzigen Dimensionen.“[26] Gemeint ist hier die Erfahrung, die jeder Mensch bisweilen macht. Er erfährt sich als einzelnes, einmaliges, unwiederholbares Ich, das sich von allem abhebt, was Ich nicht bin. Der Mensch kann nur von seinem „einmaligen Standort aus die Wirklichkeit erkennen und verstehen.“[27] So sieht er sich auch als ein winziger „Punkt in der unermesslichen Ganzheit des Seins und Geschehens, der Welt und Geschichte“[28], da er letztendlich auf sich selbst zurückgeworfen ist und allein vor seinen Entscheidungen, in seiner eigenen Verantwortung steht. Folglich kann er auch nur in „winzigen Dimensionen“ denken, da er nur seinen jeweils eigenen Ausschnitt der ihm überlegenen Wirklichkeit wahrnimmt, sozusagen in seiner ihm eigenen Welt lebt.
Eine andere Erfahrung, die mit der genannten einhergeht, wird zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht erwähnt: die Erfahrung der Größe des einzelnen Ich. Das Ich ist zwar nur ein kleiner Punkt in der Welt, aber es ist ein einmaliger, einzigartiger, durch nichts zu ersetzender Punkt. Das Ich besitzt eine gewisse Unbedingtheit, „die allein um ihrer selbst willen da ist; das ist die ungeheure Würde des einzelhaften Ich“.[29]
Wertung
Der vierten Staffel der vierten Serie gehen naturgemäß viele Folgen voraus. In Fankreisen kann man voraussetzen, dass die meisten davon bekannt sind. Daher geht die Serie auch nicht ausführlich auf ganze Aspekte des Menschen ein. Vielmehr werden an verschiedenen Stellen einzelne Punkte hervorgehoben und andere vorausgesetzt. Kommt dennoch ein neuer Punkt hinzu, kann man ihn nur von seinem jetzigen Standpunkt in der Serie aus betrachten. Das Element der Sprache ist ein solcher Punkt. Zum ersten Mal wird in den Serien auf dieses Phänomen in dieser Weise eingegangen. Ohne zuviel auf weitere Folgen zu hoffen, die im Rahmen des Gesamtwerkes Star Trek das Dargestellte aufgreifen, kann man sagen, dass die Serie in diesem Punkt sich selbst widerspricht. Sie betont die Möglichkeit der nichtsprachlichen Kommunikation zwischen Menschen oder zwischen Menschen und Borg, kann es aber nicht leisten, dies auch darzustellen. Seven of Nine soll eine nichtsprachliche Botschaft von den Borg erhalten, der Zuschauer erlebt sie aber als Sprache, als eine Stimme, die zu ihr spricht. Anders kann der Mensch komplizierte Sachverhalte auch nicht kommunizieren. Durch diesen Widerspruch kann der aufmerksame Zuschauer aber die Bedeutung der Sprache erkennen, auch wenn die Serie keine schlüssige Argumentation bietet.
Das Element der Individualität des Menschen wird in der Serie fast immer derart dargestellt, dass Unterschiede zu den Borg aufgezeigt werden. Hier sind es nur zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist zwar nicht von großer Wichtigkeit, soll aber dennoch genannt werden, da er Tuvoks Hauptargument gegen eine gedankliche Verbindung darstellt. Das Zurückgeworfensein auf sich selbst ist aber wieder recht gut dargestellt. Zwar muss man auch hier davon Abstand nehmen, von der Serie eine ausführliche Diskussion zu bekommen, dennoch bringt Seven of Nine mit den Worten „Sie sind winzig“[30] eine wesentliche Selbsterfahrung des Menschen auf den Punkt. Die gleichzeitig aufkommende Erfahrung der Größe des Menschen wird hier nicht entsprochen.
Die Gabe (V72)
Der Inhalt
Seven of Nine möchte nicht an Bord der Voyager bleiben. Das Raumschiff kann sie aber nicht auf einem Asteroiden oder Planeten absetzen, von dem sie dann von den Borg abgeholt wird, weil sich ihre menschliche Physiologie bereits regeneriert und die Borg-Implantate abstößt. Seven braucht, um nicht zu sterben, ärztlichen Beistand, der ihr nur auf dem Schiff gegeben werden kann. Zunächst wehrt sie sich heftig gegen Janeways Entscheidung, dass Seven of Nine wieder ein Mensch werden soll, weil sie ohne die anderen Borg nicht zu leben können glaubt. Sie hat große Schwierigkeiten, sich mit ihrer neuen Situation abzufinden, lenkt am Ende der Folge aber schließlich ein.
Analyse
Der individuelle Mensch
Das größte Problem für Seven of Nine ist es, ihre Individualität zu akzeptieren. Anscheinend hat sie sie in dem Moment erlangt, in dem sie vom Kollektiv abgeschnitten wurde. Es gab keine Übergangszeit. Entweder man ist Individuum, oder man ist keins.
Individualität geht aus dem griechischen Wort „atomom“ oder auch dem lateinischen Wort „individuum“ hervor[31], was soviel wie Einheit oder Unteilbarkeit bedeutet. Geht man allein von dieser Bedingung aus, kann man zu der Vermutung kommen, dass es keine Individuen geben kann, weil es kaum unteilbare Gegenstände gibt, selbst das Atom ist teilbar bzw. spaltbar. Kipfer gibt noch eine Zusatzbedingung an, nach der ein Gegenstand als individuell gilt, „der in seiner Teilung seine primäre und fundamentale Seinsart nicht erhalten kann“[32]. Beim Menschen ist es primär der Geist, der unteilbar ist. Schon Descartes erkennt, „dass, wenn man den Fuß oder den Arm oder irgendeinen anderen Teil des Körpers abschneidet, darum nichts vom Geiste weggenommen ist.“[33] Demnach ist Seven jetzt ein Individuum. Eine geteilte Seven of Nine wäre nicht mehr die menschlich lebendige Seven of Nine. Folgendermaßen kann man von den Borg auch nicht von Individuen reden, da sie, wären sie geteilt, immer noch als ein einziger großer Geist agierten.
Ein weiteres Kriterium für Individualität ist das Kriterium der Differenz oder Unterscheidung. Will man einen Gegenstand als individuell erkennen, muss man seine Andersartigkeit ausmachen, die ihn von anderem unterscheidet und somit als Einzelding kennzeichnet. Wenn der Mensch sich von anderem abheben will, benutzt er den Ausdruck: „Ich“. Das macht auch Seven, wenn sie auf dem Borg-Schiff zum ersten Mal in Erscheinung tritt. Indem sie sagt: „Ich spreche für die Borg“[34], drückt sie aus, sich von den Menschen, denen sie begegnet, abzuheben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass sie sich von den Borg abhebt. Hier ist sie inkonsequent, denn schon in ihrer nächsten Bemerkung benutzt sie das Personalpronomen wieder im Plural. Erst an Bord der Voyager, auf der sie ihre Individualität entdeckt, kann sie wieder „Ich“ sagen.
Die Kleinheit des Menschen
Seven macht die Erfahrung, auf sich allein gestellt, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Sie kommt sich „auf einmal klein“[35] vor, „allein“[36]. Die Erfahrung wirkt umso radikaler, als dass Seven sie, nun da sie vom Kollektiv getrennt ist, zum ersten Mal bewusst erlebt. Die Serie stellt diese Erfahrung sehr drastisch dar. Im Kontrast zum Kollektiv, das eine solche letzte Einsamkeit nicht kennt, weil man ein Bewusstsein mit allen anderen Borg teilt, scheint der Unterschied ungleich größer, als wenn einem Menschen diese Erfahrung im Alltag begegnet. Ein normaler Mensch kann nicht auf die Erfahrung eines kollektiven Bewusstseins zurückblicken, denn trotz größter Einfühlsamkeit ist ein anderes Bewusstsein, ein anderes Ich grundsätzlich unerfahrbar[37]. Natürlich weiß das auch die Serie. Dennoch spielt sie mit dem Gedankenexperiment des „gigantischen Bewusstseins“[38], des „vereinigten Willens“[39], um diese Erfahrung besser zur Geltung kommen zu lassen.
Der Mensch im Bezug zum Menschen
Der personale Bezug
Aber der Mensch ist nicht grundsätzlich allein. Er erlebt sich in einer Welt mit anderen Menschen, zunächst einmal mit dem anderen Menschen. Auch wenn Janeway auf die menschliche Gemeinschaft aufmerksam macht, ist sie zuerst ein Wesen, das ein anderes Wesen anspricht. Seven ist also ansprechbar, sie gibt eine Stellungnahme auf diesen Anspruch ab, meistens verbal, manchmal auch nicht-verbal. Auch keine Antwort abzugeben wäre ebenfalls eine Stellungnahme, nämlich eine negative. Diese Begegnung zwischen zwei antwortfähigen Wesen scheint meistens ungleichzeitig abzulaufen. Tatsächlich entsteht im angesprochenen Ich bereits im Angesprochensein die Antwort, und zwar auf das Du zu. Seven erlebt sich als von Janeway angesprochen. Aber nicht nur das, Janeway ruft sie auch auf zu Vernunft und Wohlwollen, sogar zu Liebe, die Seven als „oberflächliche Sympathiebezeugungen"[40] abtut.
Das Element des personalen Bezugs des Menschen wird in der
Serie nur indirekt benannt. Seven of Nine ist nun ein Individuum, das in der Gesellschaft, in der es lebt, zuerst im personalen Bezug zu den anderen steht. Sie hat ein besonderes Verhältnis zu Janeway, die sie dazu aufruft, Mensch zu werden, sie immer wieder auf verschiedene Elemente aufmerksam macht und zum Menschsein aufruft. Aber auch zu den anderen Mitgliedern der Besatzung steht sie in personaler Beziehung. Das wird besonders dann deutlich, wenn es wiederum um Elemente des Menschseins geht, wenn Seven of Nine den Crewmitgliedern als „gleichartiges und gleichwertiges geistig-personales Wesen begegnet“[41] und sich zu voller Lebensentfaltung ansprechen lässt.
Der Mensch in Gesellschaft
Seven of Nine steht am Anfang eines Prozesses, der innerhalb der Serie „Vermenschlichung“ genannt wird. Ein Element, das an dieser frühen Stelle auftaucht, ist das Element des sozialen Bezuges des Menschen. Es scheint von großer Wichtigkeit zu sein, da hier in zweifacher Weise darauf eingegangen wird. Zum einen kommt sich Seven of Nine, nun da sie vom Borg-Kollektiv getrennt ist, „isoliert vor, allein“[42]. Sie hat ihr eigenes Bewusstsein bekommen, genauer gesagt, wurde ihr Bewusstsein, das sie mit den anderen Borg gemeinsam hatte, aus dem Kollektiv herausgelöst und isoliert. Zu Anfang hat sie noch Schwierigkeiten, „Ich“ zu sagen. Sie verwendet noch die kollektive „Wir“-Form.[43]