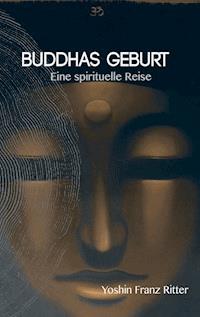Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Weltenhüter
- Sprache: Deutsch
Das Buch behandelt die spirituelle Erweckung von Meriel, einer Frau, die ein ganz gewöhnliches Leben ohne besondere Ambitionen führt. Ein geheimnisvoller Mann namens Melmoth begegnet ihr und lädt sie ein, sich auf eine Reise zu einem rätselhaften Herzen zu begeben, das sie auserwählt hat, seine nächste Trägerin zu sein. Auf dieser Reise muss sie eine Reihe von Prüfungen absolvieren, in denen sie sich vor allem selbst begegnet, aber auch einer uralten Bruderschaft, die die Macht über das Herz behalten will. Melmoth, der sie auf ihrer Reise begleitet, ist seit zweitausend Jahren Vasall des Herzens und hat die Aufgabe, die Kandidaten, die das Herz erwählt, zu ihm zu bringen. Doch seit zweitausend Jahren gelang es der Bruderschaft, jeden der auserwählten Menschen zu töten. Wird es Melmoth diesmal gelingen, mit Meriel die Reise zum Herz der Menschheit erfolgreich zu vollenden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist im Sommer 2016 unter dem Titel „Die Auserwählte“ als e-Book erschienen.
Dieses Buch ist in Erinnerung und Dankbarkeit Felicitas D. Goodman für ihr Wirken und Sein gewidmet
Ich danke den lieben Freunden, die mitgewirkt haben, damit dieser Text entstehen konnte. Allen voran natürlich meiner Lebensmenschin Margit, die alle Phasen begleitete, die mir Mut machte und mich nicht von Kritik verschonte. Vor allem die Figur der Meriel bekam durch sie Ecken und Kanten.
Suze danke ich für ihre Geduld und ihre Bereitschaft, ihr künstlerisches Talent für das Cover bereitzustellen. Es war eine Freude, ihr langsames Herantasten an die Gestaltung zu beobachten, und das Endprodukt fand meine höchste Zustimmung. Ich hoffe, es geht Dir genauso, liebe Leserin, lieber Leser.
Elisabeth Zimmermann gab dem Projekt Unterstützung aus anderen Wirklichkeiten. Sie räumte meine inneren Blockaden zu Seite und machte möglich, mich ohne Bedenkerlis und Ängstlichkeiten der Umsetzung zu widmen.
Mario C. Ackerl danke ich für seinen Enthusiasmus und seine inspirierenden Kommentare, mit denen er auf den Text reagierte. Das ist Treibstoff für die Seele eines Autors.
Desi Mauch sage ich von ganzem Herzen Danke dafür, dass sie nach „Buddhas Geburt“ nun auch mein zweites Buch korrekturgelesen und sich dafür ein ganzes Wochenende (in der Therme!) Zeit genommen hat.
Meinem Sohn Johannes verdanke ich, in die Welt des Schwertkampfes eingeführt worden zu sein und über die Geschichte dieser schrecklichen Waffe einiges erfahren zu haben.
Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt, Horatio.
William Shakespeare,
Hamlet
Inhalt
Genesis
Der Anruf
Der Wanderer
Meriel Mühlecker
Die Anderwelt
Die erste Begegnung
Melmoths Verwunderung
Meriels Mut
Abrüsten
Melmoths Bedenken
Meriels Sehnsucht
Das Herz
Liebe
Gold
Fürsorge
Die Welt des großen Geistes
Die ersten Jahre
Daheim
Der Mahlstrom des Ichs
Im Wald der Götter
Kaffee und Kuchen
Die Wahl
Handelsreise
Worte
Das Medaillon
Anderwelten
Unsterblichkeit
Die Mauern der Verzweiflung
Die Macht der Bruderschaft
Zuneigung
Der Baum der ewigen Wünsche
Die dunklen Jahre
Der Zettel
Meriels Verwandlung
Warroom
Täuschungen
Fortschritt
Vorleben
Der Mann des Schwertes
Ausflug in die Anderwelten
Begegnung
Im Tal der Vampire
Wanderungen
Michails Tod
Die Vorladung
Melmoths Manifest
Der Aufbruch
Meriels Verschwinden
Haft
Der Angriff
Der Garten der Erinnerung
Mordversuch
Wanderurlaub
Der Bergfriedhof
Neti-Neti
Erdgeister
Dunkler Strom
Die Befreiung
Rückkehr
Neubeginn
Prof. Dr. Felicitas D. Goodman
Darstellung einer rituellen Trance-Haltung
Cover Design: Suze LaRousse
Der Autor: Yoshin Franz Ritter
Weitere Bücher des Autors:
Das Neue Welt Institut
Das Herz, von dem dieses Buch erzählt, ist ein Kind des großen Geistes. Es schlug lange vor allem anderen. Es pulsierte im unsichtbaren Raum. Sein Schlagen war unhörbar wie das Tappen einer Katze im Dunkeln. Der Rhythmus seines Ausdehnens und Zusammenziehens wogte von der Sphäre des Ungeborenseins bis hinaus in die Felder der Nichtheit. Und das Herz war lange sich selbst genug und glücklich.
Doch dann empfand das Herz eine Sehnsucht. Es fühlte seine eigene Unspürbarkeit. Und es begriff diese Unspürbarkeit als Mangel. Wohin immer es sich wendete, da war nur Dasein in Leere und im unsichtbaren Raum. Die Sehnsucht wuchs, dehnte sich aus und wurde größer und größer. Dann kam der Schmerz der Unerfülltheit dazu und das Herz zog sich zusammen, aber weil es nicht war, war dieses Zusammenziehen ein Leid ohne Ort und ohne Zeit. Und das Herz gebar die Trauer über diese Unerfülltheit und die Qual, die damit verbunden war. Aber es hatte nichts und niemand, um über die Qual und die Trauer zu klagen, es hatte nichts und niemand, um zu weinen. Es erhob einen großen Gesang, in dem es seine Qual, aber auch seine Freude ausdrückte. Doch noch war da niemand, der dem Gesang lauschen konnte.
Das Lied aber zeugte eine Träne im Herzen und sie tropfte in den unsichtbaren Raum. Ein Etwas war geboren. Und die Träne milderte den Schmerz und milderte die Trauer und milderte die Qual. Und im Spiegel des einen Tropfens wurde der unsichtbare Raum sichtbar, aber das Herz hatte nichts und niemanden, um dieses Wunder wahrzunehmen. Es weinte immerfort und neue Tränen flossen in den Raum und bildeten einen großen See, in dem das Herz badete. Da spürte es plötzlich sich selbst, spürte sein Schlagen, vernahm den Ton als Schwingung und empfand den Rhythmus, der sich im See der Tränen fortpflanzte und am Ufer brach. Vom Ufer aus flossen die Wellen zurück in den See. Und das Wasser dehnte sich aus und gebar aus sich selbst neue Wasser. Und das Ufer dehnte sich aus und gebar aus sich selbst Land und Berge und Täler. Gestein brach hervor und fruchtbarer Boden. Und der brachte Pflanzen und Tiere hervor. Und eines der Tiere erhob sich und setzte sich über alle anderen Tiere und sprach. Doch die Tiere verstanden es nicht und zogen weiter. Das Wesen, das auf zwei Beinen stand, fand ein zweites Wesen, das auf zwei Beinen stand und sie vereinigten sich und brachten neue zweibeinige Wesen hervor, die über die Lande liefen und durch die Wasser schwammen und sich die Erde, die sie nun so nannten, eroberten.
Dann mussten sie nicht mehr kämpfen, um zu überleben, denn die Tiere hatten Angst vor ihnen und versteckten sich. Und in guten Jahren, wenn Gräser und Bäume genügend Früchte und Körner abwarfen, konnten die Wesen in Stille sitzen und erfanden das Denken und das Fühlen. Und sie dachten über ihr Dasein nach und sie spürten in ihre Existenz hinein. Und einige, die besonderes Talent darin hatten, wahrzunehmen, hörten den Takt des Herzens in allem, was war. Sie wurden noch stiller und verlangsamten ihren Atem, damit sie den Rhythmus deutlicher vernehmen konnten. Und so fand das Herz zu ihnen und spielte mit ihnen. Es verlangsamte auch sein Schlagen, so dass die Wesen ihren Atem noch mehr verlangsamen mussten. Es schlug plötzlich wild und unkontrolliert, so dass die Wesen erschraken und davon liefen. Bis sie merkten, dass das Herz mit ihnen spielte, mit ihnen sprach und dann lachten sie und spielten mit.
Und das Herz merkte wieder seine Sehnsucht und merkte, dass es immer noch unsichtbar war und weder Grenze noch Raum hatte. Es sehnte sich, wie diese Wesen einen Körper zu haben und Hände und Augen und einen Mund, der sprechen und lachen konnte. Und die Sehnsucht verdichtete sich wieder und schlug eine Bahn zu den Wesen. Die dunklen Ströme waren geboren und verbanden das Herz mit den Menschen. Nun verspürten die Menschen auch Sehnsucht nach dem Herzen und nach der Vereinigung mit ihm. Doch sie verstanden noch nicht und wandten sich wieder ihren Beschäftigungen zu.
Nur ein Wesen blieb still und lauschte in sich hinein, was der dunkle Strom in seinem Herzen erzählte. Es vergaß sich selbst und öffnete seine inneren Tore. Das große Herz floss in seinen Körper hinein und war plötzlich geboren. Verwundert nahm es nun die Hände des Wesens wahr, verwundert sah es die Welt, in dem die Wesen lebten, verwundert sah es das erste Mal den See der Tränen, den es selbst geweint hatte. Es begriff das Sein. Und es war wieder glücklich.
Das Wesen, in dem es wohnte, nahm überrascht das zweite Herz wahr. Es war nicht wirklich ein zweites Herz, denn es wohnte in seinem Herzen und füllte es ganz aus. Das Wesen spürte den gleichen Rhythmus im eigenen Herzschlag, es spürte die selben Gefühle, es spürte aber auch, dass ein Größeres, Ungeborenes in ihm wohnte. Doch dieses Wissen machte es glücklich, weil es sich mit dem Anfang der Welt verbunden fühlte und auch viel weiter darüber hinaus. So saß es still und lauschte dem Gesang des Herzes, der nun sein eigener war. Dies war die Geburt des einen Herzens.
Und der Ursprung unserer Geschichte seiner Wiederkehr.
Der Anruf
Das Handy schrillt. Drei Uhr morgens sehe ich an den leuchtenden Ziffern meines Weckers. Eine ungewöhnliche Zeit für einen Anruf denke ich und drücke auf die grüne Taste. Das Zimmer wird schlagartig kalt. Eine Kälte, die ich kenne und die mir Furcht einflößt. Frau Mühlecker? fragt die schnarrende Stimme im Hörer. Ich nicke und der Anrufer nimmt es entgegen, als ob er mich sehen könnte. Obwohl ich nichts sage, spricht er weiter. Er weiß, dass ich zuhöre. Sie sind ab sofort Auskunftsperson der Polizei im Fall Michail Chodor. Sie haben sich zu unserer Verfügung zu halten. Kommen Sie heute um neun Uhr ins Präsidium, Zimmer eins-nullnull-neun. Wieder nicke ich, was der Anrufer offensichtlich zur Kenntnis nimmt. Ja, und noch etwas. Sie dürfen die Stadt bis auf weiteres nicht verlassen. Es tutet im Telefon. Aufgelegt.
Alles im Zimmer wirkt vereist, als ob ein Schneesturm durchgezogen wäre. Ich fröstle am ganzen Körper. Angst, pure Angst. Die Kälte und meine Furcht erzeugen ein Zittern, das meinen ganzen Körper durchbebt. Mein Mund steht offen, ich atme in kurzen Zügen, meine Zunge fühlt sich trocken an, meine Augen sind angsterstarrt. Langsam lege ich das Telefon, das verloren noch immer von meiner Hand gehalten wird, auf den Nachttisch zurück. Michail. Ich weiß. Sie haben ihn tot auf meine Bank gelegt. Ich sehe ihn noch mit dem Messer in der Brust. Das war allerdings nicht auf meiner Bank. Sondern ganz woanders.
Die Stadt nicht verlassen, höre ich als Nachhall. Es dröhnt wie eine hart angeschlagene, riesige Glocke. Nur langsam wird das Dröhnen leiser. Gilt das auch für meine Reisen mit Melmoth? Ich kenne die Antwort. Sie heißt ja. Es ist, als ob die Türe meines Lebens zuschlägt und der Hebel von außen hochgezogen wird.
Ich liege in meinem Bett. Die Nacht kriecht wieder ins Zimmer. Noch drei Stunden bis zum Aufstehen, denke ich, als ich erneut die Ziffern am Wecker betrachte. An Weiterschlafen ist nicht zu denken. Also stehe ich auf und dusche mich. Meine Nacktheit beunruhigt mich. Können sie mich sehen, in meinem Badezimmer? Ich trockne mich ab und werfe einen Bademantel über. Nichts ist mehr, wie es war. Aber das ist schon seit einiger Zeit so. Ich habe mich bereits ein wenig an mein anderes Leben gewöhnt. Und jetzt kommt eine Macht von außen direkt auf mich zu. Eine Macht, gegen die ich schon längere Zeit ankämpfe. Doch jetzt weiß sie, wer ich bin.
Es klopft an meiner Türe.
Der Wanderer
Mein Name ist Melmoth, ich bin ein Wanderer. Wanderer werde ich deshalb genannt, weil ich seit mehr als zweitausend Jahren zwischen den Welten umherschweife. Das ist einerseits mein Auftrag und andererseits mein Zustand, in den ich geraten bin. Aber vielleicht sollte ich Dir alles der Reihe nach erzählen.
Melmoth ist eine Verballhornung meines römischen Namens Melomotus. Der wiederum ist eine Verballhornung meines ursprünglich pelagischen Namens, den ich aber vergessen habe. Ich habe die Sprache meiner Kindheit vergessen, die Sprache, die damals Menschen auf der Insel Euböa sprachen. Euböa, die sanfte Insel, die waldige Insel. Es war schön auf Euböa, wenn man durch die lichten Wälder wanderte, hinter den Baumreihen das Meer rauschen hörte und abends am Strand ein Zicklein auf Büscheln von Thymian briet, im Kreis von Freunden den süßen Wein trank, lachte, tanzte. Man trug damals grobe Kittel aus Schweinehaut und die feinen Athener Leute machten sich lustig über die Menschen auf Euböa und nannten uns derb. Das war vor über zweitausend Jahren. Als ich ein Jüngling war kamen Werber der römischen Legion nach Euböa. Sie gaben uns Wein, viel Wein, machten uns betrunken und nahmen uns am nächsten Tag mit, als Soldaten der glorreichen Armee Roms. Keiner von uns konnte damals schreiben, aber sie zeigten uns ein Papyrus, auf das wir angeblich ein Kreuz gemacht hatten und das uns verpflichtete, zwanzig Jahre in der Armee des römischen Imperiums zu dienen. Wenn wir diesen Papyrus nicht erfüllten, dann würden wir getötet, sagten sie.
Alles in allem war der Dienst in der Armee nicht schlecht, obwohl ich Handlungen setzte, die ich nie machen wollte. Aber ein Soldat tut eben einiges, vor dem er selbst Abscheu empfindet. Ich kam viel herum, in Gallien, Italien, Nordafrika. Mit der Zeit stieg ich auf, wurde Custos Armorum, der Waffenwart und später Optio. Am Ende führte ich sogar eine Hundertschaft, weil nach einer fürchterlichen Schlacht sogar die Offiziere fehlten. Ein Primus Pilus, der Führer höchsten Centurie, ernannte mich zum Centurio, obwohl ich keine Ausbildung dazu besaß. Ich hatte mir aber selbst Lesen und Schreiben beigebracht, während wir in Feldlagern saßen und auf die nächste Schlacht warteten. Die anderen soffen und prügelten herum, ich aber saß abseits und malte Zeichen auf Schiefertafeln, die ich gestohlen oder geplündert hatte. Nach einiger Zeit konnte ich sogar schon die Armeetexte lesen und verstehen und mancher Offizier zeigte mir Papyri mit alten Befehlen und erläuterte mir ihren Sinn. Wir hatte nicht viel zu tun, denn die Menschen fürchteten sich vor der römischen Armee und wagten meist keinen Aufstand. Wenn wir in einer Garnisonsstadt stationiert waren, war es leichter, da konnte man als Soldat auch als Schmied oder Bauer oder Zimmermann arbeiten. Aber die Wochen und Monate in einem Feldlager am Ufer eines Flusses oder am Fuße eines Gebirges waren langweilig und geisttötend. Die meisten von uns verblödeten dabei und sehnten sich nach einem Kampf, damit sie endlich wieder etwas tun konnten. Das tat ich nie. Nicht dass ich Kämpfen ausgewichen wäre, aber ich liebte sie auch nicht und sang die Lieder, die abends am Feuer gesungen wurden und die über Mannesmut und Soldatentugend erzählten, kaum mit.
Auf Euböa wäre ich ein Bauer geworden und hätte wie meine Vorfahren Schweine gezüchtet, eine Frau genommen und Kinder gemacht. Ich sah meinem Vater oft zu, wenn er das Fleisch der geschlachteten Tiere räucherte, um es später nach Chaldis zu bringen, dem nächsten größeren Markt, um es dort zu verkaufen. Mit dem bisschen Geld bracht er uns durch oder er vertrank es schon am Heimweg, um seinen Kummer zu vergessen. Ein elendes Leben. Wenn die Schweinepest ausbrach und die Biester reihenweise verendeten, hatten wir für lange Zeit nichts zu essen, bis Vater wieder ein paar gesunde Ferkel erstehen konnte und wir sie großzogen. Die Schweinezucht war nicht schwer auf Euböa, denn die Wälder trugen genug. Wir Kinder mussten die Tiere nur hineintreiben, dann suchten sie sich schon selber das Futter. Dadurch hatte man viel Zeit, das stimmt, und man konnte auch hinaus auf das Meer schauen, wo manchmal Segelschiffe vorbeifuhren. Das war sehr schön, aber auch hier fehlte mir die Anregung. Ich wollte immer schon mehr und war ein umherirrender Suchender, den die Menschen verlachten, weil so jemand durch sein Denken und Handeln immer ein wenig außerhalb der Gemeinschaft bleibt. Wie hätte ich denn ahnen können, dass meine Wanderschaft zweitausend Jahre lang dauern würde? Ich spürte immer eine Sehnsucht in mir, wie einen dunklen Sog, der mich aus dem herauszog, was ich gerade machte und mich schüttelte und umtrieb, mir aber nicht den Weg zeigte, den ich zu gehen hatte. So war es kein großer Verlust, bei den Römern zu landen, aber auch dort sagte mir etwas, dass ich noch nicht angekommen war. Ich wollte meine zwanzig Jahre abdienen, am Leben bleiben, dann die Bonifikation der entlassenen Legionäre kassieren und mir auf Euböa ein schönes Stück Land kaufen, auf dem andere für mich arbeiten. So dachte ich mir das damals. Es kam aber ganz anders.
In meinem letzten Dienstjahr war meine Centurie etwa zwanzig römische Meilen östlich von Alexandria stationiert, in einer kleinen Siedlung, die heute sicher schon lange verschwunden ist. Überall, wo die römische Armee lagerte, bildeten sich bald kleine Siedlungen rund um das Lager. Denn die Legion brachte Arbeit und Schutz. Die Menschen bauten zuerst primitive Hütten und später feste Häuser, und wenn so ein Lager verlegt wurde, dann zog ein riesiger Tross hinterher, mit Wirten, Bauern, Handwerkern, Huren und allem, was eine Armee zu ihrem Bestand braucht. Die Armee schützte auch diesen Tross, weil sie eng verflochten war mit den Menschen und ihren Diensten. Griffen Räuber oder Diebe einen der Wagen an, so jagten sie die Soldaten, töteten sie und hängten ihre Leichen als Abschreckung am Straßenrand auf. Allerdings kam das gestohlene Gut nicht immer zum Besitzer zurück, aber das war vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig war, dass die Armee die Macht war, die den Frieden brachte. Einen blutigen Frieden, aber doch Frieden.
Ich erinnere mich, dass ich in diesem Jahr selbst eine Patrouille leitete, die eine Räuberbande verfolgte. Die Räuber verschwanden in dieser Gegend nach ihren Plünderungen regelmäßig in der Wüste und waren dort kaum aufzufinden. Auch wir waren bei dieser Jagd erfolglos unterwegs. Das Einzige, was wir entdeckten, war ein blinder Einsiedler, der im Schutz eines großen Felsblocks lebte. Seine Wasserschale war leer und ich goss ihm aus meiner Flasche etwas nach. Dann legte ich ihm noch etwas Fladenbrot dazu und er dankte mit einem fast unsichtbaren Nicken. Wir zogen weiter, doch der Mann ging mir nicht mehr aus dem Sinn. An einem freien Tag besuchte ich ihn wieder und blieb bis in die Nachtkühle in seiner Nähe. Er saß den ganzen Tag aufgerichtet am Boden und machte keine Bewegung, obwohl die Sonne auf ihn herunterbrannte. Ich ahmte ihn nach, saß aber dabei im Schatten des Felsens. Eine stille Kraft meldete sich in mir und durchfloss meinen ganzen Körper. Mein Rücken richtete sich auf und mein Atem wurde leicht und fast nicht spürbar. Es fühlte sich wunderbar an und mein Herz war unendlich froh an diesem Tag. Für mich war es wie ein Heimkommen in eine Welt, die ich gut kannte, aber nun erst wieder gefunden hatte.
Am Abend streckte sich der Einsiedler ein wenig und grüßte mich auf Griechisch. Er legte seine Hand auf meinen Kopf, schloss seine Augen und sagte dann nach einer Weile, dass eine große Aufgabe auf mich wartet. Ich werde sie aber erst nach vielen Jahren schaffen. Nach diesen Worten versank er wieder in seine Entrücktheit und rührte sich nicht mehr. Ich ließ ihm meine Wasserflasche und einen größeren Vorrat an Fladenbrot zurück und wanderte durch die mondhelle Nacht zurück in unser Lager. Die Mitteilung vergaß ich bald wieder, weil ich annahm, dass sie das übliche Gebrabbel sogenannter Heiliger war.
Doch schon bald musste ich erfahren, dass er wusste, wovon er sprach.
Meriel Mühlecker
Mein Name ist Meriel Mühlecker. Das Außergewöhnliche an meinem Leben ist, so denke ich, dass es absolut nichts Außergewöhnliches zu berichten gibt. Ein furchtsamer Vater und eine stille, überangepasste Mutter haben mich groß gezogen. Ich hatte vor allem eines in meiner Kindheit: Angst. Die Schule und später die Ausbildung in kaufmännischem Handeln absolvierte ich als mittelmäßige Schülerin, ohne hervorstechende Leistungen, außer vielleicht in der Kunst, unsichtbar zu sein. Als später meine Mitschülerinnen das zehnjährige Reifeprüfungsfest feierten, haben sie vergessen mich einzuladen. Niemand erinnerte sich an mich. Ich erfuhr zufällig davon, weil in unserer Lokalzeitung ein kleiner Bericht über das ausgelassene Fest gebracht wurde.
In meiner Jugend zog es mich nicht zu den Burschen. Aber es zog mich auch nicht in die Mädchenrunden. Ich war irgendwo dazwischen, verloren gegangen wie ein Papiertaschentuch, das aus der Packung heraus gerutscht ist. Nicht benützt und doch nicht brauchbar.
Meinen Mann lernte ich kennen, als unsere beiden Autos zusammenstießen. Keine große Sache, aber wir tauschten Telefonnummern aus. Er rief mich an und lud mich als Wiedergutmachung (er hatte meinen Vorrang übersehen) in ein Restaurant ein. Und weil wir beide das Leben verlorener Papiertaschentücher lebten, kamen wir einander „näher“, ohne uns je nahe zu sein. Wir gingen in die Oper und zu Konzerten, später unternahmen wir Wanderungen, sogar mit Übernachtungen verbunden. Eines Nachts, als wir nur ein Doppelzimmer in einem Landgasthof bekamen, passierte `es´. Es war ein komisches Gefühl, ein wenig zog es in meinem Unterbauch, ein wenig tat es weh und er stöhnte schließlich ein bisschen. Das war es. Wir verlobten uns und heirateten ein paar Monate später. Die Hochzeit war sehr still, sein Bruder und eine entfernte Kusine von mir waren Trauzeugen. Seine Eltern wirkten wie Kopien meiner Eltern. Es kamen Suppe, Braten, Dessert und dann ein Kassettenrecorder mit Musik, aufgenommen von einer Wunschsendung im Radio. Der Sprecher gratulierte uns zu unserer Hochzeit. Der Vater von Thomas (so hieß mein Mann) hatte ein klitzekleines Glitzern in seinen Augen über seinen kreativen Einfall, die Meldung ins Wunschkonzert zu geben und die Sendung aufzunehmen. Es war wahrscheinlich der einzige kreative Einfall in seinem Leben. Wir mussten zu seiner Lieblingsmusik tanzen, was mein Mann und ich linkisch absolvierten.
Danach zogen wir zusammen in die Wohnung, die Thomas schon seit seinen ersten Berufstagen angespart hatte und die gerade kurz vor unserer Hochzeit (wir hatten den Termin darauf abgestimmt) beziehbar wurde. Monatlich zahlten wir nun eine erträgliche Summe an die Bank und gingen morgens gemeinsam aus dem Haus. Ich verkaufte mein Auto und legte den erzielten Kaufpreis auf ein Sparbuch. Als Reserve. Am Abend wartete er oder ich an der Straßenbahn-Haltestelle, damit wir wieder gemeinsam nach Hause fahren konnten. Nicht, dass ich sagen könnte, dass wir ein glückliches Paar waren, aber es sprach auch nichts gegen die Verbindung. Thomas half im Haushalt mit, weil seine Mutter ihm dazu geraten hatte, um mich glücklich zu machen. Was ihm damit aber nicht gelang. Ich wusste gar nicht, was Glück ist und es fehlte mir auch nicht. Nach dem Abendessen schaltete Thomas den Fernseher ein und wählte die Sendung, die wir miteinander ansehen sollten. Er hatte immer schon das Fernsehprogramm der ganzen Woche bei seinem Erscheinen studiert und die anzusehenden Sendungen mit farbigen Markern gekennzeichnet. So gab es keinerlei Überraschung. Unsere Tage und Wochen flossen dahin wie das Wasser in einem Kanal, der zwar vom Austrocknen bedroht ist, sich aber niemand viel daraus macht. Samstag putzten wir die gesamte Wohnung, erledigten den Wocheneinkauf, gingen nachmittags ein wenig in die Stadt bummeln und abends vielleicht sogar ins Kino. Sonntags fuhren wir mit unserem nunmehr gemeinsamen Auto hinaus zu meinen Eltern oder besuchten die seinen.
Allein benutzte Thomas das Auto nur, um zum Einkauf in den Baumarkt zu fahren. Oder wenn er beruflich einen Termin in einer anderen Stadt hatte. Dabei konnte er aber die tragische Angewohnheit, den Vorrang anderer Autofahrer zu missachten, nicht ablegen. Immer wieder wies unser Auto Spuren dieser Anpassungsstörung auf. Ein paar Jahre nach unserer Hochzeit war es allerdings ein schnellfahrendes Lastauto, das er übersah und das seinem Hang zur Vorrang-Missachtung ein Ende bereitete.
Das Begräbnis war schlicht und einfach, es gab nicht viel zu sagen. Seine Eltern und seinen Bruder habe ich danach nie wieder gesehen. Von der Lebensversicherung, die Thomas natürlich abgeschlossen hatte, zahlte ich die Wohnung aus und ging weiterhin zur Arbeit. Allerdings musste ich jetzt abends nicht mehr auf ihn warten und konnte gleich mit der nächsten Straßenbahn nach Hause fahren. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände ließ ich unverändert, da ich keine Idee hatte, was ich stattdessen wollen würde. Ich schlief im großen Bett, verschenkte seine Kleidung und setzte mich abends zum Fernseher, um irgendeine Sendung ohne großes Interesse anzuschauen. Ich hatte auch kein Interesse daran, statt Thomas einen anderen Mann in das große Bett einzuladen, weil mir Sex sowieso nie Spaß gemacht hatte und ich sonst nicht wusste, was ein Mann in meinem Leben sollte. Deswegen hatten wir wohl meine fruchtbaren Tage versäumt und kein Kind bekommen, denn Thomas reagierte immer furchtbar rücksichtsvoll auf meine Signale und zog sich sofort zurück, wenn ich den Anschein von Unwilligkeit erweckte. Was oft der Fall war.
In meiner Arbeit (ich bin Buchhalterin in einem großen Modehaus für Damen) gelte ich als zuverlässig. Ich bin nie krank und meine Zahlen stimmen immer. Ich mag keine Veränderungen und neue Computerprogramme sind mir ein Gräuel. Doch ich schaffte in der Vergangenheit auch diese Hürden und tue, was man mir anschafft.
Die schlimmsten Zeiten sind für mich die Urlaubstage und Weihnachten. Die Urlaube verbringe ich in der Regel damit, im nahen Stadtpark rund um den See zu spazieren und die Wasservögel zu füttern. Dazwischen ruhe ich mich auf einer Bank unter einer Ulme aus und beobachte die Menschen. Das tue ich bei schönem Wetter auch an Sams- und Sonntagen und so sind Urlaubstage für mich nur aneinandergereihte Wochenenden.
Zu Weihnachten gibt es zwei Katastrophen, von denen allerdings die eine, das familiäre Weihnachtsfest, aufhörte, als meine Eltern gemeinsam Selbstmord mittels Schlafmittel begingen, von denen sie immer volle Laden daheim hatten. Da ich meine Eltern aus Kostengründen nur einmal in der Woche anrief und nur einmal im Monat besuchte, kam ein Nachbar erst einige Tage später durch das sich anhäufende Reklamematerial auf die Idee, das etwas passiert sein könnte. Auch dieses Begräbnis war sehr still, vor allem, weil ich der einzige Trauergast war. Der Pfarrer sagte nicht viel, nur ein paar Worte, die ich ihm vorher auf einen Zettel geschrieben hatte, und die Leichenträger waren enttäuscht, weil keine kondolierenden Gäste da waren, von denen sie Trinkgeld bekamen. Meine entfernte Kusine hatte ich gleich gar nicht eingeladen und von anderen Verwandten hatte ich keine Adressen.
Die Katastrophe, die mir erhalten blieb, ist die betriebliche Weihnachtsfeier, auf der betrunkene Kollegen Jagd auf die Busen der Lehrmädchen und hübschen Verkäuferinnen machen. Die Chefin hält eine gequälte Ansprache, von der sie sichtlich selber den Eindruck hat, dass ihre Worte peinlich sind. Sie verdrückt sich in der Regel sehr rasch nach der Rede unter dem Vorwand einer Migräne. Jeder Mitarbeiter erhält einen Gutschein für das eigene Haus, allerdings wird von den damit gekauften Kleidungsstücken nicht der sonst übliche Mitarbeiterrabatt abgezogen. Meine Qual ist, dass ich mir einbilde, nun auch tatsächlich einkaufen zu müssen und ich absolut nicht weiß, was ich mir kaufen soll. Ich könnte den Gutschein natürlich verfallen lassen, aber ich weiß, dass meine Kolleginnen in der Buchhaltung jeden eingehenden Gutschein registrieren und die dazu gehörende Rechnung begutachten und kommentieren. Damit sie sich nicht über mich echauffieren, kaufe ich unauffällige Kleidungsstücke wie Mäntel, Jacken oder Röcke, zeige sie ein wenig im Büro vor und schenke entweder das alte Kleidungsstück oder das neue alsbald dem Roten Kreuz, denn ich mag keine übervollen Kleiderkästen.
Seit drei Jahren mache ich Yoga. Ich weiß nicht genau warum, aber ich ging einmal in eine Buchhandlung mit vielen antiquarischen Büchern, Räucherwaren und asiatischen Figuren, die ein Inder namens Kamal führt. Herr Kamal ist ein untersetzter kleiner Mann mit buschigen Augenbrauen und einem kurz geschnittenen grauen Bart. Wir kamen über ein dickes, angestaubtes Buch ein wenig ins Gespräch. Den Titel und Inhalt des Werkes habe ich heute schon wieder vergessen, da ich es auf seine Empfehlung hin nicht kaufte. Stattdessen hat er mich längere Zeit still angesehen, meine Hände eingehend geprüft und dann gemeint, ich sollte Yoga machen. Er böte einen Kurs an in der Volkshochschule an. Anfänglich hielt ich seine Begutachtung für einen Verkaufstrick, aber mit der Zeit merkte ich, dass Yoga mich wirklich entspannter und ruhiger werden lässt. Also mache ich jeden Morgen meine Yoga-Übungen, die ich im Kurs gelernt habe und sitze anschließend noch ein paar Minuten in Meditation. Das ist das einzige, was wirklich neu in meinem Leben ist. Nicht wirklich ein Aufbruch, aber etwas, was mir gut tut. Kurze Zeit war ich auch in einer Zen-Gruppe. Aber das war mir dann doch zu anstrengend. Also ließ ich es wieder.
So sah mein Leben aus bis zu jenem Tag, an dem ich mich verliebte.
Die Anderwelt
Melmoth schnippt mit seinen Fingern und ich falle durch einen Kanal aus Licht. Etwas hart lande ich in einem dunklen Raum. Erschrocken stehe ich auf. Wo sind wir hier? frage ich Melmoth, der glitzernden Staub von seiner Jacke abputzt. In Deiner Anderwelt, antwortet er knapp. Hast Du mir etwas in den Tee getan? frage ich ängstlich. Nein, lacht Melmoth, Du warst schon mehr als bereit, hierher zu kommen. Ich atme durch und blicke mich um. Ist das ein Trip? denke ich. Oder eine Attraktion am Rummelplatz und ich habe nur verpasst, wie wir hereingekommen sind? Melmoth hat mit den Fingern geschnippt. An das kann ich mich erinnern. Aber dann? Dann war ein Fliegen, das mehr ein Fallen war, und danach die Landung auf dem harten Boden, und jetzt bin ich hier. Langsam fasse ich mich ein wenig. Die Anwesenheit von Melmoth beruhigt mich. Ich putze meine Brille und kann eine sternenumsäumte Weite erkennen. Sie flößt mir allerdings keine Angst ein. Ganz im Gegenteil, ich empfinde sie beinahe behaglich. Sie vermittelt mir Geborgenheit, eine Geborgenheit, die ich schon lange nicht mehr gespürt habe. Als Kind vielleicht, aber als Erwachsene niemals.
Der Raum um mich herum wirkt sehr groß und hoch, unendlich groß und hoch sogar, zumindest in meinem Gefühl. Weder Horizont noch Umrahmung sind für mich zu erkennen. Dort wo ein Himmelsrand sein sollte, verdichtet sich einfach die Finsternis in tiefe Schwärze. Über mir wölbt sich der wundervollste Sternenhimmel, den ich je gesehen habe. Fasziniert beobachte ich das Flimmern der Himmelsobjekte, die einerseits klar und kraftvoll ihren Platz ausfüllen. Aber andererseits zittert ihr Licht ein wenig, was ihrer Existenz etwas Ungewisses gibt. Der dunkle Boden unter uns wirkt samtig weich und ist doch fest, wie ich vorhin bei meiner Landung ein wenig schmerzhaft feststellen musste. Glitzernde Steine säumen einen Weg, auf dem Melmoth langsam und ziellos umherstreift.
Was ist meine Anderwelt? frage ich verwundert. Es ist Deine Schöpfung, Meriel. Meine Schöpfung? Dieses Wort steht diametral zu meinem Selbstbild. Wann habe ich je etwas erschaffen? Ich habe von mir den Eindruck, der fantasieloseste Mensch der Welt zu sein. Melmoth lässt sich nicht beirren. Immer wenn Du Gedanken, Träume, Wünsche oder Ängste hegst, erzeugst Du hier in Deiner Anderwelt eine Manifestation davon. Hier gestaltet sich direkt im Großen Geist, was Dich bewegt, was Du aber in der anderen Welt nicht hervorbringst.
Ich bin fasziniert. Das ist mein Werk, so großartig, so prächtig? Ganz anders als mein gewöhnliches Leben. Wie habe ich das bewirkt, Melmoth? frage ich. Mit Deinen inneren Kräften, sagt er.
Das hier ist der Palast Deiner Sehnsucht. Aber ich weiß gar nicht, dass ich Sehnsucht habe, widerspreche ich. Musst Du auch nicht, sagt er leichthin über die Schulter, sie lebt hier, auch wenn Du sie nicht spürst. Ganz langsam kriecht in mir so etwas wie Verstehen hoch. Aber nicht das Verstehen eines erwachsenen Menschen, sondern ein: Ah! So ist das! Wie ein kleines Kind beginne ich mich an meiner Schöpfung zu freuen. Das ist mein Werk! Mein Werk! Unwillkürlich hopse ich herum und versuche zu begreifen, mit meinen Händen zu greifen. Ich hebe einen der glitzernden Steine hoch und betrachte ihn fasziniert. Wie wunderbar er ist, fein strukturiert, mit Linien, die wie ziseliert wirken. Ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Melmoth beobachte meine Lebhaftigkeit amüsiert. Gibt es noch andere Orte in meiner Anderwelt? forsche ich weiter. Ja, viele, den Garten Deiner Erinnerung, die Mauern Deiner Verzweiflung, das Land, in dem Deine Wünsche blühen, das Tal der Täuschung und noch anderes. Helle und dunkle Länder, in denen Deine Träume oder Deine Hoffnungslosigkeit wohnen. Wenn Du Dich fürchtest, traurig oder wütend bist, vergrößern sich Deine dunklen Länder. Wenn Du liebst oder Dich an etwas erfreust, wachsen Deine hellen Länder. In dieser Deiner Anderwelt bist Du die Königin, und in Deinem gewöhnlichen Leben bekommst Du von hier die Kraft, um zu sein. Und wenn Du eines Tages stirbst, wirst Du ganz hierher zurückkehren.
Die letzten Worte lassen mich ganz ruhig werden. Ich lege den Stein still an seinen Platz zurück. Bleibe ich dann für immer in meiner Anderwelt? frage ich neugierig, von diesem Satz gar nicht beunruhigt, sondern entzückt. Nein, Deine Sehnsucht wird Dich wieder ausschicken. Du wirst von hier aufbrechen, um ein neues Leben zu beginnen, wieder und wieder. Außer Du hast Deine Sehnsucht endgültig gestillt und den Ort des reinen Geistes erreicht. Nur dort kannst Du für immer wohnen. Den Ort des reinen Geistes? klingt es in mir. Melmoth schweigt. Er zieht eine langstielige weiße Pfeife aus seiner Jacke und beginnt sie umständlich mit einem Tabak aus einem kleinen weißen Stoffsäckchen zu stopfen. Dann zieht er ein Streichholz aus einer seiner Taschen in der Jacke und reißt es auf seiner Stiefelsohle an. Fasziniert sehe ich dem Ritual zu. Wie in einem alten Film, denke ich. Melmoth hält das brennende Streichholz quer über seine Pfeife. Er zieht die Luft ein. Der Tabak fängt an zu qualmen und duftet würzig. Eine erste Rauchwolke steigt auf. Der Ort des reinen Geistes, spricht er sinnend weiter und zieht weiter an seiner Pfeife, das ist der Ort, nach dem sich Dein Geist wirklich sehnt. Weil er nur dort sich selbst, das heißt Frieden mit sich selbst, findet. Viele Menschen nennen diesen Ort Paradies, andere Himmelreich oder Jenseits. Aber sie machen sich Vorstellungen davon, wie es sein wird und deshalb bauen sie in Wirklichkeit an ihrer Anderwelt statt in die Heimstatt des reinen Geistes zu gelangen. Dieser Ort übersteigt unsere Vorstellungskraft, weil er in unserem landläufigen Sinne gar nicht existiert. Doch in uns ist das Wissen von ihm und seinen Eigenschaften angelegt, ohne dass wir sagen können, wo er ist und wie er ist. Wir sehnen uns einfach nach ihm und diese Sehnsucht ist es, die uns führt. Aber dafür müssen wir alles ablegen, was wir glauben oder uns vorstellen, wir müssen jede Wunschenergie löschen und jede Angst abstreifen. Nur wenn wir nackt und völlig ungeschützt sind, finden wir das Vertrauen in uns, einfach weiterzugehen. Das Vertrauen ist das Eingangstor. Wenn wir diesen Einlass durchschreiten, dann ist der Ort in uns und wir sind der Ort. Der Ort des reinen Geistes.
Ich rede zu viel, bricht Melmoth ab. Aber ich muss es doch wissen! beharre ich. Du weißt es doch, antwortet Melmoth gleichmütig. Was weiß ich? sage ich patzig mit einer plötzlich scharfen Stimme. Ich schaue ihn verständnislos und ein wenig ärgerlich an. Immer diese überheblichen Ansagen! Ich weiß gar nichts! Doch Melmoth lässt sich nicht aus seiner Ruhe aufstöbern: Du bist verbunden mit diesem Wissen, mehr noch, mit dieser Gewissheit. Wie bin ich verbunden? Ich betone jedes einzelne Wort, um meine Erregung zu dämpfen. Durch Deinen dunklen Strom, sagt Melmoth leise und wendet sich ab. Er geht weiter. Ich laufe um ihn herum und zwinge ihn zum Stehenbleiben. Du sprichst in Rätseln, Melmoth! Jeder Mensch, antwortet er und macht einen Seitenschritt, um weiter zu gehen, hat in sich seinen dunklen Strom, seine eigene direkte Verbindung mit dem großen Geist. Aus diesem dunklen Strom empfangen wir Wissen und Gewissheit. Und ein anderes Leben, nach dem wir einen inneren Drang haben. Zumindest einige der Menschen, Dich eingeschlossen, schränkt er mit einem Achselzucken ein. Wenn wir in diesen dunklen Strom eintauchen, dann nimmt er uns mit auf eine Reise, von dessen Ziel wir keine Ahnung haben. Aber wir wissen, dass dort alles in seine Ordnung findet und unser Leben von dieser Gewissheit getragen wird. Und wir wissen, dass das, was wir dort finden, größer und mächtiger ist, als wir selbst je sein können.
Ich kaue an seinen Worten herum. Sie klingen fantastisch, und sie klingen auch irgendwie logisch. Zumindest in der Logik, die anscheinend hier in dieser Anderwelt herrscht. Melmoth ist unverdrossen weitergegangen. Ich laufe ihm nach, bleibe aber nach wenigen Schritten überwältigt vom Anblick der Sterne und des Nachthimmels, die mir plötzlich bewusst werden, stehen: Wunderschön. Sind diese Sterne und der Himmel auch mein Werk? Natürlich, ist die knappe Antwort. Wann habe ich das geschaffen? In Deinen klarsten Stunden, als Du ganz knapp davor warst, Deine Anderwelt zu erfahren. Ich schüttele den Kopf. Ich verstehe so vieles nicht. Melmoth, stammle ich, Du musst es mir erklären. Das werde ich, sagt er leise. Ich werde Dir helfen, es selbst zu entdecken. Aber jetzt ist Zeit, dass wir zurückkehren. Komm, lass uns gehen.
Und langsam, mit einem Schimmer von Traurigkeit im Herzen, nehme ich Abschied von meinem Himmel.
Die erste Begegnung
Plötzlich fängt mein Auto zu Stottern an. Es schüttet in Strömen, so, als ob ein bleischwerer Wassermantel vom Himmel fällt. Ich bin auf einer der Einfallstraßen unserer Stadt unterwegs und versuche nur noch den Straßenrand zu erreichen, was mir auch gelingt. Das Armaturenbrett wird dunkel. Kein Strom im Auto, also keine Heizung, kein Licht und vor allem, kein Motor. Nervös fingere ich mein Handy aus meiner Tasche, aber auch hier kein Strom, anscheinend ist der Akku leer. Also auch kein Pannendienst, keine Heimfahrt. Verärgert werfe ich das Handy in die Tasche zurück. Was mache ich jetzt? Ich bin am Rückweg vom Grab meiner Eltern in meinem Heimatdorf. Sie liegen dort gemeinsam und halten ihren Hadesschlaf. Der Pfarrer hat sie trotz ihres Doppelselbstmordes in geweihte Erde legen lassen und sogar ein gewisses, unausgesprochenes Verständnis bei ihrem Begräbnis gezeigt. Aber vielleicht habe ich mich da auch verhört. Oder vielleicht galt sein Verständnis eher meiner Gefühlsarmut.
Der Regen trommelt auf mein Autodach. Es wird kalt im Wagen und ich ärgere mich, dass wie immer mein Mantel im Kofferraum liegt. Ich schalte das Radio ein. Natürlich bleibt das Gerät stumm. Ich starre auf die nasse Straße hinaus und registriere verbittert, dass so viele Autos ohne Probleme auf ihr fahren, heim in ihre warmen und gemütlichen Wohnungen. Am Friedhof war es kühl gewesen, aber nicht kalt. Mein Mantel reichte völlig aus. Ich hatte meine mitgebrachten Blumen in die steinerne Vase vor dem Grabstein gesteckt, nachdem ich die alten herausgenommen und in Zeitungspapier gepackt hatte.
Das Grab ist schlicht und bietet keinerlei Anlass zu kritischen Bemerkungen der Dorfbewohner. Natürlich ist der Selbstmord unvergessen. Anfangs, wenn ich meinen Besuch am Grab mit einem Besuch in der Dorfschenke verband, um alte Bekannte zu treffen und nicht als abgehobene Stadtzicke zu gelten, sah ich die verschämten Blicke in den Wandspiegeln, die mich musterten und eine Frage ausdrückten, die schwer im Raum schwebte: Wie hat sie das verkraftet? Ich habe den Freitod meiner Eltern erstaunlich gut verkraftet, ohne große Trauerarbeit, eher mit einem stillen Gedenken, das nicht einmal versucht, zu verstehen. Sie waren tot. Aus. Was gibt es da schon groß zu sagen? Jeder Mensch stirbt und ich habe nie verstanden, warum ein Selbstmord ein Verbrechen sein sollte. Ich betrachte das Leben als Geschenk, das man mehr oder weniger freudvoll entgegen nimmt. Ich habe es entgegen genommen wie das Paket eines Versandhandels, in dem sich praktische Sachen befinden, die man zum Alltag braucht. Keine große Angelegenheit, eher ein Verräumen in Laden und das Wissen, dass man jetzt etwas hat, was bei der Erledigung der Pflichten hilfreich ist. Denn natürlich ist das Leben hilfreich bei der Aufgabe, zu leben. Denn ohne das Leben wäre ja niemand da, der es lebt.
Ich schüttele den Kopf. In was für absurde Gedanken mich die Situation bringt. Den Mantel aus dem Kofferraum holen. Das ist mein nächster Gedanke. Aber der Regen hat noch nicht nachgelassen. Wenn ich ihn hole, dann bin ich am ganzen Körper klitschnass. Wenn ich ihn nicht hole, dann friere ich hier ein. In meinem Augenwinkel sehe ich auf der anderen Straßenseite eine kleine Gasse von der Hauptstraße abzweigen. Wenige Schritte darin erkenne ich die Beleuchtung einer Kneipe. Dorthin muss ich, denn dort ist es wahrscheinlich warm und ich bekomme einen heißen Tee. Also springe ich entschlossen aus dem Wagen und zwinge ein anderes Auto zu einem hektischen Ausweichmanöver, das mit einem wütenden Hupen verbunden ist. Rasch nach hinten. Kofferraumdeckel aufschnappen lassen, Mantel greifen, überziehen. Dann laufe ich über die plötzlich autofreie Straße auf die Kneipe zu. Zum Weißen Kamel steht auf der Reklameleuchte. Seltsamer Name. Aber ich stoße die Türe auf und sehe – ihn. Trotz meiner angelaufenen Brille, durch die ich kaum etwas erkennen kann.
Das wäre er, denke ich, vor Schreck erstarrt.