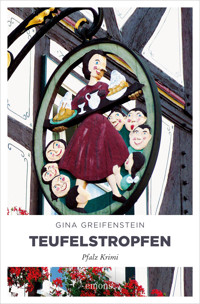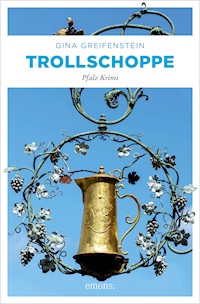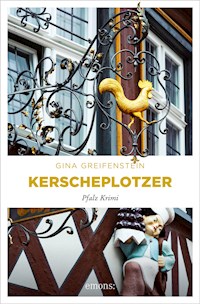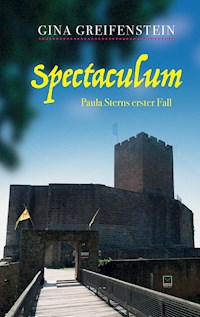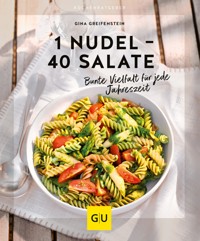Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Pfalz Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Idylle der Südpfalz ist für Benedikt Eichenlaub in dem Moment vorbei, als er tot in einem Landauer Parkhaus liegt. Paula Stern, kürzlich aus Franken zugezogen, und Bernd Keeser, der Urpfälzer schlechthin, gehen die Ermittlungen an, doch die gestalten sich alles andere als einfach. Keeser gerät in tödliche Gefahr – und Paula muss sich nicht nur mit einem verhafteten Freund, sondern auch noch mit unangemeldetem Mutterbesuch herumschlagen. Das übersteht man nur mit deftigem pfälzischen Essen . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gina Greifenstein wuchs im unterfränkischen Würzburg auf, lebt aber seit vielen Jahren als freie Autorin in der Südpfalz. Aus ihrer Feder stammen zahlreiche Bestsellerkochbücher, aber auch Romane– »Der Traummann auf der Bettkante« (Piper) war 2008 für den DeLiA-Preis nominiert. Zuletzt erschienen ist die Pfalz-Krimi-Reihe um die junge Ermittlerin Paula Stern– wo lässt es sich schließlich besser morden als vor der eigenen Haustür?
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©mauritius images/Alamy Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-980-6 Pfalz Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Vom Glück, eine Mutter zu haben
Sonntag, 20.Mai
Sie hörte ein Handy wie aus weiter Ferne.
Es war ihr Handy, erkannte sie im Halbschlaf, es hatte den gleichen Klingelton wie die Telefone vor zwanzig oder dreißig Jahren. Nach dem vierten Ring-Ring verstummte es. Die Mailbox hatte sich eingeschaltet. Dem morgendlichen Anrufer wurde von einer weiblichen Stimme höflich, aber energisch mitgeteilt, dass der angewählte Teilnehmer nicht erreichbar sei.
Zufrieden kuschelte Paula sich wieder in ihre Bettdecke.
Da, wieder: Ring-Ring. Der Anrufer gab nicht auf.
»Das ist deins«, murmelte Sebastian neben ihrem Ohr.
Es war ihr erster freier Tag seit Wochen, sie wollte ausschlafen. Missmutig zog sie sich das Kissen über den Kopf, um nichts mehr zu hören, aber es funktionierte nicht, das nervende Geräusch erreichte immer noch ihre Ohren, gedämpft zwar, aber es war nicht zu ignorieren. Dann war wieder Ruhe.
Als es erneut klingelte, drängelte Sebastian gereizt: »Geh doch endlich ran.«
Verdammt, warum habe ich bloß dieses blöde Ding gestern Abend nicht ausgeschaltet?, dachte Paula. Mit geschlossenen Augen tastete sie nach dem Handy neben dem Bett. Dort, wo sie es vermutete, lag es aber nicht. Obwohl sie es nicht zulassen wollte, begannen ihre derart unangenehm aufgeweckten Gehirnzellen zu arbeiten. Das kann nur Keeser sein, dachte sie unglücklich. Wer sonst sollte sie an ihrem freien Tag um –sie öffnete blinzelnd die Lider und erkannte mit zusammengekniffenen Augen auf Sebastians Wecker die Uhrzeit– kurz nach sieben anrufen? Konnten Mord und Totschlag nicht ein Mal ihren freien Tag respektieren?
Das Klingeln verstummte, um wenig später erneut einzusetzen.
»Bestimmt dein reizender Kollege«, sprach Sebastian ihre Vermutung aus, ohne seine Augen zu öffnen.
Jetzt war Paula endgültig wach und schnappte sich das Telefon, das unter das Bett gerutscht war. »Ich werde ihn umbringen, und zwar gaaaanz langsam«, versprach sie.
Beim Blick auf das Display stöhnte sie auf. »Das ist nicht mein reizender Kollege, es ist viel schlimmer…« Mit einem Ruck setzte sie sich auf. »Das ist meine Mutter.« Sie drückte die grüne Taste, bevor sich erneut die Mailbox einschalten konnte. Ihr Ärger wich jedoch augenblicklich aufkeimender Sorge: Es war daheim doch hoffentlich nichts Schlimmes passiert?
»Hallo, Mutsch«, meldete sie sich vorsichtig.
»Paula, wo bist du denn?«, fragte ihre Mutter vorwurfsvoll.
»Im Bett. Ich habe heute frei, das hab ich dir doch vorgestern erzählt. Und eigentlich hatte ich vor, endlich mal auszuschlafen«, erwiderte Paula.
»Das weiß ich«, sagte ihre Mutter.
Paula nahm das Handy vom Ohr und starrte es ungläubig an. Warum zum Teufel rufst du mich dann so früh an? Die Frage lag ihr auf der Zunge, aber sie sprach sie nicht aus. Sie atmete tief durch, bevor sie das Telefon wieder ans Ohr nahm.
»Kind, hörst du schlecht? Hörst du denn deine Türglocke nicht?«
Meine Türglocke?, dachte Paula verwirrt.
»Ich stehe hier vor deiner Wohnungstür und klingle mir einen Wolf«, erklärte ihre Mutter.
Ach, du Scheiße!, dachte Paula. Ihre Mutter war hier in Landau, nicht in Würzburg, wo sie hingehörte. Und sie stand höchstpersönlich vor ihrer Tür– nicht vor dem Hauseingang, nein, vor ihrer Wohnung ein Stockwerk über ihnen, über Sebastians Wohnung, in der sie sich gerade befand. Wie war ihre Mutter ins Haus gelangt? Hatte wieder mal einer ihrer Mitmieter die Haustür nicht richtig geschlossen? Und das in Zeiten steigender Einbruchszahlen, dachte die Kriminalbeamtin in ihr.
»Ich komme«, sagte sie ergeben.
»Schlechte Nachrichten?« Sebastian stützte den Kopf auf eine Hand und sah sie aus seinen wunderbaren hellgrauen Augen zärtlich an. Seine dunklen Locken schlängelten sich wild um sein Gesicht. Er sah zum Anbeißen aus. Paula wollte alles andere, als dieses Bett verlassen und auf ihre Mutter treffen, die aus unerklärlichen Gründen und ohne Vorwarnung angereist war.
»Sehr schlechte Nachrichten«, bestätigte Paula, gab ihm einen flüchtigen Schmatzer auf den Mund, sprang aus dem Bett und schlüpfte in ihren Schlafanzug. »Meine Mama ante portas. Keine Ahnung, was sie hier will.«
Schon war sie zum Schlafzimmer hinaus und durch die Diele geeilt. Mit ihrem Handy in der einen und ihrem Schlüsselbund in der anderen Hand öffnete sie die Wohnungstür. Vorsichtig trat sie in den Hausgang hinaus und zog die Tür hinter sich ins Schloss. Kurz hielt sie inne und lauschte ins Treppenhaus.
Sie atmete tief durch und schlich barfuß die Treppe eine Etage höher.
Ihre Klingel ertönte erneut. Zorn stieg in ihr auf, sie hatte doch gesagt, dass sie gleich aufmachen würde.
»Guten Morgen, Mutsch«, sagte sie bemüht freundlich, als sie schließlich hinter ihrer ungeduldigen Mutter stand.
Die fuhr erschrocken herum und musterte ihre Tochter von oben bis unten. »Wo kommst du denn her? Und noch dazu im Schlafanzug?«
Paula trat neben sie, steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür. »Aus dem Bett, sagte ich doch.« Neben ihrer Mutter stand eine prall gefüllte Reisetasche, die nichts Gutes verhieß. Paula ergriff die Henkel der Tasche und ging an ihrer Mutter vorbei in die Wohnung. »Komm rein.«
»Offensichtlich aber nicht aus deinem Bett«, sagte ihre Mutter, die ihr in die Diele folgte.
»Bingo. Jetzt weiß ich auch, von wem ich dieses phänomenale Kriminalisten-Gen habe.« Paula setzte die Reisetasche im Wohnzimmer ab. »Kaffee?«, fragte sie auf dem Weg in die Küche.
»Ja, gern.« Ihre Mutter folgte ihr. Sie strahlte über das ganze Gesicht. »Du hast also endlich einen Freund.«
Wenn ich mit einem Kerl schlafe, ist er noch lange nicht mein Freund, wollte Paula sagen, um sie zu ärgern, ließ es dann aber, als sie das glückliche Gesicht ihrer Mutter sah. »Ja, ich habe einen Freund«, gestand sie. Irgendetwas in der Art jedenfalls, fügte sie in Gedanken hinzu.
Während sie Wasser und Kaffeepulver in die Kaffeemaschine füllte, rechnete sie im Kopf grob nach: Seit Mitte August verbrachte sie jede ihrer knappen freien Minuten mit Sebastian, und jetzt war es Mai. Seit etwa neun Monaten trafen sie sich also regelmäßig, so regelmäßig, wie es ihre unregelmäßigen Dienstzeiten eben zuließen. Genauso regelmäßig landeten sie dann auch im Bett. Aber war er deswegen schon ihr Freund? Wir sollten unseren Beziehungsstatus demnächst mal klären, nahm sich Paula vor und holte zwei große Tassen aus dem Schrank.
»Hübsche Wohnung«, stellte ihre Mutter fest und setzte sich an den Küchentisch. »Mit den hohen Decken wirst du dich allerdings im Winter totheizen«, schmälerte sie ihr Lob gleich wieder.
»Keine Sorge, Mama, das kann ich mir leisten, Kriminalbeamte verdienen hier ein Schweinegeld«, entgegnete Paula spitz und holte die angebrochene Milchpackung aus dem mager ausgestatteten Kühlschrank. Vorsichtig und so, dass es ihre Mutter nicht sehen konnte, roch sie daran– es würde sie nicht wundern, wenn sie sauer wäre. Noch gut, entschied sie erleichtert und füllte ein blaues Milchkännchen aus Ton, das sie vor vielen Jahren an einem Töpferstand auf dem Würzburger Weihnachtsmarkt gekauft hatte.
»Ach, die hast du immer noch?« Ihre Mutter hielt ihr die uralte Tasse mit der Aufschrift »Mamas Liebling« entgegen. »Die hab ich dir zu deinem fünfzehnten Geburtstag geschenkt, weißt du noch?«
Klar wusste sie das noch. Die Tasse war damals mit ihren Lieblingskaramellbonbons gefüllt gewesen. Nach jahrelangem Dasein als Kakaotasse hatte sie dann irgendwann die nächste Sprosse der Karriereleiter erklommen und die Aufgaben einer Kaffeetasse übernommen. Erst mit etwa zwanzig hatte Paulas Geschmack überrascht festgestellt, dass Kaffee ein durchaus genießbares Getränk war.
Die Jahre hatten ihre Spuren an der Tasse hinterlassen. Der Rand wies ein paar Macken auf, und seit ein paar Wochen gab es einen haarfeinen Riss quer durch die Glasur, aber noch war sie dicht. Und es war Paulas Lieblingstasse.
»Wie ist er denn?«, fragte ihre Mutter.
»Wie ist wer?«
»Na, dein Freund– erzähl mir von ihm.«
Paula stöhnte innerlich auf. Sind alle Eltern, insbesondere Mütter, so? Wenn sie jetzt »nett« sagen würde, wäre die Antwort für ihre Mutter sicherlich ungenügend. Also sagte sie das, was sie eigentlich zu erfahren wünschte.
»Er heißt Sebastian, ist fünfunddreißig Jahre alt, Gymnasiallehrer, und er sieht verdammt gut aus. Und er ist nett«, fügte sie dann doch noch hinzu.
»Wenn du damals nicht die blödsinnige Idee gehabt hättest, Polizistin zu werden, wärst du jetzt vielleicht auch Lehrerin. Dann hättet ihr zusammen Ferien und zwei gute Gehälter.«
Paula sah ihre Mutter entgeistert an. Was sollte man darauf antworten? Sie war froh, Kriminalbeamtin geworden zu sein. Ihr Job war genau das, was sie immer machen wollte. Wenn Sebastian von seiner Arbeit, den schwierigen Schülern und noch schwierigeren Eltern erzählte, war sie erst recht froh, keine Lehrerin geworden zu sein. Obwohl sich ihre Eltern längst daran gewöhnt haben sollten, dass sie einen anderen Beruf gewählt hatte, ritt ihre Mutter regelmäßig auf diesem leidigen Thema herum.
Paula hatte keinen Nerv für eine derart sinnlose Diskussion. »Was machst du überhaupt hier?«, fragte sie deshalb, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Sie füllte die Tassen mit dem etwas stark geratenen Kaffee. Den konnte sie jetzt gut gebrauchen, denn die Nacht war kurz gewesen. Ein zufriedenes Grinsen huschte über ihr Gesicht. »Wolltest du nicht mit Papa zu diesem komischen Klassentreffen fahren?«
»Himmel, ist der stark«, stellte ihre Mutter nach dem ersten Schluck fest und füllte ihre Tasse mit Milch auf. »Ja, das war eigentlich so geplant, aber richtig Lust hatte ich nicht dazu. All diese alten Leute, die reden nur noch über ihre Krankheiten und welche Mittelchen sie nehmen müssen. Echt gruselig, kann ich dir sagen.« Sie verzog angewidert das Gesicht. »Einen Tag mit denen hätte ich ja noch verkraftet, aber gleich eine ganze Woche? Nein, danke.«
Paula grinste. Ihr Vater war mit seinen siebenundsiebzig Lenzen genauso alt wie diese Leute, es waren schließlich seine Klassenkameraden von früher, die sich regelmäßig einmal im Jahr trafen. Ihre Mutter war fünfzehn Jahre jünger. Jetzt, im fortgeschrittenen Alter, schien sich das auf einmal bemerkbar zu machen.
»Und immer dieses Rumgehocke«, meckerte sie munter weiter. »Die können ja alle nicht mehr richtig laufen. Kaputte Hüften, Ersatz-Kniegelenke, Rheuma. Man könnte fast meinen, sie befinden sich in einem Wettkampf, als wollten sie sich gegenseitig mit ihren komplizierten Operationen und Arzneimittel-Dosierungen übertrumpfen, das reinste Medikamente-Wettrüsten ist das. Nee, das wollte ich mir diesmal einfach nicht antun. Und als du mir vorgestern von deinem freien Tag erzählt hast, stand mein Entschluss fest, dass ich dich besuchen komme. Ich habe also deinen Vater heute Morgen in aller Herrgottsfrühe in den Bus gesetzt und bin schnurstracks hierhergefahren. Wir hatten schließlich schon ewig keinen Mutter-Tochter-Tag mehr.«
Womit sie zwar recht hatte, aber Paula wäre im Moment ein Sebastian-Paula-Tag viel lieber gewesen. Die Frage nach der voraussichtlichen Dauer ihres Besuches stellte sie lieber nicht– das würde sie früh genug erfahren.
»Außerdem hat meine Kleine ja demnächst Geburtstag«, fügte ihre Mutter fröhlich an, womit auch geklärt war, dass sie vor Dienstag nicht wieder nach Hause fahren würde.
Paulas Begeisterung hielt sich in Grenzen. »Ich muss jetzt erst mal duschen«, sagte sie gähnend. »Lass uns danach irgendwo schön frühstücken gehen und uns überlegen, wie wir den Rest des Tages verbringen wollen.« Mit dem, was sie im Kühlschrank hatte, konnte sie niemandem ein Frühstück bieten, schon der Zustand der Milch war mehr als grenzwertig gewesen. Als Hausfrau hatte sie zugegebenermaßen nicht viel drauf. Im Vergleich zu ihrer Mutter und ihren Schwestern war sie da völlig aus der Art geschlagen.
Im Bad musterte sie sich kritisch im Spiegel und zwinkerte sich aufmunternd zu. »Dafür können die aber keine Verbrecher fangen«, flüsterte sie. Ihr Spiegelbild sah sie verschwörerisch an. »Und Motorrad fahren können die auch nicht«, stellte sie auch noch fest, als sie in die Duschkabine stieg. »Und schießen schon mal gar nicht.« Einigermaßen zufrieden mit sich und ihren eher fragwürdigen Fähigkeiten drehte sie das Wasser an.
* * *
»Du hast ja noch nicht mal deine Umzugskisten ausgepackt.« Ihre Mutter bedachte Paula mit einem strafenden Blick, als sie in frischen Klamotten aus dem Schlafzimmer kam. Gerade hatte sie sich mit der Tatsache, sie mehrere Tage an der Backe zu haben, einigermaßen angefreundet, da traf sie dieser Vorwurf. Oder war es nur eine Feststellung? Nein, ein Vorwurf, Paula kannte den nörgelnden Ton nur allzu gut.
»Ich hatte viel zu tun…« Ihre Ausrede klang entsetzlich dünn. Es war ja nicht so, dass Paula die vollen Kisten, die sich noch immer im Wohnzimmer stapelten, nicht stören würden, im Gegenteil. Aber sie konnte sich einfach nicht dazu aufraffen, sie auszupacken.
»Ach, Paula«, sagte ihre Mutter. »Du wohnst seit fast einem Jahr hier. Erzähl mir nicht, dass du in all den Monaten nicht einen einzigen Tag freihattest, um das zu erledigen.« Sie machte Anstalten, einen der Kartons zu öffnen.
Paula trat energisch zwischen ihre Mutter und die Umzugskisten. Schützend breitete sie ihre Arme aus. »Ich habe noch nichts vermisst, was dadrinnen ist. Mensch, Mutsch, irgendwann packe ich die schon noch aus.«
»Wie sieht das denn aus? Man könnte glauben, du ziehst gleich wieder um. Wir könnten doch zusammen…«
Paula fühlte sich in ihre Kindheit zurückkatapultiert, ein Déjà-vu: Sie war wieder die kleine Paula, die ihr wunderbar chaotisches Zimmer aufräumen sollte, weil sie sonst nicht fernsehen durfte. Sie hatte gedacht, diese Zeiten wären Schnee von gestern. Da hatte sie wohl falsch gedacht.
»Nein, das sind meine Kisten, und ich will die genau so, wie sie sind. Jetzt hör auf, rumzumeckern, verdammt. Willst du etwa einen Mutter-Tochter-Meckertag? Also, ich kann das nicht gebrauchen.«
»Du bist noch genauso stur wie früher«, begehrte ihre Mutter auf.
»Und das werde ich auch ganz sicher bleiben«, versprach Paula grantig.
»Das ist doch lächerlich, Paula, ich will dir doch nur helfen. Aber gut, dann helfe ich dir eben nicht…« Sie wirkte beleidigt.
Bevor Paula etwas Begütigendes sagen konnte, schlug ihr Handy an. Dankbar, aus dieser absolut absurden Situation gerettet zu werden, stürzte sie an den kleinen Apparat. Ohne auf das Display zu sehen, meldete sie sich mit einem schroffen »Ja?«.
»Paula? Bist du das?«, erklang Keesers Stimme an ihrem Ohr.
»Natürlich bin ich es, wer sonst sollte bitte schön an mein Handy gehen?«
»Hm, schon klar, du hast recht, aber du klingst etwas komisch… gereizt… Stimmt was nicht?«
Sie konnte ihm unmöglich sagen, dass ihre Mutter überraschend eingetroffen war und ihr ganz entsetzlich auf die Nerven ging, denn besagte Mutter konnte jedes Wort mithören.
»Es ist noch nicht mal acht Uhr morgens, noch dazu mein freier Tag, und da rufst du an, was ganz sicher nichts Gutes zu bedeuten hat. Ist doch ganz normal, dass ich da gereizt bin«, antwortete Paula schärfer als beabsichtigt. Dabei war sie froh, dass es Keeser war, der da am anderen Ende der Leitung hing. Denn wenn er anrief, gab es ganz bestimmt irgendwo eine Leiche. Was wiederum nach sich ziehen würde, dass Paulas freier Tag beendet war. Und somit auch dieser unglückselige Mutter-Tochter-Tag. Sie würde Keeser dafür küssen, ob er das wollte oder nicht.
»Wir haben hier einen Toten…«, sagte er dann auch wie erhofft.
»Wo soll ich hinkommen?«, unterbrach sie ihn erleichtert.
Keeser blieb ihr einige Sekunden lang eine Antwort schuldig, mit so viel Arbeitseifer hatte er ganz sicher nicht gerechnet. »Parkhaus in der Badstraße, also direkt bei dir um die Ecke.«
»Bin gleich da.« Sie klappte das Handy zu und versuchte, einen enttäuschten Gesichtsausdruck hinzubekommen. »Tut mir schrecklich leid, Mutsch, aber ich muss los. Das war Kollege Keeser. Er ist an einem Tatort und wartet dort auf mich.« Sie holte ihre Boots aus der Diele, setzte sich auf die Couch und zog sie an.
»Aber du hast doch frei.« Enttäuschung schwang in der Stimme ihrer Mutter mit.
»Darauf nehmen Mörder und Verbrecher leider keine Rücksicht.« Im angrenzenden Arbeitszimmer schnappte sie sich das Schulterhalfter, das sie tags zuvor über die Stuhllehne gehängt hatte, und schlüpfte hinein. Dann schloss sie die Tür ihres Schreibtisches auf und nahm ihre Dienstwaffe heraus. Aus einer Schublade holte sie das dazugehörige Magazin und schob es in die WaltherP5.
Ihre Mutter war ihr gefolgt und beobachtete sie mit skeptischem Blick. »Dass du bei der Arbeit eine Pistole tragen musst, finde ich ganz schrecklich. Ich würde mich wirklich besser fühlen, wenn du Lehrerin geworden wärst.«
Paula ging zu ihr und nahm sie das erste Mal, seit sie angekommen war, in den Arm. »Ach, Mutsch, ich habe diese Waffe in all den Jahren erst ein Mal benutzen müssen«, sagte sie sanft. Das war zwar ein bisschen untertrieben, es war zwei Mal gewesen, aber sie wollte ihre Mutter ja beruhigen. »Außerdem könnte man heutzutage auch schon in vielen Schulen eine Schusswaffe gebrauchen, um sich zu schützen.«
Ihre Mutter nickte schwach.
»Ich muss jetzt los. Und ich kann dir nicht sagen, wann ich zurückkomme. Wenn du also wieder nach Hause fahren möchtest, bin ich dir nicht böse.« Ganz im Gegenteil, fügte sie in Gedanken hinzu.
»Das wäre ja kompletter Blödsinn und zudem schade um das verfahrene Benzin«, bekam sie zur Antwort.
Da sage mal einer, Spritsparen käme allen Menschen zugute, dachte Paula.
»Nein, ich bleibe. Ich werde mir Landau ein bisschen ansehen, irgendwann wirst du ja Feierabend haben.«
»Dann solltest du nach etwas Essbarem Ausschau halten, ich hatte nämlich keine Zeit zum Einkaufen.« Paula schlüpfte in ihre neue cognacfarbene Lederjacke, die sie sich erst kürzlich gegönnt hatte. Sie hatte zum ersten Mal das Gefühl gehabt, mit fast neunundzwanzig Jahren endgültig aus dem Alter für Jeansjacken herausgewachsen zu sein.
Sie stopfte Handy und Papiere in die Taschen und reichte ihrer Mutter einen Zweitschlüssel. »Hier, damit kannst du kommen und gehen, wie du willst. Und heute Abend gehen wir schön zusammen essen, was hältst du davon?«
»So machen wir das«, bestätigte ihre Mutter und stand verloren in der fremden Wohnung herum. »Sei schön vorsichtig.«
»Versprochen«, sagte Paula und lief die Treppen hinunter. Sie war auf dem Weg zu einem Toten, von dem sicherlich keinerlei Gefahr mehr ausging.
* * *
Landau war um kurz vor acht Uhr noch nicht richtig aufgewacht. Paula mochte diese träge Sonntagsstimmung in den beinahe auto- und menschenleeren Straßen, egal, zu welcher Jahreszeit. Sie erreichte das Otto-Hahn-Gymnasium, an dem Sebastian seit dem Ende der Sommerferien unterrichtete. Dann bog sie in die Badstraße ein und dachte an endlose Monopoly-Abende, an denen sie mit ihren Eltern und Schwestern bis zur Erschöpfung beziehungsweise bis zum Bankrott des einen oder anderen Familienangehörigen gespielt hatte.
Eine Minute später stand sie vor dem Parkhaus. Alle Zufahrten und Zugänge waren von Beamten abgeriegelt worden, kein Unbefugter durfte den Tatort betreten. Ein paar Schaulustige standen auf der anderen Straßenseite herum und diskutierten eifrig, was sich wohl hinter den Mauern ihres Parkhauses zugetragen haben mochte.
»Der Herr Keeser erwaadet Sie schun«, begrüßte sie Polizeianwärter Berger und hob galant das weiß-rote Absperrband an, damit Paula bequem und ohne sich bücken zu müssen darunter hindurchgehen konnte.
»Danke, Berger.« Paula schmunzelte. Noch vor ein paar Monaten hätte sie nicht verstanden, was Berger ihr in seinem breiten Pfälzisch mitgeteilt hatte. Inzwischen wusste sie jedoch, was er ihr sagen wollte. »Wo finde ich die Herrschaften?«
»Ganz owwe,P5.«
Paula entschied sich für die Treppe, die außen am Parkhaus entlang nach oben führte. Keeser würde stolz auf sie sein, dass sie sich gegen den bequemen Fahrstuhl entschieden hatte. Er selbst mied Fahrstühle. Treppensteigen sei gut fürs Herz, behauptete er stets. Paula vermutete eher, dass er ein kleines Problem namens Klaustrophobie hatte, was der Bär von einem Mann natürlich nie freiwillig zugeben würde.
Ein Parkhaus wäre der letzte Ort, an dem sie sterben wollte. Sie mochte keine Parkhäuser. Am schlimmsten waren die unterirdischen Tiefgaragen. Die düstere, feuchtkühle, meistens schlecht beleuchtete Umgebung, das unheimliche Hallen von Schritten, auch der eigenen, gepaart mit dem Geruchscocktail aus Abgasen, Gummi, ausgelaufenem Öl und oft auch Urin verursachte bei ihr Unbehagen. Sie konnte die Angst nachvollziehen, die viele Frauen in Parkhäusern empfanden. Da sie selbst kein Auto besaß und mit dem Motorrad immer einen Platz zum Parken fand, musste sie glücklicherweise nie diese angsteinflößenden öffentlichen Parkgaragen benutzen. Dieses Argument sollte sie sich für ihre Mutter merken, die sich nach all den Jahren noch immer nicht daran gewöhnen wollte, dass ihre Tochter begeisterte Motorradfahrerin war.
Ob es sich um eine Frau handelt, die da tot auf dem fünften Parkdeck liegt?, überlegte sie, während sie weiter nach oben stieg. Wahrscheinlich nicht, entschied Paula nach kurzem Nachdenken, denn für sie gab es extra die sogenannten Frauenparkplätze, und die befanden sich normalerweise immer ganz unten und in der Nähe eines Ausgangs.
Sie erreichte die oberste Ebene und hielt kurz überrascht inne, da dieses Parkhaus nicht mit den Parkhäusern zu vergleichen war, die sie bisher kennengelernt hatte. Es war kein bisschen dunkel hier, ja es wirkte fast freundlich durch den hellen Anstrich von Boden und Decke. Und erfreulich luftig, denn durch die großzügigen Durchbrüche in den Außenwänden konnte frische Luft zirkulieren.
Paula ließ das Szenario auf sich wirken. Blaulicht pulsierte unter der niedrigen Decke, verursacht von einem Streifenwagen, der außerhalb ihres Gesichtsfeldes stehen musste– sie vermutete, auf der Auffahrt zu dieser Parkebene, denn genau ihr gegenüber wies ein Schild auf die Abfahrt hin.
Mehrere Beamte standen am anderen Ende des Parkdecks in der rechten Ecke und sprachen mit gedämpften Stimmen miteinander. Polizeiobermeister Becker entdeckte sie und nickte ihr einen Gruß zu.
Weiter links stand ein Auto, das einzige auf diesem Stockwerk, wie Paula schnell feststellen konnte. Dann waren da noch drei Männer in weißen Overalls, unverkennbar die Leute von der Kriminaltechnik. Zwei von ihnen leuchteten ganz in ihrer Nähe mit Taschenlampen in jede Ecke und jede Ritze des Parkdecks und nahmen den Boden zentimeterweise unter die Lupe, auf der Suche nach eventuellen Spuren, die der Täter hinterlassen haben könnte. Oder die Täterin.
Der Dritte, den Paula mittels seines buschigen Schnurrbartes eindeutig als Werner Dreißigacker, den Chef der kriminaltechnischen Abteilung, identifizierte, suchte mit einem Metalldetektor die gegenüberliegende Wand ab. Daraus schloss Paula, dass es sich wohl um eine Tat handeln musste, in der eine Schusswaffe involviert war. Was sonst sollte ein Metalldetektor schließlich finden, wenn nicht ein Projektil? Oder die abgebrochene Spitze eines Schwertes, aber davon ging Paula erst mal nicht aus.
Zu ihrer Überraschung und völlig deplatziert stand mitten im Raum ein verlassener Aufsitzrasenmäher. Was zum Teufel macht ein Rasenmäher in einer Parkgarage?, fragte sich Paula. Als sie sich dem Gefährt näherte, erkannte sie jedoch, dass es sich um eine Aufsitzkehrmaschine handelte.
Direkt dahinter entdeckte sie Keeser. Obwohl sein Kopf von einer tief hängenden Querstrebe verdeckt war, erkannte sie ihn sofort: Hände in den Hosentaschen und kariertes Hemd über unübersehbarem Bauch– seine »sexuelle Schwungmasse«, wie er diesen Bauch liebevoll nannte. Ein Bewohner Bayerns würde ihn ungeniert und weit treffender als »Ranzen« bezeichnen. Erst als sie die Kehrmaschine umrundete, sah sie Andreas Knopp, den Gerichtsmediziner, der auf dem Boden kniete.
Als hätte Keeser ihre Anwesenheit gespürt, drehte er sich um. Er musste sich tief unter einen Deckenträger bücken, um sie sehen zu können. Er winkte sie herbei.
»Einen wunderschönen guten Morgen, liebste Kollegin«, begrüßte er sie fröhlich.
»Unter ›wunderschön‹ stelle ich mir eigentlich was anderes vor«, antwortete Paula mit düsterer Miene.
»Oh, oh, ein typischer Fall von Schlafus interruptus.« Keeser wechselte mit Knopp einen wissenden Blick. »In deinem Alter war ich auch immer mies drauf, wenn mich sonntags jemand vor zwölf geweckt hat.« Er reichte ihr ein Paar frische Einmalhandschuhe und machte dabei einen übertrieben tiefen Diener. »Du siehst mich zutiefst zerknirscht und voller Reue ob der Tatsache, dass ich dich so rüde aus den Federn geworfen habe.« Sein freches Grinsen war jedoch ganz gewiss kein Ausdruck von Reue, geschweige denn von Zerknirschtheit.
»Bilde dir bloß nichts auf meine miese Laune ein, die hast nämlich nicht du zu verantworten.« Paula schnappte sich die Handschuhe und zog sie über ihre Finger. Dann betrachtete sie den toten Männerkörper, der in einer großen, teilweise schon angetrockneten Blutlache lag. Womit sich ihre Theorie bestätigte: Ganz oben parken nur Männer.
»Ach, nicht?« Er schien enttäuscht.
»Nein, meine Mama kann das auch.«
»Deine Mama? Hat sie dich so früh angerufen?«
»Angerufen? Das wäre ja noch okay gewesen, aber sie stand einfach vor meiner Tür.«
Keeser sah sie dümmlich an.
»Merk dir den Gesichtsausdruck– der steht dir wirklich gut«, sagte Knopp lachend.
»Glaub mir, ich hab mindestens genauso doof aus der Wäsche geguckt wie du.« Sie tätschelte Keeser tröstend den Arm und deutete dann auf den Toten zu ihren Füßen. »Mit wem haben wir das Vergnügen?«
»Benedikt Eichenlaub.« Keeser reichte ihr die prall gefüllte Brieftasche des Mannes. »War sie denn nicht angemeldet?«
»Nein. Sie stand aus heiterem Himmel plötzlich da und wollte gleich meine Umzugskartons ausräumen«, murmelte Paula übellaunig, während sie den Inhalt des teuer aussehenden Ledermäppchens –sie tippte auf Krokodil, echtes Kroko– durchsah. Diverse Kreditkarten, unter anderem eine Visa-Karte, eine BMW-Premium-Card in Gold (davon hatte sie noch nie im Leben etwas gehört) und eine American-Express-Platinum-Karte. Wozu brauchte man die alle? Paula besaß keine einzige Kreditkarte, ihr genügte ihre Bankkarte.
Sie wedelte mit dem Plastikgeld vor Keesers Nase herum. »Scheint ja keinen armen Schlucker erwischt zu haben.«
»Mitnichten. Ihm gehörte die Reifenfabrik in Offenbach. ›Gummi Eichenlaub‹, noch nie davon gehört?«
Paula verneinte und steckte die Karten zurück an ihren Platz. Im Geldscheinfach befand sich ein dickes Bündel Scheine, zwei Fünfhunderter, die wie frisch gedruckt aussahen, vier Hunderter, drei Fünfziger und mehrere Zwanzig-Euro-Scheine. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihr Geldbeutel jemals in ihrem Leben so viel Geld beherbergt hatte. »Dann war das wohl eher kein Raubmord.«
»Seine goldene Uhr hatte er auch noch am Arm«, bemerkte Keeser.
»Warum musste er dann sterben? Hass? Neid? Oder war er nur zur falschen Zeit am falschen Ort?«, fragte Paula, während sie etwa ein Dutzend Visitenkarten hervorzog. Allesamt von diversen Firmen und deren Direktoren oder Managern. Firmenkontakte, die sie morgen überprüfen mussten. An einem Sonntag würden sie wohl niemanden erreichen können.
Dann hielt sie ein Foto in der Hand. Schon etwas abgeschabt und verblichen, sicher eine von Haus aus unscharfe Fotografie, aber es war eindeutig eine Frau darauf zu sehen. Das Datum auf der Rückseite bestätigte Paulas Annahme, dass das Bild schon einige Jahre auf dem Buckel hatte. »2001« war mit schwungvollen Lettern daraufgekritzelt. Paula ging näher an die Brüstung, um mehr Licht zu bekommen. Sie konnte trotzdem nicht viel mehr erkennen.
Keeser folgte ihr tief gebückt und trat zu ihr. Hatte schon Paula das Gefühl, bei der geringen Deckenhöhe und den in regelmäßigen Abständen noch niedrigeren Betonstützstreben den Kopf einziehen zu müssen, so konnte sich Keeser nur geduckt fortbewegen. Ihm fehlten mindestens zwanzig Zentimeter, um aufrecht stehen zu können. Wer plant eigentlich so was? Zwerge?, fragte sich Paula.
Keeser nahm ihr das Bild aus der Hand und betrachtete es eingehend.
»Nicht dein Typ, das sehe ich, obwohl es unscharf ist«, sagte Paula grinsend.
»Darum geht es gar nicht. Ich habe das komische Gefühl, diese Frau zu kennen. Das war schon vorhin mein erster Gedanke, als ich die Brieftasche untersuchte. Sie erinnert mich an jemanden, aber ich komme nicht drauf, an wen.«
»Keeser und seine Frauen.« Paula zwinkerte Knopp zu. »Wird wohl Frau Eichenlaub sein«, vermutete sie, nahm ihm das Foto ab und steckte es wieder in das Mäppchen. »Wenn er denn überhaupt verheiratet ist.«
»Keine Ahnung, ich weiß von dem Kerl nur, dass er vor Geld stinkt und seit Jahren größere Probleme mit diversen Umweltorganisationen hat.«
»Hat der Gute etwa mit seiner Firma die Umwelt vergiftet?«
»Die Umweltschützer behaupten das jedenfalls.« Keeser tippte auf die Brieftasche in Paulas Hand und zog die buschigen Augenbrauen kraus. »Wenn ich nur wüsste, an wen mich die Frau auf dem Foto erinnert. Das macht mich echt verrückt.«
»Na, das ist doch schon mal ein wunderbarer Ansatzpunkt«, freute sich Paula. »Am wenigsten mag ich nämlich die Opfer, die keine Feinde oder Neider hatten und von allen geliebt und geschätzt wurden. Da machen die Ermittlungen gar keinen Spaß, weil man immer gegen eine Wand von Nettigkeit rennt.«
Sie tätschelte ihm den Arm. »Und wer die Holde auf dem Bild ist, werden wir auch herausfinden.«
»Er war zuletzt in der Presse, weil er seine Firma vergrößern wollte«, erzählte Keeser. »Zu diesem Zweck hatte er durch einen Strohmann ein an sein Firmengelände angrenzendes Gelände erworben. Angeblich Naturschutzgebiet, das normalerweise gar nicht hätte verkauft werden dürfen. Und an ihn schon mal gar nicht. Ein Riesen-Hickhack, kann ich dir sagen.«
Paula war wie immer schwer beeindruckt von Keesers Wissen.
»Was du so alles weißt.«
»Ich interessiere mich eben für meine Heimat. Vielleicht solltest du endlich die Tageszeitung abonnieren, dann wärst du auch besser auf dem Laufenden«, schlug Keeser vor, als er mit Paula zu der Leiche zurückging.
»Politisch war er zuletzt auch recht rührig. Soweit ich mich erinnern kann, wollte er für das Bürgermeisteramt in Offenbach kandidieren«, sagte Knopp.
Noch so einer, der mehr weiß als ich, musste Paula zugeben.
»Ein Umweltsünder, der sich quasi politisch absichern will, damit er weiter sündigen kann«, resümierte Keeser.
»Genau so sahen das die Umweltaktivisten auch. Ganz zu schweigen von seinen politischen Gegnern«, bestätigte Knopp.
»Also noch mehr Verdächtige, das ist doch mal was ganz Neues«, sagte Paula hocherfreut. »Und so, wie es aussieht, hat ihn eine Kugel aus der Welt der Lebenden befördert.« Das Loch, an dessen Rändern sich der Stoff des hellen Trenchcoats mit Blut vollgesaugt hatte, war nicht zu übersehen.
»Projektil«, verbesserte Keeser sie.
»Dibbelschisser«, quittierte Paula seine Korrektur, ohne ihn anzusehen.
Keeser hob überrascht die Augenbrauen. »Sieh an, sie ist ja doch schon der pfälzischen Sprache mächtig.«
»Eine Kugel, die sich durch seinen Rücken in seinen Körper gebohrt hat«, bestätigte Knopp, indem er Paulas eher umgangssprachlichen Ausdruck verwendete. »Extrem große Austrittswunde im vorderen Bauchbereich, ich tippe auf ein größeres Kaliber. Hat so einiges in seinem Innenleben zerstört, wie ich bei der ersten kurzen Untersuchung feststellen konnte. Er war auf der Stelle tot.«
»Hinterrücks erschossen?« Keeser sah in die Richtung, aus der die Kugel in etwa gekommen sein musste.
»Ja, nicht die feine englische Art.« Knopp erhob sich mit laut knackenden Kniegelenken.
»Mensch, Knoppi, du hast dich auch schon mal jünger angehört«, neckte Keeser ihn.
»Da war ich wahrscheinlich auch jünger«, murrte Knopp und rieb sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte Knie. »Dass meine Kundschaft immer am Boden rumliegt, macht die Sache nicht besser.«
»Wurde der Schuss aus nächster Nähe abgegeben?«, fragte Paula. Sie versuchte sich einen möglichen Tathergang vorzustellen. Vielleicht war Eichenlaub mit in den Rücken gepresster Waffe von seinem Angreifer hierherdirigiert worden.
»Soweit ich das bisher beurteilen kann, war es ein Schuss aus größerer Entfernung«, sagte Knopp und machte damit Paulas Szenario zunichte.
Sie sah sich prüfend um. »Dann muss der Schütze irgendwo dort hinten gestanden haben.« Sie zeigte auf das andere Ende des Parkdecks, das auch schon ihr Kollege als Ausgangspunkt für den Schuss auserkoren hatte. »Am Ende der Außentreppe oder an der Ecke bei der Abfahrt.«
»Oder hinter einem Auto, das zu dieser Zeit vielleicht dort parkte«, ergänzte Keeser. »Das Auto des Täters, ein anderer wäre wohl nicht weggefahren, ohne die Leiche zu melden.«
»Wie weit mag das sein? Zwanzig, dreißig Meter, eher mehr. Das ist eine ganz schöne Entfernung«, stellte Paula fest. »Und dann dieser präzise Schuss… Könnte ein Profi gewesen sein.« Sie stieß Keeser mit dem Ellenbogen in die Rippen und grinste frech. »Mein Kollege hier würde das sicherlich nicht schaffen. Er war schon eine Ewigkeit nicht mehr beim Schießtraining.«
»Schießen ist wie Radfahren, das verlernt man nicht«, brummte Keeser grantig.
Paula warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Aber Übung macht den Meister, Herr Keeser.«
»Ich tippe auf einen einzigen Schuss.« Er ging gar nicht auf ihr Gestichel ein. »Wenn nämlich vor diesem tödlichen Schuss ein anderer Schuss danebengegangen wäre, hätte sich das Opfer ganz sicher umgedreht, und dann hätte ihn diese Kugel nicht von hinten erwischt.«
»Sag ich doch, das war ein Profi. Und dann kann Dreißigacker mit seinen Leuten einpacken, denn dann wird er keine Hülse und auch keine anderen Spuren finden.«
»Ein Profikiller in Landau?« Keeser sah sie ungläubig an. »Mach dich nicht lächerlich.«
»Es gibt nichts, was es nicht gibt.«
»Wollt ihr den Todeszeitpunkt gar nicht wissen?« Knopp packte seinen Koffer zusammen.
»Blöde Frage, natürlich wollen wir«, antworteten Paula und Keeser unisono.
»Wir wollten dir nur die einmalige Chance geben, es mal von dir aus zu sagen, ohne dass wir dich nötigen müssen und du dann wieder rummeckerst«, ergänzte Keeser.
»Ich meine natürlich den ungefähren Todeszeitpunkt. Ihr wisst ja, dass ich mich vor der ausführlichen Sektion nicht festlegen will, aber so viel kann ich schon mal sagen: Die Totenstarre hat noch nicht eingesetzt. Nach meiner Schätzung liegt der Zeitpunkt des Todes noch keine fünf Stunden zurück. Allerdings ist es hier eher kühl, was den Eintritt der Leichenstarre erheblich verlangsamt.«
»Saach schunn und babbel nit«, unterbrach Keeser ungeduldig.
»Gegen vier Uhr morgens, plus/minus.«
»Alla, geht doch.« Keeser grinste zufrieden.
»Mit dem genauen Ergebnis müsst ihr euch allerdings ein wenig gedulden, denn ich werde die Autopsie erst morgen früh vornehmen. Ich habe heute nämlich eigentlich frei«, verkündete Knopp zufrieden lächelnd.
»Wir auch«, beschwerte sich Paula, und Keeser nickte beipflichtend.
»Das mag sein, aber ihr habt keine strenge Ehefrau, die schon seit gestern in der Küche steht und ein aufwendiges Sonntagsmenü köchelt. Wir erwarten nämlich unsere Älteste samt zukünftigem Ehemann und dessen Eltern. Wenn ich mich da drücken würde, wäre ich in kürzester Zeit ein geschiedener Mann«, erklärte Knopp. Er warf einen drohenden Blick über den Rand seiner Brille. »Und dann müsste ich mich erst einmal bei dir einquartieren, lieber Bernd.«
»Lass gut sein«, wehrte Keeser lachend ab. »So viel Alkohol könnte ich gar nicht trinken, um das ertragen zu können. Dann wirst du also demnächst Schwiegervater und vielleicht sogar Opa?«
Knopp schenkte ihm einen kummervollen Blick. »Sieht so aus. Dabei bin ich eigentlich noch gar nicht so scharf drauf, ›Opa‹ hört sich nämlich schrecklich nach altem Mann an.«
Keeser verzog das Gesicht zu einem spöttischen Grinsen und klopfte Knopp auf die Schulter. »Na, dann passt du ja wunderbar zu deinen alten Knien, alter Freund. Grüß Sonja auf jeden Fall recht herzlich von mir.«
»Ein Schuss müsste hier sehr hallen. Das hätten die Anwohner doch mitbekommen«, überlegte Paula laut. »Ist der Funkleitzentrale etwas gemeldet worden? Dann hätten wir einen genaueren Anhaltspunkt, was die Todeszeit angeht.«
»So viele Anwohner gibt es hier gar nicht. Das dort drüben«, Keeser deutete auf das große alte Sandsteingebäude auf der anderen Seite der Badstraße, »ist eine Schule. Die ist nachts verlassen. Zum Stadtzentrum hin liegen größtenteils Geschäfte, Lokale oder gleich um die Ecke die VR-Bank, auch da ist zu dieser nachtschlafenden Zeit nichts mehr geöffnet. Außerdem liegen um drei Uhr morgens die meisten braven Bürger in ihren Betten und schlummern tief und fest. Ein einmaliges Geräusch, von dem man geweckt wird, kann man dann meist gar nicht zuordnen.«
Den Worten ihres Kollegen zum Trotz wählte Paula die Nummer der Leitzentrale.
»Guten Morgen, hier spricht Kriminaloberkommissarin Paula Stern. Ich bin hier an einem Tatort in der Badstraße in Landau. Ich hoffe, Sie können mir bei der Klärung des Tathergangs helfen. Wurden letzte Nacht zwischen… Mitternacht und vier Uhr morgens Schüsse oder Ähnliches gemeldet?«
Sie wartete geduldig und hörte dabei im Hintergrund Klingeln, Surren und Stimmen. Es schien viel los zu sein in der Leitstelle.
»Nichts«, sagte Paula schließlich enttäuscht, bedankte sich und beendete das Gespräch. »Keiner hat was gehört oder gemeldet. Keeser hatte recht.«
»Wie immer halt«, sagte der gönnerhaft.
»Wer hat denn dann die Polizei gerufen?«, wandte sich Paula an Knopp, Keesers letzte Bemerkung geflissentlich ignorierend.
»Soviel ich weiß, der Hausmeister. Hat ihn gefunden, als er die Decks kehren wollte«, antwortete Knopp.
»Und was hat er erzählt?«
»Keine Ahnung, das ist eure Baustelle, ich bin immer nur wegen der toten Zeugen hier. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich meinen toten Zeugen jetzt gern abtransportieren lassen.«
Eine Frage hatte Paula doch noch. »Sie sprachen vorhin von einer Austrittswunde, aber die Kugel ist noch nicht sichergestellt worden?«
»Meines Wissens nicht, sie müsste irgendwo im Beton stecken«, vermutete Knopp und winkte seinen Mitarbeitern.
Dreißigacker näherte sich ihnen. Er strahlte Unzufriedenheit aus. »Nichts. Wir haben nichts gefunden. Ein Bonbonpapier, diverse ausgespuckte und platt getretene Kaugummis, ein paar Zigarettenstummel, aber keine Hülsen.«
»Dann hat sie der Täter wohl mitgenommen, was einmal mehr auf einen Profi hinweisen würde«, sagte Paula. »Und das Projektil?«
»Auch negativ, die Wände sind sauber. Der Metalldetektor hat nichts angezeigt. Außer der Armierung befindet sich im Beton nichts Metallisches.« Dreißigacker zuckte ratlos mit den Schultern.
»Wenigstens ein Einschussloch?«, hakte Paula hoffnungsvoll nach.
»Meinst du, der Täter hat sich die Zeit genommen, nach dem Projektil zu suchen und es aus der Wand zu kratzen?« Keeser klang skeptisch.
»Die Hülse hat er ja offensichtlich auch aufgesammelt«, versuchte Paula ihre Theorie zu untermauern.
»Nie und nimmer«, widersprach Keeser. »Dafür hatte er keine Zeit. Er musste immerhin damit rechnen, dass jemand den Schuss gehört hat und die Polizei verständigt. Ein Profi würde nie so handeln. Profis verwenden nicht registrierte Waffen. Die Projektile können ihnen schnurz sein.«
»Profis verwenden normalerweise Schalldämpfer, damit man den Schuss nicht hört«, sagte Paula. Sie drehte sich langsam einmal um die eigene Achse. »Aber wo ist die Kugel dann?«
»Das können euch die Ballistiker sagen, wenn sie anhand von Eintrittswinkel und Verlauf des Schusskanals die Flugbahn berechnen«, sagte Knopp.
Paula schien ihn nicht zu hören. »Warum war Eichenlaub überhaupt hier? Wenn wir davon ausgehen, dass er hier geparkt hat, war er wahrscheinlich auf dem Weg zu seinem Wagen…« Sie nahm das einzige Fahrzeug auf der Ebene ins Visier. »Wenn sein Wagen nicht geklaut wurde, dann ist das vielleicht sein Auto.«
Keeser sah in die Beweismitteltüte, in der sich die Privatsachen des Toten befanden, und holte einen Schlüsselbund hervor. »Das werden wir gleich wissen.« Er betätigte die Fernbedienung des Autoschlüssels, der daran hing. Augenblicklich ertönte ein Piepton, und die Blinker des BMW begannen hektisch aufzuleuchten. »Bingo«, sagte er zufrieden. »Nettes Wägelchen.«
Paula ging auf das »Wägelchen« zu, das auf dem letzten Parkplatz auf der linken Seite des Parkdecks stand. Mit zusammengekniffenen Augen inspizierte sie das Fahrzeug.
»Ha!«, rief sie schließlich triumphierend aus. »Herr Dreißigacker, ich hab eure Kugel gefunden.« Sie deutete auf eine Stelle im Holm zwischen Heckscheibe und hinterem Seitenfenster.
»Oh, nein.« Keeser stöhnte auf und kam zu ihr herüber. »Das Auto wurde auch erschossen. Schade um das edle Teil.« Er schien sich über die Tatsache eines Projektils in einer Nobelkarosse mehr zu grämen als über eine tödliche Kugel in einem Menschen.
»Mein Gott, Keeser, das ist doch nur ein Haufen Blech«, bemerkte Paula verständnislos.
»Ja, aber was für ein Auto. Du scheinst ja keine Ahnung zu haben.«
»Klar weiß ich, was das ist: ein BMW«, antwortete Paula, die allerdings mehr über Motorräder als über Autos wusste.
Keeser schnaubte verächtlich. »Ein BMW«, äffte er sie nach.
»Das ist das funkelnagelneue BMW Coupé!«, rief er empört. Seine Stimme hallte durch das leere Parkdeck.
Die Polizeibeamten sahen erschrocken zu ihnen herüber.
»Ein 645i. Der kostet ohne Extras schlappe fünfundsiebzigtausend Euro, mit Extras ist er unbezahlbar. Nicht gerade das Auto, das sich unsereins leisten kann«, klärte er Paula mit gedämpfter Stimme und einem begehrlichen Leuchten in den Augen auf.
»Kein Mensch bezahlt so ein Auto tatsächlich, wahrscheinlich gehört es der Leasingbank«, gab Paula zu bedenken. Und ich fürchte, du könntest dir nicht mal die monatlichen Leasingraten leisten, fügte sie im Geiste hinzu.
Sanft strich Keeser über das silbermetallic-glänzende Dach. »Der hat niedliche dreihundertdreiunddreißigPS unter der Haube, da kann sich dein Motorrad verstecken.«
Er öffnete die Fahrertür mit Hilfe eines seiner großen karierten Stofftaschentücher und warf einen Blick ins Innere des Wagens. »Ledersitze, was sonst«, stellte er schwärmerisch fest. »Armaturen in Edelholzausführung, Platane rotbraun dunkel, nur vom Feinsten.«
»Du hörst dich an wie ein Autoverkäufer«, lästerte Paula.
»Schnupper doch mal, wie es dadrinnen riecht«, forderte er sie mit verzücktem Lächeln auf.
Paula nahm eine Nase voll von der Luft aus dem Inneren des Wagens. Sie konnte jedoch nichts Besonderes feststellen und zuckte hilflos mit den Schultern.
»Es riecht neu. Weder Parfüm noch Zigarettenqualm haben diesen wunderbaren Wagen entweiht«, erklärte Keeser.
»Du hast echt ’nen Knall, Kollege.« Paula schüttelte den Kopf und sah Dreißigacker hilfesuchend an. »Schaffen Sie den Wagen schnellstens in die Kriminaltechnik, sonst dreht Kriminalhauptkommissar Keeser noch durch.«
»Ich hatte noch nie ein neues Auto, immer nur gebrauchte. Und in so was hab ich noch nicht einmal gesessen…«
»Untersteh dich«, warnte ihn Dreißigacker. »Du kannst gern Probe sitzen, wenn wir die Spuren gesichert haben, aber jetzt verzieh dich und lass uns unsere Arbeit machen.« Er zückte sein Handy, um den Abtransport der Nobelkarosse zu veranlassen.
In diesem Moment beugte sich Keeser in den Wagen. Er zog den Bauch ein, um sich einigermaßen um das Lenkrad herumbiegen zu können.
»Keeser, was soll das?«, rief Dreißigacker ungehalten.
Keesers gedämpfte Stimme kam kaum verständlich aus dem Inneren des Wagens. »Ich will nur kurz was schaun…« Er steckte den Schlüssel ins Schloss, um die Zündung einzuschalten. Gleich darauf zog er ihn wieder heraus und richtete sich ächzend auf. Er hielt einige lose Blätter in der Hand. »Tachostand: Zweihundertneununddreißig Kilometer«, teilte er den Umstehenden ehrfürchtig mit und überflog die Papiere aus der Mittelkonsole. »Der Wagen wurde gestern Morgen beim Händler abgeholt. Viel hat er also noch nicht erleben dürfen.«
»Immerhin einen Mord und eine Schussverletzung«, sagte Paula trocken.
Keeser trennte sich nur schwer von dem schönen Auto.
»Und entweiht ihn bloß nicht mit irgendwelchen Gerüchen. Am besten, ihr duscht vorher«, mahnte Paula Dreißigacker, woraufhin sie von Keeser einen vernichtenden Blick erntete. Er murmelte undeutlich etwas in seinen stoppeligen Dreitagebart, das sich wie »Bananen« oder auch »Banausen« anhörte– Paula tippte auf Letzteres.
»Er war also auf dem Weg zu seinem Wagen. Anscheinend kam er über die Treppe. Warum nicht mit dem Fahrstuhl, der sich hier gleich neben seinem Wagen befindet?«, fragte Paula. »Vielleicht litt er ja genauso unter Klaustrophobie wie einer meiner engsten Kollegen. Ich will hier allerdings keine Namen nennen.«
Der Kollege, dessen Namen sie nicht nannte, sah sie grantig unter buschigen Augenbrauen hervor und über üppige sexuelle Schwungmasse hinweg an.
»Der isch kabbud«, vermeldete Hans Becker, der zu ihnen rübergekommen war.
Paula sah jetzt auch das Schild, auf dem »Außer Betrieb« stand. »Das wäre also geklärt. Bleibt noch die ungewöhnliche Uhrzeit. Was treibt ein Unternehmer Samstagnacht um vier in einer Parkgarage?«
Ihre Frage blieb unbeantwortet.
Paula nahm Keeser die Beweismitteltüte ab, in der sich neben der Brieftasche und einer goldenen Uhr auch noch andere Gegenstände befanden. Außer einem gebrauchten Stofftaschentuch, einem teuer aussehenden Kugelschreiber, einem Handy und einer Handvoll Kleingeld, das der Tote wohl ganz männertypisch in seiner Hosentasche herumgetragen hatte, beinhaltete die Tüte auch einen ledergebundenen Taschenkalender. Die Ecke eines Zettels spitzte zwischen den Utensilien hervor. Ein Parkschein.
»Bezahlt um vier Uhr einundzwanzig.« Paula drehte sich zu Knopp um, der gerade den Reißverschluss des Leichensackes schloss. »Herr Knopp, alle Achtung, Sie lagen mit Ihrer Schätzung des Todeszeitpunkts ziemlich gut!«
Knopp nickte und machte nicht den Eindruck, als würde ihn diese Tatsache irgendwie überraschen. Er nutzte die Aufmerksamkeit, die ihm die Kripoleute schenkten, und deutete auf den eingepackten Leichnam. »Wenn ihr uns nicht mehr braucht, empfehlen wir zwei uns jetzt.«
Keeser winkte kurz. »Geht nur, das bisschen hier machen wir auch ohne dich und deinen toten Kameraden.«
Paula sah Knopp und seinen Leuten nach. »Also, ich möchte niemals in einem Parkhaus sterben müssen.«
»Ich weiß gar nicht, was du hast. Dieses Parkhaus wurde immerhin schon einmal vom ADAC zum schönsten Parkhaus von Rheinland-Pfalz gewählt«, verteidigte Keeser den Tatort, als wäre dieser Sieg auch ein Gütesiegel für erstrebenswerte Orte zum Sterben.
Paula betrachtete noch einmal den Parkschein in ihrer Hand und insbesondere die Ankunftszeit: einundzwanzig Uhr siebenundvierzig. Sie rechnete nach.
»Eichenlaub hat etwas über sechs Stunden hier geparkt«, sagte sie erstaunt. »Was hat er denn in dieser langen Zeit getrieben?«
»Wir werden es früher oder später herausfinden«, prophezeite Keeser. »Eines allerdings wundert mich: Was würdest du machen, wenn du dein neues Motorrad vom Händler abgeholt hättest?« Er sah Paula erwartungsvoll an.
Die wusste nicht recht, worauf er hinauswollte. »Fahren, nehme ich mal an. Ich würde ganz sicher eine richtig schöne Tour damit machen.«
»Genau. Ich würde mit so einem tollen neuen Auto auch erst einmal eine richtig schöne Tour machen. Aber was macht Eichenlaub? Er fährt ein paar lächerliche Kilometer und stellt den neuen Wagen dann sieben Stunden in ein Parkhaus.«
»Dann gab es anscheinend etwas Wichtigeres für ihn, als durch die Gegend zu fahren«, schlussfolgerte Paula. Sie sah sich prüfend auf dem Parkdeck um. »Gibt es hier Videoüberwachung?«, fragte sie die herumstehenden Polizeibeamten.
»Nur unne am Kasseaudomat und im Schrankebereisch«, gab Becker prompt Auskunft. »Hier owwe nix. Der Hausmeeschder gebbt mir dann schbäder die Uffzeichnunge.«
Keeser sah sie prüfend an, ob sie auch alles verstanden hatte.
»Das übernehmen wir, ich würde sowieso gern mit dem Mann sprechen. Wo ist er?«, fragte Paula Becker. Sie hatte verstanden.
»Der huggt im Schdreifewache und schdeht echt newwer der Kapp.«
»Newwer der Kapp?« Hier endete ihr Pfälzisch-Vokabular.
»Neben der Kappe, er steht sozusagen neben sich selbst«, erläuterte Keeser zuvorkommend.
»Na, dann reden wir doch mal mit ihm«, schlug Paula vor.
»Der redd nix, mir hänns aach schon prowiert«, bremste Becker ihren Elan. »Eckerle hääßt er, des hot er uns grad noch verraade. Ansunschten isser schdumm wie en Fisch.«
Keeser musste ein Grinsen unterdrücken, als er das von Verständnislosigkeit gezeichnete Gesicht seiner Kollegin betrachtete. »Wenn er nicht redet, dann steht er wohl noch unter Schock. Schließlich findet man ja nicht jeden Tag eine Leiche.« Er klopfte Becker wohlwollend auf die Schulter. »Wir werden es versuchen, aber wenn wir auch nichts aus ihm herausbekommen, muss man eventuell jemanden von der Notfallseelsorge herholen, der sich um ihn kümmert.« Er nahm Paula am Ellenbogen und führte sie zum Streifenwagen hinüber, der noch immer sein Blaulicht im ewig gleichbleibenden Rhythmus über die Decken und Wände des Parkhauses streifen ließ. »Wie ich sehe, kommst du doch immer wieder an deine sprachlichen Grenzen.«
»Nur bei Becker, der Mann treibt mich noch in den Wahnsinn. Könnte der nicht wenigstens ein bisschen versuchen, hochdeutsch zu reden?«
»Um Himmels willen, bloß das nicht. Hast du schon mal gehört, wenn er das tut? Dann verstehst du ihn trotzdem nicht, und ich auch nicht mehr.« Sein lautes Lachen hallte durch das leere Parkdeck.
Erst jetzt sah Paula auf dem Rücksitz des Einsatzwagens eine in sich zusammengesunkene Person sitzen. Aufgrund der Halbglatze, die von einem weißen Haarkranz umsäumt war, schloss sie auf einen älteren Mann. Die Autotür war nicht geschlossen. Paula ging vor ihm in die Hocke.
»Herr Eckerle?«, sprach sie ihn leise an. »Mein Name ist Paula Stern, ich bin von der Kriminalpolizei und würde Ihnen gern einige Fragen stellen. Wie geht es Ihnen?«
Der Angesprochene hob langsam den Kopf. Leichenblass saß er vor ihr und sah sie aus verwirrten grauen Augen an. Er war in der Tat ein älterer Mann. Weit über sechzig, wenn nicht sogar schon siebzig.
Müsste er nicht schon lange in Rente sein? Zum Spaß arbeitet er sicherlich nicht hier als Hausmeister, vielleicht bessert er seine viel zu kleine Rente mit diesem Job auf, überlegte Paula. Wirklich gut schien es ihm nicht zu gehen.
»Wissen Sie, wo Sie sind?«, fragte sie ruhig.
Der Mann sah durch sie hindurch. Er machte nicht den Eindruck, als wäre ihre Frage bei ihm angekommen. Doch dann nickte er wie in Zeitlupe.
»Schön, Herr Eckerle.« Paula lächelte ihn freundlich an. »Sie sollten nicht länger hierbleiben. Gibt es eventuell einen Raum in diesem Gebäude, in dem wir uns in Ruhe unterhalten können?«
Wieder nickte der Mann. Er schien jetzt aufmerksamer zu sein.
Paula richtete sich auf und winkte Keeser heran. Dann hielt sie Eckerle ihre Rechte als Aussteighilfe entgegen. Er kletterte unbeholfen aus dem Fond des Wagens. Seine Knie wollten unter ihm nachgeben, aber dank Keesers kräftigem Griff unter eine seiner Achseln blieb er aufrecht stehen.
»Wir sollten einen Arzt rufen«, riet er und hakte den schwächelnden Mann unter.
Paula ärgerte sich, dass Becker das nicht längst getan hatte. Alles musste man selbst machen. Grantig wählte sie die Nummer der Rettungsleitstelle und orderte einen Krankenwagen ins Parkhaus.
»Wo ist denn der Raum?«, fragte sie Eckerle. »Hier oben?«
Ein schwaches Kopfschütteln machte ihr klar, dass sie ihn in Ermangelung eines einsatzbereiten Fahrstuhles nach unten schleppen mussten.
Zum Glück war Eckerle eher klein und schmächtig gebaut. Keeser führte ihn Schritt für Schritt über die Abfahrt hinunter. Die Bewegung schien dem Hausmeister gutzutun, langsam bekam er wieder mehr Farbe. Vielleicht lag es auch am Ortswechsel, dass er die letzten Schritte im Erdgeschoss fast ohne Keesers Hilfe gehen konnte. Er deutete stumm auf eine gelb gestrichene Brandschutztür.
»Ich sage schnell den Kollegen Bescheid, dass sie die Sanis hier rüberschicken.« Paula ließ die Männer kurz allein.
Als sie zurückkam, standen die beiden vor der gelben Tür. Eckerle hatte inzwischen einen großen Schlüsselbund aus seinem steingrauen Arbeitskittel hervorgeholt. Mit zitternder Hand versuchte er, einen der Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken. Endlich gelang es ihm. Er öffnete die Tür.
Sie betraten eine Art Aufenthaltsraum. Ein Campingtisch stand in der Mitte des fensterlosen Zimmers. Seine dünnen Metallbeine schauten unter einer hässlich gemusterten, mit angetrockneten Ringen verklebten Plastiktischdecke hervor. Darauf standen zwei halb leere Kaffeetassen und ein voller Aschenbecher. Es roch nach kaltem, abgestandenem Rauch.
Auf der Ablagefläche einer kleinen Spüle stand eine altmodische, völlig verdreckte Kaffeemaschine. Ihr gelbes Lichtchen brannte, und der Kaffeerest, der seit Stunden in der Glaskanne auf der Wärmeplatte gestanden hatte, war inzwischen eingekocht. Es roch verbrannt.
Paula schaltete die Kaffeemaschine aus und ließ Wasser in die Glaskanne laufen. In der Spüle türmten sich gebrauchte Kaffeefilter. Paula war selbst keine begnadete Hausfrau, aber so ein Chaos brachte nicht einmal sie zustande. Anscheinend fühlte sich keiner der Mitarbeiter für das Sauberhalten des Raumes zuständig.
Keeser hatte Eckerle inzwischen zu einem der Stühle geführt, auf den er sich laut stöhnend plumpsen ließ.
Paula spülte eine der Kaffeetassen aus, füllte sie mit frischem, kaltem Leitungswasser und reichte sie dem Hausmeister. Der nahm die Tasse mit zitternder Hand und trank gierig.
An der Wand gegenüber der Spüle befand sich ein Pult mit diversen Knöpfen, einem Mikrofon und zwei Monitoren. Die technische Überwachung– supermodern ist anders, aber besser als gar nichts, fand Paula. Einer der Monitore zeigte die abgesperrte Einfahrt des Parkhauses. Bei genauem Hinsehen konnte Paula Polizeianwärter Berger erkennen, der gelangweilt an einer der beiden geschlossenen Schranken lehnte und, sie musste grinsen, genüsslich in der Nase bohrte. Der zweite Monitor zeigte den Kassenautomaten. Auf einem Tisch daneben stand ein kleiner tragbarer Fernseher.
»Seit wann arbeiten Sie hier, Herr Eckerle?«, fragte Keeser, während Paula einen typischen Männerkalender in Augenschein nahm, der an einer der grauen Betonwände prangte. Eine unechte Blondine reckte dem Betrachter ihren wohlgeformten und nur spärlich verhüllten Hintern entgegen. Paula schloss aus der Art des Kalenders, dass Eckerle erheblich jüngere Kollegen haben musste. Oder hörte das bei Männern nie auf?
»Fünf Jahre«, beantwortete er Keesers Frage knapp.
»Darf ich fragen, wie alt Sie sind?«, fragte Keeser.
»Dreiundsiebzig.«
Keeser und Paula sahen sich kurz an. Hoffentlich müssen wir im hohen Alter nicht noch irgendwelche Jobs machen, um über die Runden zu kommen, schien dieser Blick zu sagen.
»Was sind Ihre Aufgaben?«, fragte Keeser.
Eckerle trank die Tasse leer und stellte sie auf den Tisch.
»Monitore überwachen. Leuchtröhren austauschen, wenn welche kaputt sind. Die Schranken reparieren, wenn sie nicht richtig funktionieren.« Er sah Keeser mit wichtigem Gesichtsausdruck an, seine Augen funkelten vor Eifer. »Und die funktionieren oft nicht.« Die Wichtigkeit seiner Tätigkeit schien ihn ein wenig zu beleben.
»Und für die Reinigung sind Sie auch zuständig.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
Eckerle nickte, bekam aber gleich darauf einen starren Blick, als er sich erinnerte, dass er genau dieser Tätigkeit nachgegangen war, als er…
Bevor sie ihn weiter befragen konnten, hörten sie von draußen Stimmen. Ein Fahrzeug näherte sich. Paula vermutete, dass das der Krankenwagen war. Die Beamten hätten bestimmt niemand anderen durch die Absperrung gelassen. Türen knallten, und dann standen auch schon zwei Sanitäter im Raum.
Keeser schilderte ihnen in Kurzform, was passiert war. Die Notfallretter überprüften Eckerles Puls, Blutdruck und Pupillenreaktion.
»Ein leichter Schock«, diagnostizierte der Ältere der beiden. »Ich gebe ihm etwas zur Beruhigung, dann bringen wir ihn in die Klinik.« Er nahm eine Spritze aus seinem Koffer, holte sie aus der sterilen Folie heraus und stach sie in ein kleines Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit.
»Wir hätten da aber noch einige Fragen an Herrn Eckerle«, insistierte Paula, während der Sanitäter die Spritze aufzog.
»Dann machen Sie schnell. Wenn das Mittel anfängt zu wirken, wird er sehr schläfrig werden.« Er desinfizierte ein paar Quadratzentimeter Haut in Eckerles Armbeuge und spritzte ihm das Beruhigungsmittel in die Vene.
Eckerle hatte ihm ohne jegliche Regung dabei zugesehen.
»Herr Eckerle«, sagte Keeser, »wann kamen Sie zum Dienst?«
Eckerle schloss die Augen. Paula befürchtete schon, er sei eingeschlafen.
»Um zehn«, antwortete er schließlich und öffnete die Lider doch wieder.
»Zweiundzwanzig Uhr?«, konkretisierte Paula die Uhrzeit.
Eckerle bejahte.
»Ist Ihnen während Ihres Dienstes irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Haben Sie einen lauten Knall gehört?«, fragte Keeser.
Eckerle dachte kurz nach und verneinte dann.
»Wer überwacht eigentlich die Monitore?«, fragte Paula.
»Na, ich, wenn ich Dienst habe. Und wenn ich keinen Dienst habe, der jeweilige Kollege.«
»Und da ist Ihnen auch nichts aufgefallen?«
»Was hätte mir denn auffallen sollen?«, fragte Eckerle, als ob es ihm wieder entfallen wäre, dass er vor wenigen Stunden ein paar Stockwerke über ihnen eine Leiche gefunden hatte.
»Menschen, die sich sonderbar benommen haben, zum Beispiel. Oder Leute, die sich stritten. Jemand, der mit einer Waffe das Parkhaus betreten oder es verlassen hat, so was meine ich.« Paula kam an die Grenzen ihrer Geduld.
Eckerle schüttelte den Kopf. Seine Bewegungen waren bereits verlangsamt. Auch schien er größere Probleme zu haben, seine Lider geöffnet zu halten, immer wieder fielen ihm die Augen zu. »Ich hab ferngesehen«, nuschelte er schwer verständlich.
Verdammt, gleich ist er hinüber. Nur noch ein paar kleine Fragen, dann darfst du schlafen, beschwor ihn Paula im Stillen. »Wann haben Sie mit dem Kehren angefangen?«, fragte sie etwas lauter, um ihn zu erreichen.
Ein müdes Schulterzucken war alles, was Eckerle zustande brachte. Sein Kopf sank auf seine Brust.
»Mist«, fauchte Paula und bedachte den Sanitäter mit einem vernichtenden Blick. Er war schließlich schuld daran, dass sie an dieser Stelle abbrechen mussten und einen wichtigen Hinweis eventuell erst später bekamen. Er hatte den Mann stillgelegt. »Hätten Sie mit Ihrer blöden Spritze nicht ein paar Minuten warten können?«
»Tut mir leid«, sagte der Sanitäter und grinste verlegen. »Aber nach ein paar Stunden Ruhe ist er wieder wie neu.«
»Wo bringen Sie ihn hin?«, fragte Keeser weitaus freundlicher.
»Um die Ecke, ins Vinzentius.«
Die beiden Kommissare sahen zu, wie Eckerle auf eine fahrbare Trage gelegt, in den Krankenwagen verfrachtet und davongefahren wurde.
Paula inspizierte die Überwachungsanlage. Es gab zwei Rekorder, für jeden Monitor einen, und bei beiden leuchtete ein rotes Lämpchen, das untrügliche Zeichen dafür, dass beide Geräte gerade aufzeichneten. Paula hoffte inständig, dass sie das schon gestern Abend und während der ganzen Nacht gemacht hatten.
Sie wollte sich nicht lange aufhalten und drückte deshalb einfach ein paar Knöpfe, bis die Rekorder endlich ihre Schubladen herausfuhren und die CDs ausspuckten.
»Na, bitte«, frohlockte sie. »Das müssten die Aufzeichnungen der letzten Nacht sein.« Sie fand zwei leere Hüllen, verstaute die kleinen Scheiben sicher darin und steckte sie ein. »Wir kaufen unterwegs eine Tüte Popcorn und machen uns dann einen gemütlichen Fernsehnachmittag.«
Sie durchquerten das leere Parkhaus. Gerade wurde die Schranke für den Krankenwagen geöffnet, damit er hinausfahren konnte. Sie gingen hinter ihm her auf die Straße.
»So was Blödes«, meckerte Paula und stampfte wütend mit dem Fuß auf. »Jetzt müssen wir unserem bisher einzigen Zeugen auch noch hinterherrennen.«
»Reg dich nicht auf, denn erstens müssen wir nicht rennen, wir nehmen einfach den Dienstwagen, und zweitens ist das eine ideale Gelegenheit, endlich etwas Nahrung zu uns zu nehmen. Mein Magen hängt in den Kniekehlen. Wie wäre es mit einem netten kleinen Frühstück?«
Da Paula auch noch nichts gegessen hatte, war sie für dieses Angebot sehr empfänglich. Sie dachte an ihre Mutter, die ohne einen Bissen zu essen in ihrer Wohnung saß, und bekam ein schlechtes Gewissen. Pah, beruhigte sie sich selbst, das kommt davon, wenn man unangemeldet Leute besucht.
»Meinetwegen«, willigte sie mürrisch ein.
»Und danach fahren wir zu Eichenlaubs Adresse und überprüfen, ob er allein gelebt hat«, schlug Keeser die weitere Vorgehensweise vor.
Bevor Paula antworten konnte, hörte sie jemanden ihren Namen rufen. Als sie sich umdrehte, sah sie ihre Mutter direkt auf sie zukommen.
Mehr als ein überraschtes »Mutsch?« brachte sie nicht heraus.
»Ich dachte, du wärst zu einem Tatort gerufen worden?«, sagte ihre Mutter vorwurfsvoll.
Paula kam langsam zu dem Schluss, dass sie nur nach Landau gekommen war, um vorwurfsvoll zu sein. »Das Parkhaus ist der Tatort«, erklärte sie kurz angebunden.
Mit unverhohlenem Interesse musterte ihre Mutter Keeser von oben bis unten. »Dann ist das sicherlich dein reizender Kollege… Bernd Keeser, nehme ich an? Paula hat ja schon so viel von Ihnen erzählt.« Sie ergriff Keesers Rechte und schüttelte sie ausgiebig. Dabei strahlte sie den großen Mann mit offener Zuneigung an. »Ich bin Juliane Stern, Paulas Mutter. Das ist aber schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen.«
Paula wäre am liebsten im Erdboden versunken.