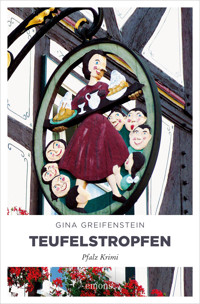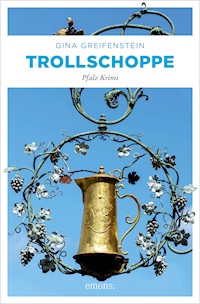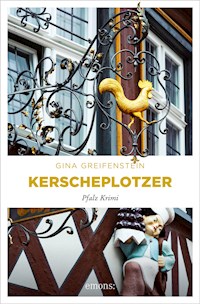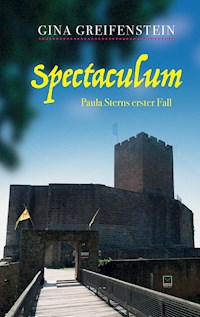3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Das jähe Ende einer eigentlich unsterblich geglaubten Freundschaft nach einem wunderschönen Sommer – und das Wiederannähern nach vielen Jahren. Für alle LeserInnen von Susann Abel und Dörte Hansen »Da stand ein alter, mit bunten, schrecklich kitschigen Poesiebildchen beklebter Schuhkarton, der ihr unangenehm bekannt vorkam. Der Deckel lag auf der Tischplatte, genauso wie unzählige Fotografien. Fotografien, die sie vor vielen Jahren in diesen Karton verbannt und seitdem nie wieder hervorgeholt hatte.« Dieser längst vergangene Sommer war flirrend vor Hitze, die Luft roch nach Dosenravioli und nach Freiheit, jeder Atemzug schmeckte nach Abenteuer. Es war diese schwerelose Zeit zwischen Kindsein und Erwachsenwerden, zwischen Abitur und Studienbeginn, zwischen Nesthocken und Flüggewerden, zwischen Unbeschwertheit und dem Ernst des Lebens. Und sie waren so verdammt jung und hungrig nach diesem Leben, das aufregend geheimnisvoll vor ihnen lag. Ein märchenhafter Sommer voller Lachen, zarter Gefühle und ewiger Freundschaft, der jedoch jäh mit einem Unglück endete. Das ist die Geschichte von Johanna, Iris und Sonja. Und natürlich von Annabell ... »Berührende Geschichte über Schuld und Freundschaft.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ein wunderschönes Buch über Freundschaft, Schuld und Träume. Man fliegt nur so durch die Seiten!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Wahnsinnig nachdenklich machendes Buch. Einige schöne Momente, die man förmlich spüren konnte! Toller Roman, der mehr Aufmerksamkeit verdient!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Der Roman wurde durch ein Stipendium der »VG Wort« gefördert.
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Dieser längst vergangene Sommer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Ulla Mothes
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Dieser längst vergangene Sommer war flirrend vor Hitze, die Luft roch nach Dosenravioli und nach Freiheit, jeder Atemzug schmeckte nach Abenteuer. Es waren besondere Wochen, wie sie einem nur einmal im Leben vergönnt sind. Es war diese schwerelose Zeit zwischen Kindsein und Erwachsenwerden, zwischen Abitur und Studienbeginn, zwischen Nesthocken und Flüggewerden, zwischen Unbeschwertheit und dem Ernst des Lebens. Und sie waren so verdammt jung und hungrig nach diesem Leben, das aufregend geheimnisvoll vor ihnen lag und von ihnen gelebt werden wollte. Die Welt wartete nur darauf, von ihnen erobert zu werden.
Ein märchenhafter Sommer voller Lachen, zarter Gefühle und ewiger Freundschaft, der jedoch jäh mit einem Unglück endete.
Dies ist die Geschichte von Johanna, Iris und Sonja. Und natürlich von Annabell …
1
Fünfzehn Jahre nach diesem längst vergangenen SommerJohanna
Die kleine federleichte Rasierklinge wog unendlich schwer in Johannas Hand, ihre zitternden Finger konnten sie kaum halten. Zum zweiten Mal in den irgendwie überlebten letzten fünfzehn Jahren war sie an diesem Punkt angekommen.
»Punkt«, sagte sie leise zu sich selbst und verzog dabei ihre entschlossen zusammengepressten Lippen zu einem kaum sichtbaren spöttischen Lächeln. Ein Punkt beendete einen geschriebenen Satz, und der Punkt hinter dem letzten Satz eines Buches beendete einen ganzen Roman. Danach kamen höchstens noch vier Buchstaben: E N D E.
Kurz dachte sie an die Manuskriptseiten auf ihrem Schreibtisch – unter diesen Roman würde sie kein E N D E mehr schreiben, er würde unvollendet bleiben. Aber das war ihr egal, sie hatte keine Kraft mehr. Sollte ihre Agentin damit machen, was sie wollte – in die Tonne werfen oder von einem anderen Autor oder einer Autorin fertig schreiben lassen. Das war das erste Buch in ihrer Laufbahn, das sie nicht pünktlich abgeben würde.
»Scheiß drauf!«, zischte sie und nahm einen großen Schluck von dem teuren spanischen Rotwein. Beim Abstellen warf sie das wunderschöne Glas, das sie vor einem gefühlten Jahrtausend auf einem Flohmarkt in der Provence erstanden hatte, um ein Haar um. Was ebenfalls egal gewesen wäre, denn sie würde es nicht mehr brauchen.
Mit der scharfen Klinge streichelte sie beinahe zärtlich über die längst verblasste Narbe an ihrem rechten Unterarm, die sich vom Handgelenk aus etwa sechs Zentimeter lang in Richtung Armbeuge erstreckte.
Dieser verfluchte Roman! Wie hatte sie nur glauben können, dass sie ihn tatsächlich schreiben könnte? Ihre eigene Geschichte, endlich verarbeitet zwischen zwei Buchdeckeln – durch das Herausschreiben abgearbeitet, wie sie fälschlicherweise gehofft hatte. Ihre, Sonjas und Iris’ Geschichte. Und Annabells. Für alle Menschen da draußen zum Lesen, zum Zeitvertreib, als Bettlektüre mit einem ordentlichen Spannungsbogen. Ihre Agentin und auch der Verlag waren begeistert von der Idee, von der immensen Tragik gewesen. Keiner von ihnen wusste, wie autobiografisch dieser Roman sein würde.
Johanna seufzte laut auf. Hatte sie wirklich geglaubt, dass sie, indem sie aufschrieb, was in diesem verfluchten Sommer damals passiert war, das finden würde, was mehrere Therapeutinnen nicht fertiggebracht hatten – Erlösung?
Natürlich war sie gescheitert. Jo Winter, die Bestsellerautorin, war sogar grandios gescheitert an den Erinnerungen von damals, die sie so viele Jahre mehr oder weniger erfolgreich verdrängt hatte. Nicht selten unterstützt von den tüchtigen Helferlein Alkohol und Tabletten. Die eine oder andere Droge hatte sie anfangs auch ausprobiert, wovon sie aber schnell abgekommen war, da sie ihr Denken dann doch zu sehr benebelt und damit ihr Schreiben unmöglich gemacht hatten. Und schreiben musste sie. Nicht nur, weil sie keinen Beruf erlernt hatte und auch nichts anderes konnte, sondern weil sie Geschichten in sich trug, die sie aus sich herausschreiben musste. Hätte sie damals nicht mit dem Schreiben begonnen, wäre sie wahrscheinlich verrückt geworden. Oder drogenabhängig. Auf jeden Fall hätte sie auch ohne den ersten Buchvertrag nicht mit dem eigentlich geplanten Studium begonnen, zu tief war ihre Welt, ihr Leben damals erschüttert worden.
Johanna atmete tief durch. Dieses Dasein als Schriftstellerin würde sich in Kürze erledigt haben. Der ewige Überlebenskampf, das immerzu Schreibenmüssen, der Leistungsdruck, bedrohlich heranrückende Abgabetermine, gemeine, vernichtende Kritiken – das alles würde sie mit einem dicken Punkt, einem Ende in blutigem Rot abschließen. Ihre zermürbenden Erinnerungen, ihre unauslöschbaren Schuldgefühle – das alles würde sie hinter sich lassen. Sie würde abtauchen in dieses stille, watteweiche, erlösende Nichts, das sie vor ziemlich genau zwölf Jahren schon einmal kurz spüren durfte, aus dem sie aber ihre Mutter gewaltsam wieder herausgerissen hatte. Etwas, was sie ihr nie verziehen hatte. Auch nicht die quälenden Monate in der psychiatrischen Klinik, wo sie ins »normale Leben« zurücktherapiert worden war. Zwölf Jahre Kampf gegen sich selbst und ihre inneren Dämonen hatte ihre Mutter ihr beschert, indem sie sie zu früh im Bad gefunden und den Notarzt gerufen hatte.
Heute würde sie mehr Erfolg haben, heute würde sie niemand finden und zurück in dieses beschissene Leben und ihre erdrückenden Erinnerungen holen.
Sie nahm einen letzten Schluck Wein, ließ ihn mit geschlossenen Augen auf der Zunge liegen, bevor sie ihn hinunterschluckte und seinem intensiven Geschmack so bewusst nachlauschte wie nie zuvor. Vollmundig, samtig, mit dem Aroma von reifen Kirschen im Abgang. Ein wirklich köstlicher Sterbebegleiter.
Nachdem Johanna das Glas abgestellt hatte, setzte sie die Rasierklinge direkt neben der Narbe an ihrem rechten Handgelenk an. Sie musste gar nicht so fest drücken, wie sie es im Gedächtnis hatte, und sie spürte fast nichts, als sich die messerscharfe Klinge ihren Weg durch die Haut in ihre Pulsader bahnte. Völlig entspannt beobachtet sie, wie ihr Blut aus dem Schnitt quoll und auf ihre Lieblingsjeans tropfte.
Der Schnitt am anderen Arm gelang ihr nicht so gut. Nicht nur, weil Johanna Linkshänderin war, sondern auch, weil sie vor lauter Blut gar nicht richtig sehen konnte, wo sie schneiden musste. Die Klinge rutschte ihr mehrmals aus den blutfeuchten Fingern, aber sie gab nicht auf. Und es tat verdammt weh. Aber auch das würde im Lauf der nächsten halben Stunde vorbei sein. Für immer. Wenn das hier überstanden war, würde Johanna nie wieder Schmerzen ertragen müssen.
Nach getaner Arbeit ließ sie die Klinge einfach auf den hellen Fliesenboden fallen. Ihr Blut würde die Fugen versauen, was aber nicht mehr ihr Problem war. Sie legte die blutenden Arme auf die Lehnen ihres Lieblingssessels und ließ sich entspannt zurücksinken. Abwechselnd betrachtete sie die Dächer der Münchener Altstadt, die ihr jenseits der Fensterfront des Wintergartens ihres Penthouses zu Füßen lagen, und die Schnitte an ihren Handgelenken, aus denen wunderbar sanft und stetig das Blut aus ihrem Körper floss.
Ihr Blick blieb an der Fingerkuppe ihres rechten Zeigefingers hängen, an einer kleinen, leicht verknorpelten Narbe, die sie dort seit beinahe fünfzehn Jahren hatte. Vorsichtig strich sie mit dem Daumen darüber. Diese Stelle hatte sich immer taub angefühlt, bestimmt waren bei dem Schnitt mit dem nicht sonderlich scharfen Taschenmesser ein paar Nerven durchtrennt worden. Die Wunde war damals nur schlecht verheilt, genau wie bei den anderen auch. Wahrscheinlich hatten sie sich einfach nur eine denkbar ungünstige Stelle dafür auserkoren. Blutsfreundinnen. Was für ein kindischer Blödsinn!
In ihren letzten Lebensminuten dachte sie, anders als es immer kolportiert wurde, nicht weiter über ihr Leben nach. Sie dachte vielmehr daran, dass sie den perfekten Ort zum Sterben ausgewählt hatte. In Filmen lagen die Menschen, die sich ihre Pulsadern aufschnitten, immer in gefüllten Badewannen. Nie und nimmer hätte sie nackt in immer kälter werdendem Wasser sterben wollen!
Eine Elster ließ sich auf dem Geländer nieder. Mit schiefgelegtem Kopf saß sie da, und es sah beinahe so aus, als würde sie Johanna beobachten. Dann breitete der Vogel seine Flügel aus, stieß sich vom Geländer ab und segelte davon.
Johanna sah ihm lächelnd nach. Genauso würde gleich ihre Seele davonfliegen.
Schläfrigkeit ergriff sie, hüllte sie ein wie ein weiches Tuch. Es fiel ihr schwerer und schwerer, die Augenlider geöffnet zu halten. Ein letztes Mal ließ sie den Blick über die Dächer ihrer geliebten Stadt gleiten, dann schloss sie die Augen. Ihre Hände, ihre Arme spürte sie nicht mehr, auch nicht ihre Beine. Da war nur ein leises Frösteln, während ihr Herz noch immer tapfer weiterschlug und das letzte bisschen Leben aus ihr herauspumpte. Ihre Gedanken zerflossen wie die Wolken am Himmel. Endlich tat das Leben nicht mehr weh …
2
Iris
»Mama?«
Iris sah von ihren Notizen auf und ihre Tochter genervt an. Demonstrativ legte sie den Zeigfinger der freien Hand an die Lippen und schüttelte den Kopf.
Mit der anderen Hand hielt sie den Telefonhörer ans Ohr, in den sie mit zunehmend dünner werdendem Geduldsfaden hineinsprach: »Wie ich Ihnen jetzt schon mehrmals sagte, Herr Wadlinger: Es ist kein Versäumnis von unserer Seite – mein Fahrer ist hier pünktlich vom Hof gefahren, aber jetzt steht er mit einem Motorschaden mitten auf der Autobahn. Ein anderer Lkw ist bereits auf dem Weg zu Ihnen, es wird nur ein wenig später.« Iris hielt inne, als sie merkte, dass sie während des Telefonats immer lauter geworden war. Nicht zum ersten Mal an diesem Tag fragte sie sich, warum es so verdammt viele begriffsstutzige Menschen auf der Welt gab. Aber sie musste unbedingt ruhig bleiben, immerhin sprach sie mit einem langjährigen Geschäftspartner. Mit der »Wadlinger Druckguss« hatte schon ihr Vater zusammengearbeitet, als sie noch im Kindergarten war. Und genauso, wie der alte Wadlinger seinen Sessel nicht räumte, hätte auch ihr Vater sich ganz sicher niemals freiwillig aus dem Geschäft zurückgezogen. Eigentlich sollte sie ihm dankbar sein, dass er viel zu früh gestorben war … obwohl, dann wäre alles anders gekommen, dann säße sie ganz bestimmt nicht hier in diesem kleinen beschissenen Büro und müsste auch nicht dieses nervenaufreibende Gespräch führen.
»Mama!« Nicola stand jetzt direkt vor ihrem mit Papieren übersäten Schreibtisch, und ihre Stimme klang mindestens so gereizt wie ihre eigene.
Iris hob den Kopf, sah sie beschwörend an und formte mit den Lippen ein lautloses »Sofort«.
»Lieber Herr Wadlinger«, wandte sie ihre Aufmerksamkeit bemüht freundlich wieder ihrem Gesprächspartner zu. »Aber ja, das klappt heute ganz sicher noch, versprochen.«
Das bemühte Lächeln, das sie extra für den alten Wadlinger aufgesetzt hatte, verging ihr mit seiner Antwort. Hatte der alte Krauter tatsächlich gerade gesagt, dass das ganz sicher nicht so schiefgelaufen wäre, wenn ihr Vater noch am Leben wäre? Als ob seine Laster nie kaputtgegangen wären! Dabei war sie es gewesen, die nach seinem Tod für einen komplett neuen und zudem viel größeren Fuhrpark gesorgt hatte. Zu Vaters Zeiten hätte nämlich gar kein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestanden – so sah das nämlich aus!
»Jammerschade, dass ihr Vater so früh verstorben ist und keinen geeigneten Stammhalter hatte, der das Geschäft übernehmen konnte«, ergänzte Wadlinger das eben Gesagte um eine weitere Unverschämtheit. »Nichts gegen Sie, Frau Seiler, Sie tun sicherlich Ihr Bestes, aber Frauen haben halt in diesem Geschäft einfach nichts verloren.«
Ungeachtet der jahrzehntealten Geschäftsbeziehungen lag ihr eine geharnischte Antwort auf der Zunge.
»Mama!«
Nicola brachte sie jedoch völlig aus dem Konzept. »Einen kleinen Moment bitte, Herr Wadlinger, da kommt gerade einer meiner Fahrer rein.«
Mit der Hand deckte sie die Sprechmuschel ab. »Was denn, verdammt noch mal!«, fuhr sie ihr Kind schlecht gelaunt an, was ihr sofort leidtat.
»Ich brauche das Foto.« Nicola schien ihr den Ton zum Glück nicht übel zu nehmen.
»Was denn für ein Foto?«
»Das Kinderfoto für die Schülerzeitung.«
Iris erinnerte sich vage, dass Nicola vor ein paar Tagen etwas in dieser Richtung erwähnt hatte.
»Hat das denn nicht Zeit bis später?« Obwohl sie Wadlinger um einen Moment Pause gebeten hatte, quakte der nicht sonderlich freundlich weiter in ihr Ohr.
Mit dem für sie typischen Schmollmund verschränkte Nicola die Arme vor der Brust. »Nein, das hat keine Zeit mehr! Ich sollte das Bild schon gestern in der Redaktion abgeben, aber du hast ja nie Zeit. Morgen früh geht die Zeitung in den Druck, ich kann also nur noch heute das Bild abgeben. Sag mir doch einfach, wo die Fotoalben sind, dann suche ich mir selbst eins raus.«
Augenblicklich hatte Iris ein schlechtes Gewissen. Ja, sie hatte viel zu wenig Zeit für ihre Tochter. Am liebsten wäre sie aufgestanden, hätte sie fest in den Arm genommen und dann mit ihr zusammen nach einem passenden Foto gesucht. Und danach hätten sie ein Eis essen gehen oder etwas anderes Schönes zusammen machen können. Aber sie hatte ja noch den alten Wadlinger an der Strippe.
»Sorry, Süße, hab ich wohl vergessen. Wird nicht wieder vorkommen.«
Nicola verzog spöttisch das Gesicht. »Ja, ja, das sagst du immer. Also, wo sind die Alben?«
»In der Abstellkammer im alten Schrank, oberstes Fach. Es ist das Album mit dem rosa Teddy drauf.«
Nicola warf ihr eine Kusshand zu und verschwand aus dem Büro.
Alois Wadlinger brüllte ihr schmerzhaft ins Ohr, ob sie überhaupt noch da sei und ob sie ihn verarschen wolle.
Iris atmete tief durch. »Nein, Herr Wadlinger, ich will Sie nicht verarschen. Ich will Ihnen nur noch schnell sagen, dass der Fahrer heute nicht mehr kommen wird. Dass nie wieder ein Fahrer von uns kommen wird. Ihre Firma habe ich nur noch als Kunden behalten, weil Sie ein langjähriger Partner meines Vaters waren. Dass ich Ihre Fracht noch zu den alten Konditionen befördert habe, haben Sie wohl nicht bemerkt, denn dann würden Sie sicherlich nicht so unverschämt mit mir sprechen. Da ich also in den letzten Jahren so gut wie nichts an Ihren doch recht kleinen Aufträgen verdient habe, kann ich in Zukunft gut auf die »Wadlinger Druckguss« verzichten. Suchen Sie sich also bitte einen anderen Spediteur.«
Kurz herrschte Stille am anderen Ende. »Aber Frau Seiler, das war doch alles nicht so gemeint!«
»Doch, Herr Wadlinger, von meiner Seite war es ganz bestimmt so gemeint. Leben Sie wohl!«
Mit dem wunderbaren Gefühl der Genugtuung legte Iris auf. Ihr Vater würde sich zwar im Grab herumdrehen, wenn er das wüsste, aber das war ihr ausnahmsweise mal egal. Schließlich war das jetzt ihre Firma. Eine Firma, die sie erst zu dem gemacht hatte, was sie jetzt war: finanziell auf soliden Füßen stehend und international agierend. Auch wenn das anfangs so gar nicht ihr Metier gewesen war, hatte sie Papas kleine Spedition zu einem ernst zu nehmenden Unternehmen mit insgesamt fünfzehn Angestellten gemacht. Sollte sich der alte Wadlinger seine blöden Druckgussteile doch sonst wohin schieben.
Iris wählte die Handynummer des Fahrers, der auf dem Weg zu Wadlinger war, um ihn zurückzupfeifen. Danach wollte sie den Anrufbeantworter einschalten und hinüber zu Nicola gehen, um mit ihr die Kinderfotos anzusehen.
Dieser Plan scheiterte jedoch gleich im Ansatz, da nach dem Gespräch mit dem Fahrer das Telefon einfach nicht stillstehen wollte.
Als sie endlich Feierabend machen konnte, den Rechner herunterfuhr und die Rufumleitung aktivierte, war es kurz nach sieben.
An der Tür, als sie gerade das Licht ausgeschalten wollte, fiel ihr der Brief ein, der noch auf dem Schreibtisch lag. Sie ging zurück und nahm ihn von der obersten Ablage. Der Empfänger war mit der Hand auf den Umschlag geschrieben worden, und er war an sie persönlich adressiert, nicht an die Firma. Da ihr der Name der Absenderin, eine Karin Becker, nicht bekannt war, hatte sie ihn noch nicht geöffnet. Das würde sie nach dem Abendessen tun.
Erleichtert trat sie hinaus ins Freie und sog die sommerliche Abendluft in ihre Lungen. Irgendwo hinter der Halle lief ein Hochdruckreiniger, einer der Fahrer spritzte also noch seinen Laster ab. Sie schloss die altmodische Bürotür aus Metallrahmen und Sicherheitsglas ab und ging über den ansonsten ruhigen Hof zum Wohnhaus hinüber.
Als sie die Diele betrat, stolperte sie erst einmal über ein mitten im Weg stehendes Paar pinkfarbener Sneakers. Ob ihre Tochter es jemals lernen würde, wenigstens ein Mindestmaß an Ordnung einzuhalten? Für ihr Alter viel zu laut ächzend, bückte sie sich danach, um die Schuhe in das dafür vorgesehene Schuhschränkchen zu stellen. In dem herrschte das pure Chaos. An ihren lächerlichen zwei Paar Schuhen, die sie im Vergleich zu der deutlich größeren Menge an Fußbekleidung ihres Kindes besaß, lag das ganz bestimmt nicht. Wenn sie mal Zeit übrighaben sollte, würde sie hier klar Schiff machen, aber heute genügte es ihr, Nicolas Schuhe irgendwo dazwischenzustopfen.
»Nicki?«, rief sie ins Haus hinein.
Sie bekam keine Antwort. Auf der Küchentheke klebte ein neonrosa Zettel: Bin um halb acht wieder da, Kuss Nic.
Iris strich zärtlich über das Papier. Nic – seit ein paar Wochen wollte ihr Küken nicht mehr Nicki genannt werden, weil das angeblich zu kindisch klang. Vierzehn war Nicki jetzt und so anders als sie selbst in diesem Alter. Ihre Tochter wusste, was sie wollte. Schon mit vier Jahren hatte sie das gewusst, egal ob es um die Farbe eines T-Shirts oder den Belag ihres Pausenbrotes gegangen war. Seit damals hatte sich nichts geändert, im Gegenteil, Nicki hatte sich zu einer ernst zu nehmenden Diskussionspartnerin entwickelt, die mit jeder Faser ihres Körpers für ihre Überzeugungen einstand und notfalls auch kämpfte.
Die Iris in Nickis Alter war schrecklich schüchtern und still gewesen. Was wahrscheinlich an ihrem Vater gelegen hatte, der nicht unbedingt ein Despot, aber doch der Mann im Haus gewesen war, der niemals Widerworte oder gar eine andere Meinung zugelassen hatte. Vielleicht aber auch daran, dass sie immer und überall die Kleinste und Jüngste gewesen war. Oder aber auch, weil sie zu sehr nach ihrer Mutter kam, die nie ein leuchtendes Beispiel für Selbstbestimmung, Durchsetzungsvermögen oder gar Rebellion für sie gewesen war und die sich stets klaglos ihrem großen und lauten Mann untergeordnet hatte. Erst nach ihrem viel zu frühen Tod hatte Iris erkannt, dass ihre sanftmütige, unscheinbare Mutter in all den Ehejahren die heimliche Strippenzieherin gewesen war, die gute Seele des Geschäfts, das Kittmaterial, das die Familie zusammengehalten hatte. Dann nämlich, als der kraftstrotzende, weltgewandte, alles schaffende Vater an ihrem Grab zusammenbrach und danach nie wieder zu dem Kerl wurde, der er mal gewesen war.
Sie wusch sich die Hände und fing an, das Gemüse für das Abendessen zu putzen und zu schnippeln. Es würde eine bunte Gemüsepfanne mit dem Reis geben, der gestern übrig geblieben war. Ohne Fleisch, denn seit Kurzem war Nicki auf dem Vegetariertrip.
Verständnisvoll lächelnd briet Iris das Gemüse in Olivenöl an. Vegetarierin war sie auch eine Zeitlang gewesen, acht Monate oder so. Womit sie bei ihren Eltern, vor allem bei ihrem Vater, auf Unverständnis gestoßen war. Kein Wunder, denn er war Jäger und hätte Fleisch in allen Variationen auch ohne lästige Beilagen zu sich genommen.
Überhaupt waren ihre Eltern nicht die Eltern, die zu ihr »gepasst« hatten. Der Vater ein derber, unbehauener Klotz, mit dem sehnlichen Wunsch nach einem Sohn. Er hatte es ohne Schulabschluss, aber mit Lkw-Führerschein zum recht angesehenen Kleinunternehmer geschafft. Die Mutter eine stille, nicht unintelligente zierliche Person mit Realschulabschluss, die zwar den Haushalt und die Bücher führen durfte, aber ansonsten nichts zu sagen hatte. Und dann kam sehr spät in dieser eher trostlosen Ehe sie, Iris, auf die Welt, ausgerechnet ein Mädchen. Ein Mädchen, ebenso zierlich wie die Mutter. Mit einem IQ von hundertfünfzig, von dem keiner wusste, wo er überhaupt herkommen konnte, und vor allem, wie man damit umgehen sollte. Ein Mädchen, das eine Schulklasse übersprang und dank der wohlwollenden Unterstützung ihrer Lehrer tatsächlich und gegen den Willen des Vaters Abitur machen durfte. Das erste Abitur seit Familiengedenken. Mit einem so guten Abitur, dass sie ohne Wartezeit einen Studienplatz für Medizin bekommen hatte.
Auch wenn sie tief im Innern wusste, dass ihr Vater stolz auf sie gewesen war und sie auf seine Art geliebt hatte, war sie als junge Frau davon überzeugt gewesen, in der falschen Familie, im falschen Leben gelandet zu sein.
Iris sah auf die Uhr. Fünf Minuten vor halb acht. Sie mischte den Reis unter das Gemüse und schaltete den Herd aus.
Heute würden sie und Nicola nicht in der Küche, sondern im Esszimmer essen. Sie wollte mit ihrer Tochter mal wieder »dinieren«, mit tollem Geschirr, feinen Gläsern und dem Silberbesteck ihrer Großmutter, das deren Mutter während des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht aus Schlesien in die neue Heimat mitgeschleppt hatte.
Als sie hinübergegangen war und das Licht eingeschaltet hatte, beschleunigte sich ihr Herzschlag. Auf dem Esstisch lag noch aufgeschlagen das Fotoalbum mit Nickis Kinderbildern, und daneben … Iris hielt die Luft an. Da stand ein alter, mit bunten, schrecklich kitschigen Poesiebildchen beklebter Schuhkarton, der ihr unangenehm bekannt vorkam. Der Deckel lag auf der Tischplatte, genauso wie unzählige Fotografien. Fotografien, die sie vor vielen Jahren in diesen Karton verbannt und seitdem nie wieder hervorgeholt hatte.
Mit einem dicken Kloß im Hals trat sie an den Tisch und wagte kaum, eines der Fotos anzusehen, geschweige denn anzufassen. Sie hätte sie damals vernichten und nicht in der hintersten Ecke des Schrankes verstecken sollen.
Iris bekam gar nicht mit, wie Nicola die Haustür aufschloss und nach ihr rief. Sie zuckte heftig zusammen, als sie plötzlich neben ihr stand.
»Die hab ich vorhin gefunden, aber ich kenne niemanden darauf außer dir.« Nicola griff nach einer der Aufnahmen und hielt sie ihr unter die Nase. »Die zweite von links, das bist doch du, oder?«
Iris starrte wortlos auf das Bild. Vier junge Frauen standen da nebeneinander, Arm in Arm, und lachten dem Fotografen fröhlich und unübersehbar glücklich in die Kamera. Vier junge Frauen aus einem anderen Leben in knappen bunten Bikinis. Eine davon, die kleinste und zierlichste, war sie. Die mit der hellsten Haut und dem Sonnenbrand. Die drei anderen waren sommersonnengebräunt. Iris glaubte beinahe die Hand zu spüren, die Johanna ihr damals beim Fotografieren auf die schmerzhaft gerötete Schulter gelegt hatte.
Nicola sah ihre Mutter prüfend von der Seite an. »Witzig, da schaust du so aus wie ich heute.«
Iris sah dem beinahe fünfzehn Jahre jüngeren Ich ins fröhliche Gesicht. Ja, Nicola hatte recht, sie sah aus wie ihr Klon. Bis auf die dunklen Augen und die beiden kleinen Grübchen, die sie von ihrem Vater mitbekommen hatte.
»Das hier ist lustig.« Nicola zeigte ihr eine andere Aufnahme.
Iris nahm sie in die Hand. Dreieinhalb lachende Gesichter waren darauf zu sehen, das halbe war ihres. Dieses Bild war das klägliche Ergebnis ihres Versuchs gewesen, sich selbst und die andern zu fotografieren. Heute hieß das Selfie, aber damals gab es diesen Begriff noch nicht. Auch nicht die Möglichkeit, sich beim Selbstfotografieren auf einem Display zu sehen. Sie wusste noch genau, wann sie dieses Foto aufgenommen hatte …
»Wie alt warst du da?«, fragte Nicki munter und schob die anderen Fotografien auf dem Tisch herum, als suche sie etwas.
»Siebzehn«, sagte Iris mit brüchiger Stimme. Sie wunderte sich, dass sie überhaupt einen Ton über die Lippen brachte.
Nicki betrachtete sie aufmerksam. »Ist was mit dir? Du bist so komisch.«
»Ich hab nur … nicht damit gerechnet, diese Bilder hier … zu finden.«
»Ihr hattet wohl sehr viel Spaß, ihr seht so glücklich aus. Hier, schau mal.«
Vier junge lachende Frauen bäuchlings nebeneinander auf einer Luftmatratze, mitten im blauen Wasser eines Pooles. Iris konnte nur mit Mühe die Tränen zurückhalten. Ja, da waren sie noch glücklich gewesen. Aber nach diesem Schnappschuss, wie lange noch? Zwei Tage? Oder sogar nur einen Tag? Ein paar wenige Stunden?
»Wo wart ihr da?«
Iris atmete tief durch. »In Italien.«
»Und wer sind die anderen Mädels? Waren das damals deine Freundinnen?«
Iris betrachtete das Luftmatratzenfoto genauer. An einem der Zeigefinger ihres jüngeren Ichs entdeckte sie ein durchgeweichtes Pflaster. Die anderen drei hatten auch ein solches Pflaster gehabt, auch wenn man das auf dieser Aufnahme nicht sehen konnte. Wie Trophäen hatten sie sie damals getragen.
»Blutsfreundinnen«, sagte sie leise, und es klang beinahe ehrfürchtig. Sie setzte sich, weil ihre Knie zitterten.
»Echt? Ihr habt Blutsfreundschaft geschlossen? Wie cool! Hat das wehgetan?«
Iris befühlte die kleine Narbe an ihrem linken Zeigefinger. Sie glaubte, ein leises Kribbeln zu spüren.
»Es ist wochenlang nicht verheilt.«
»Zeig mal.«
Iris hielt ihr den Finger hin.
»Besonders beeindruckend sieht das aber nicht aus«, stellte Nicki enttäuscht fest. »Wer sind die Mädchen? Die Rechte sieht echt umwerfend aus. Die ist bestimmt Schauspielerin oder Model geworden.«
Iris nahm allen Mut zusammen, um die Namen auszusprechen.
»Das da links ist Jo.« Sie räusperte sich. »Johanna, aber wir nannten sie alle Jo. Daneben ich, dann Sonni, also Sonja, und …« Sie brach ab. »Annabell«, sagte sie schließlich tonlos.
»Hattest du auch einen Spitznamen?«
»Blümchen.«
»Blümchen? Wieso das denn?«
»Weil Iris ein Blumenname ist und ich immer die Kleinste in der Klasse war.«
»Du hast nie von ihnen erzählt – seid ihr nicht mehr befreundet?«
»Nein.« Iris schob mit fahrigen Bewegungen die Bilder zusammen und warf sie in den Schuhkarton, als wären sie heiße Kohlen. »Unser Leben hat uns, kurz nachdem diese Fotos gemacht wurden, in alle Himmelsrichtungen verteilt. Das passiert leider, wenn man erwachsen wird.«
»Mit Elli und mir ganz bestimmt nicht, wir werden ein Leben lang Freundinnen bleiben!«
Bevor Iris den Deckel schließen konnte, griff Nicki nach dem Foto, das jetzt obenauf lag. »Und die Jungs? Wer waren die?«
Iris riss ihr das Bild aus den Fingern und stopfte es in den Karton. Dann legte sie den Deckel auf und behielt die Hand darauf, als wäre der Inhalt gefährlich und könnte wieder herausgekrochen gekommen.
»Irgendwelche Jungs, Urlaubsbekanntschaften, ihre Namen weiß ich nicht mehr. Ist ja auch völlig egal. Und jetzt komm in die Küche, das Essen ist fertig.«
Iris war nicht mehr nach Silberbesteck und gutem Geschirr. Sie wollte nur weg von diesem Karton voller schmerzlicher Erinnerungen.
Sobald Nicki im Bett war, ging Iris ins Esszimmer. Der Karton stand unverändert da, mitten auf dem Esstisch, die Hängelampe darüber warf ihr Licht wie ein Bühnenscheinwerfer darauf.
Iris stand mit schützend vor der Brust verschränkten Armen da und starrte ihn an. Schließlich überwand sie sich, packte ihn und trug ihn durch die Diele, öffnete die Haustür und trat hinaus auf den in tiefer Dunkelheit liegenden Hof. Nach dem zweiten Schritt reagierte der Bewegungsmelder, drei Strahler tauchten alles in gleißende Helligkeit. Neben der Halle standen die Mülltonnen. Mit einer Hand öffnete Iris den Deckel der großen Altpapiertonne. Mit der anderen hielt sie den buntbeklebten Schuhkarton einen kurzen Moment lang über dem geöffneten Schlund, so als würde sie endgültig Abschied von ihm und seinem Inhalt nehmen, dann ließ sie ihn fallen. Mit dumpfem Poltern landete er auf dem Boden des vor Kurzem geleerten Behälters. Schnell schloss sie den Deckel und eilte zurück zum Haus. Mit der nächsten Leerung würden dann endlich die letzten Erinnerungen an diesen längst vergangenen Sommer für immer und unwiederbringlich vernichtet sein.
3
Sonja
Nach einem langen Vormittag bei Gericht und einem noch längeren Nachmittag in der Kanzlei fuhr Sonja durch die beiden mannshohen Pfosten, die die breite Einfahrt flankierten, und stellte den Motor ihres neuen Audi TT Coupé ab. Mit dem Absterben des Motors war auch die Musik aus dem Radio erloschen. Nur das leise Klopfen der Regentropfen auf dem Autodach war noch zu hören. Die Sicht durch die Windschutzscheibe wurde zunehmend undeutlicher, da auch der Scheibenwischer nicht mehr arbeitete. Aber sie wusste auch so, wie es draußen aussah. Sie stand auf dem Hof einer ehemaligen, U-förmig angelegten Tuchfabrik. Tuche und Stoffe wurden hier aber schon lange keine mehr gewoben. Vor vier Jahren hatten ihre Freundin Bea und sie diese vor sich hin verfallenden Gebäude entdeckt und gekauft. Sie hatten sie restauriert und saniert und jede Menge Geld und Nerven hineingesteckt. Jetzt war das alte Gemäuer aus roten Ziegelsteinen ein Schmuckstück, um das sie vor allem die beneideten, die ihnen damals vom Kauf abgeraten hatten. Im Gebäude zu ihrer Rechten, in dem einst die riesigen Webstühle gestanden hatten, befand sich das großzügige Atelier, hinter dessen deckenhohen Fenstern jetzt kein Licht brannte. Vor ihr, jenseits der wasserbenetzten Windschutzscheibe, lag der Trakt mit den Garagen, der Werkstatt und dem großen Raum, der zum Feiern genauso gut taugte wie für Ausstellungen. Und links, nur ein paar Schritte entfernt, war das Wohnhaus. Wo einst die Büros und Aufenthaltsräume der Arbeiter waren, lebten sie nun. Dort brannte Licht. Es spiegelte sich auf dem regennassen, über Jahrzehnte rundgefahrenen Kopfsteinpflaster.
Sonja öffnete die Fahrertür, nahm den Aktenkoffer vom Beifahrersitz, blieb dann aber mit ihm auf dem Schoß sitzen. Sie war zu müde zum Aussteigen. Einzelne Regentropfen verirrten sich ins Wageninnere, trafen ihre linke Hand, der eine oder andere ihr Gesicht. Sie fühlten sich an wie kleine, kalte Stiche auf der Haut.
Dass eine Partnerschaft in der Kanzlei mehr Verantwortung bedeuten würde, war ihr von vorneherein klar gewesen, nicht aber, dass sie auch mehr als doppelt so viel würde arbeiten müssen. Hätte sie es gewusst, hätte sie wohl dankend abgelehnt. Oder?
Was nützte ein atemberaubendes Gehalt, wenn sie keine Zeit mehr hatte, es auszugeben? Wenn sie keine Zeit mehr hatte für sich, für ihre Beziehung, ihre Freunde? Was hatte sie von dem tollen neuen Auto, wenn sie damit nur von zu Hause ins Büro und von dort wieder zurückfuhr? Das hätte sie auch mit dem alten Golf machen können, den sie einer der Praktikantinnen so gut wie geschenkt hatte.
Sie sog den unverwechselbaren Duft ein, den nur neue Autos verströmen. Eine Mischung aus jungem Kunststoff, bislang unbetretenem Teppichboden und dem jungfräulichen Leder, mit dem die Sitze bespannt waren.
»Wer viel arbeitet, muss sich auch belohnen.« Das war der Lieblingsspruch ihres Vaters gewesen. Und als Alleinverdiener und Oberhaupt der fünfköpfigen Familie hatte er ihn oft bemüht, er hatte sich regelmäßig belohnt. Nach solchen Belohnungen war er meist sehr spät und sehr betrunken nach Hause gekommen. Sonja konnte sich nur allzu gut an den Geruch erinnern, den er dann an sich haften hatte: Er roch nach kaltem Rauch und Alkohol. Wenn er in diesem Zustand ankam, ging man ihm am besten aus dem Weg. Ihre Mutter hatte das nicht immer geschafft. Eine geplatzte Lippe und ein blaues Auge waren nur die für alle sichtbaren Verletzungen, was sie unter ihrer Kleidung, im Sommer manchmal unter langen Ärmeln verbarg, konnte Sonja im Nachhinein nur erahnen. Für sie war ihre Mutter eine tragische Gestalt, eine Frau, die den ganzen Haushalt mit ihm und drei Kindern schmiss, kochte, backte, einweckte, wusch, bügelte, nähte, flickte, Hausaufgaben betreute, Elternabende besuchte, den Garten pflegte, dadurch kein winziges Zipfelchen eigenes Leben hatte und sich trotzdem nie beklagte. Nicht mal über die Prügel, die sie immer wieder einstecken musste.
Sonja liebte ihre Mutter, doch dank dieses zugegebenermaßen bedauernswerten Vorbildes war ihr schon sehr früh klar gewesen, dass sie auf gar keinen Fall ein solch kleines, auf Familie und Haus reduziertes Leben führen wollte. Schon als Zehnjährige hatte sie sich erfolgreich geweigert, kochen zu lernen. Damals hatte sie sich geschworen, niemals für einen Mann ihr Leben, ihre Persönlichkeit, ihr Selbstwertgefühl aufzugeben. Dass es in dieser Form sowieso nie dazu kommen würde, davon hatte sie mit zehn noch keine Ahnung gehabt.
Natürlich war Sonja damals zu klein, um ihrer Mutter zu helfen, aber schon da war ihr klar, dass solchen Frauen wie ihrer Mutter geholfen werden musste. Und deshalb wusste sie schon mit knapp elf, dass sie Anwältin werden wollte. Bis sie es allerdings zu der erfolgreichen Anwältin im neu duftenden Sportwagen schaffte, hatte sie unzählige schwere Kämpfe mit und gegen ihren Vater ausfechten müssen, der ihre Zukunft in einem Besuch der Hauswirtschaftsschule und baldiger Ehe mit einem gutverdienenden Mann sah. Inklusive natürlich fleißiger Fortpflanzung und Vermehrung.
Gegen seinen Willen – und da hatte die Mutter sie zum ersten Mal unterstützt – blieb sie nach der Mittleren Reife auf der Schule und machte ein recht gutes Abitur. Das hatte ihm schon gefallen, er erzählte es schließlich jedem, ob er es wissen wollte oder nicht, dass seine Älteste das Abitur gemacht hatte. Aber dann kam der Bruch: Als sie ihm nämlich eröffnete, dass sie sich für ein Jurastudium eingeschrieben hatte, warf er sie – gerade volljährig geworden – aus dem Haus. Derartige Hirngespinste wollte er nicht unterstützen. Dabei hätte sie nur ein kostenloses Dach über dem Kopf gebraucht, den Rest hätte sie schon allein geschafft.
Bei dieser Erinnerung angekommen, entfuhr Sonja ein leiser Seufzer. Fünfzehn Jahre war das nun her, und es tat noch immer weh. Aus der Entfernung gesehen war dieser Sommer damals, der eigentlich so gut angefangen hatte, der beschissenste Sommer ihres gesamten Lebens gewesen.
Auch wenn sie am liebsten einfach in ihrem ergonomisch geformten Schalensitz hocken geblieben wäre, wurde es jetzt kühl und vor allem feucht hier drin. Sie raffte sich auf und stieg aus. Wenn ihre Gedanken schon zu ihrem Vater und zu diesem Sommer zurückgeschweift waren, dann würde unweigerlich noch mehr hochkochen. Das wusste sie aus Erfahrung, und das wollte, nein, das musste sie vermeiden.
Außerdem wartete Bea drinnen auf sie. Mit ihrem Lächeln, ihrer Wärme würde sie die Gespenster aus der Vergangenheit schnell vertreiben.
Sonja warf die Fahrertür zu und strich im Vorbeigehen liebevoll über den nassen Lack des Wagens.
Ja, sie hatte dieses Auto verdient! Nicht nur, weil sie viel arbeitete, sondern weil sie die letzten fünfzehn Jahre doch irgendwie heil überlebt hatte.
Bevor sie die Haustür öffnete, blieb sie kurz auf der Schwelle stehen und streckte das Gesicht in den Nachthimmel. Die kühlen Tropfen, die ihr auf Stirn, Wangen und Kinn fielen, taten gut.
Der Geruch von frisch gekochter Tomatensoße, Knoblauch und Kräutern empfing sie, als sie die Diele betrat. So roch Heimkommen. So roch es, wenn sich jemand auf einen freute, jemand, der für einen gekocht hatte. Ob sich ihr Vater jeden Abend so gefühlt hatte, wenn er nach getaner Arbeit nach Hause gekommen war? Geliebt? Dabei war Sonja keineswegs überzeugt davon, dass ihre Mutter ihren Ehemann geliebt hatte.
»Hallo Liebes!« Bea erschien mit einem blaukarierten Küchenhandtuch, mit dem sie ihre Hände abtrocknete, in der Tür zur Küche. Wie immer trug sie ihre mit Farbe bekleckste Latzhose, die irgendwann mal vor Sonjas Zeit weiß gewesen sein musste. Ihre wilde tizianrote Lockenmähne, die sie zu einem lockeren Knoten hochgebunden hatte, war in Auflösung begriffen, schon kringelten sich die ersten dicken Locken über ihren Schultern. Dieses Lächeln, der schiefgelegte Kopf – in diesem Moment hatte sie eine unglaubliche Ähnlichkeit mit … nein, das war Unsinn! Sonja schob den Gedanken schnell beiseite.
Bunte Farbkleckse zierten Beas kaum zähmbare Haarpracht und ihre Arme. Ein hellgrüner Tupfer war auf ihrer rechten sommersprossigen Wange gelandet und dort wahrscheinlich schon vor Stunden eingetrocknet.
Daraus schloss Sonja, dass sie noch vor Kurzem im Atelier gearbeitete hatte – ihre kleine Malerin, wie sie Bea liebevoll nannte. Dort hatte sie wohl wie immer den ganzen Tag verbracht, und mit ziemlicher Sicherheit hatte sie den Pinsel nur zur Seite gelegt, um für sie zu kochen.
Wie sie sie so stehen sah, in der viel zu großen Hose, die ihren schlanken, knabenhaften Körper weit umspielte, mit diesem zärtlichen Strahlen ihrer Augen, die von dem gleichen hellen Grün waren wie der Farbklecks auf ihrer Wange, und der wildroten Mähne, wallte warme Liebe in ihr auf. Bea war für sie wie eine verträumte Elfe in einer harten Welt, die mit ihren farbenfrohen abstrakten Gemälden diese Welt zu verzaubern vermochte. Genauso, wie sie sie verzaubert hatte, damals bei dieser Vernissage, zu der sie eigentlich gar nicht hatte hingehen wollen. Gefallen hatte ihr die unkonventionelle junge Malerin sofort. Dieses zarte, rotgelockte Wesen, das mutig die ersten zaghaften Schritte auf der hart umkämpften Bühne der Kunstszene zu machen wagte, das zwar noch unbekannt war, aber doch selbstbewusst zu seinen Werken stand. Fasziniert war Sonja mit ihrem Sektglas in der Hand von einem großformatigen farbgewaltigen Gemälde zum nächsten gegangen und hatte am Ende des Abends tatsächlich eines gekauft. Zu einem Spottpreis, heute war es sicherlich das Zehnfache wert. Das erste Originalgemälde, das sie jemals gekauft hatte. So groß, dass sie es in ihrer damaligen Wohnung gar nicht aufhängen konnte. Und es war das erste Bild gewesen, das Bea bis dato verkauft hatte. Dieses Bild war also in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Es hing seit ihrem gemeinsamen Einzug hier über der Anrichte im Esszimmer, und Sonja liebte es noch immer.
Damals schon waren Beas Arbeiten ein wahrer Farbenrausch gewesen, und das hatte sich in den acht Jahren ihres Zusammenlebens nicht geändert. Sie spiegelten so gut ihr Wesen wider, ihr durch und durch positives Denken, ihre unerschütterliche Fröhlichkeit und Lebenslust, ihre Kraft, ihr positives Denken. Irgendwie hatte Bea wohl einen anderen Blick auf das Leben und die Menschen als sie selbst. In Sonjas Alltag als Familien- und Scheidungsanwältin, in dem sie es mit traurigen, unglücklichen Menschen zu tun hatte, herrschte hingegen die Farbe Grau vor. Grau und natürlich schwarz und weiß. Sonja war dankbar, dass sie an Beas wunderbar positiver Kunst hautnah teilhaben durfte und so doch etwas auf sie abfärbte.
»Harten Tag gehabt?« Bea sah ihr mitfühlend lächelnd zu, wie sie den Aktenkoffer abstellte, die Pumps von den Füßen streifte und die regenfeuchte Kostümjacke auszog und ordentlich auf einen Bügel an der Garderobe hängte.
»Scheiß hart, vielleicht sollte ich es einfach mal als Malerin versuchen?«
»Nur zu, aber ob wir uns dann noch dieses Haus leisten können?« Beas Augen blitzten frech.
Nachdem Sonja die Schuhe ausgezogen hatte, war Bea noch immer einen halben Kopf kleiner als sie. Ihre Beziehung war dennoch auf Augenhöhe. Als Paar harmonierten sie perfekt – wahrscheinlich, weil sie dasselbe wollten: ein friedliches gemeinsames Leben, ohne Druck und Unterdrückung. Aber auch als Einzelpersonen hätten sie nach einer Trennung problemlos weiterleben können, da sie nicht voneinander abhängig waren. Sie waren selbstständige Personen geblieben, hatten beide ihre Jobs, in denen sie erfolgreich waren. Natürlich wäre auf jeden Fall mindestens ein Herz gebrochen, aber sie hätten jede für sich weiterexistieren können.
Sonjas Mutter dagegen hätte ihren Mann niemals verlassen können, nicht einmal, wenn sie es gewollt hätte. Ohne Schulabschluss und Berufsausbildung – wovon hätte sie leben sollen? Als Putzfrau hätte sie vielleicht arbeiten können, denn putzen konnte sie.
Bea stellte sich auf die nackten Zehen, die auch einige Farbkleckse abbekommen hatten, und küsste Sonja liebevoll auf den Mund.
»Zieh dich um, Liebes, Essen ist gleich fertig.« Dann verschwand sie wieder in der zum Wohn- und Esszimmer hin offenen Küche.
Ehrlicherweise musste Sonja eingestehen, dass sie, wenn sie sich wirklich irgendwann einmal trennen sollten, wieder von Fast Food und Fertiggerichten würde leben müssen.
In bequemer Gymnastikhose und weitem Sweatshirt kam sie wenig später in die Küche, wo Bea gerade die Nudeln in ein altes Metallsieb abgoss, das schon die eine oder andere Macke abbekommen hatte. Bea liebte solch alte Dinge. Egal ob Küchenutensilien, Geschirr oder Möbel, sie war immer auf der Jagd nach Gegenständen, die schon ein Leben in einer anderen Zeit und bei anderen Menschen gelebt hatten. Hingebungsvoll reinigte und polierte sie hundert Jahre altes Silberbesteck, laugte Schränke und Stühle ab und ließ die Gegenstände in neuem Glanz wieder die Aufgaben tun, für die sie bestimmt waren.
»Kümmerst du dich um den Wein?«, fragte Bea, als sie die Tomatensoße in eine bauchige cremefarbene Suppenterrine mit schlichtem Goldrand umfüllte. Egal wie einfach das Essen auch sein mochte, so stilvoll, wie Bea es servierte, konnte es mit Edelspeisen im Sternelokal mithalten.
Sonja nahm eine Flasche von dem leichten Chardonnay aus dem Kühlschrank. Auf dem Weg zum Esstisch entfernte sie die Metallkappe und schenkte den hellgelben Rebensaft in die schön geformten Weingläser, die sie Bea mal zum Geburtstag geschenkt hatte.
Bea kam mit der antiken Schüssel und stellte sie mitten auf dem Tisch ab. Mit dem Berg Spaghetti, der sich großzügig darin türmte, hätte man locker ein paar Leute mehr satt bekommen können.
Als krönenden Abschluss zündete Bea die Kerzen an, die in einem leicht angelaufenen Silberkandelaber steckten. Ihr Schein spiegelte sich in allen Teilen wider, die sich auf dem Tisch befanden. Bei diesem Anblick nahm Sonja Bea spontan in den Arm.
»Ich danke dir«, sagte sie von ihren Gefühlen überwältigt.
»Das ist doch nur eine langweilige Tomatensoße. Zu mehr hatte ich einfach keine Zeit.« Das klang tatsächlich entschuldigend.
»Was heißt da nur? Du hast sie immerhin selbst gekocht, und sieh dir nur den wunderschön gedeckten Tisch an!«
»Ist ja gut«, sagte Bea ein wenig verlegen und setzte sich. »Lass uns essen, sonst wird alles kalt.« Mit geschickten Bewegungen verteilte sie Nudeln auf die Teller und gab jedem einen Schöpfer von der Soße darüber.
Sonja ergriff ihr hochstieliges Glas und hielt es ihr einladend hin. »Lass uns auf die langweilige Tomatensoße und den toll gedeckten Tisch anstoßen.«
Bea nahm ihr Glas und ließ es leise an Sonjas klirren.
Doch Sonja trank nicht. Sie saß da, mit ihrem erhobenen Glas und sah Bea an. »Und darauf, dass ich für jeden Tag dankbar bin, seit wir uns begegnet sind.«
Bea nahm einen Schluck und stellte das Glas neben ihren Teller. »Ach ja? Darf ich dich bei der Gelegenheit daran erinnern, dass du mich anfangs gar nicht haben wolltest?«, sagte sie mit leicht spöttischem Unterton. Diese Tatsache betonte sie regelmäßig, sobald sie auf dieses Thema zu sprechen kamen.
»Ich kann nur wiederholen, dass ich zu diesem Zeitpunkt einfach keine Beziehung haben wollte. Aber du hast mich dann ja doch noch vom Gegenteil überzeugt.«
Bea nahm das Glasschälchen mit dem grob geriebenen Parmesan.
»Das ist Quatsch, und das weißt du. Du wolltest nur keine lesbische Beziehung«, sagte sie, während sie Käse über ihre Nudeln streute. Sie reichte Sonja das Schälchen und sah sie dabei herausfordernd an. »Gib es doch endlich zu.«
Natürlich hatte Bea recht mit dieser Aussage. Sie hatte sich viele Jahre nicht eingestehen wollen, dass sie kein Interesse an Männern hatte. Geahnt oder vielmehr befürchtet hatte sie es seit diesem Sommer nach dem Abitur. Aber nach dem Sommer war sowieso alles anders gewesen, da war sie völlig verstört, und lange Zeit hatte sie überhaupt nichts mehr gefühlt. Blindwütig hatte sie sich in ihr Studium gestürzt, und für Beziehungen, egal wie auch immer sie geartet gewesen wären, hätte sie neben der Uni und ihrem nächtlichen Job in der Kneipe sowieso keine Zeit gehabt.
Außerdem wurde man, wenn man sein Herz nicht verschenkte, auch nicht verletzt. Und ihr Herz war viele Jahre viel zu wund, viel zu zersprungen gewesen, um sich überhaupt jemandem zuzuwenden.
»Ja, stimmt. Ich war damals wohl noch nicht so weit. Aber du hast mich erweckt.« Sonja legte ihre Linke auf Beas warme Rechte und drückte sie leicht.
»Schwer genug war es. Eins sag ich dir: Wenn du dich noch länger geziert hättest, hätte ich irgendwann aufgegeben.«
»Es war schon süß, wie du immer wieder gesagt hast, dass du dein Bild sehen und kontrollieren willst, ob es ihm auch gut bei mir geht.« Sonja zwinkerte ihr zu. »Ich denke, es war gut für uns beide, dass es nicht so schnell ging. So konnte ich mir meiner Sache ganz sicher werden …«
»Du bist dir also ganz sicher?«
Empört zog Sonja die Hand zurück. »Natürlich! Immerhin sind wir seit acht Jahren ein Paar, wir haben ein wunderschönes Zuhause, wir sind glücklich, haben ein schönes Leben, wir …«
»Dann lass uns heiraten.«
Sonja sah sie verdattert an.
»Was?«
»Wenn du mich liebst, wenn du dir deiner Sache angeblich so sicher bist, dann lass uns heiraten. Denn ich bin mir meiner Sache sicher. Seit ich dich zum ersten Mal vor meinen Bildern stehen sah, weiß ich: Ich will mit dir zusammen sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich will mit dir alt werden.«
»Ist das etwa ein Heiratsantrag?«
»Du doofe Nuss, natürlich ist das ein Heiratsantrag!«
Sonja war sprachlos. Heiraten – musste das sein? Die vielen Ehen, die sie in den Jahren als Anwältin bis hin zur Scheidung begleitet hatte, inklusive Rosenkriege und Streit um Kinder, Hund und Haus. Nicht zu vergessen die verkorkste Ehe ihrer Eltern, die ihr stets ein Mahnmal gewesen war. Natürlich war es bei ihr und Bea anders, die letzten acht Jahre hatten nichts zu tun mit dem lieblosen Zusammenleben ihrer Eltern. Ihre Beziehung war geprägt von Zuneigung, Vertrauen und Achtung. Bea würde sie nie schlagen, wie ihr Vater es bei seiner Frau getan hatte, aber trotzdem …
Sie wusste, dass Bea auf eine Antwort wartete. Während ihr so viel durch den Kopf ging, verdüsterte sich der sonst so sonnige Blick ihrer wunderbaren Freundin, Geliebten und Lebensgefährtin zusehends. Wenn sie jetzt Nein sagte, gäbe das einen tiefen Bruch zwischen ihnen. Einen Bruch, der wahrscheinlich nie mehr heilen würde. Sie liebte Bea, von ganzem Herzen und ohne Vorbehalte. Ein Leben ohne sie konnte sie, wollte sie sich nicht vorstellen. Sie hatten glückliche acht Jahre miteinander gelebt – die glücklichsten Jahre, die Sonja je hatte. Warum, verdammt, zögerte sie dann noch?
Sie fasste sich ein Herz. »Ja.«
»Was – Ja?« Bea sah sie ärgerlich an.
»Ja, ich heirate dich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dich zur Frau zu haben.«
Bea sprang auf und umschlang Sonja stürmisch mit den Armen. Sie küsste und herzte sie. Endlich ließ sie von ihr ab. »Ich hole den Champagner.«
»Hattest du das geplant?« Sonja stand auf, als sie mit Gläsern und der Flasche zurückkam.
Bea reichte ihr die fein geschliffenen Sektflöten und befreite den Flaschenhals von der edlen goldenen Alukapsel und dem Drahtkörbchen. Mit einem dumpfen Plopp ließ sie den Korken herausspringen und schenkte geschickt ein. »Das Schampustrinken ja, den Antrag nicht, der war ganz spontan. Ich wollte eigentlich auf den Verkauf eines Bildes mit dir anstoßen, aber so lohnt sich das teure Prickelwasser doppelt.«
Sie stießen an, sahen sich dabei tief in die Augen und küssten sich.
Oh mein Gott, ich werde heiraten, dachte Sonja teils glücklich, teils unbehaglich, als sie das Glas mit einem Zug leerte. Sie würde den Bund fürs Leben eingehen, obwohl sie sich immer geschworen hatte, nie in diese Falle zu tappen. Zu viele unglücklich verheiratete Menschen hatte sie erleben müssen. Menschen, die nach ein paar Jahren gelangweilt nebeneinanderher lebten, sich gleichgültig geworden waren und sich jahrelang in dieses Schicksal fügten, bis sie sich endlich aufraffen konnten, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Ja, Ehe war für sie ein selbst gewähltes Gefängnis.
Aber mit Bea und ihr würde es sicher anders sein. Sie würden sich nicht gegenseitig einschränken, unterdrücken, belauern, verletzen und am Ende hassen. Oder?
Sie stellte das leere Glas neben ihrem Teller ab. Das Essen war jetzt kalt. Ob ihre Liebe auch eines Tages erkalten würde?
»Du hast ein Bild verkauft?«, fragte Sonja, um sich selbst auf andere Gedanken zu bringen.
»Ja, die Grüne Landschaft. An einen Architekten aus Berlin, es wird in Kürze die Wand seiner frisch restaurierten Gründerzeitvilla schmücken.«
Es klang fröhlich, als sie das erzählte, aber Sonja wusste, dass Bea jeder Abschied von einem Bild wehtat, so als wären ihre Gemälde ihre Kinder. Und irgendwie waren sie das ja auch, immerhin hatte sie jedes einzelne erschaffen. In wochen- und monatelang währenden Arbeitsprozessen schenkte sie jedem eine Existenz auf einer Leinwand, hauchte ihnen Leben und Einzigartigkeit ein, lebte mit ihnen, durcharbeitete so manche Nacht an ihnen, entwarf, verwarf, malte, übermalte und überspachtelte wieder, nur um neu zu beginnen. Nur um sie eines Tages schweren Herzens zu verkaufen.
»Ausgerechnet dein Lieblingsbild?«
Bea deutete mit ihrem Glas auf eine Stelle hinter Sonja. »Mein Lieblingsbild hängt an dieser Wand da – aber ja, ich mag es sehr. Bloß kann ich sie nicht alle behalten. Ich hab vorhin mit dem Käufer telefoniert – wir können das Bild jederzeit besuchen, wenn wir in Berlin sind.«
Sie hatte tatsächlich besuchen gesagt, und Sonja liebte sie dafür. Die Art und Weise, wie Bea mit Menschen und mit Dingen umging, war ihr so noch nie begegnet. Allem näherte sie sich mit Achtung und Neugier und Hingabe, ob es nun eine uralte verbeulte Emailleschüssel, ein klappriger Stuhl oder ein Mensch war. Sie liebte irgendwie alles und jeden. Wenn man mit ihr zusammen war, dann gab sie einem stets das Gefühl, das Wichtigste in ihrem Leben zu sein. Und was kaputt war, das reparierte und heilte sie. Genau wie bei ihr. Bea hatte auch sie repariert. Wie ein verstörtes und verwahrlostes Kätzchen hatte sie sie gefunden und aufgepäppelt, hatte ihr ein warmes, sicheres Zuhause gegeben.
»Ich liebe dich«, sagte Sonja überwältigt von ihren eigenen Gefühlen.
»Ich liebe dich auch. Und jetzt werde ich das Essen noch mal warm machen.«
Bea schnappte sich die Teller und trug sie in die Küche. Gleich darauf hörte Sonja das Zuklappen der Mikrowellentür. Etwa drei Minuten später erklang ein metallisches »Ping«, und Bea kam mit dampfenden Tellern zurück.
Sie wünschten sich einen guten Appetit und küssten sich – ein tägliches Ritual. Manche beteten vor dem Essen, sie küssten sich. Sogar im Restaurant machten sie das, was ihnen schon so manchen spöttischen Blick von Tischnachbarn eingebracht hatte. Auch vor dem Frühstück und dem Mittagessen hielten sie so kurz inne. Bea hatte es eingeführt, und Sonja hatte es gern angenommen.
Schweigend aßen sie, nur das Klappern ihres Bestecks auf dem Porzellan und das leise Ticken der zierlichen intarsienverzierten Kaminuhr, die nicht auf einem Kaminsims, sondern in einem schlichten, aus gebrauchten Gerüstdielen grob gezimmerten Regal stand, war zu hören.
Aber es war ein angenehmes Schweigen, eines, das einen wie eine warme Decke umhüllte.
Als sie fertig waren, schob Bea ihren Teller in die Mitte des Tisches und holte ein Tabakpäckchen aus der Tasche ihres Latzes. Geschickt drehte sie sich eine Zigarette. Als sie sie angezündet und den ersten tiefen Zug gemacht hatte, legte sie die Füße auf die Sitzfläche des Stuhles neben ihr. Mit in den Nacken gelegtem Kopf sog sie immer wieder genussvoll den Rauch ein, hielt ihn einen Moment in ihrer Lunge und entließ ihn dann langsam als Kringel durch ihre feingezeichneten Lippen.
Sonja rauchte nicht mehr. Als erwachsener Mensch wollte sie nicht von so einem Glimmstängel abhängig sein, der, wenn man ehrlich war, noch nicht einmal schmeckte. Natürlich hatte sie in ihrer Jugend mitgequalmt, aber auch nur, weil die anderen sie dazu gedrängt hatten, vorneweg Johanna.
Jo – warum dachte sie jetzt ausgerechnet an Jo? Schon zum zweiten Mal an diesem Tag schlichen sich Erinnerungen an sie heran, die sie seit vielen Jahre verdrängt geglaubt hatte.
Sie zwang ihre Gedanken in eine andere Richtung, und sie landeten zwangsläufig bei ihrem Vater, der ein starker Raucher gewesen war, was sie schon als Kind als sehr unangenehm empfunden hatte. Wenn dann noch seine Freunde zum Kartenspielen und Biertrinken da waren, war die Luft in der Wohnung zum Schneiden gewesen. Und dann erst der eklige Gestank des kalten Qualms am nächsten Morgen!
Sie beobachtete Bea. Es störte sie komischerweise nicht, dass sie rauchte. Bea rauchte nicht oft, gern aber nach dem Essen – oder nach dem Sex. Bei ihr sah Rauchen nicht wie Rauchen aus, bei ihr war es etwas Sinnliches, etwas Hingebungsvolles. Irgendwie war alles, was Bea tat, sinnlich, ob sie nun konzentriert und weltentrückt an der Staffelei stand oder am Herd, ob sie Unkraut zupfte oder Radieschen schnippelte – alles tat sie so wunderbar intensiv. Bea lebte mit allen Sinnen. Eine Fähigkeit, die sich in ihren Bildern widerspiegelte. Dadurch empfand sie Glück noch glücklicher – aber auch Leid viel leidvoller, Schmerz viel schmerzlicher.
Sie selbst war das krasse Gegenteil. Als sie Bea kennengelernt hatte, war sie eine kühle, rationale Frau gewesen, die nichts und niemanden mehr an sich heranlassen wollte, die nicht mehr fühlen wollte. Nach dem, was damals geschehen war, wollte sie nie wieder lieben, nie wieder leiden. Es war harte Arbeit gewesen, bis sie so gut wie emotionsfrei geworden war, das trockene Jura-Studium und der harte Überlebenskampf waren dabei sehr hilfreich gewesen.
Doch dann war Bea in ihr Leben getreten, und mit ihr alles, was sie viele Jahre erfolgreich von sich ferngehalten hatte. Bea, die so viel Ähnlichkeit hatte mit … mit Annabell.