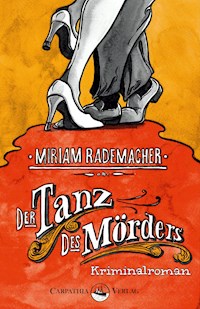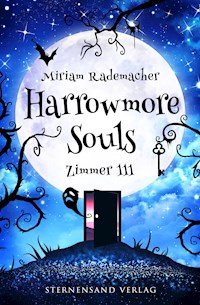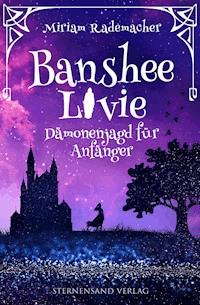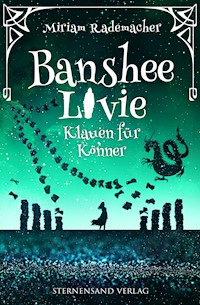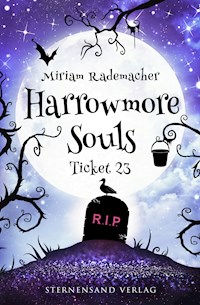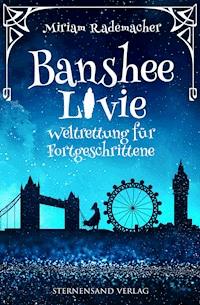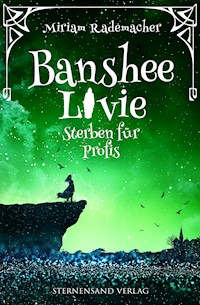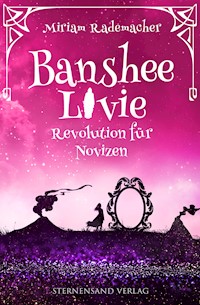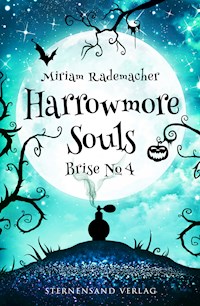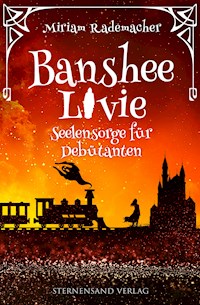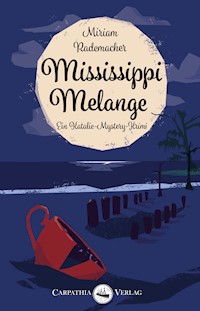
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carpathia Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Katalie-Mystery-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Lebenskünstler Smiljan wohnt in Esbjerg an der dänischen Nordseeküste und hält sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. Als ihm ein geheimnisvoller Fremder einen ungewöhnlichen Job anbietet, scheint endlich Geld in die Haushaltskasse zu kommen. Alles, was er dafür tun muss, ist, ein wachsames Auge auf dessen Schützling zu werfen, eine exzentrische junge Frau namens Katalie, die im Haus gegenüber einzieht. Doch was einfach klingt, stürzt Smiljan in ein Abenteuer, wie er es bisher nur aus Büchern kannte: Menschen verschwinden, in Esbjergs Straßen werden Personen mit einer Injektionsnadel attackiert, und am Strand finden Touristen eine verkohlte Leiche. Und wenn er Katalie glauben darf, dann sind all die mysteriösen Ereignisse tatsächlich einem Klassiker der Weltliteratur entsprungen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Struktur
Titelseite
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorspann
Textanfang
Seitenzahlen im gedruckten Buch
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Über die Autorin
Impressum
Die Personen dieser Geschichte sind frei erfunden und die geschilderten Ereignisse haben in keinem Land der Welt jemals so oder so ähnlich stattgefunden. Wenigstens hofft die Autorin das.
Dänemark gibt es allerdings wirklich.
Kapitel 1
Alle guten Geschichten beginnen in einem Buchladen.
Meine nicht.
Sie begann genau genommen über einem Buchladen, einem staubigen Antiquariat gleich an der Gammelgade gelegen. Manchmal stieg ich die Treppe zu jenem Büchergrab hinunter und arbeitete dort. Immer dann, wenn Lasse Ostvin, der Inhaber, Besseres zu tun hatte, als selbst hinter dem Verkaufstresen zu stehen, und das kam mit zunehmender Häufigkeit vor.
Ich war kein Buchhändler. Aber das machte nichts, denn das Antiquariat war auch eher eine Sammelstelle für zerlesene Taschenbücher, doch wer würde denn so kleinlich sein?
Weder das Entstauben zerfledderter Strandlektüren noch das Verkaufen machte mir wirklich Freude, aber darauf kam es nicht an. Ich arbeitete dort nicht zum Spaß, ich arbeitete für Geld, und zwar aus dem einzig wahren Grund: Ich brauchte es zum Leben. Daher stand ich nicht nur gelegentlich für Lasse im Antiquariat, sondern schuftete auch für seinen Vetter Piet. Dieser betrieb ein Fitnesscenter in Fußnähe, und dort durfte ich mich an hausmeisterlichen Tätigkeiten versuchen. Ich ersetzte defekte Glühbirnen, reparierte tropfende Wasserhähne und ölte quietschende Foltergeräte. War die stets leidende und stark unterernährte Yogalehrerin mal krank, übernahm ich auch ihren Job. Ich konnte sehr vielseitig sein, wenn es von mir verlangt wurde.
Zu dem Zeitpunkt, als diese seltsame Geschichte ihren Anfang nahm, übte ich etwa fünf oder sechs verschiedene Tätigkeiten aus, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ganz sicher war ich mir über die genaue Anzahl meiner Arbeitsplätze nie, und manchmal hatte ich Angst, meine Arbeitszeiten, Einsatzorte oder Aufgaben zu verwechseln. Nachts träumte ich davon, wie ich potenziellen Käufern im Buchladen eine Meditation aufnötigte, während zur gleichen Zeit im Fitnesscenter alle Glühbirnen durchbrannten. In solchen Nächten wachte ich schweißgebadet auf.
Mein neuester Job war zugleich mein bequemster: Ich zählte die Nutzer der Gammelgade-Bushaltestelle. Um diese Aufgabe hatte ich mich wirklich gerissen, denn die Haltestelle lag genau gegenüber dem Antiquariat und meiner darüber gelegenen Wohnung. So konnte ich alles von meinen Fenstern im ersten Stock aus wunderbar überblicken. Ich betrieb gewissermaßen ein Homeoffice für Erhebungen in öffentlichen Verkehrsmitteln, das konnte mir so schnell keiner nachmachen. Zwischen zwei Bussen schrieb ich noch ein paar fiktive Briefe und tränentreibende Schicksalsberichte für die Daisy, ein Käseblatt, das täglich erschien. Der Bus, der die Gammelgade hinabfuhr, kam nur alle zwanzig Minuten vorbei, ich konnte beiden Aufgaben gleichzeitig gerecht werden. Und wenn ich den Bus und die von ihm aufgenommenen Fahrgäste wirklich einmal verpasste, weil ich mich zu sehr mit einer selbst erdachten Tragödie beschäftigt hatte, erfand ich ein paar realistisch klingende Zahlen für die Statistik. Diesbezüglich kannte ich keine Skrupel. Es war nicht wichtig, ob meine Zahlen korrekt waren, wichtig war, dass die Buslinie durch unseren Vorort erhalten blieb. Wir waren ohnehin schon weit ab vom Trubel Esbjergs, waren eine Randerscheinung am äußersten Zipfel der Stadt. In die Gammelgade verirrten sich nur selten Touristen, zahlreich fanden nur ihre alten Taschenbücher in vorwiegend deutscher Sprache ihren Weg in Lasses Buchladen.
Trotzdem tat man in der Gammelgade alles dafür, um auch am Tourismus zu verdienen. Der mäßige Erfolg tat diesen Bemühungen keinen Abbruch. Für die Touristen taten wir ganz gern so, als sei unsere Haupteinnahmequelle der Fischfang, doch das war natürlich Unsinn. Jeder Eisverkäufer verdiente hier mehr als ein Fischer, zumindest während der Sommermonate. Aber für die Reisenden, die sich an dem Anblick der hübschen Häuser mit ihren Fahnenmasten in jedem Vorgarten erfreuten, pflegten wir unser Image als beschauliches Fleckchen am Rande der großen Stadt. Der Mensch glaubt, was er glauben will. Meistens. Ich bin seit Beginn meines Abenteuers diesbezüglich eine Ausnahme. Mich lässt man nicht mehr glauben, was ich glauben will, mir werden Ansichten und Theorien aufgenötigt, die so abwegig und so haarsträubend sind, dass sich gesunde Menschen dagegen auflehnen würden. Aber ich habe keine Wahl. Nicht mehr.
Doch um das zu erklären, muss ich wieder zurückgehen. Zurück zu jenem Tag, an dem ich zumindest sporadisch die Nutzer der Buslinie an der Gammelgade erfasste. Dem Tag, der mein Leben auf den Kopf stellen sollte.
Der zweite Nachmittagsbus war gerade abgefahren, der letzte jammervolle Brief, den ich unter dem Namen Marijan, Alter 42, bei der Redaktion der Daisy abliefern würde, war geschrieben. Und so übte ich an einer von mir selbst erfundenen Yogafigur, die ich »Schwankende Schwalbe« getauft hatte. Sie sollte bei meinem nächsten Auftritt als Vertretungs-Yogalehrer zum Einsatz kommen.
Aus dem Fenster starrend, war ich auf der Suche nach meinem Schwerpunkt und irgendetwas, auf das ich meinen Blick richten konnte. Dabei ein bewegliches Objekt als Fixpunkt zu wählen, war allerdings nicht clever gewesen. Doch der schwarze Vogel, seiner Größe nach zu urteilen ein Rabe oder eine ungewöhnlich fette Krähe, der am gegenüberliegenden Haus den Rand der Dachrinne für eine Rast genutzt hatte, war mir sofort ins Auge gefallen. Und ich entschied mich als Fixpunkt immer für das Objekt, das mir zuerst ins Auge fiel. So versuchte ich, nicht umzufallen, und dabei das Tier im Blick zu behalten. Der Vogel starrte zurück.
Ich bin nicht sehr gut in Balanceübungen. Von allen selbst kreierten Yogafiguren waren es die einbeinigen, die mir die meisten Schwierigkeiten bereiteten. Und prompt begann ich zu wackeln, als die Rabenkrähe, oder was immer es war, ihre Flügel ausbreitete und majestätisch davonschwebte. Ich fiel ziemlich unmajestätisch in mich zusammen.
»Er beobachtet dich.«
Das war die Stimme meines Vaters. Er störte mich nicht oft bei der Arbeit, und wenn er es doch tat, dann ging es meist um etwas Wichtiges. Dieses Mal klang es eher nicht bedeutungsvoll.
»Vater, ich bitte dich«, gab ich zur Antwort, löste die rechte Fußsohle von der Wade und wandte ihm den Kopf zu, um ihm einen vorwurfsvollen Blick zu schenken. Doch der Aufmerksamkeit meines Vaters entging nur wenig.
»Du hast bereits gewackelt, bevor ich dich angesprochen habe, Smiljan. Versuch also bitte nicht, mir einzureden, dass es meine Schuld war.«
Ich versuchte es nicht. Stattdessen warf ich einen erneuten Blick aus dem Fenster und sah hinunter auf die Straße. Herbstblätter säumten den Rinnstein vor der Bushaltestelle, Autos fuhren deutlich weniger als noch während des Sommers, und außer ein paar Kindern, die sich einen Spaß daraus machten, sich gegenseitig mit Laub zu bewerfen, war kaum jemand unterwegs. Der Tag war grau und ließ schon den nahen Herbst erahnen.
»Niemand beobachtet mich«, stellte ich sachlich fest.
»Nicht dort unten, mein Junge. Dort drüben. Im Nachbarhaus. Der Gammelgade 104.« Mein Vater streckte den Zeigefinger seiner rechten Hand in eben jene Richtung, in die ich noch kurz zuvor geblickt hatte.
Unterhalb der jetzt vogelfreien Dachrinne fiel mein Blick auf eine Reihe von Fenstern. Hinter einigen hingen Gardinen, hinter anderen Jalousien, und in einem stand die Silhouette eines Mannes. Hinter ihm, in einer wie es schien leeren Wohnung, baumelte eine nackte Glühbirne von der Decke und sorgte dafür, dass ich ihn nur als Schatten wahrnehmen konnte. Die Gestalt hinter der Fensterscheibe im ersten Stock des gegenüberliegenden Hauses stand ebenso still wie ich selbst noch Augenblicke zuvor. Sein runder, allem Anschein nach kahler Kopf saß auf einem kurzen Hals über massigen Schultern. Es machte tatsächlich den Eindruck, als würde er zu mir herüberstarren, doch ganz sicher war ich mir nicht.
Bis vor Kurzem war diese gegenüberliegende Wohnung noch das Zuhause einer alte Dame gewesen. Auf ihren Fensterbänken hatten Petunien geblüht, und hinter eben jenem Fenster, durch das ich jetzt angestarrt wurde, hatte eine weiße Spitzengardine gehangen. Die Alte hatte mir manchmal ein Lächeln geschenkt, wenn sie am Fenster gestanden und ihre Blumen gegossen hatte. Doch eines Tages war die Dame buchstäblich weg vom Fenster, und ich war, während ich auf meine Busse wartete, dazu verdammt gewesen, den Petunien beim Welken zuzuschauen. Bald darauf waren die Spitzengardinen entfernt, die trockenen Petunien entsorgt, und die ganze Wohnung weiß gestrichen worden, was nur bedeuten konnte, dass die Alte dahin gegangen war, von wo niemand jemals zurückkam. So handelte es sich bei dem Beobachter hinter dem Fenster vermutlich um den neuen Mieter der Wohnung.
»Der Mann sieht sich nur seine Umgebung an«, sagte ich. Meinen Vater und den Fremden hinter dem Fenster bewusst ignorierend, bereitete ich mich auf den »Kuss des Buddha« vor, eine ebenfalls von mir selbst erfundene Übung.
Gerade hatte ich tief Luft geholt und die Arme gehoben, als mein Vater unser Gespräch fortsetzte. »Wie ein Insekt unter dem Mikroskop.«
Ich ließ die Arme wieder sinken. »Was willst du mir damit sagen?«
»Ich beobachte ihn schon eine ganze Weile dabei, wie er dich beobachtet, Junge. Er studiert dich. Der hat was vor, glaub mir.« Die Augen in dem früh gealterten Gesicht meines Vaters waren schmal geworden, und er nickte bedächtig, als habe er mir soeben eine große Weisheit verkündet.
Ich atmete vorwurfsvoll und deutlich hörbar aus, gab meinem Vater aber doch eine Antwort auf seine absurde Theorie. »Ja, sicher hat der Mann etwas vor. Er zieht gerade in diese Wohnung dort drüben ein.«
»Ach ja?« Die vielen Fältchen in seinem hageren Gesicht schoben sich zusammen. Er grinste sein wissendes Grinsen, das ich noch nie hatte leiden können. »Und wo hat er sein Leben gelassen?«
Ich gab auf. Der Buddha würde ungeküsst bleiben müssen, jedenfalls für heute. »Sein Leben? Was meinst du damit: Wo hat er sein Leben gelassen?«
Das Grinsen meines Vaters wurde noch eine Spur breiter. Überheblicher. Ich spürte einen Anflug von Ungeduld. »Niemand betritt eine neue Wohnung allein. Man bringt sein altes Leben mit.«
Jetzt ahnte ich, worauf er hinauswollte, und antwortete: »Vermutlich stapeln sich außerhalb unseres Sichtfeldes Möbel und Umzugskartons.« Dann bückte ich mich, um meine Yogamatte aufzurollen.
»Da ist nichts. Absolut nichts. Der Mann hat nichts mitgebracht, außer einen Kasten Bier. Und jetzt steht er da am Fenster und schaut dich an. Hast du was angestellt, Junge?«
»Ich?« Ich gab mir Mühe, nicht ironisch zu klingen, versagte aber kläglich. »Ob ich etwas angestellt habe? Du versuchst, witzig zu sein, oder? Oder unterstellst du mir, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt?«
Die Yogamatte unter dem Arm, schob ich mich an meinem Vater vorbei, dem meine Worte das Grinsen aus dem Gesicht gewischt hatten.
Meine Wohnung über dem Buchladen war eher von bescheidener Größe. An einem quadratischen Flur, gleich hinter dem Eingang, stießen die Türen von Bad, Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer zusammen. Das heißt, sie würden, wenn ich nicht die Wohnzimmertür entfernt hätte, weil ihr Glaseinsatz bei meinem Einzug sowieso schon gefehlt hatte. Ich brauchte eigentlich gar kein Wohnzimmer, ich brauchte einen Arbeitsplatz, und genau das war es, was dieser Raum nun war: Hier stand mein Schreibtisch nahe an einem der Fenster und meine Yogamatte lag unter einem anderen. Ein Werkzeugkasten mit allerlei Nützlichem und jede Menge Kleinkram für zukünftige Projekte stapelten sich in den Ecken. Der Raum sah so planlos aus wie es mein Leben war, doch beides vermochte ich derzeit nicht zu ändern.
»Er kommt rüber.« Mein Vater preschte an mir vorbei und rannte wie von Furien gehetzt in Richtung meines Schlafzimmers. Meines ehemaligen Schlafzimmers, denn ich hatte es auf unbestimmte Zeit an meinen Vater abgetreten. Seitdem schlief ich mehr schlecht als recht auf meiner Yogamatte.
»Vielleicht ist er gar nicht hinter dir, sondern hinter mir her. Hätte ich auch gleich drauf kommen können.« Mein Vater riss die Tür zum Schlafzimmer auf und drehte sich noch einmal zu mir um. »Wenn er fragt, du hast mich seit Monaten nicht gesehen, verstanden?«
»Ich habe dich seit Monaten nicht gesehen«, wiederholte ich geduldig und sah zu, wie mein alter Herr von der Bildfläche verschwand.
Dann trat ich ans Fenster und sah hinüber zu dem Fremden. Doch das Fenster im Nachbarhaus war jetzt leer. Die Glühbirne an der Decke spendete noch immer ihr gelbes Licht. Die Wohnung wirkte verlassen.
Da schrillte meine Türglocke.
Einen Moment lang zögerte ich. Ein seltsames Gefühl, eine Vorahnung überkam mich. So, als stünde eine entscheidende Wende in meinem Leben bevor. Statt zur Gegensprechanlage zu gehen, trat ich wieder ans Fenster, öffnete es und sah hinunter. Vor der Haustür, gleich neben dem Eingang zum Antiquariat, stand der kahlköpfige Fremde, der mich eben noch vom Nachbarhaus aus beobachtet hatte. Gerade drückte er ein weiteres Mal auf meinen Klingelknopf, woraufhin es hinter mir erneut zu schrillen begann. Ich stand noch immer still da und sah dem Fremden dabei zu, wie sich dieser hartnäckig in mein Leben klingelte. Und das seltsame Gefühl in meiner Brust verstärkte sich.
Jetzt hob der Mann den Kopf, suchte und fand mich, wie ich reglos dastand und auf die Straße hinunterblickte.
»Wollen Sie mich nicht hereinlassen?« Die Stimme des Mannes war laut, sein Dänisch verzerrt durch einen starken Akzent.
Ich erwog kurz, meinem Bauchgefühl zu folgen und den anderen genau dort zu lassen, wo er war. Doch stattdessen verließ ich meinen Beobachtungsposten und ging in den Flur. Während ich den Türöffner betätigte, lauschte ich meiner inneren Stimme, die mich zu erhöhter Wachsamkeit mahnte. Dann öffnete ich dem Fremden.
»Guten Abend.«
Ich betrachtete den Herrn, der die Treppe hinaufkam. Ein großer, breitschultriger Mann mit weit über hundert Kilo Lebendgewicht, ein rotgesichtiger Glatzkopf von etwa fünfzig Jahren, gekleidet in einen beigefarbenen Leinenanzug. Letzterer erschien mir zu edel für einen Umzugstag.
»Kann ich Ihnen behilflich sein?« Irgendwie hoffte ich, dass ich das nicht konnte. Ich hatte weder Lust, dem Mann beim Einzug zu helfen, noch, mich länger mit ihm zu unterhalten. Da war ein Ausdruck von Überlegenheit im Gesicht des Fremden, der mich zutiefst abstieß. Und wenn es hier doch um meinen Vater ging? Das war das denkbar schlechteste Anliegen, mit dem der Fremde zu mir kommen konnte.
»Ja«, antwortete der andere jetzt. »Sie können mir helfen. Ich denke, Sie sind genau der Mann, den ich suche.«
Ich dachte an meinen Vater hinter der Schlafzimmertür und fühlte mich unbehaglich. Der Fremde überragte mich um Haupteslänge und seine Gesichtszüge wirkten so freundlich wie die einer englischen Bulldogge. Nur um überhaupt etwas zu tun, zog ich ein Haargummi aus der Tasche meiner Jogginghose und band mein schulterlanges Haar im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammen.
»Sie suchen einen Yogalehrer? Oder einen Hausmeister? Einen Texter vielleicht? Ich bin ganz gut in Schicksalsgeschichten, Sie kennen diese Blättchen?«, fragte ich und war mir ganz sicher, dass die Antwort Nein lauten würde.
»Nein.«
Ich hatte es ja gewusst.
»Darf ich eintreten?«
Jetzt hätte ich gerne meinerseits verneint. Doch der gesunde Menschenverstand und meine gute Erziehung warfen sich dazwischen und veranlassten mich, den Mann eintreten zu lassen. Rational betrachtet sprach nichts dagegen. Nichts, außer eben diesem warnenden Gefühl in der Bauchgegend und meinem Vater im Schlafzimmer.
»Darf ich fragen, wer Sie sind und was Sie zu mir führt?«, fragte ich meinen Besucher, wies ihm den Weg und deutete auf einen schon recht abgenutzten Ledersessel. Doch der Mann blieb stehen und sah sich in meinem Arbeitszimmer um. Mir wurde immer unwohler.
»Sie heißen Smiljan Sandhus?«
Ich nickte und setzte mich auf den Drehstuhl vor meinem Schreibtisch. Mit einer, wie ich hoffte, unauffälligen Bewegung schob ich die geschönte Haltestellenstatistik unter ein Journal. War ich etwa aufgeflogen?
»Sie leben und arbeiten hier in diesem Raum.«
Es war keine Frage, es war eine Feststellung. Wusste der Kerl etwa, dass ich seit Wochen auf meiner Yogamatte schlief, weil mein Schlafzimmer von meinem Vater okkupiert worden war? Nein, das konnte er nicht wissen.
»Meistens«, gab ich zur Antwort. »Manchmal gebe ich Kurse in einem Fitnessstudio. Oder ich kümmere mich um die dort anfallenden Arbeiten«, ergänzte ich.
»Verstehe.« Der Fremde wanderte gemessenen Schrittes im Raum herum.
»Ich leider nicht«, gestand ich. Mittlerweile kam mir die Situation reichlich grotesk vor. Diese Unterhaltung glich einem Bühnenstück ohne Publikum.
Der andere verlor jäh das Interesse an meiner kargen Einrichtung und konzentrierte seinen Blick jetzt ganz auf mich. »Sie haben also eine Ausbildung zum Fitnesslehrer vorzuweisen? Eine Bescheinigung, ein Diplom oder dergleichen? Oder haben zumindest weitreichende Kenntnisse auf einem artverwandten Gebiet?«
»Ich kann gut anleiten.« Ich wusste, dass diese Worte eher nach einer Verteidigung als nach einer richtigen Antwort klangen.
»Und außerdem verfassen Sie herzzerreißende Texte für Klatschblätter. Übernehmen Sie auch noch andere Arbeiten?«
»Ich habe noch Kapazitäten frei.«
Der Fremde nickte. »Ja, natürlich haben Sie das. Ich erkenne einen Verlierer, wenn ich ihn sehe.«
Das war genau der Moment, in dem ich den Kerl einfach nur noch loswerden wollte. »Wenn Sie gekommen sind, um mich zu beleidigen, dann finde ich es großartig, dass Sie gar nicht erst Platz genommen haben. Finden Sie allein raus, oder soll ich Ihnen helfen?«
Die Worte klangen mutiger, als ich mich fühlte. Ich bin nicht gerade groß und eher das, was man schmächtig nennt. Auf Handgreiflichkeiten hatte ich mich schon zu Schulzeiten nie eingelassen, ich war mehr fürs Weglaufen bestimmt. Doch wie sollte ich guten Gewissens aus meiner eigenen Wohnung davonlaufen?
Noch immer erschien mir diese Szene unwirklich und der Mann vor mir war sehr groß und kräftig. Mit einer gewissen Erleichterung bemerkte ich jetzt ein schwaches Zucken im Mundwinkel des Fremden. Und auch wenn mir selbst nicht zum Lachen zumute war, entspannte es doch die Situation.
»Sie sind jung, nicht auf den Mund gefallen und vermutlich auch nicht auf den Kopf. Und Sie brauchen Geld«, fuhr er fort und stützte sich auf die Lehne des leeren Stuhls.
»Ich brauche kein Geld, ich verdiene genug mit meiner Arbeit«, erwiderte ich.
»Blödsinn.« Der Fremde verdrehte die Augen. »Sie haben keine vernünftige Ausbildung, keinen richtigen Job und dazu noch einen Vater zu versorgen, der im ganzen Land gesucht wird.«
Er wusste Bescheid. War er gekommen, um ihn zu holen? Aber was wollte er dann noch von mir?
»Sie werden nicht immer jung und gesund sein, Smiljan, das ist niemandem vergönnt, ganz egal wie oft man ins Fitnessstudio läuft. Wollen Sie mir erzählen, Sie könnten sich Rücklagen schaffen? Für die schlechten Tage? Und die werden kommen, Smiljan Sandhus, darauf können Sie wetten. Sie brauchen mehr Geld, als Sie jetzt verdienen, Junge. Viel mehr. Oder Sie werden höher verlieren, als Sie es sich jetzt vorstellen können.« Der Fremde ließ die Stuhllehne los und bewegte sich gemächlich auf die Wohnungstür zu. »Wenn Sie mir zustimmen, und Sie sind vielleicht klug genug, um genau das zu tun, dann habe ich einen Job für Sie. Einen guten und interessanten Job, und legal ist er auch noch. Ich gehe jetzt wieder rüber in diese Schuhschachtel, die eine Wohnung sein soll, und werde dort genau zwei Stunden auf Sie warten, Smiljan Sandhus. Das gibt Ihnen genug Zeit zum Nachdenken. Danach fahre ich ab. Zurück in mein eigenes Leben. Und Sie sehen mich nie wieder.«
Ich fand, dass das wie ein Versprechen klang, und beobachtete voller Erleichterung, wie der Fremde die Wohnungstür von außen schloss. Dann stand ich in meinem Arbeitszimmer und starrte vor mich hin. Während ich starrte, durchlief ich alle emotionalen Stadien, die einer solchen Begegnung angemessen waren. Es begann mit Empörung, die sich fast bis zur Wut steigerte, verlegte sich dann auf Verachtung gegenüber einem Fremden, der offensichtlich nichts vom Leben im Allgemeinen verstanden hatte, und schließlich begann ich zu rechnen.
»Geh da nicht hin, Junge. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache.« Mein Vater hatte natürlich gelauscht. Und entgegen meiner Vermutung, dass er sich für den Rest des Abends im Schlafzimmer verbarrikadieren würde, stand er jetzt hier vor mir.
»Wir brauchen wirklich mehr Geld, Vater.«
»Ich hab’ doch nur eine kleine Durststrecke, Junge. Alles wird wieder gut, vertrau mir. Noch ein paar Monate und dann werde ich …«
»Du wirst gar nichts«, erwiderte ich ruhig. »Sei froh, dass alle dich am anderen Ende der Welt vermuten und nicht hier bei mir. Lass es gut sein, ich werde eine Lösung für uns finden.«
Dann ging ich duschen. Ich hatte schließlich zwei Stunden Zeit. Unter dem Strahl des warmen Wassers rechnete ich weiter, überlegte kurz, die letzten Kontoauszüge zurate zu ziehen, tat es aber als sinnlos ab. Ich kannte meinen Kontostand. Abschließend kämpfte ich noch eine Weile mit meinem Stolz. Letzterer schrumpfte auf ein Minimum zusammen, nachdem ich einen Blick in den Kühlschrank geworfen und das letzte halbe Bier getrunken hatte. Die letzte Käsescheibe aß ich ohne Brot und mit einer gehörigen Portion Selbstverachtung. Und gerade als ich den Schlüssel einstecken und die Wohnung verlassen wollte, öffnete sich die Tür des Schlafzimmers erneut.
»Wer war der Kerl überhaupt, Smiljan? Weißt du das?« Die Augen meines Vaters blickten sorgenvoll aus dem unrasierten Gesicht, der grüne Morgenmantel, den er meistens trug, wies Reste von Eigelb am Revers auf.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
»Smiljan. Ich finde, es reicht schon, wenn ich mein Leben versaut habe. Handle du dir nicht auch noch Ärger ein.« Seine Stimme klang aufgeregt, und ich beeilte mich, ihn zu beruhigen.
»Ich höre mir an, was er zu sagen hat, und dann sehen wir weiter.«
Mein Vater runzelte die Stirn und fuhr sich durch das feine, farblose Haar. »Da geht es doch bestimmt um irgendwas Illegales.«
»Dann mach ich den Job nicht.« Er sah nicht überzeugt aus, und ich spürte, wie ich die Geduld verlor. »Ich gehe jetzt. Wenn du dich so um mich sorgst, dann stell dich hinter die Gardine. Vom Fenster aus wirst du genau beobachten können, was sich in der Wohnung gegenüber tut.«
Ich flüchtete vor weiteren Nachfragen ins Treppenhaus. Ein paar Stufen später stand ich auf dem Bürgersteig und atmete die wohlvertraute Mischung aus Nachtluft und Autoabgasen. Es war kühl, der Sommer vorbei, und irgendwo lag schon der lange, stürmische Winter auf der Lauer. Im ersten Stock des Nachbarhauses brannte noch immer die einzelne Glühbirne. Ich überquerte die Gammelgade und klingelte kurzentschlossen bei Maiberg, denn dieser Name war der einzige, der erst kürzlich mit einem Streifen Kreppband über das ursprüngliche Klingelschild geklebt worden war. Kein dänisch klingender Name, wie ich fand. Gleich darauf hörte ich den Summer und lehnte mich gegen die Tür, die sogleich aufsprang. Schon beim Eintreten in den dunklen Hausflur hörte ich die Stimme des fremden Mannes.
»Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Kommen Sie rauf.«
In der fremden Wohnung des Mannes mit dem Namen Maiberg stand tatsächlich kein einziger Umzugskarton. Hinter allen weit geöffneten Türen herrschte gähnende Leere.
»Ist das jetzt Ihre Wohnung?«, fragte ich und machte ein paar Schritte vorwärts in den Raum mit der nackten Glühbirne. Es war die Küche, wie mir die Wasseranschlüsse an der Wand verrieten.
Maiberg gab keine Antwort. Stattdessen nahm er eine Bierflasche von der Bank des Küchenfensters, eben jenes Fensters, durch das er mich beobachtet hatte, öffnete sie und reichte sie an mich weiter.
Ich zögerte, daraus zu trinken, und sagte, was mir unter der Dusche am wichtigsten erschienen war: »Sie haben von einem legalen Job gesprochen und nur deswegen bin ich hier. Wenn ich merke, dass ich für irgendwelche krummen Machenschaften benutzt werden soll, dann werde ich nicht zögern …«
Maiberg griff in die Innentasche seines Sakkos und zog ruckartig etwas heraus. Ich hielt den Atem an, doch statt einer Waffe wurde mir unvermittelt eine Fotografie vor das Gesicht gehalten. Sie zeigte ein Mädchen mit ausdruckslosem Gesicht und Mireille-Mathieu-Frisur. »Sie ist Ihr Job. Sehen Sie sie genau an, denn daraus wird Ihre Arbeit bestehen: Sie genau anzusehen. Jeden Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und darüber hinaus. Schaffen Sie das? Wenn Sie gerade mal ein bisschen unterrichten müssen, kann Ihr Vater für Sie einspringen. Das wäre doch eine nette Abwechslung für den alten Mann. Wo er doch nun schon seit Wochen in der kleinen Wohnung dort drüben festsitzt. Und es wird noch viel Zeit vergehen, bis Gras über seine Verbrechen gewachsen ist.«
»Mein Vater ist kein Verbrecher«, widersprach ich. »Er hatte die besten Absichten, als er das Geld seiner Kunden und Freunde anlegte. Er hatte einen todsicheren Tipp bekommen, verstehen Sie?«
»Ja, diese Art Tipps kenne ich sehr gut.« Maiberg wedelte mit der Fotografie vor meinem Gesicht herum. »Interessanterweise liegen die Tippgeber meist kurz nach dem Platzen der Seifenblase an einem fernen Strand und zählen ihre Millionen, während andere wie Ihr Vater bis zum Hals in der Scheiße stecken. Aber was rede ich. Das sind Probleme, die mich eigentlich gar nichts angehen. Mir geht es einzig und allein um sie.«
Maiberg ließ zu, dass ich ihm das Foto aus der Hand nahm. Ich betrachtete das runde Gesicht genau und schätzte das Mädchen auf etwa dreizehn Jahre.
»Das ist ein Kind«, stellte ich fest und machte Anstalten, das Bild zurückzugeben, doch Maiberg nahm es nicht zurück.
»Sie ist dreiundzwanzig.« Die Stimme des anderen knarrte nicht mehr. Sie hatte eine warme Färbung angenommen. »Und ihr Name ist Katalie.«
Dreiundzwanzig, nur fünf Jahre jünger als ich selbst. Mir fiel es schwer, das zu glauben. Das Mädchen auf dem Foto trug einen Nickipullover und eine Cordhose. Kein Mensch trug heutzutage noch Cordhosen, schon gar keine junge Frau. »Katalie. Ein seltsamer Name. Habe ich noch nie gehört.«
»Ein seltsamer Name für ein seltsames Mädchen.« Die Stimme des Mannes war noch weicher geworden, seine Gedanken schienen für einen Moment abzuschweifen, doch dann klang er wieder ganz geschäftsmäßig, als er fortfuhr: »Sie wird hier einziehen. Katalie hat diese Wohnung von ihrer Großmutter geerbt, die vor einigen Wochen im Krankenhaus verstorben ist. Ihr ganzer Besitz ging an Bedürftige, nur diese Wohnung hinterließ sie ausgerechnet ihrer Enkelin. Katalie ist fest entschlossen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Deswegen und weil es so am besten ist, werden Sie von dem Tag ihres Einzuges an ein wachsames Auge auf sie haben, verstanden?«
»Nein«, gab ich unumwunden zu. »Was bedeutet es, ein wachsames Auge auf jemanden zu haben? Wie stellen Sie sich das vor?«
Maiberg deutete auf das Fenster und hinüber zu meiner Wohnung. »Sie werden morgens nachsehen, ob sie aufsteht, werden darüber wachen, was und wie oft sie isst, werden sicherstellen, dass sie jeden Abend heimkommt und beobachten, mit wem sie sich umgibt oder anfreundet.«
Mir kam ein Verdacht. Noch einmal betrachtete ich das Foto in meiner Hand genau. »Kann sie nicht auf sich selbst aufpassen? Ist Katalie behindert oder geistig zurückgeblieben?«
»Das konnte niemals nachgewiesen werden!« Maiberg klang jetzt aufgebracht und rang die Hände, hatte sich aber Sekunden später wieder in der Gewalt. Er räusperte sich und seine Stimme klang verlegen, als er weitersprach: »Katalie ist sonderbar, ja. Ihre Art, die Dinge zu sehen, ist einzigartig. Sie ist nicht ganz von dieser Welt.« Er machte eine ausladende Geste und wirkte nun gar nicht mehr wie der weltgewandte Mann, der mir in meinem Arbeitszimmer gegenübergestanden hatte. Jede Überheblichkeit war von ihm abgefallen. »Manchmal wären wir alle gern nicht von dieser Welt, nicht wahr? Aber unser Verstand folgt allgemeinen Regeln und Gesetzen und kann gar nicht mehr anders, als immer wieder auf denselben ausgetretenen Pfaden zu wandeln, verstehen Sie? Bei Katalie ist das anders.« Seine Arme fielen herab. »Um sie herum scheint die Wirklichkeit sich zu verzerren, wenn Sie mir folgen können.« Das konnte ich nicht, und meine Mimik hatte wohl auch genau das zum Ausdruck gebracht, weswegen Maiberg einmal mehr hilflos die Hände rang und sagte: »Sie werden es erleben, junger Mann. Und dann werden Sie verstehen, wovon ich rede. Sie und ich, wir sind beschränkt in unserer Gedankenwelt, Katalie ist das nicht.« Er rieb sich über den kahlen Kopf, auf dem jetzt Schweißperlen glitzerten. »Aber genau das macht die Realität zu einem gefährlichen Ort für sie. Jemand muss ein Auge auf sie haben. Jemand, der ständig in ihrer Nähe ist. Jemand, der in ihrer Nähe lebt und arbeitet. Jemand wie Sie.«
Jetzt glaubte ich, verstanden zu haben. Und ich beschloss geistesgegenwärtig, das Beste für mich aus dem Dilemma meines Gegenübers herauszuholen. »Haben Sie einen Zettel und einen Stift?«, fragte ich Maiberg.
Der Mann zog wortlos einen teuer aussehenden Kugelschreiber aus der gut bestückten Innentasche seines Jacketts und fand in der Tasche seiner Hose die Quittung einer Tankstelle. Beides reichte er mir. Ich drückte den Zettel an die weiße Küchenwand und notierte rasch eine Reihe von Zahlen.
»Was soll das?«, fragte Maiberg.
»Das ist meine Kontonummer und die Summe, die Sie mir monatlich überweisen werden. Beginnend mit dem Monat, in dem Katalie hier einzieht.« Ich reichte den Zettel an Maiberg zurück. »Und erwarten Sie bitte nicht, dass ich für den Preis eines gewöhnlichen Kindermädchens arbeite. Dass das ein Fulltimejob ist, den Sie mir da anbieten, ist Ihnen ja wohl klar.«
Maiberg zückte nun seinerseits eine Visitenkarte, die er mir überreichte. »Und dies ist die Mailadresse, an die Sie jeden Abend einen Bericht über Katalies Tätigkeiten der vergangenen Stunden schicken werden. Ist das auch klar?«
»Völlig klar.« Ich warf einen Blick auf die Visitenkarte.
Maiberg Industries.
Ich hätte eine höhere Summe auf dem Kassenzettel vermerken sollen. »Der Betrag, den ich von Ihnen für meine Arbeit verlange …«
»Ja?« Maiberg zog eine Augenbraue hoch.
»Liegt er oberhalb oder unterhalb ihrer ursprünglichen Preisvorstellung?«
Maiberg bleckte die Zähne zu einem kalten Grinsen. »Er liegt weit unter dem, was ich zu zahlen bereit gewesen wäre.«
Mist. Aber vielleicht ließ sich noch etwas mehr aus dem Mann rausholen. »Wenn der Job sich als anstrengender als erwartet entpuppen sollte, werde ich eine Lohnerhöhung fordern.«
»Er wird viel anstrengender, als Sie es erwarten, verlassen Sie sich darauf.« Maibergs Unterkiefer verkrampfte sich grimmig.
Kapitel 2
Drei Wochen später
Missgelaunt saß Tom Sawbarn am Steuer seines Kleintransporters und rumpelte viel zu schnell über den ausgefahrenen Kiesweg. Die leuchtenden Ziffern am Armaturenbrett ließen ihn wissen, dass es stramm auf fünf Uhr morgens zuging. Was für eine verschwendete Nacht, was für eine sinnlose Herumfahrerei, was für eine alberne Idee. Rund um Esbjerg gab es die herrlichsten Strände, aber nein, sie mussten ja die Küste hochfahren, bis zu dem einen, dem besten, dem vielversprechendsten aller Strände.
»Da vorne musst du abbiegen, Tom. Gleich dort drüben bei den zwei niedrigen Kiefern ist der nächste Parkplatz«, rief Kalle vom Beifahrersitz aus und fuchtelte mit seiner Hand vor Toms Gesicht herum. Kalle stank nach Schweiß, Frittenfett und Armut und wechselte nie seine Jogginghose oder seinen Pullover mit dem aufgedruckten Maskottchen eines Möbelhauses. Kalle war eine Nervensäge und hatte immer wieder blöde Einfälle, so blöde wie eben diesen. Aber er war noch immer einer von Toms besten Freunden. Und war es etwa Kalles Schuld, dass in seinem Leben seit ihrer gemeinsamen Schulzeit alles schiefgelaufen war? Manches war schon seine Schuld, dachte Tom und bog auf den nahezu verlassenen Parkplatz vor den grasbewachsenen Dünen ein. An der Einfahrt zu dem steinigen Platz wuchsen wenige krüppelige Kiefern und warfen bizarre Schatten im Mondlicht.
Manches war ganz eindeutig Kalles eigene Schuld gewesen. Vielleicht nicht der Verlust seines ersten Jobs, aber der Verlust aller folgenden schon. Vielleicht nicht das Scheitern seiner letzten Ehen, doch das der allerersten schon. Und jetzt hatte Kalle aufgegeben. Nicht alles und nicht völlig, aber die Dinge, auf die es Toms Meinung nach ankam, die hatte Kalle endgültig hinter sich gelassen. Das Streben nach einem festen Wohnsitz beispielsweise, die Suche nach einer Arbeit, einer richtigen Arbeit, die ihn ernähren und kleiden konnte. Stattdessen unternahm er Ausflüge wie diesen hier und Tom half ihm auch noch dabei.
»Nur ein anderes Auto zu sehen«, sagte Kalle und spähte hinaus auf den vom Vollmond beschienenen Parkplatz inmitten der Dünenlandschaft. »Das gehört sicher ein paar Teenagern, die sich gerade nackt und eng umschlungen durch die Dünen wälzen.«
Tom bezweifelte das. Der Strand am Gammelgab wurde selbst bei Tage nur von wenigen Sonnenanbetern heimgesucht, er lag weiter abseits der Ferienhäuser als die beliebten Touristenstrände. Und jetzt, da die Sommersaison vorbei war und die ersten kühlen Herbstnächte Einzug hielten, hatte dieser Ort auch für die einheimischen Liebespaare an Reiz verloren.
Kalles guter Laune tat der verlassene Wagen, der ganz vorn am Dünenweg geparkt war, keinen Abbruch. »Wir sind konkurrenzlos, Tom. Alles, was wir heute Nacht finden, gehört uns.«
Sein Freund schlug ihm mehrmals hintereinander auf die Schulter und riss die Beifahrertür auf. Tom zog den Zündschlüssel ab und stieg ebenfalls aus. Augenblicklich fuhr ihm der Wind durch das schwarze Haar und zerzauste es. Im Gegensatz zu Kalle, der jetzt mit Ende dreißig fast kahl war, hatte Tom sein volles Haar behalten.
»Der Wind steht richtig«, jubelte Kalle, schlug die Wagentür zu und marschierte zielstrebig in Richtung eines mit Stroh ausgelegten Pfades, der sie durch die Dünen zum Meer führen würde.
»Der Wind schon«, rief Tom und folgte dem Freund mit schnellen Schritten. Bald hatte er ihn eingeholt und fuhr etwas gedämpfter fort: »Aber abgesehen von der Windrichtung ist so ziemlich alles verkehrt. Es ist noch viel zu warm, um wirklich etwas zu finden. Dunkel ist es auch noch.«
»Es wird schon hell werden«, erwiderte Kalle. »Wird es jeden Tag. Und heute werden wir die ersten an der Wasserlinie sein. Alles gehört uns. In Blåvand hat man mir versichert, dass man mir alles abkaufen würde, was ich zusammenbringe.«
»In Blåvand? Du warst also wieder bei Sven«, stellte Tom fest und verdrehte die Augen. Sven hatte ebenfalls mit ihm und Kalle die Schulbank gedrückt. Und genau wie Tom hatte Sven, wann immer Kalle stinkend und hungrig bei ihm auftauchte, das Gefühl, seinem Freund aus Kindertagen irgendwie helfen zu müssen. Obwohl Sven als Juwelier seinen Bernstein längst zu günstigen Konditionen aus Russland bezog, kaufte er Kalle dessen Funde noch immer für viel zu viele Kronen ab.
»Diese Gegend ist perfekt für Bernstein.« Kalle verließ den mit Stroh ausgelegten Strandweg zugunsten eines Trampelpfades und erklomm die erste Düne. »Hier habe ich vor zwei Jahren meinen größten Bernstein gefunden. Und noch viele andere schöne Brocken.«
»Es ist nicht kalt genug für Bernstein. Und Sturm wäre besser als das bisschen Wind, das weiß doch jeder.«
Tom kam das ganze Unternehmen noch immer blödsinnig vor. Er wusste, dass der Bernstein bei niedrigen Wassertemperaturen nach oben getrieben und durch Sturm bis an die Küste gespült wurde. Der Sommer war keine gute Zeit zum Bernsteinsuchen, auch der frühe Herbst war es nicht. Je schlechter das Wetter, umso besser die Chancen auf Bernstein. Warum kurvte er also mehr als eine Stunde in aller Herrgottsfrühe durch die Landschaft, um Kalle an seinen Bernsteinstrand zu bringen, wo sie jetzt im September und ohne Sturm kaum fündig werden würden? Er konnte verstehen, dass Kalle lieber die unsinnigste und unproduktivste Arbeit auf sich nahm, als um Geld betteln zu müssen. Er konnte verstehen, dass es einen Rest von Stolz unter Kalles Dreckschicht gab, Stolz, den er hegte und pflegte, um ihn nicht auch noch zu verlieren. Aber dass er, Tom Sawbarn, ein hart arbeitender Gastwirt aus Esbjerg, deswegen um seinen Schlaf gebracht wurde, das sah er nicht ein. Rebecca hatte eben doch recht gehabt, als sie ihn vor Ausflügen mit Kalle gewarnt hatte. Der Schlafmangel würde ihm den Rest des Tages zu schaffen machen.
Der volle Mond hing wie ein großer, gelber Käse über den Dünen, die, je näher sie dem Wasser kamen, an Bewuchs einbüßten und in sandigem Weiß schimmerten. Tom konnte die Brandung des Meeres bereits hören, ohne den Strand zu sehen. Sie war nicht laut genug. Es würde kein guter Morgen für Bernstein werden, der, leicht wie er war, auf dem Wasser schwimmend den Strand erreichte und sich dadurch von allen anderen Steinen unterschied. Doch heute würde es außer Treibholz, Tang und leeren Eikapseln nichts zu finden geben. Aber vielleicht fand sich im Müll des Meeres ja etwas anderes Brauchbares, das Kalle zu Geld machen konnte. Irgendetwas, das dieser Aktion einen Sinn gab.
In diesem Moment entdeckte Tom die beiden Gestalten im Dünental zu seiner Linken. Und kaum, dass er wirklich begriffen hatte, was er dort sah, sank er schon in die Hocke und zog Kalle mit sich.
Kalle war nicht dumm. Er stellte keine Frage, ging kommentarlos zwischen dem lichter werdenden Strandgras in Deckung und spähte vorwärts. Tom suchte den Blick des Freundes und tippte sich vielsagend an das linke Ohr. Zum Rauschen des Meeres hatten sich die angestrengt klingenden Flüche eines Fremden gesellt. Die gesprochenen Worte endeten so abrupt, wie sie begonnen hatten. Stille folgte.
»Was geht da vor?«, raunte Kalle schließlich und machte Anstalten, sich aus der Hocke zu erheben.
Tom hielt ihn zurück. »Da vorn ist jemand. Da scheint etwas sehr Eigenartiges vor sich zu gehen.« Dieser Jemand war seiner Meinung nach ein Mann. Ein Mann, der etwas hinter sich herzog. Und dieses Etwas hatte Tom stark an einen schlaffen menschlichen Körper erinnert.
»Was meinst du damit?« Kalles Stimme war auf minimale Lautstärke herabgesunken, während er selbst jetzt den Hals reckte, um mehr sehen zu können. »Braucht jemand Hilfe?«
Tom schüttelte den Kopf. Die Gestalt vor ihnen hatte ihre Last nicht in Richtung Parkplatz geschleppt, sondern tiefer in die Dünen, fort von der Zivilisation. Was immer sich dort abspielte, sollte bestimmt in aller Heimlichkeit geschehen. Tom glaubte nicht, dass Zeugen wie er und Kalle zu diesem Zeitpunkt sehr willkommen gewesen wären. »Ich glaube, da schleppt jemand einen Toten mit sich herum«, erklärte er seinem Freund die Lage.
»Ach du Scheiße«, raunte Kalle zurück. Er schien angestrengt nachzudenken. Dann sagte er: »Jemand, den wir kennen?«
»Woher soll ich das wissen, kenn’ ich ganz Dänemark persönlich, oder was?«, zischte Tom. »Außerdem habe ich die zwei doch nur für eine Sekunde gesehen.«
In diesem Moment tauchte die Gestalt vor ihnen auf der Kuppe einer höher gelegenen Düne auf. Noch immer zog sie einen reglosen menschlichen Körper hinter sich her. Tom warf Kalle einen raschen Blick zu und stellte fest, dass sein Freund die Situation ähnlich einschätzte wie er selbst. Kalles Augen waren vor Entsetzen geweitet, seine linke Hand hielt er sich vor den Mund gepresst.
»Duck dich tiefer«, befahl ihm Tom.
Und während er selbst jetzt fast mit der Nase im Strandsand verschwand, sah er aus den Augenwinkeln, dass Kalle sich sogar noch weiter streckte, um einen besseren Blick auf das nächtliche Schauspiel zu haben.
Gleich darauf hörte er seinen Freund flüstern. »Ich glaube, du hast hast Recht, Tom. Der zieht wirklich eine Leiche durch die Landschaft. Und jetzt, jetzt …«
Kalles Gestammel war mehr, als Tom vertragen konnte. Auch wenn es ihm leichtsinnig erschien, hob er den Kopf, um zu sehen, was Kalle beobachtete, und stellte fest, dass die Silhouette des Mannes, jetzt scheinbar von aller Last befreit, Schritt für Schritt hinter dem Dünenkamm verschwand.
»Was ist passiert?«, wollte Tom wissen.
»Er hat den anderen einfach die Düne runtergeschubst und läuft nun seelenruhig hinterher«, stellte Kalle fest. »Da kullert gerade ein Toter über den Nordseestrand, ist das zu fassen? Ob er den hier draußen verbuddeln will? Den findet hier dann sicher keiner mehr wieder.«
Doch, dachte Tom. Wenn die Dünen weiterwandern, dann wird man ihn finden. Aber das konnte eine ganze Weile dauern. Laut sagte er: »Was sollen wir denn jetzt machen?«
»Abhauen natürlich«, antwortete Kalle. »Nur schade um den schönen Bernstein am Strand und all das Benzin, das du heute Nacht ganz umsonst verfahren hast.«
»Abhauen? Ist das dein Ernst? Da vorne entsorgt jemand den Körper eines Menschen zwischen den Dünen. Da können wir uns doch nicht einfach umdrehen und abhauen.« Doch schon wich Toms Empörung plötzlicher Klarheit. Natürlich mussten sie abhauen. Auf direktem Wege mussten sie zur nächsten Polizeistation fahren und dort berichten, was sie hier im Gammelgab beobachtet hatten. Das Kennzeichen des zweiten verlassenen Wagens auf dem Parkplatz würde er sich vorsorglich notieren, wenn sie wieder daran vorbeikämen. Es könnte die Polizei direkt zum Täter führen.
»Polizei«, entfuhr es ihm, und schon wollte er den Weg zurückkriechen, den sie gerade erst gekommen waren.
Doch Kalle hielt ihn zurück. »Gute Idee, Tom. Aber ich geh’ lieber allein. Ich nehme dein Auto und hole die Polizei hierher. Du beobachtest, was sich hier weiter tut. Ohne Leiche glaubt uns das hier nämlich niemand. Wir müssen wissen, was er mit dem Toten macht.«
»Wieso fährst du zur Polizei?«, begehrte Tom auf. »Wieso nicht ich? Es ist mein Auto.«
»Schere, Stein, Papier«, flüsterte Kalle und hob die Hand.
Einen Augenblick später hatte sein Stein Toms Schere geschlagen, und noch einen Augenblick später sah Tom seinen Freund den Weg zum Parkplatz zurückschleichen. Wie dumm, dass er Kalle nicht geraten hatte, sich das Kennzeichen des fremden Wagens zu notieren.
Noch immer rauschte das Meer. Er beobachtete abwechselnd den Zeiger seiner Armbanduhr und die Kuppe der Düne, hinter der der Mann mit der Leiche verschwunden war. Wenn der Kerl den Toten noch tiefer in die Dünenlandschaft zerren wollte, dann müsste seine Gestalt so langsam auf einem der weiter entfernten Dünenkämme auftauchen, oder etwa nicht? Vergrub er den Toten bereits in einer Senke? Und wenn ja, womit?
Tom dachte angestrengt nach, doch er konnte sich nicht erinnern, eine Schaufel bei dem Mann gesehen zu haben. Grub der Kerl etwa mit den bloßen Händen? Dann könnte die Polizei doch noch rechtzeitig genug eintreffen, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Was aber, wenn der Mann einen ganz anderen Plan verfolgte?
Plötzlich fröstelte Tom. Er hockte hier noch immer auf dem Trampelpfad, der vom Strandweg zur Wasserlinie führte. Dieser Weg war nur einer von vielen im Gewirr der Dünen, doch wenn jemand zu eben jenem Parkplatz zurückkehren wollte, dann war es nicht unwahrscheinlich, dass er hier entlangkam, um zu seinem Fahrzeug zu gehen. Hier, zwischen den Dünen, konnte der Fremde sich ihm von allen Seiten nähern: von links, rechts, vorn oder …
Tom blickte sich hektisch um. Er war ganz allein. Aber er saß auf dem Präsentierteller und musste wachsam bleiben. Noch zweimal drehte Tom sich in der Hocke um die eigene Achse, um alle Himmelsrichtungen im Blick zu haben. Dann war er es leid. Die Rolle des Verfolgten lag ihm nicht, lieber war er der Verfolger, und solange er noch nicht entdeckt worden war, befand er sich klar im Vorteil. Es war an der Zeit, diesen zu nutzen.
Langsam und auf allen vieren kroch Tom durch das stachelige Strandgras. Keinesfalls wollte er auf sich aufmerksam machen, indem er aufstand und, wie der Kerl mit der Leiche zuvor, eine scharfe Silhouette im Mondlicht abgab. Er krabbelte vorwärts, bis es plötzlich steil bergab ging. Ein kleines Stück ließ er sich den Hang hinunterrutschen, dann kam er auf die Füße und lief bis zum tiefsten Punkt des Dünentals. Kalter, weicher Sand rann ihm in die Turnschuhe, machte sie schwer und unbequem, doch Tom ignorierte es. So schnell er konnte, erklomm er die nächste Düne und spähte wie ein Indianer auf dem Kriegspfad vorsichtig über den Kamm. Vor ihm breitete sich ein weiteres Dünental aus weißem Sand aus. Und unter ihm, dort wo der steile Hang endete, lag eine menschliche Gestalt und rührte sich nicht.
Der Tote, dachte Tom und hielt nach dem Mann Ausschau, der die Leiche hierhergeschleppt hatte, konnte ihn aber nirgendwo entdecken. Inzwischen war die Nacht so weit vorangeschritten, dass der Himmel von Nachtblau in ein Bleigrau zu wechseln drohte. Tom konnte immer mehr Einzelheiten wahrnehmen und erkannte, dass der Körper unten im Dünental einen schwarzen Anzug, schwarze Schuhe und ein weißes Hemd samt Fliege trug. Er war gekleidet, als wäre er noch Stunden zuvor Teil einer vornehmen Abendgesellschaft gewesen. Tom begann sich zu fragen, warum der Fremde diesen Anzugträger bis hierher geschleppt hatte, um ihn dann einfach liegen zu lassen. Hatte er keine Zeit mehr gehabt, sein Opfer zu vergraben? Oder war der Mann da unten gar kein Opfer? Lebte er vielleicht sogar noch?
Tom kniff die Augen zusammen. Der Kerl unter ihm rührte sich nicht. Tom zählte bis zehn. Dann traf er eine Entscheidung. Er würde sich vergewissern. Rutschend erreichte er nur einen Augenblick später die Gestalt, die reglos im Sand lag, und beugte sich über sie. Während er mit der einen Hand nach dem Puls am Hals tastete, wanderte sein Blick immer wieder unruhig zum Dünenkamm hinauf. Was, wenn der andere doch noch zurückkehrte?
Nach einer gefühlten Ewigkeit war er sich sicher, dass der Kerl vor ihm im Sand keinen Puls mehr besaß. Der Körper war auch schon recht kalt und von seiner Kleidung ging ein deutlicher Uringeruch aus. Tom betrachtete das schmale Gesicht des Enddreißigers mit dem albernen Oberlippenbärtchen genauer. War er dem Typ nicht irgendwo schon einmal begegnet? Vielleicht in seinem eigenen Café? Nein, dort verkehrten einfache Leute, keine Männer mit Oberlippenbart im schwarzen Anzug. Und trotzdem kam ihm der Kerl irgendwie bekannt vor. Da bemerkte Tom auf Brusthöhe des Mannes eine Ausbuchtung im schwarzen Anzugstoff. Der Tote trug etwas in der Innentasche seines Jacketts spazieren. Vielleicht ein Handy oder eine Brieftasche, möglicherweise etwas, das Tom Aufschluss über die Identität des Mannes gab?
Er zögerte nur kurz. Dann schob er seine Hand zwischen Hemd und Revers, ertastete im Innenfutter die gesuchte Tasche und zog einen Gegenstand heraus. Das Ding sah aus wie ein Zigarettenetui. Tom war enttäuscht. Ohne sich etwas davon zu versprechen, ließ er das silberne Etui aufschnappen und blickte auf ein zusammengefaltetes Taschentuch, das einen seltsamen Geruch verströmte. Tom konnte sich keinen Grund vorstellen, warum jemand ein feuchtes und müffelndes Taschentuch in ein Zigarettenetui sperren sollte. Gerade wollte er das Kästchen schließen, um es zurückzustecken, als er instinktiv spürte, dass er nicht mehr allein war.
»Was machen Sie denn da?«, fragte eine fremde Stimme hinter seinem Rücken.
Tom fuhr zusammen, sprang auf die Füße und sah sich um. Die Stimme war vom oberen Rand der Düne her gekommen. Schon sah er eine einsame Gestalt, die sich ihm rutschend näherte. Ein Mann, groß gewachsen und auffallend dünn. Er kam allein und trug einen Benzinkanister in der linken Hand. Tom erkannte augenblicklich die Gestalt wieder, erkannte in ihr den Mann, der gerade diesen toten Körper mit sich geschleift hatte. Jetzt durfte er keinen Fehler machen, durfte nichts Falsches sagen. Der Mann könnte ein Mörder sein. Ein Mörder, der in Ermangelung einer Schaufel beschlossen hatte, sein Opfer mit Benzin zu übergießen und zu verbrennen. Was sollte einen solchen Kerl davon abhalten, einen weiteren Mord zu begehen, um einen lästigen Zeugen zu beseitigen? Tom öffnete den Mund, um eine Lüge zu erfinden, irgendeine Erklärung dafür, was er hier tat.
Doch der Fremde kam ihm zuvor. »Tom? Bist du das etwa? Junge, ich glaube, du hast gerade einen schlimmen Fehler gemacht.«
Nur wenig später in der Havnegade in Esbjerg
Seit einer geschlagenen Stunde versuchte Marta Jorgensen vergeblich, ihren Hausarzt zu erreichen. Natürlich waren die frühen Morgenstunden keine Zeit, um einen schwer arbeitenden Mann aus dem Bett zu klingeln. Doch die einzige Alternative für Marta war, eines der Krankenhäuser von Esbjerg aufzusuchen, und das war etwas, was sie unter gar keinen Umständen wollte.
Etwa seit Mitternacht hatte sich Marta nicht recht wohlgefühlt. Zunächst hatte sie an den Anflug einer Grippe geglaubt, denn die Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen inklusive einer schnell ansteigenden Körpertemperatur waren wie aus dem Nichts über sie hereingebrochen. Doch von einer Grippe ließ sie sich nicht Bange machen. Marta Jorgensen war achtundsiebzig Jahre alt, dies war nicht ihre erste kleine Influenza. Mit einer Grippe gehörte man eben ins Bett und in ein paar Tagen würde dann alles wieder gut sein.
Doch als sie weit nach Mitternacht aus dem Schlaf aufgeschreckt war, hatte sie am ganzen Körper gezittert und die Lymphknoten in Achseln und Leisten waren zwischenzeitlich so groß und so hart geworden wie Hustenbonbons. Kurz darauf hatte Martas Sehfeld angefangen, sich zu verzerren, und das war der Moment gewesen, in dem sie eingesehen hatte, dass sie dringend Hilfe benötigte. Nichtsdestotrotz war ein Krankenhaus der letzte Ort, in dem Marta sich wiederfinden wollte. Krankenhaus war für sie gleichbedeutend mit Endstation. Noch nie war jemand, den sie gekannt hatte, gesünder aus einem Krankenhaus herausgekommen, als er es betreten hatte. Man ging mit einer lästigen Blasenentzündung hinein und kam mit einer Krebsdiagnose wieder heraus. Da konnte man mal sehen, was Krankenhäuser den Menschen antaten.
Mit zitternden Fingern wählte sie erneut die Nummer ihres Hausarztes Jonas Bager. Er musste doch längst zu Hause in seinem Bett liegen. Aber der Mann schien einen gesunden Schlaf zu haben. Nach einer Weile sprang, wie schon bei den Versuchen zuvor, der Anrufbeantworter an, der sie aufforderte, eine Nachricht zu hinterlassen. Bis zu diesem Moment war Marta dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Was sie wollte, war einen Arzt, nicht die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Jetzt aber, gepeinigt vom Schüttelfrost, kam sie der Bitte nach.
»Marta Jorgensen hier. Jonas, ich fühl mich, als ob ich sterben muss. Kommen Sie schnell und bringen Sie etwas von diesem Antispirin mit oder wie das Zeug heißt.«
Marta hustete ein paar Spritzer Blut auf das Telefon und legte auf. Kein Aspirin und kein Antibiotikum konnten ihr jetzt noch helfen. Doch das wusste sie natürlich nicht. Der Gedanke kam ihr erst, als das Atmen von Moment zu Moment anstrengender wurde. Jetzt wählte sie den Notruf, kam aber nur noch bis zur zweiten Ziffer. Ein Ende im Krankenhaus blieb Marta Jorgensen erspart.
Kapitel 3
»Sie streicht die Wände schon wieder um«, hörte ich meinen Vater sagen, der mit einem hellblauen Plastikfeldstecher vor den Augen an der Gardine vorbei aus dem Fenster spähte. Das Fernglas, das er dabei nutzte, hatte ich noch vor Katalies Einzug in einem Spielwarenladen in der Innenstadt erstanden. Obwohl es sich um billigen Schrott aus dem Reich der Mitte handelte, war es uns bei der täglichen Überwachung unserer Zielperson eine kleine Hilfe. Es verriet uns Details aus der gegenüberliegenden Wohnung, die uns ansonsten verborgen geblieben wären.
»Welche Farbe ist es diesmal?«, fragte ich und biss in mein geröstetes Weißbrot, auf dem die noch warme Leberpastete fettig glänzte. Endlich hatten wir wieder einen vollen Kühlschrank, endlich gab es alles, worauf wir gerade Lust und Appetit hatten. Und diesen Luxus verdankten wir der kleinen Katalie. Kaum zu glauben, wie leicht man sein Geld verdienen konnte. Hier saß ich an meinem Schreibtisch und genoss das Leben, sah gelegentlich nach Katalie und den anhaltenden Bussen und schrieb auch hin und wieder einen Brief für die Kummerkastentante der Daisy. Bei Lasse im Antiquariat und auch im Fitnessstudio ließ ich mich immer seltener sehen. Durch Maiberg verdienten wir genug, um uns kleine und größere Wünsche erfüllen zu können. So konnte es weitergehen.
»Die Grundfarbe bleibt erhalten. Sie bereichert das Grün lediglich um eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Blumen. Vielleicht sollten wir dem Kind ein Malbuch schenken. Anonym, versteht sich. Wir könnten es nachts in ihren Briefkasten werfen.«
Meinem Vater war die Kleine bereits ans Herz gewachsen. So wie jedem anderen im näheren Umkreis, wie es mir schien. Es war kaum zu glauben, aber ich hatte Jahre hier an der Gammelgade gewohnt, bevor ich auch nur den Vornamen meiner direkten Nachbarin erfuhr. Katalie hingegen kannte nach drei Wochen scheinbar jeden, grüßte jeden und wurde von jedem gegrüßt. Morgens saß sie auf den Gehwegplatten vor dem Haus und erwartete den Briefträger. Obwohl er so gut wie nie Post für sie hatte, bekam er von ihr eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne und ein paar nette Worte, auch bei Regenwetter.