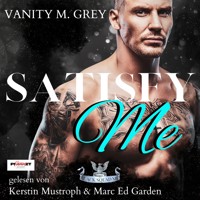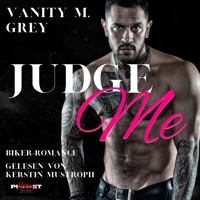3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Eigentlich will Mira nur ein entspanntes Wochenende an der Küste verbringen, gemeinsam mit ihrer Schwester und deren Familie. Doch als sie in Gransin ankommt, herrscht dort das totale Chaos: Emma, die 12-jährige Tochter ihrer Schwester, ist spurlos verschwunden. Die Polizei schaltet sich nur zögernd ein und so startet Mira auf eigene Faust eine Suchaktion. Zufällig begegnet sie dabei einem düsteren Biker, der sie gleichermaßen fasziniert wie abstößt. Anscheinend stecken er und sein Club tief in dubiosen Geschäften, die Rede ist sogar von Mädchenhandel. Führt Emmas Spur ausgerechnet zu Rabble und seinen Männern, die ihr Quartier in einem ehemaligen Hotel aufgeschlagen haben? Mira setzt alles auf eine Karte und lässt sich auf ein heißes Abenteuer mit dem Rocker ein. Vielleicht bekommt sie so die Chance, Emma zu finden und sich notfalls im Tausch für sie anzubieten. Doch plötzlich wendet sich das Blatt und ausgerechnet Rabble bietet ihr seine Hilfe an. Kann sie ihm vertrauen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mistrust Me
Black Squad MC
Vanity M. Grey
Impressum
© Vanity M. Grey 2023
Layout und Covergestaltung: Vanity M. Grey
Bilder: stock.adobe.com
Kontakt:
Vanity M. Grey
Werneburg Internet Marketing- und
Publikationsservice
Philipp-Kühner-Straße 2
99817 Eisenach
Sämtliche Charaktere und Schauplätze dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen beziehungsweise Vereinen, Clubs und Örtlichkeiten wären ggf. rein zufällig. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
Bei diesem Buch handelt es sich um einen Band aus der Reihe Black Squad MC. Jedes Buch ist einzeln und ohne Vorkenntnisse lesbar.
Die Protagonisten dieses Buches verzichten konsequent auf Verhütung. Das entspringt meiner künstlerischen Freiheit und dient ausschließlich der besseren Lesbarkeit. Im echten Leben ist Verhütung natürlich wichtig.
Life is a journey,
enjoy the ride!
Schlechte Nachrichten
Mira
Ungeduldig trommle ich auf das Lenkrad. Wenn ich noch länger so schleichen muss, werde ich erst in der Nacht in Gransin ankommen! Die schier endlose Schlange von Autos, die sich Stoßstange an Stoßstange Richtung Ostsee quält, schiebt sich in unerträglicher Langsamkeit über die schmale Allee. Auf der Autobahn bin ich noch gut vorangekommen, doch seit ich sie verlassen habe, geht nahezu nichts mehr.
Dabei habe ich doch keine Zeit! Es ist Freitagmittag und mir bleiben nur zwei Tage, bis ich Sonntag Abend schon wieder zurück nach Hause fahren muss.
Schon jetzt graut es mir vor der Heimfahrt. Wie soll ich mich denn bitte in den knapp achtundvierzig Stunden ausreichend erholen, um mich für die nervenaufreibende Rückfahrt zu wappnen? Dieser Trip an die Küste war von Anfang an eine Schnapsidee gewesen.
Seufzend unterdrücke ich das dringende Bedürfnis, meinen Frust durch einen herzhaften Hieb auf die Hupe abzubauen. Es würde ja doch nichts helfen. Um meinen Ärger noch zu vergrößern, sehe ich im Rückspiegel eine kleine Gruppe dunkel gekleideter Motorradfahrer, die sich in halsbrecherischem Tempo nähern und dann aggressiv an der Kolonne vorbeiziehen. Dabei zwingen sie etliche PKW-Fahrer dazu, auf die Bremse zu treten, damit sie sich bei Gegenverkehr kurzfristig einfädeln können.
»Idiot!«
Fluchend mache ich eine Vollbremsung, denn auch vor mir drängt sich einer der Biker rücksichtslos in die winzige Lücke zwischen mir und dem voranfahrenden Wagen, weil ihm im Gegenverkehr ein Sattelzug entgegenkommt. Mein Hintermann bremst ebenfalls abrupt und nur um ein Haar entgehe ich einem Auffahrunfall.
»Verdammtes Arschloch!«, brülle ich durch die geschlossene Scheibe, doch der Biker kann mich garantiert nicht hören.
Das hätte mir gerade noch gefehlt! Ohne eine Geste des Dankes gibt der Biker Gas und schießt mit aufröhrendem Motor aus der Lücke heraus. Sekunden später ist er aus meinem Blickfeld verschwunden.
Ich ärgere mich. Über ihn und über mich selbst. Die sinnlos vergeudete Zeit hier könnte ich besser zuhause auf meinem Sofa verbringen und mich dort erholen. Vermutlich werde ich noch mindestens zwei Stunden bis zu meinem Ziel brauchen, wenn es so langsam weitergeht wie bisher. Am liebsten würde ich wenden und das Thema Ostsee abhaken.
Doch dann denke ich an Emma und daran, was ich ihr versprochen habe. Wir beide hatten früher eine sehr enge Verbindung zueinander, die wir auch jetzt noch aufrechtzuerhalten versuchen. Zwar sehen wir uns nur noch selten, da sie in Berlin wohnt, aber seit einem Jahr hat sie ein Smartphone und so schicken wir uns regelmäßig Nachrichten und Fotos hin und her.
Emma ist mein Patenkind und ich habe die Kleine wirklich ins Herz geschlossen, auch wenn ich sonst nicht besonders viel Lust auf Familie habe. Ich bin Single und das aus Prinzip. Kaum ein Mann ist bisher damit klargekommen, dass ich einen eigenen, gutgehenden Betrieb führe, den ich über alles andere stelle. Auch über einen Mann, wenn es sein muss.
Ich bin Gartenbauerin und muss gemeinsam mit meinen beiden Angestellten auch selbst mit Hand anlegen, denn mein Betrieb ist nicht groß. Meine Firma betreut Gärten und manchmal auch kleine Grünanlagen in und um Hannover. Das erfordert Zeit und Energie, die ich dann natürlich nicht in eine Beziehung stecken kann. Aber es ist das, was ich schon immer machen wollte und so war ich froh gewesen, als ich damals die alte Gärtnerei gefunden habe, aus der ich dann mein kleines Landschaftsbauunternehmen aufgebaut habe.
Mittlerweile bin ich achtundzwanzig und ahne, dass ich bald eine Entscheidung werde treffen müssen, denn anscheinend werde ich ohne Mann und Kinder bleiben, wenn ich meine Prioritäten weiter so beibehalte. Vielleicht sollte ich mir doch noch einen weiteren Gärtner einstellen: sexy, muskulös und zu allem bereit. Nach einem harten Tag mit der Schaufel in der Hand könnte er dann nachts in meinem Bett meinen ganz persönlichen Acker bestellen.
Ich grinse dämlich in mich hinein bei diesem Wortspiel, merke aber, wie sich meine Laune bei der Vorstellung merklich hebt. Auch ich habe eben meine Bedürfnisse und es wäre zur Abwechslung ganz nett, wenn ich zu deren Erfüllung mal einen Schwanz aus Fleisch und Blut in mir spüren würde. Auf Dauer wird der rote, genoppte Freudenspender in meinem Nachttisch nämlich langweilig.
Nun, die Tage mit meiner Schwester Steffi und deren Familie werden mich von solchen Gedanken abbringen. Ich weiß aus Erfahrung, dass Emma sich förmlich auf mich stürzen wird. Vermutlich werden wir nicht mehr, wie früher, gemeinsam Sandburgen bauen, denn dafür ist sie nun zu groß. Obwohl: Wann ist man für eine Sandburg schon zu alt? Eigentlich nie.
Doch als Einzelkind hungert Emma regelrecht nach familiärer Zuwendung und ich ahne, dass es mit den gemütlichen Stunden am Strand zumindest heute noch nichts werden wird.
Anscheinend geht es nun etwas schneller voran, denn die Bremslichter vor mir erlöschen und ich schaffe es sogar, mal im zweiten Gang zu fahren.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreiche ich schließlich das Ortseingangsschild von Gransin und folge der Ausschilderung zu dem Campingplatz, auf dem Steffi und Hendrik eine Hütte gemietet haben, um das Campingfeeling ihrer Kindheit wiederaufleben zu lassen, ohne vollkommen auf Komfort zu verzichten. Steffis Vorschlag, am Wochenende in dem letzten freien Bett in ihrer Blockhütte zu schlafen, habe ich allerdings dankend abgelehnt. Campingurlaub ist nicht so meins. Stattdessen habe ich mir ein ziemlich überteuertes Zimmer in einem Vier-Sterne-Hotel geleistet, das direkt an der Promenade liegt.
Ich stelle meinen Wagen auf dem zum Campingplatz gehörigen Parkplatz ab. Während ich mir meine Handtasche vom Beifahrersitz schnappe und dabei mein Handy und einen angebissenen Schokoriegel einstecke, bemerke ich aus den Augenwinkeln einen Streifenwagen, der das Gelände verlässt. Vermutlich hat es eine alkoholgeschwängerte Auseinandersetzung zwischen Campern gegeben oder einen Diebstahl.
Mit steifen Beinen steige ich aus und strecke mich erstmal. Herrlich, diese salzige, klare Luft! Alleine der Geruch fühlt sich nach Urlaub und dem Versprechen einer schönen, sorgenfreien Zeit an. Lächelnd und mit beschwingten Schritten werfe ich die Wagentür zu und lenke meine Schritte zu dem Übersichtsplan, der das gesamte Gelände zeigt. Ich werfe einen Blick darauf, um herauszufinden, wo sich die Blockhütten befinden, von denen meine Schwester und ihre Familie eine gemietet haben. Natürlich könnte ich auch schnell anrufen und meine Ankunft ankündigen, doch ich möchte die drei gerne überraschen.
Ich staune sowieso, dass Emma nicht schon hier steht und mich ungeduldig erwartet. Vor zwei Jahren hätte sie das garantiert noch getan. Doch vermutlich ist sie mit ihren zwölf Jahren nun schon zu alt dafür.
Ich präge mir den verschlungenen Weg ein und marschiere, an etlichen Wohnwagen mit Vorzelten vorbei, über das hügelige Gelände. Es ist angenehm schattig hier, denn die Stellplätze befinden sich unter hohen Kiefern. Die Hütte meiner Schwester erkenne ich schon von weitem. Hendrik und Steffi stehen davor und scheinen aufgeregt über irgendetwas zu diskutieren. Ich winke den beiden fröhlich zu und beschleunige meinen Schritt. Steffi winkt hektisch zurück und wirkt vollkommen aufgelöst.
Erst jetzt bemerke ich, dass außer den beiden noch etliche andere Camper und Kinder um sie herumstehen und genauso aufgeregt wirken. Schlagartig erinnere ich mich an das Polizeiauto. Ist am Ende bei meiner eigenen Familie eingebrochen worden?
»Was ist los?«, frage ich knapp, statt einer Begrüßung, und sehe meine Schwester besorgt an. Statt etwas zu erwidern, bricht Steffi jedoch in Tränen aus und sinkt wie eine Ertrinkende in meine Arme.
»Miriam!«
Hendrik findet als Erster seine Worte wieder, doch seine Stimme ist rau und klingt vollkommen anders als sonst, beinahe verzweifelt. Außerdem kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, wann er mich zuletzt bei meinem vollen Namen genannt hat. Für alle innerhalb der Familie bin ich eigentlich immer nur Mira.
Ich bemerke seine geröteten Augen, die mich beinahe flehentlich ansehen. »Emma ist weg.«
Der Auftrag
Rabble
Missmutig hämmere ich den Takt des Rocksongs, der aus meinem Radio dröhnt, auf meinem Lenkrad mit. Selbst Radio BOB kann mich gerade überhaupt nicht aufheitern. Seit einer gefühlten Ewigkeit stecke ich in diesem beschissenen Stau fest, gefangen zwischen Campingwagen, bis zum Anschlag mit Kindern und Gepäck überfüllten Kombis und hippen Städtern, die mal eben schnell an die Ostsee wollen.
Hätte ich mir ja eigentlich denken können, dass Freitag Mittag die ungünstigste Zeit ist, um nach Gransin zu fahren. Aber der President unseres Clubs konnte darauf keine Rücksicht nehmen. Auftrag ist Auftrag und wenn wir Ware erhalten, muss einer hochfahren, um sie in Empfang zu nehmen. Natürlich bin ich nicht alleine unterwegs. Doch während die anderen Jungs sich auf ihren Bikes wie Aale durch den Stau winden, muss ich mich mit dem bulligen RAM hinten anstellen.
Es würde sich viel besser anfühlen, wenn ich genau wie Beck, Slave und Driller an allen vorbeiziehen könnte und am besten noch den Mittelfinger nach den hupenden Touris ausstrecke, die sich darüber aufregen. Aber ich bin der Leader unseres Teams hier und einer muss ja schließlich den Wagen mit den abgedunkelten Scheiben fahren. Soll ja keiner sehen, was sich dahinter abspielt.
Queens Auftrag war eindeutig und ich werde mich als hochrangiges Mitglied unseres Security-Teams darum kümmern, dass er zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wird. Seit Queen vor inzwischen fast zwei Jahren die Zügel von Dragon übernommen hat, weht ein anderer Wind im Club. Wo Dragon Milde hat walten lassen, setzt Queen das Clubrecht gnadenlos durch. Wer nicht spurt, wird rundgemacht, so einfach ist das.
Ich komme gut damit klar, kann mich in seinen autoritären Führungsstil einfügen. Doch hin und wieder knirscht es ganz schön im Gebälk, wenn eines der jüngeren Member nicht so will wie er. Erst letzte Woche hat er Muffin, einem Prospect, der exakt so aussieht, wie sein Name andeutet, seinen Standpunkt klargemacht. Muffin wird seinen Kuchen nun eine Weile mit der linken Hand essen müssen, bis die Brüche rechts verheilt sind.
Auf der Freisprecheinrichtung geht ein Anruf ein: Wenn man vom Teufel spricht!
»Hallo, Pres«, nehme ich das Gespräch an und drücke dabei minimal aufs Gas, weil es wieder ein paar Meter vorangeht.
»Bist du schon am Zielort?« Queen liebt solche markigen Sprüche, die einem das Gefühl geben, man befände sich in einem Actionthriller.
»Nein, Pres. Hier ist ein verfickter Stau. Kann noch eine Weile dauern.«
»Sieh zu, dass du bald da bist. Die Ware ist heiß und muss weitergeleitet werden.«
»Weiß ich doch«, murre ich angepisst. Manchmal behandelt er mich wie einen Hangaround, der noch keine Ahnung von unserem Geschäft hat. »Ich sehe zu.«
Um meine Bemühungen zu unterstreichen, donnere ich meine Hand einmal kräftig auf die Hupe. Als ob das beim Vordermann etwas ausrichten würde, der selbst hinter einem dieser bis unters Dach mit Strandkram vollgestopften Kombis feststeckt!
»Bleib cool, Alter«, ordnet Queen nun an, als er meine Bemühungen mitbekommt. »Lässt sich nicht ändern. Aber die Lieferung ist inzwischen da.«
»Okay.« Ich beende das Gespräch und kann es kaum glauben, als sich die Fahrzeuge vor mir kurz darauf tatsächlich in Bewegung setzen. Ich erreiche eine Kreuzung, an der es einen Abzweig nach Ahrendsee gibt. Anscheinend wollen etliche Urlauber dorthin und nicht nach Gransin, sodass sich der Stau allmählich auflöst.
Mit einem Stoßseufzer drücke ich kräftig aufs Gas und achte dabei aber immer darauf, nicht geblitzt zu werden. In meinem Job ist es ganz wichtig, unterhalb des Radars zu fliegen. Ich bin überhaupt nicht hier und ein verdammter Strafzettel würde exakt das Gegenteil beweisen.
Also zwinge ich mich dazu, das Tempolimit halbwegs einzuhalten und nicht darüber nachzudenken, dass meine Jungs Gransin schon längst erreicht haben werden. Meine Harley steht brav zuhause in der Garage und es macht wenig Sinn, mich jetzt darüber zu ärgern. Nächste Woche schwinge ich mich dafür wieder in den Sattel und lasse ordentlich die Sau raus.
Suchaktion für Emma
Mira
»Und niemand hat sie gesehen? Hier sind doch so viele Leute! Einer von denen muss etwas bemerkt haben!«
Hendrik schüttelt traurig den Kopf. Er wirkt, als wäre er um Jahre gealtert, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe.
»Niemand. Ich habe alle Nachbarn befragt. Keiner hat etwas gehört oder gesehen. Es ist, als wäre sie vom Erdboden verschluckt worden.«
»Aber wie kann das sein?« Ungläubig blicke ich mich um. »All diese Menschen und keiner hat etwas gesehen? So ein Kind verschwindet doch nicht einfach von der Bildfläche, ohne dass jemandem etwas auffällt. Was hat denn die Polizei gesagt?«
Hendrik schnaubt ungehalten und fährt sich mit der rechten Hand in einer verzweifelten Geste durch die langsam ergrauenden Haare. Mein Schwager ist Anfang vierzig, so genau weiß ich das gar nicht. Aber heute wirkt er wesentlich älter und vollkommen erschöpft.
»Die Polizei! Die haben uns gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, sie würde schon wieder auftauchen«, stammelt er hörbar frustriert. »Sie haben auch vorgeschlagen, dass wir nochmal am Strand nachsehen sollten und auf dem Spielplatz. Vielleicht sei sie ja auch zu einem anderen Kind mit in den Wohnwagen gegangen oder in den Wald.«
Empört runzle ich die Stirn. »Emma ist zwölf! In diesem Alter verschwindet ein Kind doch nicht einfach so, ohne die Eltern zu fragen. Und auf dem Spielplatz – nun, der reizt sie garantiert nicht mehr so wie früher. Das glaube ich nicht!«
»Ich auch nicht«, bestätigt Hendrik mit einem finsteren Blick, »aber die Polzei scheint das anders zu sehen. Anscheinend verschwinden hier öfter mal Kinder eine zeitlang und tauchen dann nach einem kleinen Abstecher zum Strand oder in die Dünen wieder auf.«
»Aber nicht Emma!«
Es ist das erste Mal, dass Steffi überhaupt etwas sagt, seit ich angekommen bin. Sie wirkt wie versteinert und gleichzeitig in Tränen aufgelöst. Es muss ein absoluter Albtraum für meine Schwester sein, genauso wie für mich. Doch ich versuche, meine Anspannung und Verzweiflung so gut es geht zu verbergen, denn ich will sie nicht noch weiter belasten.
Fieberhaft überlege ich, was ich tun könnte, um zu helfen. Objektiv betrachtet haben die Polizisten natürlich recht: Das ganze Gelände hier ist wie ein großer Abenteuerspielplatz für die Kinder und Emma ist erst seit heute früh um neun verschwunden. Jetzt ist es halb vier. Das ist natürlich noch keine Ewigkeit. Aber für ein so zuverlässiges Mädchen wie Emma ist es absolut ungewöhnlich und passt ganz und gar nicht zu ihr. Sie würde niemals sechseinhalb Stunden wegbleiben, ohne dass etwas wirklich Außergewöhnliches vorgefallen ist.
Und es gibt eine Menge Dinge, die einem Mädchen hier zustoßen können. Ich möchte mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, welche Möglichkeiten existieren, wenn man an die Presseberichte der letzten Jahre denkt.
»Und was hat die Polizei nun vorgeschlagen? Sollt ihr die Füße stillhalten, bis sie wieder hier auftaucht, oder was?«
Ich kann es kaum fassen. Emma ist so jung und ein hübsches Mädchen! Wenn nun ein Pädophiler hier sein Unwesen treibt oder sie aus irgendwelchen Gründen im Meer ertrunken ist? Ich kann Steffi ansehen, dass sie all diese furchtbaren Möglichkeiten in Gedanken schon hundertmal durchgespielt hat, seit den beiden heute früh, als Hendrik vom Brötchenholen zurückkam, aufgefallen war, dass Emma nicht mehr in ihrem Bett lag, wie sie eigentlich erwartet hatten.
»Ich gehe in den Ort und sehe mich da noch einmal um«, verkünde ich schließlich. Auch wenn Hendrik heute schon mehrmals dort gesucht hat, werde ich trotzdem nicht einfach untätig hier herumstehen können. Vielleicht glauben die Bullen ja, abwarten zu müssen, bis genügend Zeit vergangen ist, ehe sie einen Suchtrupp losschicken. Ich werde nicht solange warten.
»Ich komme mit.« Steffis Stimme klingt belegt, sie macht auf mich den Eindruck, als könne sie sich nicht mehr lange auf den Beinen halten. Daher lege ich meinen Arm um sie und schüttele energisch den Kopf.
»Nein. Du bleibst hier, falls sie zurückkommt. Jemand muss hier bei der Hütte auf sie warten.«
Die Erwähnung der Möglichkeit, dass Emma von selbst wieder hier auftauchen könnte, gibt ihr offensichtlich Kraft. Sie richtet sich auf dem Campingstuhl auf, auf dem sie während ihrer Schilderung der Ereignisse gesessen hat und sieht unschlüssig zu mir auf.
»Wenn du meinst. Vielleicht hast du recht: Jemand sollte hier auf sie warten.«
Eine Campingnachbarin, die bereits die ganze Zeit über neben uns gestanden hat, tritt einen Schritt näher an mich heran. Sie hat warme, freundliche Augen und wirkt mit ihrer kompakten Figur und dem Kurzhaarschnitt energisch und zupackend. »Wie wäre es, wenn wir ein paar Gruppen bilden, die sich in unterschiedlichen Richtungen auf die Suche nach dem Kind machen?«
Steffi blickt dankbar zu ihr und dann zurück zu mir, als wäre ich hier plötzlich diejenige, die die Entscheidungen trifft.
»Ja. Eine gute Idee.«
Langsam drehe ich mich zu den Zuschauern um, die aus Langeweile und Neugier immer noch in Grüppchen um uns herumstehen und das Geschehen diskutieren.
»Wer von Ihnen würde bei der Suche nach Emma helfen?«, frage ich mit erhobener Stimme. Sofort heben sich eifrig etliche Hände, während andere, die nur ihre Sensationsgier befriedigen wollten, möglichst unauffällig das Weite suchen. Doch es finden sich immerhin sieben Freiwillige, denen ihr Kaffee oder das Nachmittagsnickerchen nicht wichtiger zu sein scheint, als das Schicksal einer Zwölfjährigen. Immerhin verspricht das mehr Spannung als der Alltag auf dem Campingplatz, wo die aufregendste Entscheidung des Tages ist: gehe ich an den Strand oder auf die Seebrücke?
Ich zücke mein Smartphone und zeige den Campern ein ziemlich aktuelles Foto von Emma, das sie mir kurz vor ihrer Abreise hierher geschickt hat. Die Helfer sehen es sich aufmerksam an und prägen sich die Gesichtszüge ein, auch wenn einige von ihnen Emma sicher vom Sehen her kennen.
Auch ich werfe noch einmal einen Blick auf das Foto, das ein, schon ziemlich erwachsen aussehendes, ernstes Mädchen zeigt. Auf Außenstehende muss Emma älter wirken, schon richtig weiblich und mir fällt zum ersten Mal bewusst auf, wie lasziv ihre Pose auf dem Bild ist. Mir versetzt das Foto einen leichten Stich in der Magengegend und ich frage mich, ob andere diese Ausstrahlung vielleicht auch bemerken. Könnte es sein, dass sie einem Mann aufgefallen ist und er sie unter einem fadenscheinigen Vorwand von der Hütte weggelockt hat?
Schnell schüttle ich diese Gedanken ab. Alleine die Vorstellung, was er mit ihr anstellen könnte, erregt Übelkeit bei mir. Jetzt geht es erst einmal darum, Emma zu finden und anscheinend warten die Camper nun auf meine Anweisungen, so erwartungsvoll wie sie mich anblicken.
Ich habe keine Ahnung, wohin ich die Leute schicken soll, denn ich bin noch nie in Gransin gewesen. Doch ich kenne von früher etliche Nachbarorte und vermute, dass jeder Urlaubsort hier ähnlich strukturiert ist: Strand, Radweg mit Promenade und dann der schmale Kiefernwald, hinter dem sich die Hotels und der Rest des Ortes befinden.
Ist sie vielleicht alleine in den Ort gegangen? Was soll sie so früh am Morgen und ganz alleine dort gewollt haben? Vielleicht befindet Emma sich ja noch in der Nähe und hat sich doch nur den Knöchel verstaucht oder findet den Weg zurück zum Campingplatz nicht mehr, warum auch immer.
Wir müssen alle Optionen in Erwägung ziehen. Warum unternimmt die Polizei nur nichts? Es kann doch nicht deren Ernst sein, dass man einen ganzen Tag lang warten will, bis man etwas unternimmt! Emma ist doch kein Teenager, der sich vielleicht mit einem heimlichen Freund in die Büsche geschlagen hatte. Himmel, sie ist zwölf!
»Teilen wir uns am besten auf«, schlage ich vor. »Immer zwei Leute gehen zusammen in den Ort, zwei weitere am Strand entlang, zwei gehen in Richtung Ahrendsee durch den Wald. Vielleicht können wir auch Passanten befragen, ob ihnen ein Mädchen aufgefallen ist.« Ich habe eine Idee. »Wie wäre es, wenn Sie alle mir Ihre Handynummern geben und ich schicke Ihnen Emmas Foto? So haben Sie ihr Bild vor Augen, während Sie suchen und können es gegebenenfalls auch anderen Passanten zeigen.«
Die Camper nicken und einige von ihnen verschwinden kurz in Richtung ihrer Unterkünfte, um die Handys zu holen. Zehn Minuten später habe ich Emmas Foto an etliche ältere Paare und Familienväter verteilt. Wenn sich das alles als Quatsch herausstellt, weil Emma in einer Stunde wohlbehalten hier wieder auftaucht, wird sie mich dafür vermutlich hassen. Egal. Lieber verliere ich den Status als ihre Lieblingstante, ehe ich eine Chance versäume, sie wiederzufinden. Immerhin ist es ja kein Bikinifoto, auch wenn ich das Top und die knappen Jeansshorts schon ziemlich aufreizend finde für ein Mädchen ihres Alters.
Wenig später durchkämmen wir die Umgebung. Entschlossen stapfe ich den sandigen Waldweg zu den Dünen entlang und blicke mich dabei aufmerksam um.
Zwei Stunden später erreiche ich wieder die kleine Holzhütte, in der Steffi, Hendrik und Emma einen unbeschwerten Urlaub hatten verbringen wollen. Wie sehr wünsche ich mir, dass eine lachende und erleichterte Emma auf mich zustürzt. Sie würde in meine Arme sinken und mir eine harmlose Erklärung für ihr Verschwinden geben. Doch schon als ich die Hütte erblicke, weiß ich, dass das nicht der Fall sein wird. Stattdessen sitzt Steffi blass und matt immer noch auf ihrem Klappstuhl und lässt es zu, dass zwei Frauen ihre Hand halten und ihr Mut zusprechen.
»Gibt es etwas Neues?«, frage ich in möglichst neutralem Ton. Steffi schüttelt synchron mit den anderen beiden ihren Kopf. »Nein, nichts.«
»Sind die Suchtrupps denn schon zurück?«
Wieder das hoffnungslose Kopfschütteln. Diesmal antwortet nur eine der Frauen.
»Einige sind schon wiedergekommen. Mein Mann zum Beispiel.« Sie nickt zu einem der Campingwagen in der nahen Umgebung der kleinen Blockhüttensiedlung, wo ein Mann in der Zeitung liest, als wäre nichts passiert. »Aber sie haben sie nicht gefunden.«
»Wann wollten die Polizisten wiederkommen?«
Die Frau wirft einen mitleidigen Blick auf Steffi, die so teilnahmslos daneben sitzt, als gehe sie das alles gar nichts an. Vermutlich steht sie unter Schock und erlebt das Geschehen wie aus der Ferne oder wie einen Film, der an ihr vorüberzieht. Es ist wohl das Beste so, denn ich könnte nur schwer ertragen, sie in Tränen aufgelöst zu sehen, während ich selbst nicht wirklich helfen kann.
»Sie haben wohl versprochen, eine Runde durch den Ort zu drehen und nach dem Mädchen Ausschau zu halten.« Sie versucht ein halbherziges Lächeln und streckt mir ihre runzlige, sonnengebräunte Hand entgegen, die ich ergreife. »Ich heiße übrigens Gudrun. Wir sind jedes Jahr hier, seit über dreißig Jahren. Aber so etwas ist hier noch nie passiert. In all diesen Jahren nicht!«
»Eine schreckliche Geschichte, aber ich bin mir sicher, dass wir schon sehr bald etwas Positives hören werden«, verkündet sie mit einem Kopfnicken in Steffis Richtung. Meine Schwester steht sichtlich kurz vor einem Nervenzusammenbruch, deshalb will sie sie garantiert nicht noch mehr beunruhigen, indem sie irgendwelche Mutmaßungen verbreitet.
»Ich bin Miriam, Steffis Schwester.«
Gudrun nickt und offensichtlich fallen ihr keine passenden Worte mehr ein, denn sie nickt nur betreten und stapft dann mit vorsichtigen Schritten zu ihrem Camper.
Vollkommen erledigt gehe ich neben Steffis Stuhl in die Hocke. Zwei Stunden lang bin ich in strammem Tempo durch die Gegend gehetzt, habe in Gärten gesehen, erstaunte Urlauber angehalten und ihnen das Foto von Emma gezeigt. Zwischendurch bin ich auch anderen Mitgliedern unseres kleinen Suchtrupps begegnet, die ihre Aufgabe offenbar auch sehr ernst nahmen und die Spielplätze und Geschäfte abgeklappert hatten. Doch offensichtlich gab es keine Spur von Emma.
»Ich hole mir etwas zu trinken aus der Hütte«, kündige ich Steffi an, denn meine Kehle ist wie ausgetrocknet. »Kann ich dir auch etwas bringen?«
Steffi starrt nur blicklos vor sich hin und reagiert nicht.
»Ich hole dir ein Glas Wasser«, entscheide ich kurzerhand und verschwinde in der kleinen Hütte. Überall finde ich Anzeichen für die Anwesenheit eines Kindes: Ein Badeanzug mit einem Glitzerprint, Kuscheltiere, unzählige Haarspangen und eine halbvolle Tüte mit Gummibärchen. Der Anblick versetzt mir einen schmerzhaften Stich.
Ich bemühe mich, nicht zu lange auf diese Dinge zu starren und suche in den beiden kleinen Küchenschränken nach zwei Gläsern. Nachdem ich sie mit Leitungswasser gefüllt habe, bringe ich sie nach draußen.
»Hier.« Ich drücke Steffi eines der Gläser in die Hand, das diese mir wie mechanisch abnimmt und dann unberührt in Brusthöhe vor sich hält. »Trinken!«
Erst nach der zweiten Aufforderung folgt Steffi meiner Anweisung und nippt an dem Glas. Ich nehme es ihr wieder ab. »Ich stelle es hier auf den Tisch. Du trinkst bitte, okay?«
Steffi nickt abwesend. Wir beide waren nie besonders eng miteinander verbunden, vielleicht schuf der kurze Altersabstand so etwas wie eine Konkurrenzsituation zwischen uns. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dominierten Streit und Zickenkrieg in unserem Alltag und brachte unsere Mutter mehr als einmal an den Rand der Verzweiflung. Doch das ist lange her und gerade jetzt, angesichts des Geschehens, sollte all das vergessen sein.