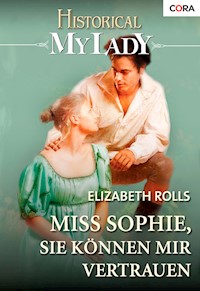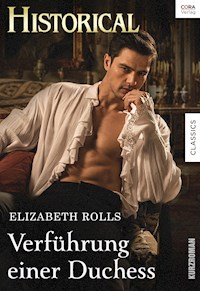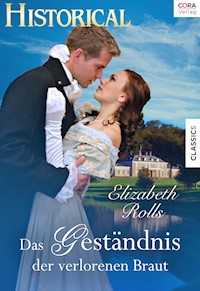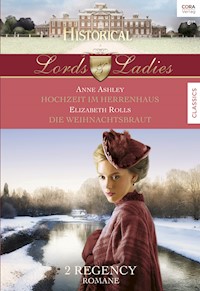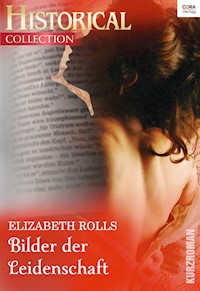3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Lords & Ladies
- Sprache: Deutsch
Wie wird es sein, ihre Jugendliebe Crispin, Duke of St. Ormond, wiederzusehen? In unruhiger Erwartung reist Lady Tilda zu einer eleganten Party an. Sie weiß, dass er sich bald schon mit einer anderen verloben wird! Einerseits eine schmerzliche Vorstellung: Noch immer sehnt sie sich insgeheim nach ihm. Andererseits: Nach dem Tod ihres älteren Gatten ist sie endlich unabhängig. Nichts will sie weniger als die seidene Fessel einer zweiten Ehe spüren! Doch dann küsst Crispin sie so kühn, dass Tilda alle Bedenken vergisst - wenn auch zunächst nur eine zärtliche Nacht lang …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Elizabeth Rolls
Mit bangem Herzen
IMPRESSUM
HISTORICAL LORDS & LADIES erscheint im CORA Verlag GmbH & Co. KG, 20350 Hamburg, Axel-Springer-Platz 1
© 2003 by Elizabeth Rolls Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V., Amsterdam
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL LORDS & LADIESBand 15 2009 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg
Fotos: Harlequin Books S.A.
Veröffentlicht im ePub Format im 01/2011 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86295-376-9
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Führung in Lesezirkeln nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernimmt der Verlag keine Haftung. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
1. KAPITEL
„Nur damit ich sicher sein kann, dass ich dich richtig verstanden habe, Onkel Roger“, Lady Winter küsste Lord Pemberton pflichtschuldig auf die Wange und streifte sich ihre eleganten Lederhandschuhe ab, „Tante Pemberton hat mich doch brieflich hierher gebeten, damit ich ihr während ihres bevorstehenden Wochenbettes zur Hand gehen kann. Und nun teilst du mir mit, dass ich Milly als Anstandsdame zu einer Hausparty begleiten soll.“ Der Unmut darüber, dass auf diese Weise über ihre Zeit verfügt wurde, war Lady Winters Stimme deutlich anzuhören.
Der anmutige Anblick, den die hochgewachsene Dame in dem eleganten tiefbraunen Reisekleid bot, wurde durch ihre würdevolle Haltung noch unterstrichen. Nichts erinnerte mehr an die linkische, schüchterne Miss Matilda Arnold, die sieben Jahre zuvor Viscount Winter geheiratet hatte. Ihrem Onkel indes entging der Unterschied.
„Nun hör mir mal gut zu, Miss …“, polterte er los.
Doch Lady Winter ließ ihn nicht aussprechen. „Hat nicht Tante Casterfield Milly während der vergangenen Saison begleitet? Was ist denn aus ihr geworden? Man könnte meinen, dass sie in deinen Augen eine passendere Anstandsdame abgäbe als ich.“
Die Tatsache, dass sie seinen Gedanken so genau Ausdruck verliehen hatte, besänftigte Lord Pemberton keineswegs. Gefährliche Röte stieg ihm in die Wangen. „Ihre Schwiegermutter liegt im Sterben!“, bellte er. „Sie kann nicht auf Milly aufpassen.“
Lady Winter legte den Kopf schräg und schien diese Aussage ausführlich zu erwägen. Schließlich äußerte sie nachdenklich: „Dennoch ist mir nicht ganz klar, inwiefern diese Angelegenheit mich betrifft. Und weshalb ich nicht zumindest gefragt wurde.“
Mit beinahe hörbarem Zähneknirschen setzte Lord Pemberton an: „Deine Tanten und ich sind der Auffassung, dass es für dich nicht den geringsten Unterschied macht, wo du dich aufhäl…“
Fast beiläufig wurde er von seiner pflichtvergessenen Nichte unterbrochen. „Möglich. Allerdings bin ich für euren Mangel an Weitblick keineswegs verantwortlich. Du willst also sagen, dass ihr mich als Chaperone für Milly vorgesehen habt, ohne mich auch nur zu fragen?“
In dem Versuch, sie gebührend einzuschüchtern, funkelte Lord Pemberton sie drohend an und sagte: „Du bist unsere Nichte und unser Mündel, und du wirst gefälligst deine Pflicht tun!“
Lady Winter setzte ihr reizendstes Lächeln auf. „Leider unterliegst du da einem gravierenden Irrtum. Ich bin keineswegs noch dein Mündel, sondern vielmehr Jonathans Witwe. Und meine Pflicht ist es, mich um unsere Tochter zu kümmern. Außerdem bin ich fünfundzwanzig und meine eigene Herrin. Nur ich allein entscheide, ob ich Milly auf diese Hausparty begleite oder nicht. Und ich fürchte, dass meine Neigung dazu im Augenblick recht gering ist.“ Sie lächelte noch strahlender. „Zweifellos wirst du mir irgendwann schon mitteilen, wo es überhaupt hingehen soll, wer die Gastgeberin ist und wer währenddessen auf meine Tochter aufpassen wird. Lass dir ruhig Zeit dabei. Danach kann ich dann eine endgültige Entscheidung treffen. Da ich ein wenig erschöpft bin, ziehe ich mich vor dem Dinner noch ein Weilchen zurück. Wir sprechen dann später weiter darüber.“
Mit einem angedeuteten Knicks schwebte sie aus dem Salon und ließ ihren Onkel wütend und vollkommen entgeistert zurück. Nach ihrem majestätischen Abgang musste sich Seine Lordschaft erst einmal einen großzügigen Schluck Brandy genehmigen.
Er schäumte vor Wut über das leidige Schicksal, das ihn dazu zwang, seine ungeliebte Nichte aus Leicestershire hierher nach Broughton Place kommen zu lassen. In den Jahren seit ihrer Hochzeit hatte Lord Pemberton sie kaum zu Gesicht bekommen. Nun war seine Tochter Amelia drauf und dran, den Fang des Jahres – wenn nicht gar des Jahrzehnts! – zu machen, und Matilda – nein, Lady Winter – bildete sich offensichtlich ein, sie könne einfach so alle seine Pläne umstürzen. Die Witwenschaft schien ihr zu Kopfe gestiegen zu sein. Da glaubte sie doch tatsächlich, sie könne rücksichtslos ihren Dickschädel durchsetzen! Nur über seine Leiche!
Während er zornig vor dem Kamin auf und ab schritt, rief er sich die Mittel ins Gedächtnis, mit denen er früher den Gehorsam seiner Nichte erzwungen hatte. Sie würden auch diesmal zum Erfolg führen. Schließlich hatte er damit sogar Matildas Heirat mit Viscount Winter durchgesetzt.
Es war Lady Winter nicht leichtgefallen, während der Unterredung ihre würdevolle Haltung zu bewahren, statt ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. Rasch stieg sie nun die Treppe in den ersten Stock hinauf und strebte dem besten Gästezimmer zu. Es verwunderte sie kaum, dass sie dort weder ihr eigenes Gepäck noch das ihrer Tochter vorfand. Mit einem verhaltenen Lächeln betätigte sie energisch die Klingel.
Fünf Minuten später tauchte die überraschte Haushälterin auf. „Was zum … oh! Sie sind es, Miss Tilda!“
Lady Winter nickte bestätigend. „Ganz recht, Mrs. Penny. Sind meine Koffer noch nicht heraufgebracht worden?“ Sie verbrämte die Frage mit einem Blick unschuldigster Neugier.
Die Bedienstete blinzelte verblüfft. „Doch, natürlich, Miss Tilda!“ Angesichts des hochmütigen Blickes, der sie traf, verbesserte sie hastig: „Will sagen, Mylady. Die Herrin hat angeordnet, dass sie wie üblich ins Zimmer Ihrer Cousine getragen werden.“
In gespielter Unschuld hob Lady Winter eine Braue und fragte herablassend: „So, und was sollte wohl Miss Amelia mit meinen Sachen anfangen? Sorgen Sie bitte dafür, dass sie umgehend hierher transportiert werden. Und wo steckt Miss Anthea?“
Die Haushälterin war sprachlos. Was war nur aus dem schüchternen Mädchen geworden, das früher nie gewagt hätte, den Befehlen seiner Tante zu widersprechen? Nachdem Mrs. Penny einige Male den Mund auf- und zugemacht hatte, stammelte sie: „Miss Anthea ist im Kinderzimmer, zusammen mit … mit den anderen Kindern.“
Lady Winter schien sich die Auskunft durch den Kopf gehen zu lassen. „Aha. Sie besucht also ihre Vettern und Cousinen. Nun gut. Aber schlafen kann sie hier im Ankleidezimmer. Bitte kümmern Sie sich darum, Mrs. Penny. Außerdem hätte ich gerne eine Tasse Tee. Vielen Dank.“
Kurz darauf fand sich die Haushälterin auf der anderen Seite der Tür wieder, ohne dass sie zu sagen vermocht hätte, wie sie dorthin gekommen war. Fassungslos schüttelte sie den Kopf. Die Ehe hatte Miss Tilda offensichtlich vollkommen verändert.
Sobald sich die Tür hinter Mrs. Penny geschlossen hatte, ließ sich Lady Winter, geborene Matilda Arnold, in einen Sessel sinken und seufzte vor Erleichterung. Himmel, es war anstrengend, immerzu selbstbewusst zu tun und sich zu behaupten! Aber es machte auch Spaß. Sie hätte sich nie träumen lassen, wie ungehalten ihr Onkel sein würde! Ganz zu schweigen von der armen Mrs. Penny. Aber noch war es nicht ausgestanden. Sie war Lady Pemberton noch nicht unter die Augen gekommen.
Ein störrischer Zug erschien um Tildas Mund. Um nichts in der Welt würde sie je wieder nach der Pfeife ihrer Tante tanzen – schon gar nicht, um einen reichen Ehemann für Amelia einzufangen. Nein, sie würde bleiben, um der Wöchnerin zur Hand zu gehen. Und sollte sich herausstellen, dass das nur ein Vorwand gewesen war, um sie herzulocken – nun, sie konnte sich jederzeit wieder auf den Weg nach Leicestershire machen.
Es dauerte keine Viertelstunde, bis ihre Zofe Sarah im Gästezimmer eintraf, einen Bediensteten im Schlepptau, der die schweren Koffer hereintrug. Der Lakai war kaum wieder zur Tür hinaus, als Sarah ihrer Herrin einen belustigten Blick zuwarf. „Sie haben sich wohl in den Kopf gesetzt, hier das Unterste zuoberst zu kehren, was?“
Tilda unterdrückte ein schelmisches Lächeln und entgegnete unschuldig: „Wieso nicht? Mit Höflichkeit und Gehorsam habe ich nie auch nur einen Blumentopf gewonnen, also …“
Die Tür ging erneut auf. Diesmal betrat ein schmales Mädchen von fünf Jahren mit einer Puppe im Arm den Raum.
„Mama, muss ich im Kinderzimmer schlafen? Großtante Pemberton hat gesagt, dass ich die ganze Zeit dort bleiben muss.“ Ein flehender Blick aus braunen Augen bat die Mutter, das Unheil abzuwenden.
Lachend streckte Tilda die Arme aus. „Wenn ich nicht bei dir sein kann, wirst du mit deinen Cousins und Cousinen im Kinderzimmer bleiben. Aber wir werden hier im Ankleideraum ein Bett für dich aufstellen.“
Mit einem Seufzer der Erleichterung warf Anthea sich ihrer Mutter in die Arme. „Ein Glück! Cousine Maria wollte, dass meine Susan in ihrem Bett schläft!“
„Und was hast du ihr geantwortet?“, fragte Tilda und drückte einen Kuss auf die braunen Locken ihres Töchterchens, die so sehr ihren eigenen glichen. Gleichzeitig warf sie Sarah einen warnenden Blick zu.
Später. Tilda wollte vermeiden, dass Anthea von der Bitterkeit zwischen ihr und den Pembertons etwas mitbekam.
„Ich habe Nein gesagt, und dann bin ich dich suchen gegangen“, berichtete Anthea und schmiegte sich enger in Tildas Arme.
„Bravo“, sagte ihre Mutter. „Wenn wir alles ausgepackt und eingeräumt haben, erzähle ich dir noch eine Geschichte, bevor du zum Abendessen ins Kinderzimmer gehst. Und ich komme zwischen den Gängen hoch und decke dich zu.“
Als Tilda sich zum Dinner nach unten begab, stand ihre Strategie fest. Sie war einfach und würde mit Sicherheit zum Erfolg führen. Abgesehen davon dürfte sie Onkel und Tante bis aufs Blut reizen. Lächelnd sah Tilda in den Spiegel und nickte der fremden Frau zu, die ihr daraus entgegenblickte.
Ja, sie hatte sich verändert. Abgesehen von Haar- und Augenfarbe bestand kaum noch Ähnlichkeit zwischen dem linkischen, braven Mädchen von vor sieben Jahren und der eleganten Dame im Spiegel. Natürlich war sie immer noch zu groß, aber zumindest stolperte sie nicht mehr über den eigenen Schatten. Statt der streng zurückgebürsteten Frisur, auf der Tante Pemberton bestanden hatte, trug Tilda die glänzenden braunen Locken nun locker hochgesteckt. Unter anmutig geschwungenen Brauen sahen goldbraune Augen zuversichtlich in die Welt.
Auch wenn man sie vielleicht immer noch nicht als Schönheit bezeichnen konnte – sie hatte sich unzweifelhaft zu ihrem Vorteil verändert. Zumindest hatte sie an den richtigen Stellen Rundungen bekommen. Zutiefst befriedigt bemerkte Tilda, wie sich die dunkelgrüne Satinrobe an ihre schlanke, aber weibliche Gestalt schmiegte. Das Dekolleté war zwar nicht besonders tief ausgeschnitten, aber dennoch wirkte das Kleid keineswegs gesetzt genug für die Chaperone eines jungen Mädchens.
Ein Umstand, der Lady Pemberton zu einer Bemerkung anstachelte, sobald ihre Nichte einen Fuß über die Schwelle des Salons gesetzt hatte.
Selbst in eine rötlich braune Kreation gewandet, betrachtete sie Tildas elegante Erscheinung mit unverhohlenem Abscheu. „Grundgütiger, Mädchen! Das ist nun wirklich keine angemessene Kleidung für eine Anstandsdame!“
In Gedanken trat Tilda in den Hintergrund, um Lady Winter die Bühne zu überlassen. Diese hob eine Augenbraue und entgegnete ausgesucht ruhig: „Nein, natürlich nicht. Sehr richtig bemerkt. Guten Abend, Tante. Ich hoffe, du erfreust dich guter Gesundheit. Onkel Roger sagte mir bei meiner Ankunft, dass du dich ausruhst. Ich wollte dich nicht stören.“
Lady Pemberton überhörte die Begrüßung. „Wie ich höre, hast du dich auch noch im besten Gästezimmer eingerichtet. Nun, für diese eine Nacht kannst du meinetwegen dort bleiben. Aber morgen früh ziehst du wieder zu deiner Cousine. Das Gästezimmer ist Gästen vorbehalten!“
Graziös ließ sich Lady Winter im bequemsten Lehnstuhl nieder. „Tatsächlich? Ich wusste gar nicht, dass du so kurz vor der Entbindung noch Besuch erwartest.“ Sie warf einen betont überraschten Blick auf den gerundeten Leib ihrer Tante. Dann lächelte sie gewinnend. „Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Amelia mit ihren beiden Verwandten in einem Raum schlafen will.“
Lady Pemberton runzelte die Stirn. „Was soll der Unsinn? Deine Tochter bleibt im Kinderzimmer, Matilda. Dort gehört sie schließlich hin. Ich dulde nicht, dass sie verzogen wird.“
In Lady Winters Stimme kroch ein Ausdruck von Unnachgiebigkeit. „Entschuldige, aber Antheas Angelegenheiten regele ich so, wie ich es für richtig halte. Selbstverständlich soll sie sich tagsüber bei den anderen Kindern aufhalten. Aber nachts ist sie es gewöhnt, in meiner Nähe zu sein.“
In diesem ungelegenen Moment erschien Seine Lordschaft. Sofort rief Lady Pemberton ihn um Unterstützung an. „Mylord! Also wirklich! Deine Nichte spielt hier die große Dame und besitzt die Unverschämtheit, auf dem besten freien Zimmer zu bestehen!“
Sofort setzte ihr Gatte zu einer vernichtenden Standpauke an, die Miss Matilda Arnold noch vor sieben Jahren die Tränen in die Augen getrieben hätte. Nachdem er sich lang und breit über ihre Frechheit, Pflichtvergessenheit und Undankbarkeit ausgelassen hatte, schloss er: „Du bist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen deiner Mutter zu treten, warte nur ab!“
Bequem zurückgelehnt, lauschte Lady Winter ihm. Ihre Miene verriet nichts als höfliches Interesse. Sie errötete noch nicht einmal beim krönenden Abschluss der Predigt. Als er geendigt hatte, bemerkte sie lediglich: „In diesem Fall bin ich mehr als erstaunt darüber, dass ihr mich als Anstandsdame für Milly überhaupt in Betracht zieht. Falls ihr euch inzwischen anders entschieden habt, bin ich gerne bereit, euch von meiner unerwünschten Anwesenheit zu erlösen.“ Ihre Mundwinkel bogen sich leicht nach oben. „Bis die Pferde ausgeruht sind, bleibe ich allerdings, wo ich bin.“
Fassungslos starrte Lord Pemberton sie an. Nur das Eintreten seiner beiden Ältesten verhinderte einen Wutausbruch.
Man sah Thomas und Amelia auf den ersten Blick an, dass sie Geschwister waren. Beide hatten dunkle Haare, und ihre Augen erstrahlten in demselben Blau, das bei Lady Pemberton im Laufe der Jahre etwas verblasst war. Doch während Amelia mit ihrer zierlichen Gestalt der Mutter nachschlug, hatte Thomas, der inzwischen in Oxford studierte, die beeindruckende Körpergröße seines Vaters geerbt.
Als Tilda aufstand, um die beiden zu begrüßen, erkannte sie, dass Amelia von einem vielversprechenden Mädchen zu einer hinreißenden Schönheit herangewachsen war. Ihre weichen Locken und die lebhaften blauen Augen boten einen so reizenden Anblick wie eh und je. Ihre Gestalt wies genau die scheinbar zerbrechliche und dennoch wohlgerundete Weiblichkeit auf, die dem Geschmack der meisten Gentlemen zu entsprechen schien.
Einen Augenblick lang fühlte sich Tilda wieder als der linkische Backfisch, den man beständig mit der viel hübscheren Cousine verglichen hatte. Doch die überraschte Bewunderung, die sich in Toms Zügen malte, als er sie freudig begrüßte, gab ihr die Selbstsicherheit zurück.
„Tilda!“ Strahlend umarmte er sie. „Also wirklich, ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt!“ Er hielt sie ein Stück von sich ab, um sie zu mustern. „Du siehst fantastisch aus. Dieses Grün steht dir einfach großartig. Es ist wahrscheinlich besser, wenn nicht ausgerechnet du die Anstandsdame für Milly spielst, sonst gibt Seine Gnaden dir noch den Vorzug!“
Tilda ließ ein belustigtes Lachen hören – eines, das außer ihrer Tochter und ihrem ältesten Cousin kaum ein Mensch jemals zu hören bekommen hatte. „Ach Tom, du Schmeichler! Kein Mensch würde mich Milly vorziehen.“ Damit wandte sie sich an Amelia und sagte: „Du siehst entzückend aus, Milly. Ich brauche gar nicht erst zu fragen, wie es dir geht.“
Pikiert entgegnete die Cousine: „Ich ziehe es vor, Amelia genannt zu werden. Schließlich bin ich inzwischen erwachsen und in die Gesellschaft eingeführt. Milly klingt so kindisch.“
„Ach, hab dich nicht so, Milly“, empfahl ihr Tom mit brüderlicher Offenherzigkeit. „Nimm dir ein Beispiel an Tilda: piekfein und von Kopf bis Fuß eine Viscountess. Und macht sie etwa ein Getue um ihren Namen?“ Dann drehte er sich wieder zu der Cousine um. „Sag mal, gehört dieses famose Gespann in den Ställen etwa dir? Und die graue Stute auch?“
Heiterkeit sprühte aus Tildas Augen, als sie nickte. „Ja. Allerdings befürchte ich, dass du für Frosty zu schwer bist.“
Tom seufzte. „Jammerschade. Aber diese beiden Braunen! Sie passen wirklich vollendet zusammen.“
Der sehnsuchtsvolle Ton seiner Stimme ließ sie lächeln. „Wenn du willst und Onkel Roger es erlaubt, darfst du sie morgen vor den Phaeton spannen lassen und ausprobieren.“ Nach einer kleinen Pause setzte sie bedeutungsvoll hinzu: „Sobald ich mich davon überzeugt habe, dass du mit ihnen umgehen kannst.“
Tom wurde rot und grinste schuldbewusst. Sein Vater machte unterdessen große Augen. Empört mischte er sich ein: „Und wer, bitte schön, entscheidet das?“
Tilda begegnete seinem Blick mit Gleichmut. „Ich dachte, ich hätte mich deutlich genug ausgedrückt. Ich.“
„Oh nein!“, widersprach Lord Pemberton heftig. „Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass irgendein junges Ding eine meiner Sportkutschen zu Schanden fährt! Du lässt Tom die Pferde ausprobieren, und damit Schluss.“
Toms Röte vertiefte sich, und er warf Tilda einen entschuldigenden Blick zu.
Doch wenn er erwartet hatte, dass seine Cousine klein beigab, dann hatte er sich getäuscht. Sie hob lediglich die Augenbrauen und verkündete ohne Umschweife: „Keineswegs, Sir. Die Pferde gehören mir. Ich konnte mich nicht mehr von Toms Fahrkünsten überzeugen, seit er mich vor acht Jahren in einem Gig umgeworfen hat. Daher kann ich ihm das Gespann erst anvertrauen, wenn ich weiß, dass den Tieren nichts passiert.“
„Grundgütiger!“ Lady Pemberton war außer sich. „Du willst doch nicht behaupten, dass du das besser beurteilen kannst als dein Onkel!“
„Nein, Madam“, gab Tilda zurück. „Allerdings kenne ich meine eigenen Pferde besser als er, und ich habe nicht vor, ihre Beine oder Toms Genick in Gefahr zu bringen. So, und nun sagt mir bitte, was man tun muss, um hier etwas zu trinken angeboten zu bekommen.“
Tom lachte. „Recht hast du! Was kann ich dir bringen? Ratafia?“
Sie gab vor zu erschauern. „Nein, danke. Jonathan hat äußersten Wert darauf gelegt, meinen Geschmack zu bilden. Ich ziehe Madeira vor.“
Die Zornesfalte auf Lord Pembertons Stirn vertiefte sich. „Zu meiner Zeit haben junge Mädchen …“
Ein spöttischer Blick aus braunen Augen traf ihn. „Aber mein lieber Onkel, sag doch nicht so etwas! Man könnte sonst noch denken, du wärst alt genug, um … um mein Ehemann zu sein!“
Auf die betonte Anspielung, dass der verstorbene Lord Winter seiner achtzehnjährigen Braut fünfunddreißig Jahre voraus gewesen war, folgte lähmendes Schweigen.
Endlich fand Lady Pemberton die Sprache wieder. „Du kannst von Glück sagen, dass du diesen Antrag überhaupt bekommen hast!“
„Gewiss“, äußerte Lady Winter gedankenverloren. „So, und nun erzählt mir von Amelias Saison. Es ist deine zweite, oder? Und immer noch nicht verlobt? Du lieber Himmel! Ich war schon nach einer halben Saison unter der Haube! Habe ich nicht recht, liebe Tante? Ach, danke, Tom.“ Sie nahm den Madeira mit einem charmanten Lächeln entgegen und nippte daran.
Zornig holte Amelia Luft. „Ich durchschaue dich. Du bist nur neidisch, weil ich hübscher bin als du und mehr Anträge bekommen habe …“
Sie wurde sanft unterbrochen. „Nein, keineswegs. Ich wünsche dir Glück. Und wie viele Männer haben schon um deine Hand angehalten?“
Bevor Lady Pemberton ihr mit einem Blick Schweigen gebieten konnte, platzte Amelia heraus: „Vier! Fünf, wenn man Seine Gnaden mitzählt.“
„Vier!“ Lady Winter musste lächeln. „Was für ein Glück du hast, wählen zu können! Und ich dachte schon, dass die Londoner Gentlemen blind sein müssen, weil du immer noch unverheiratet bist. Weißt du, ich war immer noch in dem Glauben befangen, dass ein Mädchen den allerersten Antrag annehmen muss, damit das Geld für die Einführung des nächsten gespart werden kann.“
„Aber der Erste war Lord Walmisley“, wandte Amelia ein. „Und der ist viel zu alt. Ich wette, er ist schon fast vierzig!“
„Vierzig!“, wiederholte Lady Winter mit dem Ausdruck größten Erstaunens. „Nun, das ist wirklich ziemlich alt. Du lieber Himmel, ich staune, dass der gute Jonathan es überhaupt fertigbrachte, ohne Stock vor den Altar zu treten.“ Nachdenklich hielt sie inne. „Von der Hochzeitsnacht ganz zu schweigen.“
Wieder legte sich bleiernes Schweigen über den Salon. Als habe sie nichts bemerkt, fuhr Lady Winter kurz darauf in verbindlichem Tonfall fort: „Und darf ich fragen, welchen Herzog Amelia in der Hinterhand hat? Du hast doch von Seiner Gnaden gesprochen, nicht wahr, Tom?“
Ihr Cousin nickte benommen. „Äh, ja. St. Ormond.“
Niemand bemerkte das kurze Zögern, bevor Lady Winter heiter antwortete: „Donnerwetter! Das ist wirklich eine Eroberung, für die man den alten Walmisley getrost stehen lassen kann. Und wenn ich mich recht entsinne, ist St. Ormond auch nicht wesentlich älter als sechsunddreißig.“
An dieser Stelle hatte das Schicksal ein Einsehen und ließ den Butler verkünden, dass angerichtet sei.
Man konnte das Dinner kaum als Erfolg bezeichnen. Lord Pembertons Versuche, seiner Nichte ihre Verfehlungen vor Augen zu führen, wurden durch die Anwesenheit der Dienerschaft empfindlich behindert. Lady Winters spitze Zunge dagegen lief wie geölt. Es schien Tilda großes Vergnügen zu bereiten, einen Seitenhieb nach dem anderen auszuteilen.
Während der Mahlzeit staute sich so viel Wut in Lady Pemberton an, dass sie meinte, bersten zu müssen. Endlich zogen sich die Damen zurück. Kaum hatte sich die Salontür hinter ihnen geschlossen, als die Tante auch schon zu einer geharnischten Rede über das Betragen und den Aufzug ihrer Nichte ansetzte.
Während Lady Winter Platz nahm und sich zurücklehnte, hörte sie scheinbar aufmerksam zu. Erst nachdem Lady Pemberton geendet hatte, äußerte sie gelassen: „Verzeihung, ich habe eben nicht ganz aufgepasst. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein, nein, nicht alles“, fügte sie hinzu, als ihre Tante ungläubig nach Luft schnappte, „nur die letzten Sätze. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ging es darum, dass ich keine passende Chaperone abgebe. Das ließ mich aufhorchen.“
Angesichts dieser Unverfrorenheit blieb Milly der Mund offen stehen. Glücklicherweise gesellten sich in diesem Augenblick Lord Pemberton und Tom wieder zu den Damen.
Seine Lordschaft verschwendete keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln. Drohend blickte er seine Nichte an und erklärte: „Ich hoffe, dass du inzwischen wieder zur Vernunft gekommen bist. Merk dir in Zukunft, dass du gefälligst deine Pflicht zu tun und das Urteilen uns zu überlassen hast.“
„Aber selbstverständlich, Onkel“, antwortete Lady Winter spöttisch lächelnd. „Tante Pemberton hat mich soeben darüber aufgeklärt, dass ich mich nicht zur Anstandsdame eigne. Diesem Urteil beuge ich mich gerne.“
Einen Moment lang sah es so aus, als träfe Seine Lordschaft auf der Stelle der Schlag. Seine Augen traten hervor, und sein Gesicht verfärbte sich bedrohlich violett.
Lady Winter nutzte die kurzzeitige Sprachlosigkeit ihres Onkels, um liebenswürdig, aber bestimmt weiterzusprechen. „Weißt du, ich bin schon lange kein kleines Mädchen mehr, das voll und ganz von euch abhängt und für alles eure Zustimmung braucht. Als ihr mich zu der Ehe mit Jonathan gezwungen habt, habt ihr mich befreit, ohne es zu wissen. Inzwischen bin ich eine unabhängige und reiche Frau und kann tun und lassen, was ich will.“
Sie holte Luft und fuhr kühl fort. „Ich bin nicht gekommen, weil du es befohlen hast, sondern weil ich größtes Verständnis für die Bitte meiner Tante hatte, ihr während des Wochenbettes zur Seite zu stehen. Als Frau konnte und wollte ich nicht ablehnen. Außerdem“, an dieser Stelle bebte ihre Stimme leicht, „dachte ich, ihr hättet vielleicht doch noch ein klein wenig Zuneigung für mich entdeckt. Aber ich lasse mich keinesfalls von euch herumkommandieren. Wenn ihr vorhabt, weiterhin einfach über mich zu verfügen, dann reise ich mit Anthea umgehend ab.“
Lord Pemberton lachte höhnisch auf. „Reich! Das glaubst du vielleicht, aber wenn du das Geld auch künftig für überflüssigen Luxus zum Fenster hinauswirfst, dann wirst du nicht lange Freude daran haben.“ Bedeutungsvoll ließ er den Blick über die grüne Satinrobe, das teure Retikül und die eleganten Escarpins schweifen.
Ungläubig erwiderte Lady Winter: „Du willst doch nicht sagen, dass du wirklich nichts davon weißt? Es hat dich so wenig interessiert, an wen du mich verheiratest, dass du noch nicht einmal eine Ahnung von Jonathans Vermögensverhältnissen hattest?“
Ihr Onkel zuckte die Schultern.„Es war allgemein bekannt, dass Winters Güter genug abwarfen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass noch viel übrig geblieben ist, nachdem er für seine Tochter gesorgt hatte. Außerdem ist das Geld wahrscheinlich an die Bedingung geknüpft, dass du nicht wieder heiratest.“ Sein Ton machte deutlich, dass er diese Möglichkeit ohnehin für äußerst unwahrscheinlich hielt.
Diesmal zeigte Lady Winters Miene einen Ausdruck ehrlicher Belustigung. „Du solltest dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Jonathan hatte keine Lust, Leute zu beeindrucken, an deren Meinung ihm nichts lag. Aber er war äußerst wohlhabend. Die Geschäftsreise, die er in jungen Jahren nach Indien unternahm, hatte ihm offenbar ganz außerordentliche Gewinne eingebracht. Diesen Reichtum, der von Titel und Erbvermögen unabhängig ist, hat er zur Hälfte mir hinterlassen. Und zwar unabhängig von einer Wiederverheiratung.“
Tom war der Erste, der die Sprache wiederfand. „Ist das wahr, Tilda? Du hältst uns nicht zum Besten?“ Seine Stimme drückte ehrliche Begeisterung aus.
Sie nickte.
„Du bist eine wohlhabende Witwe?“
Wieder nickte sie. Das spöttische Lächeln lag immer noch auf ihrem Gesicht. „Ganz entsetzlich wohlhabend sogar.“
Rücksichtslos mischte sich Lord Pemberton ein. „Zweifellos wirst du das Geld innerhalb kürzester Zeit durchbringen.“
Sie schüttelte den Kopf. „Oh nein. Jonathan hat dafür gesorgt, dass ich lerne, ein Vermögen zu verwalten. Und bis zu meinem fünfunddreißigsten Lebensjahr ist sein Erbe mein Treuhänder. Mein Gatte hielt es offenkundig für – sagen wir: nicht ganz unwahrscheinlich, dass er vor mir das Zeitliche segnet, und er nahm seine Pflichten sehr ernst. Ich bin durchaus in der Lage, für mich selbst zu sorgen.“
Ihre nächste Spitze traf. „Ihr seht also, dass es überhaupt kein guter Einfall ist, mich als Anstandsdame für Amelia zu wählen. Denn von meinem Äußeren einmal völlig abgesehen, kann zumindest mein Erbe auch den anspruchsvollsten Mann in Versuchung führen.“
Ihre Tante holte hörbar Luft. „Dann hast du also vor, dich wieder zu verheiraten?“
Nachdenklich legte Lady Winter den Kopf schräg. „Oh, ich könnte es tun. Aber ich halte es wirklich nicht für notwendig.“ Vielsagend hob sie eine dunkle Augenbraue. „Schließlich hält das Leben für eine Witwe viel interessantere Möglichkeiten bereit.“
„Du schamlose Kokotte!“, schäumte Lady Pemberton aufgebracht.
Milly blinzelte fassungslos.
Lady Winter hob die Braue noch höher. „Aber meine liebe Tante, was meinst du nur damit? Es besteht doch wirklich nicht die geringste Notwendigkeit, dass ich mich wieder binde und damit einem anderen armen Mädchen den Ehemann wegnehme. Außerdem finde ich Gefallen daran, meine eigene Herrin zu sein.“ Als bemerke sie gar nicht, welche ungläubige Ablehnung ihr entgegenschlug, schloss sie liebenswürdig: „Aber nun genug davon. Ich fühle mich ein wenig müde und möchte mich zurückziehen. Gute Nacht.“
Siegreich und hoch erhobenen Hauptes verließ sie das Schlachtfeld, während ihre Verwandten ihr hinterhersahen: wütend, voller Bewunderung – und überaus verwirrt.
Merkwürdigerweise hielt sich Tilda in Gedanken nicht lange bei ihrem Triumph über die Pembertons auf. Sie sah zu Anthea herein, die im Ankleideraum tief und fest schlummerte, Susan beschützend an sich gedrückt. Nachdem sie der Tochter und ihrer Puppe je einen Gutenachtkuss gegeben hatte, spazierte Tilda zurück ins Schlafzimmer, legte das grüne Kleid ab und schlüpfte in ein seidenes Nachthemd, zu dem ein ebensolches Negligé gehörte. Wohlig spürte sie den weichen Stoff auf den Schultern. Ihrem Ehemann zuliebe hatte sie sich jahrelang in vernünftige, warme, aber reizlose Nachtgewänder gehüllt. Jonathan hatte in der ständigen Angst gelebt, sie könne sich erkälten. Nun genoss Tilda es, nachts frivole und gewagte Kreationen zu tragen – selbst wenn es niemanden gab, der den verführerischen Anblick würdigen konnte. Diesen Zustand gedachte sie keineswegs zu ändern.
Sie betätigte den Klingelzug und wartete. Kurze Zeit später erschien Sarah.
„Hier bin ich, Mylady.“ Die Zofe runzelte die Stirn. „Ach du liebe Zeit, habe ich nicht schon tausend Mal gesagt, dass ich dazu da bin, um Ihnen beim Auskleiden zu helfen?“ Geschäftig hob sie die grüne Robe auf und schüttelte sie aus.
„Ach, hören Sie auf damit, Sarah“, sagte Tilda. „Um Himmels willen, Sie wissen doch, dass ich allein zurechtkomme. Jetzt erzählen Sie schon, was in den Dienerzimmern geklatscht wird.“
Ohne eine Einladung abzuwarten, setzte sich Sarah auf die Chaiselongue, das Kleid in der Hand. „Also, als Erstes: Sie können es alle nicht fassen, wie Sie sich verändert haben. Die meisten finden’s aber gut.“ Beiläufig bemerkte sie: „Muss ja eine ganz schöne Verwandlung gewesen sein. Ich persönlich habe Sie ja vor der Hochzeit nicht gekannt.“ Ein Anflug von Neugier war ihrer Stimme anzuhören.
Tilda zog ein Gesicht. „Ich war das schüchternste junge Ding, das Sie sich vorstellen können. Zu allem Überfluss auch noch schlaksig und linkisch, sodass ich ständig über alles gestolpert bin.“ Spöttisch lachte sie auf. „Vermutlich ist Lady Winter eine ganz schöne Überraschung für den gesamten Haushalt. Tja, Kleider machen Leute. So, aber was ist mit diesem Duke? Angeblich St. Ormond.“ Obwohl sie den Namen beiläufig aussprach, spürte sie, wie sich etwas in ihr schmerzhaft zusammenzog.
Sarah grinste. „Wenn man das Geschwätz hört, könnte man meinen, die Anzeige hätte schon in der Zeitung gestanden. Die Dowager Duchess hat Miss Pemberton zu einem Besuch auf dem Landsitz der Familie eingeladen. Man munkelt, dass St. Ormond sie besser kennenlernen soll, bevor er ihr einen Antrag macht. Scheint in London ganz schön hinter ihr her gewesen zu sein: hat auf Bällen mit ihr getanzt und sie in den Park geführt und so. Angeblich hat er sogar schon ihrem Vater seine Aufwartung gemacht.“
Nachdenklich sagte Tilda: „Ich soll sie bei dem Besuch als Anstandsdame begleiten. Meine Tante kann diese Aufgabe natürlich nicht übernehmen. Wenn sie mich gefragt hätten, statt mich einschüchtern zu wollen, dann hätte ich wahrscheinlich zugestimmt. Aber wie die Dinge stehen, werden wir wohl in ein paar Tagen wieder nach Hause fahren. Danke schön, Sarah. Gehen Sie schlafen. Ich läute, wenn ich aufwache.“
Sarah erhob sich und bedachte ihre Herrin mit einem strengen Blick. „Bleiben Sie nicht zu lange auf!“ Nachdem sie das Seidenkleid sorgsam im Schrank verstaut hatte, verschwand sie und überließ Lady Winter ihren Gedanken.
Tilda schritt ruhelos auf und ab. Der Seidenstoff des Nachthemds liebkoste ihre Beine, aber sie bemerkte es kaum. St. Ormond. Der Name hatte sich ihr förmlich ins Gedächtnis eingebrannt. Er rief immer noch Gefühle der Verletzung, der Wut und des gekränkten Stolzes in ihr wach. Selbst nach sieben langen Jahren besaß er die Macht, sie zu fesseln und ihr den Kopf zu verdrehen.
Verdammt! Sie war nun Lady Winter, eine reiche und nicht ganz unansehnliche Witwe, nicht mehr die tollpatschige und schüchterne Debütantin von damals. Warum also traf die Erinnerung an eine mädchenhafte Schwärmerei sie so tief? Selbst in ihren kühnsten Träumen hatte Tilda gewusst, dass sie sich nur etwas vorgaukelte. Es hätte der unwissentlichen Grausamkeit des Dukes nicht bedurft, um ihr zu zeigen, dass ihre Wege sie nicht zusammenführen würden. Auch so war ihr klar gewesen, dass er ihr keinen zweiten Blick gönnen würde. Der erste und einzige hatte bei ihm offenbar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ich fahre ohnehin nicht zu dieser schrecklichen Gesellschaft auf seinen Landsitz, sagte sich Tilda, während sie sich auf der Chaiselongue niederließ und die Beine unter den Körper zog. Warum also zitterte sie so sehr? Unwillkürlich dachte sie an jenen Ballabend bei den Seftons zurück. Seine Gnaden, elegant wie gewöhnlich, in einem modischen Rock aus feinstem blauen Tuch … Sie sah immer noch die Goldknöpfe glänzen … die Diamantnadel in den Falten des meisterhaft gebundenen Krawattentuchs … muskulöse Beine, die in den makellosen Unaussprechlichen vollendet zur Geltung kamen. Er überragte alle Männer im Saal und gehörte damit zu den wenigen, zu denen sich Tilda beim Tanzen nicht hätte herunterbeugen müssen. Sein kastanienbraunes, welliges Haar schimmerte im Kerzenlicht rötlich, und er verengte die sündhaft grünen Augen, als er in das Gelächter eines Freundes einstimmte. Mit einem Wort: Der Duke of St. Ormond verkörperte alle Träume einer einsamen jungen Debütantin – er war der parfait et gentil chevalier ihrer Fantasien.
Mit mildem Spott blickte Tilda auf ihr früheres Ich zurück. Sie erinnerte sich daran, wie sie den Duke of St. Ormond während der ersten Wochen der Saison von fern beobachtet hatte. Er war beliebt und beständig von Bewunderern umgeben. Einmal hatte er der jungen Miss Arnold bei Hatchard’s ein Buch vom Regal gereicht, und drei Tage vorher hatte er sie sogar zum Tanz aufgefordert …
Seine eigentliche Partnerin, die hübsche und anmutige Lady Diana Kempsey, hatte an jenem Abend bei den ersten Schritten auf der Tanzfläche einen leichten Schwächeanfall erlitten, sodass er sie zu ihrer Mama zurückgeleiten musste. Tilda stand, die wie üblich nur halb volle Tanzkarte in der Hand, neben ihrer Tante in der Nähe.
Mit dem ihm eigenen Charme hatte er sich umgedreht und sie gebeten, ihm die Ehre des Tanzes zu erweisen. „Bestimmt nicht die schmeichelhafteste Aufforderung, die Sie jemals erhalten werden, Miss Arnold, aber ich bitte Sie trotzdem herzlich, sie anzunehmen!“
Annehmen? Tilda lächelte bitter, als sie sich entsann, dass sie geradezu aufs Parkett geschwebt war. Er kannte sogar ihren Namen! Sprachlos hatte sie ihre Hand in die seine gelegt und gespürt, wie er sie mit seinen feingliedrigen Fingern umschloss. Zu allem Überfluss wurde auch noch ein Walzer gespielt. Der anrüchige Tanz hatte erst kurz zuvor Gnade vor den Augen der hochmütigen Patronessen von Almack’s gefunden. Aber aufgrund ihrer Körpergröße kam Matilda Arnold nur sehr selten in den Genuss, ihn zu tanzen.
Wenn sie dennoch einmal aufgefordert wurde, folgte eine Art musikalischer Folter. Tilda konnte einfach die Länge ihrer Schritte und ihre überschäumende Freude an der Musik nicht auf die gesetzten jungen Herren abstimmen, die sie im Arm hielten. Es endete jedes Mal damit, dass sie stolperte oder ihren Partnern auf die Füße trat. Ihre Verlegenheit darüber machte alles nur noch schlimmer. Schließlich war sie so verschreckt gewesen, dass sie noch nicht einmal eine vernünftige Unterhaltung zustande brachte.
In St. Ormond hatte sie den perfekten Partner gefunden, das spürte sie, sobald er den Arm um sie legte. Seine Körpergröße passte genau zu ihrer. Mit ihm konnte sie sich mühelos zur Musik wiegen und drehen. Es gelang ihr sogar, mit ihm zu plaudern, auf seine Scherze einzugehen und fröhlich seine Fragen zu beantworten. Schließlich hatte sie sich sogar dabei ertappt, ihm von ihrem Kater Toby zu erzählen, den sie als kleinen Findling in ihrem Bett aufgezogen hatte. St. Ormond schien ihren lebhaften Bericht äußerst unterhaltsam zu finden. Umgehend revanchierte er sich mit der Geschichte eines verwaisten Stutfohlens, das später sein liebstes Reitpferd war.
„Natürlich habe ich Sirene nicht mit ins Bett genommen. Mama wollte leider nichts davon hören. Aber ich habe etliche Nächte an ihrer Seite im Stall geschlafen.“
Nur zu bald war die Musik verklungen. Seine Gnaden hatte sie zu Lady Pemberton zurückgeleitet und zum Abschied Grüße an Toby bestellt. Sie hatte ihn ihrerseits gebeten, Sirene eine Möhre von ihr zu geben.
Lady Pemberton hatte für diesen Wortwechsel lediglich ein Stirnrunzeln übrig gehabt. Scharf war Tilda von ihr getadelt worden, sich nicht in aller Öffentlichkeit zum Narren zu machen. „Du bringst die Familie in Verlegenheit, wenn du die Angel nach St. Ormond auswirfst. Er hat dich nur aufgefordert, weil er zu höflich war, dich zurückzuweisen.“
Beim nächsten Tanz war Tilda wieder über die Füße ihres Partners gestolpert und wurde vorzeitig nach Hause gebracht.
Drei Tage später hatte Lady Pemberton ihre Drohung gelockert, Tilda nie wieder zu einem Ball mitzunehmen. Die weisen Worte ihres Gatten hatten zu guter Letzt gewirkt. Wie zum Teufel sollten sie das Mädel auch vom Hals bekommen, wenn man es in der Öffentlichkeit nicht zu sehen bekam? So hatte sich ihre Tante schließlich erweichen lassen, Tilda zur Abendgesellschaft der Seftons zu begleiten.
Selbstverständlich war auch Seine Gnaden, der Duke of St. Ormond, auf dem Fest gewesen. Allerdings hatte Tilda ihn bis nach dem Supper lediglich aus der Ferne gesehen. Sie hatte sich in einen der Salons geflüchtet, um sich von einem besonders furchtbaren Tanz mit Lord Winter zu erholen. Dieser Gentleman war einen halben Kopf kleiner als sie und hatte ihre Angriffe auf seine Zehen mit schwer zu ertragendem Taktgefühl übergangen.
Als sich der Raum mit kichernden jungen Damen gefüllt hatte, war Tilda zurück in den Ballsaal geschlüpft und hatte hinter einer Kübelpalme Zuflucht gesucht. In diesem Augenblick war St. Ormond mit seinem Schwager, Lord Hastings, vorbeigegangen.
Die gut gelaunte Unterhaltung der beiden hatte sich ihr für alle Zeiten im Gedächtnis eingebrannt.
„Also wirklich, Cris, jede dieser charmanten Debütantinnen würde sich um die Ehre reißen, dein Taschentuch aufzuheben, und du willst mir sagen, dass dir keine Einzige von ihnen gefällt? Mein Guter, du wirst allmählich zu wählerisch“, hatte Lord Hastings den Freund mit mildem Spott aufgezogen.