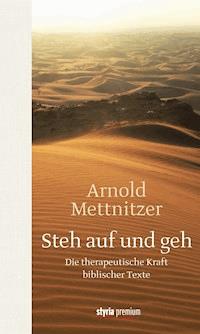Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eine Konstante im Leben des Psychotherapeuten und Theologen Arnold Mettnitzer ist die Spiritualität. Dabei versteht er sie – fernab von Glaubensdogmen ¬ als das Teilen von dem, was einen bewegt, mit seinen Mitmenschen. So kann und soll sie im Alltag in der unmittelbaren Lebenswelt eines jeden spürbar werden. Dieses Buch ist auch eine Rückschau: Anlässlich seines 65. Geburtstag reflektiert der Autor prägende Stationen seines Lebens und verknüpft diese Meilensteine auf vielfältige Weise mit seinem Spiritualitätsverständnis. Die Texte laden die Leser dazu ein, in sich selbst hinein zu spüren; sind aber auch eine (ent)spannende und inspirierende Lektüre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnold Mettnitzer
Mit dem Herzen atmen
Erinnerungen & Erfahrungen
Für Jutta, meine Frau, die mir zeigt, dass die Liebe sich nicht wichtigmacht.
Einleitung
Wer das Wort ergreift, hat es in der Hand, wenn er schreibt, und im Mund, wenn er spricht, damit das Herz eines anderen Menschen zu berühren. Das kann ihm aber nur gelingen, wenn sein Wort aus dem Herzen kommt, sein Klang aus einer Tiefe, die mehr zu vermitteln vermag als bloßes Wissen. Genau das will der Titel dieses Buches zum Ausdruck bringen. Dazu ermutigt hat mich zuallererst die sogar von Medizinern bisher kaum beachtete anatomische Besonderheit, auf die schon vor Jahren der Klangforscher Alexander Lauterwasser hingewiesen hat. Demnach wird die Stimme eines Menschen von zwei Nervensträngen gesteuert, die ihren Weg nicht direkt vom Gehirn zu den Stimmbändern, sondern über den „Umweg“ des Herzens nehmen. So darf auch im rein naturwissenschaftlich-medizinischen Sinn der Klang der menschlichen Stimme als aus dem Herzen kommend verstanden werden. In jedem durch den ausströmenden Luftzug hervorgehenden und erklingenden Ton, mit jedem Laut, den ein Mensch von sich gibt, macht er rein physikalisch betrachtet seinen Atem hörbar. Im so hörbar gemachten Atem schwingt und wirkt das Herz auf so wundersame Weise mit, dass wir (freilich ohne das „beweisen“ zu können) im Klang der Stimme eines Menschen seine Seele zu hören vermögen. Die Seele des Menschen, das Unsichtbare, Verborgene, Ungegenständliche und gewissermaßen Unfassbare, wird so „erahnbar“, hörbar durch unser so sensibel auf den Klang hin gebildetes Ohr. Deshalb hören Menschen, wenn sie miteinander reden, nicht nur, was sie zueinander sagen, sie hören vor allem hinter den Worten und zwischen den Zeilen, was sie damit meinen. Noch rätselhafter und in ihrer Bedeutung und Funktion bis heute für die Anatomen anscheinend gar nicht erklärbar sind zwei kleine Ausbuchtungen an den Innenwänden der beiden Vorhöfe des Herzens selbst, denen man den sinnfälligen Namen „Herzohren“ gegeben hat. Sollte also, wenn Menschen miteinander zu reden beginnen, selbst das Herz auf etwas hinlauschen und hinhorchen, ohne das die menschliche Stimme leblos und seelenlos bliebe?
Zu diesem Buch haben mich darüber hinaus persönliche Erinnerungen ermutigt, die ich als Einladung an meine Leserinnen und Leser verstehe, im eigenen „Vergangensein“ nach den dort geborgenen unverlierbaren Kostbarkeiten zu suchen.
Ein Wort des Philosophen Sokrates an seine Schüler lautet: „Sprich, damit ich dich sehe!“ Miteinander- und Voneinander-Lernen wächst nicht aus stumm-staunendem Zuhören, sondern aus gegenseitigem „Hebammendienst“, der einem Menschen Mut zu machen weiß, den Mund aufzutun und davon zu reden, was in seinem Herzen vor sich geht. Erzähl von dir! Schreib auf, was du denkst, und teil es mit anderen! Nur so wollte der Weise auf dem Marktplatz in Athen Philosophie betreiben, nur so konnte in seinem Sinn „die Liebe zur Weisheit“ wachsen. Nur so können Hörende zu Redenden, Lesende zu Schreibenden und nicht zuletzt Redende und Schreibende zu Fragenden werden. Nur dadurch entsteht die ewig junge Landschaft des Miteinander-Teilens, aus dem im besten Sinne des Wortes „Mitteilen“ wächst. Der Gipfel der Weisheit liegt dabei freilich nicht in ewig gültigen Antworten, sondern im Wechselspiel von Frage und Antwort in immer neuen Erkenntnissen, die präziser gestellte Fragen zur Folge haben.
Aus dem Zettelkasten meiner persönlichen Aufzeichnungen habe ich 65 Skizzen bis hin zu lyrischen Notizen in unterschiedlichen literarischen Gattungen hervorgeholt, um sie in diesem Buch in all ihrer Unvollständigkeit darzulegen. Die Zahl „65“ bezieht sich dabei auf meine bis jetzt erlebten Lebensjahre und erhebt darüber hinaus keinerlei Anspruch auf weitere besondere Bedeutung, schon gar nicht darauf, dass einige meiner Zeitgenossen meinen, das wahre Leben finge erst „mit 66 Jahren“ an. In diesen Beiträgen wird, so hoffe ich, auch etwas von dem spürbar, was ich persönlich unter Spiritualität verstehe: Ein Reden und Schreiben, das nicht nur „Erinnerung“ weckt und Wissen vermittelt, sondern „Verinnerung“ bedeutet und ein „Begriffen-haben“ in ein „Ergriffensein“ wandelt. Wertvolle Unterstützung habe ich dabei von meiner Freundin Ingrid Spona erfahren. Albert Einstein nennt denjenigen einen Freund, „der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast“. In diesem Sinne hoffe ich, dass möglichst viele meiner Leserinnen und Leser im Folgenden einen Text finden, der sie „von innen her“ anrührt und ihnen zum Freund wird.
Arnold Mettnitzer
Erinnertes
1
Franz Turbing
Wenn ich im kleinen Kirchlein meiner Kindheit in Altersberg stehe, gilt mein Besuch immer noch vor allem meinem ersten Heimatpfarrer. Ein scheuer Mann mit leiser Stimme, gütig und anspruchslos. Ich erinnere mich, wie ich am Sonntag immer gespannt auf das Klingelzeichen von der Sakristei her warte. Erst mit diesem Klang und dem Erscheinen des Pfarrers wird es lebendig und spannend im Raum. Was er sagt, verstehe ich zwar nicht, aber ich fühle mich verstanden, daheim und geborgen, mehr als in meinem Elternhaus. Wenn er uns dort besucht, schlägt mir vor Freude das Herz bis zum Hals. Mein Vater sucht das Weite. Meine Mutter deckt den Tisch zur Bewirtung. Wenn sie mit ihm spricht, liegt in ihrer Stimme ein angenehmer Ton, den ich so aus ihren Gesprächen mit unserem Vater nicht kenne. Franz Turbing (1899–1962) ist ein guter Zuhörer. Für meine Mutter immer wieder eine Klagemauer. Der Pfarrer meiner kleinen Kinderseele ist mir so im besten Sinn des Wortes als „Seelsorger“ in Erinnerung. Warum er aus Deutschland nach Kärnten gekommen ist, vermag niemand zu sagen. „Dem hochwürdigen Herrn“ persönliche Fragen zu stellen, ist damals wohl niemandem eingefallen. Französisch, Englisch und Italienisch beherrscht er „schulmäßig“, wie es im Personalbogen der Diözese Gurk-Klagenfurt heißt. Er wird ähnliche Anstrengungen wie beim Erlernen einer Fremdsprache gebraucht haben, um sich als Saarländer im Dialekt und in der Mentalität der Oberkärntner Bauern zurechtzufinden.
In meinem dritten Lebensjahr, an einem Sonntag in der Kirche in Altersberg, taucht zum ersten Mal der Wunsch auf, „Pfarrer“ zu werden; in einem günstigen Moment der Stille während des Gottesdienstes teile ich diesen meinen Wunsch für alle gut hörbar meiner Mutter mit. So einer wie er will ich werden. Einer, der am Sonntag die Menschen in „seiner“ Kirche versammelt, mit ihnen betet und singt, bei Hausbesuchen allein durch sein Auftauchen Atmosphäre verwandelt und beim Gespräch eher zuhört, selten und wenn schon, dann kurze Fragen stellt und zum Schluss fürstlich bewirtet wird. Die Faszination, die von ihm und seinem Wesen ausging, spüre ich heute noch. Jedenfalls war sie groß genug, um mich studieren und Seelsorger werden zu lassen. Und als mir im Oktober 1996 mit einem Schreiben des österreichischen Bundesministeriums für Gesundheit mitgeteilt wird, dass ich als Psychotherapeut in die Psychotherapeutenliste eingetragen und somit zur selbstständigen Ausübung der Psychotherapie berechtigt bin, feiere ich diesen Moment mit meiner mit mir inzwischen verheirateten Frau mit einem Festessen im besten Restaurant des Bezirks. Im Grunde ist nämlich erst mit diesem Schritt der Traum eines Dreijährigen in Erfüllung gegangen.
2
Verkostbare Kindheit
Vor meinem Elternhaus stand ein mächtiger Quittenstrauch. Jedes Jahr klagte meine Mutter über die Mühe, sie sagte dazu „Patzerei“, die ihr die Zubereitung von Marmelade und Quittenkäse aus den von diesem Strauch geernteten Früchten bereitete. Das Ergebnis ihrer Arbeit allerdings konnte sich sehen und schmecken lassen.
Bei der Alternative Marmelade oder Quittenkäse kann ich mich heute noch nicht entscheiden, am liebsten beides, vorausgesetzt, beides ist aus der Quitte hergestellt. „Die Quitte – viel mehr als nur eine ferne Erinnerung …“ So beginnt ein Buch, das der Quitte gewidmet ist.1
Die Quitte ist eine ebenso charmante wie altmodische Frucht. Allein ihr Duft ist bezaubernd: zart, frisch, herb, pelzig – irgendwo zwischen Apfel und Birne und doch ganz eigen und anders. Bis sie in den letzten Jahren wiederentdeckt wurde, lag die Quitte im Dornröschenschlaf. In der Küche verwendete man sie nur zur Herstellung von Marmelade, Gelee, Kompott oder Quittenbrot, auch Quittenkäse genannt. Nie aber wurde die Quitte dabei zum Küchenschlager; auf Märkten fand man sie kaum, schon gar nicht im Supermarkt, geschweige denn in der Haubenküche. Auch aus den Gärten schien sie schon lange verschwunden zu sein.
Ein Quittenbaum wird nicht jahrhundertealt. Seine Lebensdauer ist mit 40 bis 55 Jahren angegeben. Daraus könnte man schließen, dass seine Ära bis in die 1960er-Jahre reichte und danach nur noch von ausgesprochenen Liebhabern neue Bäume beziehungsweise Sträucher gepflanzt wurden. Der britische Biogärtner Monty Don vermutet, dass es unser Instantzeitgeist ist, der der Quitte keine Beachtung mehr schenkt. Wie mein Quittenbuch verrät, ist die Frucht bedingt durch den hohen Anteil an sogenannten Steinzellen, an dem ausgesprochen harten Fruchtfleisch und am Gehalt an Fruchtsäuren und Gerbstoffen, roh nicht genießbar. Wer an ihrem Genuss interessiert ist, benötigt also viel Zeit.
Noch im 19. Jahrhundert wurde der Anbau von Quitten trotz ihrer herben Widerspenstigkeit als ein sich auch wirtschaftlich lohnendes Projekt betrachtet. Johann Ludwig Christ schrieb 1814 in seinem „Allgemein-practische(n) Gartenbuch für den Bürger und Landmann über den Küchen- und Obstgarten“: „Die Quitten sind zwar kein Obst für jeden Gartenbesitzer, wenigstens nicht zur eigenen Consumation. Es kann aber indessen mancher bald diese, bald jene Absicht dabey haben, diesen Baum auch in seinem Garten zu haben, um seine Früchte zu erzielen. Wenigstens werde solche in den Apotheken, von Zuckerbeckern und anderen gut bezahlet.“2 Immer wieder bereiten mir Menschen, die wissen, was mir die Quitte bedeutet, mit aus ihr bereiteter Marmelade oder Käse besondere Freude. Eine Freundin beschenkt mich mehrmals im Jahr mit Likör, Käse und Tee aus Quitten, die am Iselsberg wachsen.
Wer immer den Quittenstrauch im Garten meines Elternhauses gepflanzt hat, alles, was ich heute von der Quitte genieße, ist mir seit Kindertagen vertraut, geradezu heilig, die innigste Erinnerung an das erste Haus meines Lebens. Dieses Haus gibt es schon lange nicht mehr, auch den Lindenbaum davor nicht und schon gar nicht den Quittenstrauch. Verschwunden sind mit ihm auch der Garten, der Brunnen dahinter und die Bienenstöcke meines Großvaters. Nein, eben nicht verschwunden, sondern gebündelt da im Geschmack der Quitte, löffelweise von innen her „verkostbare“ Kindheit. Wie arm bin ich, wenn ich nur an das denke, was im Laufe des Lebens verloren gegangen ist, wie reich aber, wenn ich auf das zu schauen vermag, was mir durch alle Höhen und Tiefen hindurch geblieben ist!
3
Einladung zum Oktoberfest
In meiner Zeit als Kaplan in Spittal an der Drau besucht uns im Pfarrhof ein Jerusalem-Pilger und bittet für ein paar Tage um Gastfreundschaft. Als Dank dafür liest er uns die Zukunft aus der Hand, prophezeit Ereignisse, die auch kurz danach tatsächlich eintreffen, und sorgt mit seiner heiteren Art für eine angenehme Atmosphäre im Haus. Mir als dem Jüngsten in der Runde sagt er ein langes Leben mit vielen positiven Überraschungen voraus, von einem kleinen Verkehrsunfall in naher Zukunft solle ich mich nicht verunsichern lassen! Als ich dann tatsächlich eine Woche später auf der Fahrt zum Begräbnis meines Onkels Michael schuldlos in einen harmlosen Unfall gerate und mit Blechschaden weiterfahre, ist unser Pilger schon über alle Berge in Richtung Jerusalem unterwegs.
Zum Abschied hatte er uns noch eine herzliche Einladung ausgesprochen. Wir sollten unbedingt in diesem Jahr zum Oktoberfest nach München kommen und dort seine persönlichen Gäste sein. Einmal im Leben müsse man das erlebt haben, sagt er mit Nachdruck! Und wenn wir tatsächlich kommen könnten, müssten wir es ihm auch rechtzeitig sagen. Seit Jahren wäre er in dieser Zeit rund um die Uhr beschäftigt; er betreibe nämlich dort eine hoch frequentierte Herrentoilette, die wir dann selbstverständlich gratis benützen könnten …
4
Der Geschmack der Freiheit
Die erste Reise meines Lebens führt mich 1963 zum Beginn der Mittelschule nach Wien. Innerhalb weniger Stunden ereignet sich ein Feuerwerk von Weltpremieren: Im „Opel Rekord“ meines Großvaters geht es über den Katschberg nach Tamsweg, von dort mit der Murtalbahn in der ersten Zugfahrt meines Lebens nach Unzmarkt. Dort steige ich um in die Südbahn. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich einen Zug gesehen und jetzt sitze ich nach der Fahrt in der Schmalspurbahn von Tamsweg nach Unzmarkt in einem „richtigen“ Zug auf der Fahrt von Unzmarkt nach Wien! In der Nähe von Kapfenberg, beim zufälligen Blick aus dem Fenster, entdecke ich einen Flugplatz mit einem Flugzeug auf der Piste, das mir unheimlich groß vorkommt. „Richtige Flieger“ kannte ich bis zu diesem Zeitpunkt ja nur von den Kondensstreifen am Himmel über meinem Elternhaus. In Wien angekommen, finde ich auf dem Pult im Studiersaal des Internats in der Auhofstraße 8 meine Schulbücher vor. Darunter im grauen Umschlag in grünlicher Schrift „I learn English“, was mich kurz darauf hoffen lässt, die englische Sprache könnte vielleicht mit dem Dialekt in Oberkärnten verwandt sein, weil sie sich ja so liest, wie ich daheim zu sprechen gewohnt bin …
Meine erste Reise ins Ausland führt mich im September 1974 nach Rom, um an der Päpstlichen Universität Gregoriana meine theologischen Studien fortzusetzen. Das erste prägende Erlebnis dort ist für mich der Moment, in dem mich meine Italienischlehrerin, Signora Olga Lampe-Minelli, bei der Hand nimmt und mir mit den Worten „Eccolo!“ das Meer zeigt. Weit mehr als das mir vertraute Glück, im Sommer von den Gipfeln der Nockberge ins Liesertal zu blicken, erfüllt mich hier die unendliche Weite des Meeres. Niemals zuvor hat mich die Natur so sprachlos gemacht! Eine größere Weite hatte mir vorher noch niemand gezeigt. In neun Jahren meines römischen Studiums wächst diese Weite in mich hinein. Mit 3000 Studenten aus 130 Nationen in Rom leben und studieren zu können, ist ein seltenes Privileg.
Meinen Horizont haben auch Menschen erweitert, denen ich in meinem Leben begegnen und ein Stück des Weges gehen durfte. An einige dieser Weggefährten erinnere ich mich in großer Dankbarkeit. Die Erfahrungen und Begegnungen mit ihnen finden für mich an entscheidenden Wegkreuzungen statt:
1990 zum Geburtstag im November schenkt mir Rosi ein Buch mit der knappen Widmung „molto interessante – hoffentlich findest Du auch die Zeit, darin zu lesen“. Als wäre es nur für mich geschrieben, lässt mich dieses Buch nicht mehr los und verändert mein Leben. Heribert Fischedick, damals noch Pfarrer in Meerbusch bei Düsseldorf und schon Psychotherapeut, erzählt in seinem Buch „Von einem, der auszog, das Leben zu lernen“ (1987) und bringt damit mein Inneres heilvoll-gründlich durcheinander. Ich lese es immer wieder, zuerst allein, dann mit anderen. Wenig später lade ich Heribert nach Kärnten ein und veranstalte mit ihm Seminare.
1991 im Sommer besuche ich Bischof Egon Kapellari in seinem Urlaub auf der Alm und schütte ihm mein Herz aus, erzähle ihm, dass ich nicht wüsste, wie mein Leben weitergehen solle, dabei aber davon überzeugt wäre, es ändern zu müssen. Sein Wort ermutigt mich: „Was immer Sie tun, es wird uns nichts trennen!“ Ich kann die innere Freiheit, die dieser Satz in mir auslöst, auch heute noch nicht beschreiben. Ich erinnere mich nur, wie beschwingt und befreit ich den Weg von der Alm zu Fuß hinunter ins Tal zurückgelegt habe. Unten angekommen hätte ich viel darum gegeben, noch unterwegs sein zu dürfen und den Geschmack der Freiheit im Unterwegssein genießen zu können. Mein „Versuch, in der Wahrheit zu leben“3, hat so mit kleinen Schritten zögernd begonnen. Nach und nach aber wurde mir klar, dass es keinen Schritt mehr zurück gibt.
Im Jahr 1990 lerne ich Peter Turrini kennen. Die Uraufführung seines Stückes „Tod und Teufel“ am 10. November dieses Jahres im Wiener Burgtheater ist für mich ein unvergessliches Ereignis. Gemeinsam mit Gerd Bacher, dem legendären Generaldirektor des ORF, sitze ich als Gast des Autors in einer Loge. In der Pause erhebt sich Bacher und sagt zu mir: „Hochwürden, wir gehen! Dieses Stück ist eine Zumutung!“ Stolz entgegne ich ihm: „Ich bin von Peter Turrini persönlich eingeladen. Ich bleibe!“ Kennengelernt hatte ich Turrini im Mai 1990 bei einer „Welturlesung“ aus seinem Theaterstück „Die Minderleister“, zu der ich ihn als damaliger Rektor des Bildungshauses St. Georgen am Längsee eingeladen hatte. Diese Begegnung prägt mich nachhaltig und bildet die Basis für eine bis heute dauernde Freundschaft. Als ich ihn deshalb vor drei Jahren bitte, mein Trauzeuge zu sein, antwortet er mir: „Immer schon wollte ich bei der Hochzeit eines katholischen Pfarrers der Trauzeuge sein!“
Am 10. Juni 1991, in meinem 39. Lebensjahr, beginne ich mit der Lehranalyse bei Erwin Ringel in Wien und damit die Ausbildung zum individualpsychologischen Psychotherapeuten. Ich erinnere mich noch gut an die erste Stunde, in der ein einziger Wortschwall aus mir herausbricht und ich dabei das Gefühl habe, noch nie jemandem so rückhaltlos mein Leben erzählt zu haben. „Ich fühle mich wie hinter einer Mauer“, sagt Christian Bley in Peter Turrinis Stück „Tod und Teufel“. So ähnlich mag ich mich bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben auch gefühlt haben. Die Begegnungen mit Peter Turrini und danach mit Erwin Ringel helfen mir, diese Mauer nach und nach abzubauen.
Nach dem Fall der anderen Mauer, 1989 in Berlin, entsteht ein geflügeltes Wort: „Wer nach allen Seiten hin offen ist, ist nicht ganz dicht!“ So mag ich damals auf viele gewirkt haben, ungefragt offen und „nicht ganz dicht“. Aber es ermutigt mich und macht Appetit auf einen neuen Weg. Die Abenteuerlust und der Zauber des Anfangs legen Kräfte frei und geben mir das Gefühl, jetzt erst geboren zu sein. Eine im mehrfachen Sinne des Wortes spannende Zeit.
5
Hoffnung für beide Seiten
Im Kampf um die Unabhängigkeit der baltischen Staaten war es zwischen diesen und Russland immer wieder zu erbitterten Kämpfen gekommen. Als dabei einmal der Oberbefehlshaber einer der kämpfenden Truppen lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, warteten Pressevertreter beider Lager gespannt auf den ärztlichen Bericht über den Zustand des in Lebensgefahr schwebenden Helden. Die eine Seite hoffte, er möge am Leben bleiben, die andere wünschte sein Ende herbei. Als der behandelnde Arzt vor den Presseleuten sein Bulletin verkündete, fasste er es in dem einen Satz zusammen: „Für beide Seiten besteht Hoffnung!“
Als mein Lehrer Erwin Ringel in den ersten Monaten meiner Lehranalyse im Wiener Rathaus während eines Empfanges auf Diözesanbischof Egon Kapellari traf und von diesem gefragt wurde, wie es mir denn aus seiner Sicht gehe, borgte sich Ringel das Wort seines baltischen Kollegen und antwortete: „Für beide Seiten besteht Hoffnung!“ In einer für mich damals nicht vorhersehbaren Art sollte mein Lehrer recht behalten: Weder ist mir seither die Lust an der Seelsorge vergangen, noch kann ich mir heute vorstellen, im Rahmen der kirchlichen Seelsorge tätig zu sein.
Immer wieder musste ich in den Zeiten des Übergangs an ein mir lieb gewordenes französisches Sprichwort denken, das Erneuerungsphasen des Lebens mit der Technik des Weitsprungs vergleicht. Dort ginge es ja darum, sich in der Kunst zu üben, sich zurückzunehmen, die Kräfte zu bündeln, um mit geballter Kraft besser nach vorne springen zu können: „Reculer pour mieux sauter.“ – „Zurückzuweichen, um besser nach vorne springen zu können.“ Oder, um es mit einem geflügelten Wort zu sagen: „Love it, change it, or leave it!“ – Das, was du tust, musst du lieben! Wenn du es nicht (mehr) lieben kannst, musst du es ändern! Wenn sich dadurch nichts ändert, musst du es lassen und etwas anderes suchen, das den Intentionen deines Herzens mehr entspricht!
6
Grillparzer im Pornoladen
Zur Premiere von Peter Turrinis Theaterstück „Grillparzer im Pornoladen“ am 15. September 1994 im Wiener Rabenhof bin auch ich eingeladen. Mein Sitzplatz befindet sich direkt hinter Bürgermeister Helmut Zilk und seiner Gattin Dagmar Koller, deren Kommentare während des Stücks mich ähnlich erheitern wie Dolores Schmidinger und Otto Schenk in den Hauptrollen auf der Bühne. Was dort den Zuschauern geboten wird, ist wunderbares Theater, beinahe eine Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen und unfreiwillig komisch, in einem Pornoladen.
Nach der Premiere bewegt sich der Kreis der geladenen Gäste in Richtung des Wiener Nobelstundenhotels „Orient“ am Tiefen Graben im 1. Bezirk. Weil ich telefoniere, verliere ich den Anschluss an die Gruppe und stehe wenig später alleine vor der Eingangstür zum „Orient“. Plötzlich und unerwartet begrüßt mich dort der damalige Österreichische Botschafter auf den Philippinen, Dr. Wolfgang Jilly. Er ist ein langjähriger Freund, den ich bereits während meines Studiums in Rom kennengelernt und gemeinsam mit Bischof Egon Kapellari während seiner Zeit als österreichischer Botschafter in Chile in Santiago de Chile besucht habe. Auf seine Frage, was ich hier denn suche, antworte ich ihm, dass ich im „Orient“ zu einer Premierenfeier eingeladen bin. Er klopft mir auf die Schulter und meint: „Gratuliere! Jeder muss einmal damit beginnen!“ Und wie ich ihm vorschlage, doch mit mir zu kommen, um sich von der Lauterkeit meiner Absicht zu überzeugen, lehnt er mit dem Hinweis darauf ab, dass ihm seine Frau diese Geschichte nicht glauben würde. Damit versäumt er ein wunderbares Fest, das mit selbstgebackenen Süßigkeiten der Großmütter der Damen des Hauses erst in den frühen Morgenstunden ausklingt …
7
Svjatoslaw Richter
Wenn du einem Spiel zuschaust, ist es Vergnügen, wenn du es spielst, ist es Erholung, wenn du daran arbeitest, ist es Studium.
Wassily Kandinsky
(1866–1944)
Meinem Kollegen Alfred Kirchmayr verdanke ich den schönen Satz, wonach ein Mensch erst dann reif ist, wenn er den Ernst wiederfinden kann, den er als Kind beim Spielen hatte. Der spielende Mensch, oder besser gesagt, erst der spielende Mensch ist in der Kraft seiner Kreativität lebendig und in der Lage, diese seine Welt unverwechselbar mitzugestalten. Mag sein, dass die großen Erfindungen und Entdeckungen unendlich viel Mühe und zeitlichen Aufwand erfordert haben, aber die Tatsache, dass es so weit kommen konnte, hat wohl immer auch mit der Leidenschaft des Herzens zu tun, an den Dingen, die uns beschäftigen, so lange mit aller Leidenschaft dranzubleiben, bis sie uns durch alle Tiefschläge und Talsohlenerfahrungen hindurch mit einem Male und dann endlich ganz leicht und spielerisch von der Hand gehen. Oft erlebe ich gerade in der Musik diese Art des Spielerisch-Kreativen als den Inbegriff des Lebendigen. Es bedarf allerdings einer großen Professionalität, die zuallererst darin besteht, Können und Wollen als inneren Ruf wahrzunehmen, der den Berufenen erst dann zur Ruhe kommen lässt, wenn er sein Bestes gegeben hat und trotzdem nie genau wissen wird, ob das, wofür ihn andere loben, tatsächlich auch das Beste war, das zu geben er mit etwas Glück in der Lage sein könnte.