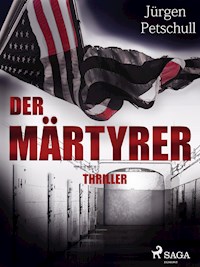Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Packende Geschichte über eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR! September 1979. Um dem verhassten Regime der DDR zu entkommen, planen zwei Männer aus Thüringen ihre Flucht. In einem selbstgebastelten Heißluftballon wollen sie mit ihren Familien in den Westen fliehen. Doch der erste Versuch misslingt. Die Flüchtenden können zwar unerkannt entkommen, aber die Staatssicherheit ist ihnen auf den Fersen. Mit einem zweiten Ballon starten die Familien schließlich einen neuen Versuch und landen in der Nacht des 16. Septembers 1979 tatsächlich in der BRD. Petschulls nach den Original-Tonbandprotokollen aufgezeichneter Tatsachenbericht ist zugleich Abenteuerbuch, Politthriller und ein spannend vermitteltes Dokument deutscher Zeitgeschichte. 1982 diente Petschulls Buch über diese wohl spektakulärste "Republikflucht" als Vorlage für den gleichnamigen Walt-Disney-Spielfilm unter der Regie von Delbert Mann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jürgen Petschull
Mit dem Wind nach Westen
Die abenteuerliche Flucht von Deutschland nach Deutschland
Saga
Mit dem Wind nach WestenCopyright © , 2019 Jürgen Petschull und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726350937
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Vorwort
Kein Zweifel, es war die abenteuerlichste Flucht in der Geschichte des geteilten Deutschland. Zusammengepfercht auf einer winzigen Gondel, getragen von einem riesigen, selbstgenähten Ballon, überquerten zwei Familien unter sternklarem Himmel die Grenze zwischen Deutschland und Deutschland, zwischen Kommunismus und Kapitalismus, zwischen den Machtblöcken in Ost und West.
»Acht Menschen mit Heißluftballon aus der DDR geflüchtet«, berichtete per Eilmeldung am Sonntag, dem 16.September, die »Deutsche Presse Agentur«. Die Nachricht ging um die Welt. Überall im Westen – von Amerika bis Australien, von Finnland bis Südafrika – wurde das anscheinend unglaubliche Ereignis verbreitet und kommentiert. Und überall im Osten peinlich verschwiegen.
Eine Portion Schadenfreude war im Westen wohl auch dabei – platzte die Ballonflucht doch mitten in die Vorbereitungen zur größten Jubelveranstaltung der DDR, die unter dem Motto »Größte Leistungsschau des Sozialismus auf deutschem Boden« gerade ihren 30. Jahrestag feiern wollte. Vor diesem Hintergrund geriet die symbolträchtige Ballonfahrt der Familien Strelzyk und Wetzel aus der kleinen Stadt Pößneck in Thüringen in die kleine Stadt Naila in Oberfranken zum weltweiten Politikum.
Für die »New York Times« sprach »die Flucht zweier Familien mit einem Ballon Bände über die politischen, wirtschaftlichen und menschlichen Verhältnisse in der DDR«.
Die »Süddeutsche Zeitung« wertete das Ereignis als »unerhörte Tat, die einen bitterbösen Kommentar auf die Verhältnisse im Herzen Europas schreibt; zugleich freilich ist sie eine Hymne auf die Freiheit«.
Der gewöhnlich auch bei ernsten Angelegenheit zu Ironie neigende »Spiegel« pries das Geschehen diesmal mit ungebremster Begeisterung: »Die Ballonflucht stellt an schierer, vorbedachter Tollkühnheit nun wirklich alles in den Schatten, was unsere hochbezahlten Stuntmänner, Risikosportler und Abenteurer zu bieten haben.«
Die so bejubelten Flüchtlinge sehen das anders: »Warum muß man unbedingt einen Beweis unseres Heldentums finden?« überlegt sich der Ballonfahrer Peter Strelzyk, früher SED-Mitglied und »Verdienter Aktivist des sozialistischen Wettbewerbs«. Er fragt: »Ist es heldenhaft, frei sein zu wollen?« Und er stellt fest: »Unser Drang zur Freiheit war jedenfalls größer als unsere Angst.«
Dieses Buch entstand nach wochenlangen Gesprächen mit den Flüchtlingen und nach zusätzlichen Recherchen in Ost und West. Es schildert die dramatische Ballonflucht und ihre Hintergründe, und es gibt einen Einblick in das Alltagsleben in der DDR. Aber es kann nicht objektiv sein. Denn es schildert die Verhältnisse drüben aus der Sicht von Menschen, die gute Gründe hatten, den »ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden« zu verlassen. Sie fühlten sich unfrei und unterdrückt. Sie hoffen im Westen die Freiheit zu finden.
Viele Menschen drüben denken wie die Strelzyks und die Wetzels, viele würden über die Grenze wechseln, hätten sie die freie Wahl – gäbe es nicht Mauer und Minen, Stacheldraht und Selbstschußanlagen. Aber nicht alle. »Wir vergessen manchmal«, schrieb meine Kollegin Eva Windmöller 1 , zwei Jahre lang Korrespondentin des »Stern« in der DDR, »daß sich die Mehrheit der 17 Millionen Menschen mit der ihr aufgezwungenen Gesellschaftsordnung arrangiert hat. Den meisten ist die DDR Heimat geworden – so wie sie ist, so verbesserungsbedürftig wie sie ist.«
JP
1
Tagsüber war es drückend schwül, so daß empfindliche Leute Kopfschmerzen bekamen. Am späten Nachmittag strömte eine Kaltfront aus Norden ein und schob die warmen Luftmassen gegen die Berge des Thüringer Waldes. Am frühen Abend entlud sich ein heftiges Gewitter. Erst quirlten Windböen kleine Schaumkronen auf das Wasser der Saale; dann drückten schwere Regengüsse das noch nicht abgeerntete Korn auf den Feldern platt; dann fuhr der Sturm in die hohen Fichtenwälder, und an der »Staatsgrenze West« spaltete ein Blitz eine meterdicke deutsche Eiche – nicht weit vom Minengürtel entfernt.
Ebenso schnell, wie es gekommen war, legte sich das Unwetter. Blitz und Donner zogen über die Berge ab. Zurück blieb ein blanker, fast wolkenloser Himmel. Jetzt, eine Stunde vor Mitternacht, ist es sternenklar. Ein schmaler Mond hängt über der kleinen Stadt Pößneck in Thüringen.
In einem Haus in der Tuchmacherstraße haben an diesem 15. September zwei Männer gespannt die Entwicklung des Wetters beobachtet und die Vorhersagen in Radio und Fernsehen verfolgt. Zuletzt meldet der »Zentrale Wetterdienst Potsdam« die weiteren Aussichten für die Deutsche Demokratische Republik: »Am Rande eines skandinavischen Tiefdruckgebietes wird weiterhin kalte Meeresluft polaren Ursprungs in unser Gebiet geführt. Bei klarem Himmel gehen die Temperaturen nachts bis auf drei Grad zurück. In Bodennähe kann örtlich leichter Frost bis minus zwei Grad auftreten ...«
Der eine Zuhörer sagt: »Das hört sich doch prima an. Ich glaube, heute Nacht kann es endlich losgehen.«
Der andere antwortet: »Es sieht gut aus, aber laß uns lieber noch mal den Wind kontrollieren.«
Die beiden Männer ziehen festes Schuhwerk und Pullover an, bevor sie das Haus verlassen. Der eine trägt eine braune Kunstlederjacke, der andere eine graue Windjacke. Sie fahren in einem blauen Wartburg mit weißem Dach, ostdeutsches Kennzeichen NK-9743, durch stille Straßen aus der Stadt hinaus und weiter über eine schmale Landstraße in Richtung Süden. Ein gleichmäßiger Wind hat die Fahrbahn schon wieder trocken gefegt. Hinter den Ortschaften Wernburg und Ludwigshof biegen sie nach links in einen holprigen Schotterweg ab. Im zweiten Gang kriecht der Wartburg die Bahrener Höhe hinauf. Unterhalb dieser 600 m hohen kahlen Bergkuppe erlöschen die Scheinwerfer des Wagens.
Die beiden Männer steigen aus und gehen die letzten Meter zu Fuß gegen einen starken, aber nicht stürmischen Wind an. Dann blicken sie über das in blasses Sternenlicht getauchte Land zu ihren Füßen. Im Nordwesten, in knapp 30 km Luftlinie, können sie noch den Widerschein der Lichter von Weimar erkennen. Genau im Norden, gut 20 km entfernt, liegt Jena. Rechts daneben, im Nordosten, die Bezirksstadt Gera. Im Süden sind nur vereinzelte Lichtpunkte auszumachen; sonst zeichnet sich in dieser Richtung nur dunkle Landschaft unter dem helleren Himmel ab, sanfte Höhenzüge, Wälder und Felder – das südliche Grenzgebiet der Deutschen Demokratischen Republik.
Der Mann mit der Kunstlederjacke befeuchtet seinen rechten Zeigefinger mit Spucke und hält ihn prüfend hoch. Der andere wirft ein paar helle Wollfäden in die Luft. Beide beobachten im Schein einer Taschenlampe, in welche Richtung die Fäden davongetrieben werden. Dann leuchten sie auf einen einfachen Kompaß. Der Wind weht aus Nord-Nord-Ost nach Süd-Süd-West – genau in Richtung Bundesrepublik Deutschland. Die Windgeschwindigkeit, so schätzen die beiden Männer, beträgt etwa 30 bis 40 Stundenkilometer. Sie sind mit ihrem Test zufrieden. Der mit der Kunstlederjacke sagt: »Vom Startplatz aus müßten wir nach 20 bis 30 Minuten Flugzeit drüben sein.«
Es ist kurz vor Mitternacht. Ein ganz gewöhnlicher Sonnabend geht in beiden Teilen Deutschlands zu Ende, keine besonderen Vorkommnisse in Ost und West.
Nachrichten aus der Bundesrepublik: Der deutsche Fußballmeister HSV schlägt den 1. FC Kaiserslautern im Spitzenspiel der Bundesliga mit 1:0. – Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff sieht »keine Gefahr für das wirtschaftliche Wachstum der Bundesrepublik«. – Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Josef Kardinal Höffner hat »erneut die Auffassung bekräftigt, daß der legale Schwangerschaftsabbruch als Mord anzusehen ist«. – Die »Bild«-Zeitung berichtet auf ihrer ersten Seite über einen Einbruch in die römische Luxusvilla des Filmstars Claudia Cardinale und über einen Auftritt des Künstlers Hardy Krüger in der Münchner Nachtbar »Intermezzo«; der habe dort im Suff ein »schweres Silbertablett mit Getränken auf die beleuchtete Tanzfläche« geschleudert.
Nachrichten vom Tage aus der Deutschen Demokratischen Republik: Das »Neue Deutschland«, das »Organ des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei«, meldet auf der ersten Seite: »Leonid Breschnew besucht die DDR zum 30. Jahrestag.« – Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, überbrachte »zum Tag der Werktätigen des Bereiches der haus- und kommunalwirtschaftlichen Dienstleistungen« seine sozialistischen Grüße und Glückwünsche. – Auf Seite zwei steht, »der Bürger der BRD Bernhard Twiehoff« sei als »Grenzverletzer« festgenommen und »zur Prüfung der näheren Umstände den zuständigen Organen« übergeben worden. – Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, und der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Willi Stoph, gratulieren dem Generalgouverneur von Papua-Neuguinea Sir Tore Lokoloko zum Nationalfeiertag. – Im Spitzenspiel der DDR-Fußballoberliga schlägt an diesem Sonnabend der FC Carl-Zeiss-Jena den 1. FC Magdeburg mit 3:2.
Es ist schon nach Mitternacht, schon Sonntag der 16. September, als der blau-weiße Wartburg von der Bahrener Höhe zurück in die Stadt Pößneck fährt. Am Steuer sitzt der Mann mit der Kunstlederjacke: Peter Strelzyk, 37 Jahre alt, früher Luftfahrtmechaniker, zuletzt selbständiger Elektromonteur, verheiratet, zwei Kinder. Der Mann auf dem Beifahrersitz ist Günter Wetzel, 24 Jahre alt, Maurer und Kraftfahrer von Beruf, auch verheiratet, ebenfalls zwei Kinder.
Die beiden Männer sind schweigsam und nachdenklich. Aufmerksamer als sonst – so werden sie später erzählen – betrachten sie im Vorüberfahren die vertrauten Straßen und Gebäude ihrer Heimatstadt. Am Ortseingang erfassen die Scheinwerfer das Schild »Pößneck grüßt seine Gäste«. Wenig später fällt schwaches Laternenlicht am grauen Gebäude der SED-Kreisverwaltung auf den Leitspruch der Partei: »Vorwärts unter dem Banner von Marx, Engels und Lenin.«
Die Straßen der Innenstadt sind um diese Zeit menschenleer. In den Schaufenstern brennt kein Licht. Selten kommt ihnen ein Auto entgegen. Nur im »Café Dittmann« hinter dem »Hotel Posthirsch« ist noch was los. Hier schwingt wie immer in der Nacht zum Sonntag die reifere Jugend das Tanzbein, diesmal zu den fröhlichen Klängen einer Kapelle, die sich »Dance« nennt.
Als sie am Marktplatz und am »Kaffee Neubert am Markt« vorüberkommen, denkt Peter Strelzyk daran, daß er hier zum erstenmal einem Lehrmädchen namens Doris nähergekommen ist. Die Kapelle spielte »Tanze mit mir in den Morgen«. Nun sind sie bald 16 Jahre verheiratet.
Am gotischen Rathaus fällt Günter Wetzel ein, daß hier im Standesamt seine »sozialistische Eheschließung« vollzogen worden ist. »Petra hatte sich zur Hochzeit ein teures weißes Kleid mit Blumenstickereien machen lassen, dafür waren unsere Ringe billiger, die sind aus Golddoublé und haben 35 Mark das Stück gekostet.« Die Hochzeit war vor fast sechs Jahren. Nun ist ihr Sohn Peter schon fünf Jahre alt, der kleine Andreas wird zwei. Er sagt: »Komisch, daß man in solchen Situationen plötzlich an solche Sachen denkt«.
In dieser Nacht soll wahr werden, wofür sie gearbeitet, ihr Geld geopfert und hohe Gefängnisstrafen riskiert haben:
Die beiden Männer werden in dieser Nacht ihr Leben aufs Spiel setzen und das ihrer Frauen und Kinder – sie wollen mit dem Wind nach Westen.
2
In der Tuchmacherstraße 22 warten die Frauen und Kinder. Sie haben in der guten Stube im ersten Stock im Westfernsehen den Spielfilm »Angélique« gesehen und danach in »Radio DDR I« die Musiksendung »Tanze mit bis Mitternacht« gehört. Die kleine Quarzuhr im Schrankregal zeigt bereits 0.30 Uhr, als die Männer von ihrem Ausflug zurückkommen.
Petra Wetzel brüht noch einmal Kaffee auf, »keinen Muckefuck, richtigen guten Bohnenkaffee aus dem Delikatess-Laden«. Für die großen Kinder, für den 15jährigen Frank Strelzyk und seinen elfjährigen Bruder Andreas, gibt’s Tee. Der fünfjährige Peter Wetzel bekommt heißen Kakao, und dem noch putzmunter zwischen den Erwachsenen rumlaufenden zweijährigen Andreas flößt Petra Wetzel dreißig Baldriantropfen zur Beruhigung ein, die sie zuvor in heißem Zuckerwasser aufgelöst hat, damit es nicht so bitter schmeckt.
Die Männer sprechen sich noch einmal Mut zu. »Eigentlich kann gar nicht viel schiefgehen«, sagt Peter Strelzyk. »Wenn sie uns schnappen, dann kommen wir eben alle für eine Weile ins Gefängnis, aber dann werden wir nach einiger Zeit bestimmt ausgetauscht. Die machen jetzt doch mit der Bundesrepublik diesen Menschenhandel auf Devisenbasis.«
Wie die Wetzels haben auch die Strelzyks ein eigenes Haus in Pößneck. Sie fahren ein eigenes Auto, sie besitzen ein Fernsehgerät, einen Kühlschrank und eine Waschmaschine. Sie gehören zum gehobenen Mittelstand der DDR. Bei der letzten Tasse Kaffee in der alten Heimat sagt Doris Strelzyk: »Manchmal frage ich mich doch noch, warum wir das alles aufgeben und abhauen – anderen geht es doch viel schlechter als uns.«
Ihr Mann Peter Strelzyk, der Wortführer der Gruppe, macht sich indessen schon Gedanken darüber, »wie ich denen drüben möglichst kurz und bündig klarmachen kann, warum wir es nicht mehr in der DDR ausgehalten haben«. Schließlich hat er seine Antwort-Formel gefunden. Er sagt: »Weil wir endlich als freie Menschen und nicht mehr länger als Eigentum eines totalitären Regimes leben wollen und weil uns die Zukunft unserer Kinder am Herzen liegt ...«
So oder ähnlich begründen die meisten der mehr als 180000 DDR-Flüchtlinge, die seit dem Bau der Mauer in der Bundesrepublik registriert worden sind, ihren Absprung in den Westen. Peter Strelzyk hat da nichts Neues zu bieten. Er hat keinen bestimmten Grund. Er ist nicht politisch verfolgt oder persönlich bedroht; er habe, so sagt er, statt dessen viele Gründe – die Erfahrung seines Lebens in der Deutschen Demokratischen Republik.
Seine Bilanz summiere sich einerseits zu einem gewissen materiellen Wohlstand. Dem stehe jedoch eine wachsende Steigerung von Skepsis zu Mißmut, von Unbehagen zu Enttäuschung, von Zweifel zu Verzweiflung, von unterdrücktem Zorn zu ohnmächtiger Wut gegenüber. Peter Strelzyk fühlt sich schließlich von den Machthabern, von der Einheitspartei, von den Funktionären, von dem »ganzen gleichgeschalteten System entmündigt und unterdrückt«. Er sagt: »Am Ende empfand ich das ganze Leben als eine einzige geistige Vergewaltigung.«
Peter Strelzyk ist an diesem Tag genau 37 Jahre und einen Monat alt. Er sieht nicht älter aus, als er ist, aber er wirkt abgespannt und nervös, wie einer, der schon unter Magenbeschwerden leidet und aufpassen muß, daß kein Geschwür daraus wird. Er ist schlank, fast mager. Schatten liegen unter seinen braunen Augen. Markante Falten ziehen sich von der Nase zu den Mundwinkeln herab. Der dünne, dunkle Bart läßt sein Gesicht schmal und blaß aussehen. Er raucht zuviel, meist mehr als 50 Filterzigaretten Marke »Cabinett« pro Tag. Er wiegt bei seiner Größe von 1,75 m mit 64 Kilo zuwenig. »Ich bin nicht kräftig, aber zäh. Ich kann körperlich einiges aushalten.«
Noch vor zwei Jahren, so ist im Familienalbum nachzusehen, sah Peter Strelzyk zehn Jahre jünger aus. Da ist ein flotter junger Mann mit modisch langgeschnittenem Haar abgebildet, bartlos, mit einem fröhlichen Grinsen im vollen Gesicht. Nun spricht Peter Strelzyk leise und bedacht; oft macht er längere Denkpausen, bevor er auf Fragen antwortet, wie einer, der fürchten muß, daß ihm jedes Wort falsch ausgelegt werden kann – aber auch wie jemand, der gewohnt ist, daß man ihm zuhört. Er spricht Thüringer Dialekt, ein wenig weich, oft nuschelnd.
Peter Strelzyk ist am 15. August 1942 in Oppeln geboren, Sternzeichen Löwe. Nach dem Krieg wird seine Familie aus Oberschlesien vertrieben. Sein Vater arbeitet bei der Bau-Union in Gera. Der Junge wächst in verschiedenen Thüringer Dörfern auf, denn seine Eltern ziehen auf der Suche nach neuen, besseren Wohnungen häufig um. Nach der Schule beginnt Peter Strelzyk eine Lehre als Maschinenschlosser in Pößneck. Nebenbei besucht er einen Abendkursus für Elektrotechnik. »Ich habe meinen Elektromonteur in Qualifizierung gemacht«, sagt er auf DDR-deutsch, das heißt, er hat Abendkurse besucht. Mit 18 wird der Jungtechniker zur Nationalen Volksarmee der DDR eingezogen. »Eigentlich wollte ich einmal Pilot werden und meldete mich für die Luftwaffe.«
Er kommt zur fliegertechnischen Schule in Karmitz bei Dresden. Er wird als Flugzeugmechaniker ausgebildet. Bei Reparaturarbeiten an einem Kampfflugzeug stürzt er von einer Leiter und verletzt sich am Lendenwirbel. Die Folgen spürt er noch heute. »Aus war der Traum, Pilot zu werden. Ich wurde 1963 als Flugzeugmechaniker aus der Armee entlassen.« Peter Strelzyk geht zurück nach Pößneck. Er bekommt eine Stelle beim Volkseigenen Betrieb »Polymer«, einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen.
Peter Strelzyk ist ehrgeizig. Er arbeitet hart und lange. Er macht Karriere. Er wird Hauptmechaniker, dann Spezialist für »Betriebsmeß-, Steuer- und Regelungstechnik« und schließlich sogar Abteilungsleiter für Rationalisierung. »Ich habe fast 16 Jahre lang an Spritzgießautomaten gearbeitet«, erzählt er, »das sind Maschinen mit komplizierten Steuerungstechniken, mit Hydraulik und mit Elektronik.«
Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, er sei »richtig vernarrt in die ganze Technik« gewesen. Oft habe er an Feiertagen, sogar Weihnachten und Sylvester, defekte Maschinen repariert, »weil davon der ganze Produktionsablauf abhing«. Er sagt: »Mir haben sie immer die schwierigsten Probleme gegeben, die kompliziertesten Reparaturen, mit denen sonst keiner klarkam. Dann habe ich mich stunden- oder tagelang hingesetzt, habe gearbeitet und gegrübelt und habe mir gesagt: Du mußt diese verdammte Russenmaschine – wir hatten meist russische Maschinen – wieder hinkriegen! Du mußt einfach! Du mußt!« Meist habe es dann auch geklappt, und er habe »die Dinger wieder zum Laufen gekriegt«.
Sein Einsatz und seine berufliche Weiterbildung bringen Peter Strelzyk überdurchschnittliche Lohnsteigerungen ein – »zuletzt hatte ich manchmal an die 1500 Mark im Monat, das ist sehr viel für DDR-Verhältnisse«. Zusätzlich verdient sich der leidenschaftliche Tüftler noch ein kleines Vermögen durch seinen Einfallsreichtum hinzu. Er macht zahlreiche Betriebs-Verbesserungsvorschläge, führt sie auch selbst aus und erhält dafür Geldprämien. »Ich habe versucht, die meistens total veralteten Produktionsanlagen der Firma mit einfachen Mitteln zu modernisieren. Da war zum Beispiel eine Kunststoffmaschine, die wurde noch von einem Arbeiter mit zwei Handhebeln bedient. Der mußte nur diese Hebel drücken und das Schließen und Öffnen der Preßformen damit hydraulisch auslösen. Das Ding habe ich dann so umgebaut, daß das vollautomatisch lief und der Mann was Sinnvolleres machen konnte.«
In eine andere Anlage sei eine amerikanische Pumpe eingebaut gewesen, und »die war dauernd defekt«. Ersatzteile habe es nicht gegeben, und außerdem hätte die Firma dafür wertvolle Devisen zahlen müssen. Er habe schließlich eine DDR-Pumpe, die für ganz andere Zwecke gebaut war, so umgebaut, daß sie in diese Maschine paßte. »Das hatte noch einen wichtigen Nebeneffekt: Die Pumpe sparte nicht nur Devisen, sondern auch noch Strom, weil sie regulierbar war. Zweihunderttausend Kilowattstunden hat die Firma im Jahr durch diese Änderung weniger verbraucht.«
Dafür habe ihm die Betriebsleitung mit 3000 Mark die höchste Einzelprämie, die je im Werk für einen einzelnen Verbesserungsvorschlag gezahlt worden sei, aufs Konto überwiesen. Alles in allem – und darauf ist Peter Strelzyk stolz – habe er in den letzten zwölf Jahren mehr als achtzig Verbesserungsvorschläge gemacht und dafür insgesamt rund 50000 Mark Prämien kassiert.
Der ehrgeizige Techniker bekommt nicht nur Geld, sondern auch gute Worte. Peter Strelzyk wird zweimal vor der versammelten Belegschaft im Kreiskulturhaus von Pößneck als »verdienter Aktivist des sozialistischen Wettbewerbs« ausgezeichnet. Einmal bekommt er zusätzlich die »Medaille für ausgezeichnete Leistung«.
Diese Ehrungen der besten Arbeiter finden gewöhnlich am 13.November statt, am »Tag des Chemiearbeiters in der DDR« – VEB Polymer gehört zur Chemiebranche. Fahnen, Spruchbänder und Blumen schmücken dann die Bühne des Kreiskulturhauses. Die Besten des Betriebes werden heraufgerufen, und die anderen Werktätigen, alle in Schlips und Kragen und feinem Anzug, klatschen Beifall. Die Lobreden kann Peter Strelzyk noch heute auswendig:
»Liebe Genossen, liebe Kollegen! Es ist uns in diesem Jahr wieder ein großes Bedürfnis, unsere Besten auszuzeichnen, zu würdigen und zu ehren. – Lieber Genosse Strelzyk, du bist für deine hervorragende Tätigkeit im friedlichen sozialistischen Wettbewerb von deinem Kollektiv, von der Leitung des Betriebes, von der Gewerkschaftsleitung und von der Parteiorganisation zur Ehrung als ›Verdienter Aktivist‹ vorgeschlagen worden. – Wir überreichen dir hiermit die Urkunde und wünschen dir weiterhin Schaffenskraft bei bester Gesundheit und persönliches Wohlergehen für dich und deine Familie...« 200 Mark gibt’s auf die Hand, dazu einen Handschlag vom SED-Kreisleiter, Schulterklopfen vom Gewerkschaftsführer, Glückwunsch vom Vorsitzenden des Betriebes.
Peter Strelzyk, Sohn eines Arbeiters, hat es weit gebracht in der ersten Arbeiter- und Bauernrepublik Deutschlands. Im Sinne der Staatsideologie hätte er eigentlich ein glücklicher sozialistischer Mensch sein müssen – wenigstens ein zufriedener.
Denn auch in seinem Privatleben ist eigentlich alles so glatt verlaufen, als hätte er erfolgreich nach einem Plan gewirtschaftet. Mit 23 – Peter Strelzyk hat gerade seinen Wehrdienst hinter sich – sitzt er zusammen mit Freunden im »Kaffee Neubert am Markt«, einem plüschigen Treffpunkt für junge Leute ebenso wie für ältere Kaffeetanten. Hier gibt es, so steht es an der Außenfassade, »Torten, Kaffee, Gebäck, Lukullus-Keks, Baumkuchen und Gefrorenes«.
Am Wochenende ist Tanz oder Konzert. Dabei fällt Peter Strelzyk am Nebentisch ein zierliches, schüchtern wirkendes Mädchen mit großen, dunklen Augen auf. »Sie hat mir gleich gefallen, und irgendwie habe ich es geschafft, sie anzusprechen. Wir haben übers Wetter und über die Musik geredet, und dann haben wir getanzt.«
Sie heißt Doris, ist gerade 16 Jahre alt und Industriekaufmanns-Lehrling. Nebenbei, so verrät sie ihm, sei sie Souffleuse beim neugegründeten Arbeitertheater von Pößneck. Von nun an macht auch Peter Strelzyk mit, als Laienschauspieler. Er spielt in seiner ersten Rolle den Advokaten in »Der eingebildete Kranke« von Molière.
»Die Doris«, so erinnert sich Peter Strelzyk, »war wirklich eine sehr gute Souffleuse, da brauchte man kaum den Text zu lernen.«
Sie sagt: »Er war ein ganz passabler Schauspieler, dafür, daß er eigentlich wenig Talent hatte.«
Als dritte Vorstellung des Arbeiter-Theaters wird »Der Schatten eines Mädchens«, ein Stück des DDR-Schriftstellers Rainer Krendl, gegeben. Es handelt vom Ende des Zweiten Weltkrieges in Polen, und es ist auch schon das Ende des Arbeiter-Theaters von Pößneck. »Einige Leute hatten keine Zeit mehr. Sie mußten sich zu sehr um ihre Arbeit kümmern, und da ging die ganze Truppe schließlich sang- und klanglos auseinander.«
Die Souffleuse und der Laiendarsteller aber bleiben zusammen. Nach drei Jahren sagt sie ihm im Standesamt von Pößneck das Ja-Wort vor, – am 17. Juni 1966, der im Westen als Tag der deutschen Einheit gefeiert wird. »Diesen Hochzeitstermin hatten wir nicht extra ausgewählt«, sagt Peter Strelzyk, »aber damals habe ich mich schon ein bißchen für Politik interessiert, und irgendwie fand ich dieses Datum als Symbol sehr gut für unsere Ehe.«
3
Die erste Wohnung der Eheleute Doris und Peter Strelzyk ist zwölf Quadratmeter groß, ein Zimmer mit Handspülbecken. Das Klo ist unten auf dem Flur. Ihr Sohn Frank muß sein erstes Lebensjahr in dieser Enge verbringen. Peter Strelzyk rennt von einer Behörde zur anderen, vom Betriebsleiter zum Rathaus und zur Partei, um eine größere Wohnung zu bekommen. Immer vergebens, immer hört er dieselbe Antwort: »Sie sind doch nicht in der Partei, Herr Strelzyk! Da sind noch viele Genossen vor Ihnen dran, die brauchen ebenso dringend eine größere Wohnung.«
Da habe er zum ersten Mal »eine richtige Wut« auf diese Funktionäre bekommen, sagt der junge Familienvater. Er habe es in »diesem dunklen Loch« nicht mehr aushalten können. Schließlich drohte er, sich mitsamt seiner Familie in einem Zelt auf dem Marktplatz von Pößneck als Wohnungs-Notleidender zur Schau zu stellen. Er ging zur Lokalzeitung »Volkswacht« und kündigte diese Protest-Aktion an. »Daraufhin kam ein humorlos dreinschauender Mann zu uns und sagte, wenn ich Ärger mache, würden sich ›andere Organe‹ um mich kümmern – also der Staatssicherheits-Dienst.«
Eines Tages habe er doch nachgegeben. »Ich habe das Aufnahme-Formular für die SED unterzeichnet, das sie mir ständig unter die Nase gehalten haben.« Wenige Wochen später klappt es bereits: Die Eheleute Strelzyk können eine Wohnung in der Pößnecker Friedrich-Engels-Straße beziehen, gleich unter dem Dach. »Eine Bruchbude war das«, erinnert sich Peter Strelzyk, »aber man konnte was draus machen.« Drei Jahre später, 1970, wird im ersten Stock desselben Hauses eine größere Wohnung frei. »Da habe ich eine richtige Komfort-Wohnung draus gemacht – für DDR-Verhältnisse. Ich habe tapeziert, habe Toilette, Bad und Gaszentralheizung eingebaut, sogar den alten Kamin habe ich wieder in Betrieb gesetzt.«
Nach vier Jahren bekommen die Strelzyks ein zweites Kind. Andreas wird der Junge genannt. Für die nun vierköpfige Familie ist es in der Wohnung zu eng, und da das Haus direkt an einer viel befahrenen Durchgangsstraße liegt, hat die Mutter ständig Angst, wenn die Kinder draußen spielen. Peter Strelzyk – im VEB Polymer inzwischen auf der Karriereleiter und in der Gehaltsstufe nach oben geklettert und als SED-Mitglied mit guten Beziehungen ausgestattet – sieht sich nach einem eigenen Haus um. Etwas außerhalb sollte es gelegen sein, und einen Garten für die Kinder sollte es haben. 1975 klappt es.
Am Altenburgring finden sie ein älteres, aber noch solides Haus, Baujahr 1930. Sie kaufen es für nur 8300 Mark, den Einheitswert von 1914, von der kommunalen Wohnungsverwaltung. Peter Strelzyk erklärt: »Es ist bei Altbauten in der DDR so üblich, daß der alte Taxwert noch heute gilt. Das ist schon sehr günstig drüben.« Mit einem Renovierungs-Kredit von 30000 Mark und mit viel Eifer und Eigenarbeit macht Peter Strelzyk aus »der alten Bruchbude ein Schmuckkästchen«. Freunde helfen ihm dabei. »Wir haben mit dem Hammer erst mal die Wände rausgehauen, um größere Räume zu bekommen.« Neue Wände werden hochgezogen, eine Kohle-Zentralheizung wird gebaut, ein neues Bad, eine neue Toilette. Ein Teil des Kellers wird Garage mit einer schrägen Einfahrt. Alles in allem ziehen sich die Renovierungsarbeiten über Jahre hin. Es gibt immer wieder Lieferschwierigkeiten bei den Materialien. Mal ist wochenlang kein Tapetenkleister zu haben, dann gibt es jahrelang keine Fliesen fürs Bad. Die Badewanne hat zwei Jahre Lieferzeit. Der Tischler, der die Haustür nach Maß machen soll, sagt, es würde etwa zwei bis drei Jahre mit der Fertigstellung dauern, so lange sei er ausgebucht.
Dennoch – die Strelzyks sind stolz auf ihr kleines Wirtschaftswunder. »Nach und nach haben wir uns auch neue Sachen angeschafft. Eine Schrankwand fürs Wohnzimmer, Polstermöbel in Goldgelb und in Rot, eine Stereo-Anlage und ein Schwarz-Weiß-Fernsehgerät.« Die Wohnzimmerwände täfelt Peter Strelzyk mit wärmedämmenden Kunststoff-Schaumplatten. »Die waren nicht billig, die haben 13,90 Mark das Stück gekostet, und auf einen Quadratmeter gehen neun Platten, und ich hatte 16 Quadratmeter zu vertäfeln.« Gleich links neben der Tür stand das Prachtstück des Wohnzimmers, ein Kamin. »Den habe ich mit weißen Riemchensteinen verkleidet, aber leider durfte ich ihn nicht in Betrieb setzen, denn es hätte wegen der Mischung mit anderen Gasen Explosionsgefahr im Schornstein bestanden.«
Durch die Prämien, die er für seine Verbesserungsvorschläge im Betrieb bekommt, reicht es sogar zur Anschaffung eines zehn Jahre alten, gebrauchten »Moskwitsch«. Die Ehefrau Doris verdient als Sachbearbeiterin in der Kreissparkasse Pößneck ja auch noch vier- bis fünfhundert Mark im Monat dazu. Wie es in der DDR üblich ist, werden ihre Kinder zuerst in der Kinderkrippe und später im Kindergarten betreut, und schließlich besuchen sie die Ernst-Tählmann-Schule.
Die Strelzyks haben es zu Wohlstand und Ansehen gebracht. Ihre Straße, der Altenburgring, gilt als gute Adresse in Pößneck. Hier wohnen geachtete Bürger, Leute, die in der Kleinstadt-Hierarchie etwas gelten. Die Nachbarn sind meist stramme SED-Genossen, drei Mitglieder des Kreisrates wohnen in den Häusern zur Linken, gegenüber ist das Haus eines früheren Bürgermeisters, daneben lebt ein Gewerkschaftsfunktionär vom FDGB, dem »Freien Deutschen Gewerkschaftsbund«. Dann ist da noch die Station der Volkspolizei, und gleich um die Ecke, in der Körnerstraße, wohnen der Betriebsleiter des VEB Polymer und der für Peter Strelzyks Partei-Kollektiv zuständige Sekretär der Sozialistischen Einheits Partei, Kreisleitung Pößneck.
Trautes Eigenheim, ausgeglichenes Familienleben, Erfolg im Beruf – eigentlich hätten die Strelzyks rundherum zufrieden sein können. Doch dann macht Peter Strelzyk, wie er es nennt, einen Fehler, »den man unbedingt vermeiden muß, wenn man das Leben in der DDR ertragen will«.
Er habe angefangen, sich intensiver für Politik zu interessieren. Er vergleicht die reine kommunistische Lehre von »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« mit der Wirklichkeit in der DDR. Er mißt die ständige Propagandaberieselung von immer neuen Erfolgen im sozialistischen Wirtschaftswettbewerb, von der angeblichen Steigerung des Lebensstandards an der Realität des Alltags. Er kommt zu der Erkenntnis: »Gerade in den letzten Jahren ist es nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Es gab immer größere Versorgungsschwierigkeiten, die Preise stiegen, und besonders der Spielraum für eigene Gedanken und Meinungen wurde immer mehr eingeengt.«
Peter Strelzyks Zweifel am gleichgeschalteten Leben in der DDR wächst sich schließlich zur Verzweiflung aus. »Es ist auf die Dauer unerträglich, wenn man immer nur das nachplappern darf, was die Partei erlaubt.« Er sieht die Verhältnisse in der DDR anders als die prominenten Systemkritiker, anders als die Intellektuellen Robert Havemann, Wolf Biermann und Rudolf Bahro – der »Verdiente Aktivist« Strelzyk kritisiert den Zustand des ersten deutschen Arbeiter- und Bauern-Staates aus der Perspektive des total verwalteten Werktätigen. »Was mich zuerst gestört hat, waren diese billigen Propaganda-Lügen, diese Schwarz-Weiß-Malerei, nach der bei uns alles gut und im Westen alles schlecht ist.«
Peter Strelzyk erinnert sich an Episoden aus seiner Kindheit und aus seiner Jugendzeit. »Da war zum Beispiel die Geschichte mit den Kartoffelkäfern, als ich noch zur Schule ging. Das war Anfang der 50er Jahre, ich war wohl zehn oder elf Jahre alt. Da hat man uns in der Schule beigebracht, die Amerikaner hätten aus Flugzeugen Kartoffelkäfer auf das Gebiet der DDR abgeworfen, um unsere Ernte zu vernichten. Wir sollten diese ›feindlichen Käfer‹ wieder einsammeln, um die Ernte zu retten.« Wahrscheinlich, so meinte er, hatten die Funktionäre das nur erfunden, um den Arbeitseifer der Schüler anzustacheln. Dennoch – die ersten Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Lehrer und Funktionäre waren geweckt.
Als Jugendlicher hat Peter Strelzyk andere Schlüsselerlebnisse. »Ich war Lehrling und hatte gerade eine neue Nietenhose aus dem Westen bekommen, ein kostbares Geschenk, das ich stolz meinen Freunden vorführte. Wir standen in einer Gruppe von jungen Leuten auf dem Marktplatz in Pößneck, als einige Volkspolizisten herankamen, uns als ›Halbstarke‹ beschimpften und mit zur Wache schleppten. Dort wurden die westlichen Markenzeichen aus unseren Hosen herausgetrennt.«
Damals, Ende der 50er Jahre, sei in der DDR der streichholzkurze »Ami-Haarschnitt« verboten gewesen. Ein paar Jahre später, zur Zeit der Beatles, wurden langhaarige Jugendliche von der Vopo festgehalten und mitten auf dem Marktplatz auf bereitstehende Stühle gesetzt. Dann seien zwei Friseure gekommen und hätten ihnen die langen Haare kurzgeschnitten. »Die Leute standen schweigend herum«, erzählt Peter Strelzyk, »kaum einer hat etwas gesagt. Die meisten fanden dieses Schauspiel offensichtlich entsetzlich, diese brutale Demonstration staatlicher Gewalt. Ein älterer Mann sagte laut: ›Das sind doch Nazi-Methoden.‹ Er wurde davongejagt.«
Während seiner Ausbildungszeit bei der Volksarmee und schließlich im Beruf seien ihm die ständigen Versammlungen, Veranstaltungen und Kundgebungen der SED, bei denen Erscheinen Pflicht war, »ganz schön auf den Wecker gefallen«. Peter Strelzyk sagt: »Ich habe schließlich geradezu allergisch auf Worte wie ›Kampfziel, Kollektiv, Brigaden, freiwillige Plan-Übererfüllung‹ reagiert. Sozialismus«, so sagt er, »mag eine große und wichtige Sache sein, aber in der DDR wird dieses Wort so oft im Munde geführt und für jeden Quatsch mißbraucht, bis es einen üblen Beigeschmack bekommt.«
Nach einiger Zeit habe er so gelebt wie die meisten seiner Freunde und Kollegen in Pößneck – nach außen hin angepaßt, sogar arriviert, aber mit einer heimlich wachsenden Wut und mit vorsichtigem Widerstand. Immer häufiger habe er die an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfindende Betriebs-Parteiversammlung geschwänzt, obwohl das Erscheinen »sozialistische Pflicht« gewesen sei. »Einmal bin ich rausgegangen, als der Parteisekretär zum x-ten Male verkündet hat: ›Um die Erfordernisse des Sozialismus zu erfüllen, ist es notwendig, unsere Produktionsanlagen weiter zu automatisieren, damit wir im friedlichen sozialistischen Wettbewerb den Wohlstand unserer sozialistischen Bevölkerung weiterhin heben können.‹«
Als ihm auf der Bühne des Pößnecker Kreiskulturhauses die Urkunde als »Verdienter Aktivist« überreicht wird, sei ihm »das ganze Brimborium drumherum schon peinlich gewesen«, sagt Peter Strelzyk. »Ich habe mich vor den Kollegen im Saal geschämt, weil die genau wie ich wußten, was das für ein Propaganda-Theater ist, das zu immer mehr Arbeit und zu immer weiteren Plan-Übererfüllungen anspornen soll. Ich bin mir da als komischer Held vorgekommen.«
Zusammen mit einer Handvoll Kollegen verläßt Peter Strelzyk 1968 aus Protest eine Betriebsversammlung der Partei, als dort der Einmarsch der DDR-Truppen in die Tschechoslowakei gerechtfertigt wird. Dann beschwert er sich energisch über gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen im VEB Polymer. »In einer Abteilung mußten sechs Frauen in einem fensterlosen Raum arbeiten, in dem hochgiftige Lackverdünnungen gelagert wurden.« Man habe ihm gesagt, das sei nicht so schlimm, er übertreibe furchtbar, daran könne der Betrieb nichts ändern – bis alle sechs Frauen mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten.