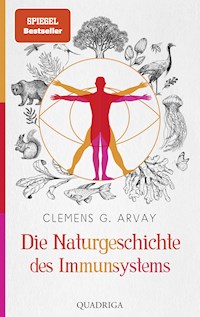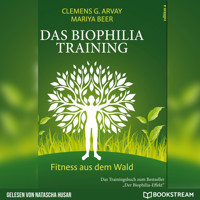8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Naturkontakt hilft uns auf die Sprünge, frei von Zwang und Anspruch
Die Wirkung des Waldes auf die Gesundheit des Menschen erforscht der Biologe Clemens G. Arvay seit Jahren mit Neugier und Methode. In diesem Buch verknüpft der Vater eines autistischen Jungen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Heilkraft der Natur mit ganz praktischen Tipps zur Förderung der Entwicklung insbesondere autistischer Kinder. Wald und Fluss bieten den idealen Raum für spielerischen Kontakt zur Außenwelt. Wie die Waldtherapie die kindliche Wahrnehmung durch gezielte Sinnesreize in der Natur stimuliert, fokussiert und trainiert, beschreibt Clemens Arvay anhand zahlreicher Beispiele. Der natürliche Weg zu persönlichem Wachstum und einem besseren Verständnis des Phänomens »Autismus«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Die Wirkung des Waldes auf die Gesundheit des Menschen erforscht der Biologe Clemens G. Arvay seit Jahren. In diesem Buch verknüpft der Vater eines autistischen Jungen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Heilkraft der Natur mit praktischen Tipps zur Förderung der Entwicklung insbesondere autistischer Kinder. Wie die Waldtherapie die kindliche Wahrnehmung durch gezielte Sinnesreize in der Natur stimuliert, fokussiert und trainiert, beschreibt Clemens G. Arvay anhand zahlreicher Beispiele. Schritt für Schritt begleitet er autistische Kinder auf dem natürlichen Weg zu persönlichem Wachstum und trägt bei zu einem besseren Verständnis des Phänomens »Autismus« in unserer Gesellschaft.
»Clemens Arvay untermauert die Waldtherapie für autistische Kinder in seiner gewohnt wissenschaftlich fundierten Art und mit behutsamen eigenen Beobachtungen aus der Praxis. Die Einzelfallbeobachtung ist ein mächtiges Instrument der Erkenntnis, weil sie erlaubt, die komplexe Verbindung zwischen Natur und Kind abzubilden. Clemens Arvay hat diese Methode in berührender Weise genutzt und so einen unverzichtbaren Ratgeber für Autismusbetroffene geschaffen.« Univ.-Prof. DDr. Christian Schubert, Arzt, Psychologe und Psychotherapeut, Medizinische Universität Innsbruck.
Autor
Clemens G. Arvay war Diplom-Ingenieur, Biologe und Sachbuchautor. Er studierte Landschaftsökologie und Pflanzenwissenschaften in Wien und Graz. Arvay beschäftigte sich mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur, wobei er die gesundheitsfördernden Effekte des Kontakts mit Pflanzen, Tieren und Landschaften in den Mittelpunkt rückte. Clemens G. Arvay hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter die Bestseller »Der Biophilia-Effekt« und »Der Heilungscode der Natur«.
Von Clemens G. Arvay ist bei Goldmann außerdem erschienen:»Der Heilungscode der Natur«»Biophilia in der Stadt«
Clemens G. Arvay
Mit den Bäumen wachsen wir in den Himmel
Autistische Kinder mit der Heilkraft des Waldes fördern
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Hinweis: Da Sachbücher ein besonders hohes Maß an Übersichtlichkeit und Lesbarkeit beanspruchen, wurde beim Verfassen des vorliegenden Buches weitgehend auf geschlechtsneutrale Formulierungen verzichtet. Sofern es aus dem Kontext nicht anders hervorgeht, sind stets Frauen sowie Männer gleichermaßen gemeint und angesprochen.
Originalausgabe Juli 2019
Copyright © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Coverfoto: Clemens G. Arvay
Lektorat: Judith Mark
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
KF · Herstellung: kw
ISBN 978-3-641-24385-2V003
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
»Willkommen im Wald der Vielfalt!« Eine kurze Einleitung
Kapitel 1: Der Wald – ein Lebensthema. Persönliche Rückblicke
Frühe Faszination
Zivildienst – im Wald
Jan
Samantha
Julius
Wiedersehen mit Julius
Kapitel 2: Mit den Bäumen wachsen wir in den Himmel
Was Baumstämme mit unserem Nervensystem zu tun haben
Wahrnehmungstraining in der Natur
Gestalten des Waldes
Waldesruhe und biologische Stressreduktion
Motorik und körperliche Gesundheit
Der Wald als Physiotherapeut
Das heilsame Trio des Waldes
Denken und sprechen lernen mithilfe der Natur
Kapitel 3: Die Waldkindergruppe – Natur als Sozialtherapeutin
Raphael
Geteilte Aufmerksamkeit – Sozialtraining im Wald
Den Wald gemeinsam erleben
»Waldmusik« – heilsame Klänge zwischen heilsamen Bäumen
Kapitel 4: Was wir vom Wald über Autismus lernen können
Optimismus und Eigeninitiative
Was die Lehrbücher über Autismus sagen
»Frühkindlicher Autismus« (Kanner-Syndrom)
»Asperger-Syndrom«
Autismus-Spektrum-Störung
Anderssein als »Krankheit«?
Hans Asperger und die »autistischen Psychopathen«
»Verhaltensmodifikation« durch angewandte Verhaltensanalyse (ABA) – therapeutischer Meilenstein oder Drill?
Der »funktionierende« Mensch?
Die evolutionäre Perspektive
Die Farbenvielfalt des Autismus
Das Verborgene sehen
Danke!
Bildteil
Bildnachweis
Anmerkungen
»Ich glaubte, man könne den Himmel und die Erde in der Sprache von Blau und Braun miteinander reden hören, wenn man nur ausreichend hinhörte.«1
Tito Mukhopadhyay, autistischer Schriftsteller
»Willkommen im Wald der Vielfalt!« Eine kurze Einleitung
Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist Autist. Aus dieser persönlichen Betroffenheit ist das vorliegende Buch entstanden, in dem ich meine beiden großen Lebensthemen Waldmedizin und Autismus zusammenführe. Als Biologe bin ich kein Experte für die Erforschung des Autismus-Spektrums. Mein Schwerpunkt liegt in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den therapeutischen Wirkungen des Waldes auf den menschlichen Organismus und somit auch die Psyche. Ich nähere mich dem Thema »Autismus« also aus waldmedizinischer und ökologischer Sicht – sowie aus der Perspektive eines Betroffenen. Dabei greife ich auf persönliche Erfahrungen mit autistischen Kindern im Rahmen der Waldtherapie zurück und ergänze diese Erlebnisberichte durch wissenschaftliche Erkenntnisse. Auf dieser Basis zeige ich, welchen Nutzen Naturerfahrungen für autistische Kinder haben. Dabei richte ich mich einerseits an Eltern, Großeltern, Betreuer und ökologisch interessierte Therapeuten. Andererseits ist das Buch so verfasst, dass darin auch Menschen, die selbst nicht unmittelbar vom Phänomen »Autismus« tangiert werden, Wissenswertes über diese faszinierende Art des Seins sowie über die therapeutischen Potenziale des Waldes erfahren. Darüber hinaus vermittelt der Bildteil einige Eindrücke der im Buch geschilderten Erlebnisse im Rahmen unserer Waldtherapie.
Die Natur zeigt uns, was Vielfalt bedeutet. Waldtherapie findet nicht nur in der Natur statt. Sie hat auch das Ziel, von der Natur zu lernen. Als naturalistischer Ansatz arbeitet sie mit den individuellen Potenzialen der Kinder. Es geht nicht darum, die Kinder an gesellschaftliche Normen anzupassen. Im Zentrum steht vielmehr das Angenommen-Sein so, wie man ist. Wie die Bäume sollen auch unsere Kinder ihrer Natur entsprechend wachsen und ihre persönlichen Potenziale ungehindert entfalten können. Darum geht es in diesem Buch.
So vielgestaltig wie die Natur ist auch die autistische Formenvielfalt. Kinder aus dem Autismus-Spektrum sind keinesfalls homogen, sondern jedes ist anders. Auffälligkeiten im Sozialverhalten oder bei der Wahrnehmung können gering bis stark ausgeprägt sein. Jedes Kind bringt seine individuellen Stärken und Schwächen mit – so wie jeder andere, nicht-autistische Mensch. Im Grunde ist »Autismus« ein Kunstbegriff, der geschaffen wurde, um Menschen, die aus der Norm fallen, in einer diagnostischen Kategorie zusammenzufassen. Zur Wahrung der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit des Textes werde ich dennoch die Begriffe »autistisch« und »Autismus« benutzen. Die Vielfalt dieses autistischen Spektrums bringe ich dabei anhand meiner Erlebnisse mit betroffenen Kindern zum Ausdruck. Im Laufe des Buches werden wir auf Begriffe und Konzepte stoßen, die Autismus nicht mehr – so wie derzeit üblich – als eine Krankheit im Sinne einer psychiatrischen Diagnose betrachten, sondern als Ausdruck derselben Naturvielfalt, der wir auch im Wald begegnen. Wir werden sehen, dass die autistische Formenvielfalt sogar ein »Experiment« der Natur sein könnte, um die Evolution des Homo sapiens voranzubringen. Alle diese Betrachtungen fügen sich in die naturalistische Perspektive der Waldtherapie ein und sind daher als Bestandteil dieses Ansatzes zu sehen. Da wir Menschen nicht nur Kulturwesen, sondern auch Naturwesen sind, können uns natürliche Ökosysteme wie der Wald viel Wertvolles über uns selbst und unser Menschenbild lehren. Nun lade ich Sie auf einen gedanklichen Streifzug durch die Wälder ein.
Kapitel 1: Der Wald – ein Lebensthema. Persönliche Rückblicke
Linde, Buche, Eichenbaume,ob bei Tage, ob im Traume,wir sind mit dem Baum im Bunde,das verrät die Menschenkunde.
Frühe Faszination
Im Alter von 19 Jahren – das war 1999 – schloss ich eine Buchbinderlehre ab, und ein wichtiges Kapitel meiner Jugend ging zu Ende. Zwar übte ich mein Handwerk mit großer Begeisterung aus und zog in Erwägung, meine Zukunft als Buchrestaurator zu verbringen, doch während meiner Lehrzeit hatte ich festgestellt, dass mich der Inhalt vieler Bücher noch mehr faszinierte als ihr Einband. Ich arbeitete in einer Kunstbuchbinderei in meiner Geburtsstadt Graz und hatte oft historische Handschriften mit Zeichnungen auf Pergament in den Händen, die aus dem Mittelalter stammten. Wir restaurierten diese altehrwürdigen Bände, um sie vor dem Verfall zu retten, oder fertigten für die kulturhistorische Forschung detailgetreue Kopien davon an, sogenannte Faksimiles. Daher war ich in der glücklichen Lage, neben zeitgenössischen auch alte, kunstvolle Bindetechniken zu erlernen, die weitgehend in Vergessenheit geraten waren.
In den Pausen und nach Feierabend befasste ich mich mit den Inhalten dieser Werke, die oft mittelalterliches Heilpflanzenwissen oder Naturweisheiten zum Gegenstand hatten. Manche Bücher enthielten Gedichte oder Erzählungen, voll mit atmosphärischen Naturszenen. Um sie zu verstehen, war ich natürlich auf die Übersetzungen ins zeitgenössische Deutsche angewiesen, die ebenfalls in dem Unternehmen, in dem ich arbeitete, gedruckt und gebunden wurden. Das Buch vom liebentbrannten Herzen2, ein vom Fürsten René von Anjou verfasster Roman in Gedichtform aus dem 15. Jahrhundert, begeisterte mich besonders und prägt bis heute meine Erinnerung an meine Zeit als Buchbinder. In dieser Geschichte begibt sich ein an Liebeskummer erkrankter Ritter, begleitet vom Knappen »Ardent Désir« (Brennende Begierde), auf die Suche nach seiner Angebeteten und begegnet dabei Charakteren wie »Jalousie« (Eifersucht), »Tristesse« (Traurigkeit), »Courroux« (Zorn) und »Espérance« (Hoffnung). Er reitet auf seinem Pferd über grüne Wiesen, durch wilde Schluchten, vorbei an majestätischen Schlössern und durch idyllische Haine. Schließlich verweilt er im »Wald des langen Wartens« und findet Trost bei den Bäumen. Der 1444 geborene Buchmaler Barthélemy d’Eyck illustrierte diese Erzählung farbenfroh und mit virtuoser Feinfühligkeit für natürliche Lichtverhältnisse wie beispielsweise bei Sonnenaufgang, Nacht oder Sonnenuntergang.
In der Buchbinderei zog es meine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Natur- und Pflanzengemälde und insbesondere auf die dargestellten Wälder. Das Binden solcher Bücher ging mir leichter von der Hand und machte mir mehr Freude als die Arbeit mit Büchern anderen Inhalts. Ich konnte der Magie der Naturmalereien und Pflanzenbeschreibungen einfach nicht widerstehen. Diese prächtigen Bilder aktivierten meine Biophilie – laut dem Psychoanalytiker Erich Fromm die Liebe des Menschen zum Lebendigen, spürbar als Faszination für die natürliche Welt und als Wunsch, dieser nahe zu sein. Die »biophile« Buchkunst befeuerte diesen Wunsch in mir. Auch die mittelalterlichen Gebetbücher, Gedichtbände und Schriften von Rechtsgelehrten fand ich interessant, aber die Kunstwerke mit Naturbezug fesselten mich geradezu. Mein Lebensthema klopfte wieder einmal bei mir an und erinnerte mich daran, in welche Richtung meine Reise gehen sollte.
Der Wald hatte in meinem Leben schon früh eine wichtige Rolle gespielt. Ich wuchs an einem städtischen Waldrand auf und konnte durch das Fenster meines Zimmers direkt in die Baumkronen blicken, um den Eichhörnchen beim Spielen oder den Spechten bei der Arbeit zuzusehen. Nachts hörte ich die Rufe der Eulen, die durch den Wald hallten. Mein Großvater, ein Förster und Botaniker, nahm mich schon früh auf Streifzüge durch seine Reviere in der Steiermark mit, die uns manchmal hoch hinauf zur Baumgrenze führten. Fast jedes Wochenende wanderten meine Eltern mit mir durch Wälder und auf Berge, trugen mich als Kleinkind dabei auf den Schultern. Ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, wie prägend solche frühen Naturerlebnisse sein können. Wie viel Nähe zur Natur uns bleibt, wenn wir erwachsen sind, hängt ohne Zweifel auch davon ab, wie viel Naturbezug uns von unseren Eltern in der Kindheit vermittelt wurde. Zwar sind Kinder höchstwahrscheinlich von Geburt an auf die Natur geeicht, und Biophilie als starkes Interesse am Lebendigen ist uns angeboren, aber für mich steht außer Zweifel, dass unsere Kindheit und das Verhalten unserer Eltern eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer Naturbeziehung spielen. Der Grundstein dafür, wie stark die Biophilie des späteren Erwachsenen ausgeprägt ist, wird schon früh gelegt. Als Jugendlicher zog ich mich nach sozialen Konflikten oder bei seelischem Kummer häufig in den Wald zurück und fand dort Abstand vom Alltag sowie eine deutliche Linderung meiner Sorgen. Dazu brauchte es regelmäßige Besuche im Wald, denn Wälder sind nicht wie Pillen, die man »einwirft«, um rasch eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Ich stellte fest, dass ich mit der Zeit eine heilsame Beziehung zum Wald aufbaute. So wie viele andere Menschen fühlte ich mich in der Natur geborgen und gestärkt. Vor allem aber übte die Natur eine Faszination auf mich aus, die mich immer wieder in den Wald zog – und später, wie erwähnt, als Buchbinderlehrling stundenlang in alten Naturbüchern blättern ließ.
Noch während meiner Lehrzeit holte ich in Abendkursen das Abitur nach, in Österreich als »Matura« bezeichnet. Das Ziel war mir bald klar: Ich wollte Biologe werden und den Wald erforschen, der mich über viele Jahre hinweg in seinen Bann gezogen hatte. So kam es, dass ich schließlich doch nicht als Buchrestaurator Einzug in eine alte Klosterbibliothek oder sogar in die Nationalbibliothek nahm, sondern nach der Abendmatura an die Universität ging und mich für das Fach Biologie einschrieb. Doch bevor ich für diesen neuen Lebensabschnitt wirklich frei war, hatte ich noch eine Hürde zu bewältigen.
Zivildienst – im Wald
Ich hatte bald nur noch Biologie und Waldökologie im Kopf. Der Zivildienst kam mir dabei äußerst ungelegen, hatte ich doch das Gefühl, ein ganzes Jahr mit verpflichtender, ganztägiger Arbeit würde mich von meinem eigentlichen Ziel ablenken. Widerwillig begann ich im Frühjahr 2000 die Grundausbildung, bei der wir zwei Wochen lang in das österreichische Sozialwesen eingeführt wurden, unsere Rechte und Pflichten als Zivildienstleistende beigebracht bekamen, Katastrophenschutzübungen absolvierten und mit Berufsfeuerwehrmännern angestrengt in Kanus stromaufwärts paddelten. Und da war er wieder: der Wald! Wir bewegten uns in schlanken Booten einen Flusslauf durch ein Auwaldgebiet an der österreichisch-slowenischen Grenze hinauf, und sofort begann die magische Anziehungskraft der Bäume wieder auf mich zu wirken. Ich atmete tief durch, vergaß alle Mühen und öffnete meine Sinne für die vorbeiziehende Landschaft. Die Waldkulisse spornte mich zum Durchhalten beim Paddeln an. Dieser Tag war für mich der willkommene Höhepunkt meiner Grundausbildung. Ich ahnte seinerzeit noch nicht, dass Wälder in meinem Zivildienst eine zentrale Rolle spielen würden.
Nach der Grundausbildung wurde ich für zwölf Monate einer Grazer Einrichtung zur mobilen Betreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen zugewiesen. Meine Aufgabe bestand darin, die vorwiegend jugendlichen Klienten zu Hause zu besuchen, sie bei Alltagstätigkeiten zu unterstützen oder sie bei ihren Freizeitaktivitäten zu begleiten. Es war eine bunte Mischung charismatischer junger Menschen im Alter von sechs bis 25 Jahren mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen, manchmal auch beidem zugleich. Ich lernte querschnittgelähmte Kinder und Jugendliche kennen, die auf den Rollstuhl angewiesen waren. Andere hatten das Down-Syndrom, das Fragiles-X-Syndrom – eine erbliche Form kognitiver Beeinträchtigungen –, waren taubstumm, blind, autistisch oder litten unter einer schweren Form des Muskelschwunds, die wegen der fortschreitenden Schwächung der Atemmuskulatur zum damaligen Zeitpunkt durchschnittlich im Alter von 20 Jahren zum Atemstillstand führte. Die Lebenserwartung bei dieser sogenannten progressiven Muskeldystrophie des Typs »Duchenne« ist dank neuer Behandlungsansätze inzwischen auf durchschnittlich 40 Jahre gestiegen.
Dass ich als unerfahrener »Grünschnabel« teilweise allein zu den Assistenzeinsätzen geschickt wurde, empfand ich in manchen Fällen als belastend, insbesondere dann, wenn Pflegemaßnahmen zu leisten waren, für die ich nicht ausgebildet war. Eigentlich sollen Zivildienstleistende laut Gesetz auch gar nicht allein arbeiten, sondern lediglich unterstützend und verstärkend. Es handelt sich ja in der Regel um medizinische Laien. Zum damaligen Zeitpunkt nahmen es die meisten Einrichtungen mit dieser Regelung aber nicht so genau. Daher bat ich die Einsatzleiterin, mich vorwiegend zu Klienten zu schicken, mit denen ich gut umgehen konnte und die auch ihrerseits einen guten »Draht« zu mir hatten. Das brachte für beide Seiten Vorteile. So entwickelte sich beispielsweise eine tiefe Vertrauensbasis zwischen dem sechs Jahre alten Jan und mir.
Jan
Jan war der erste Autist, mit dem ich näher in Kontakt kam. Der kleine Junge war taubstumm. Außerdem war bei ihm »frühkindlicher Autismus« diagnostiziert worden. Das bedeutet, der Autismus war bereits vor dem dritten Lebensjahr als tiefgreifende Entwicklungsstörung aufgetreten. Der Begriff »frühkindlicher Autismus« wird inzwischen vor allem im US-amerikanischen Raum, zunehmend aber auch in Europa, nicht mehr verwendet. Stattdessen werden alle Autismusdiagnosen unter dem Begriff »Autismus-Spektrum-Störung« zusammengefasst. Auf diesen Sachverhalt werde ich an späterer Stelle genauer eingehen.
Jans geistige Entwicklung war beeinträchtigt, was nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, dass er nichts hören und nicht sprechen konnte und es ihm als Autist grundsätzlich schwerfiel, mit seiner Umwelt in Austausch zu treten. Aber Jan war ein unglaublich unternehmungslustiger, aufgeweckter und lieber Junge. Schnell stellte sich heraus, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft hatten – das Wandern.
Nach einer Phase des Kennenlernens holte ich Jan zweimal pro Woche zum Wandern ab. Wir konnten nicht miteinander sprechen – er war ja wie erwähnt taubstumm –, und es war unmöglich, längeren Blickkontakt zu ihm aufzunehmen. Ich konnte nur kurze Blicke von ihm erwarten, für ein oder zwei Sekunden, und es war generell schwer, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Jan wirkte auf mich, als lebte er in einem Paralleluniversum, in das man kaum vordringen konnte. Er war körperlich anwesend, aber sein Geist schien fast ununterbrochen mit Dingen befasst, die für die meisten von uns wenig Bedeutung haben. Jan betastete hingebungsvoll Glasscheiben oder Tischkanten, als könne er an ihnen kleine Einzelheiten oder Strukturen feststellen, denen die Mehrheit der Menschen keine Beachtung schenkt. Er drehte sein Spielzeug scheinbar endlos in seinen Händen hin und her, nahm jedes Detail unter die Lupe, studierte die Funktionsweise von Rädern an Spielzeugautos, von Kreiseln oder Aufziehfiguren. Er beklopfte und befühlte die Formen und Oberflächen von Steinen, Ästen, Tassen, Löffeln und anderen Objekten. Es war schwer, Jan aus seiner Welt der Gegenstände zu locken, aber mit viel Geduld war es möglich. Ich musste mich zwar mit kurzen Momenten seiner Aufmerksamkeit zufriedengeben, bemerkte aber bald, dass er seine Umgebung aus dem Augenwinkel penibel überwachte und fast alles registrierte, was rund um ihn geschah. Erstaunlich rasch schöpfte er Vertrauen zu mir. Durch Gesten konnte ich ihm bis zu einem gewissen Grad klarmachen, was ich ihm mitteilen wollte. Er nahm im Auto Platz, wenn ich ihm die Türe öffnete und auf den Sitz deutete. Manchmal war es auch nötig, ihn behutsam hineinzuheben. Dagegen leistete er nie Widerstand, denn er wusste: Mein Auto fuhr immer zu den Bergen. Und er liebte die Berge.
Im Auto führte Jan mit seinen Händen monotone Bewegungen aus. Wenn ich ihn genau beobachtete, konnte ich darin interessante Bewegungsmuster erkennen, die sich wiederholten. Häufig gab er Laute in Form von Vokalen von sich, die je nach Stimmung freudig, aufgeregt, gedämpft, ruhig oder enttäuscht klingen konnten. Diese Laute waren ein Teil seiner Kommunikationsmöglichkeiten. Einmal fuhren wir mit einer Gondel auf den Schöckl, einen fast 1500 Meter hohen Berg nahe des Grazer Stadtrandes. Während der Bergfahrt zappelte und lautierte Jan aufgeregt – ganz offenkundig vor Freude. Er schlug mit seinen kleinen Händen gegen die Fensterscheibe, ohne sich dabei wehzutun. Es gefiel ihm, wie wir lautlos über die Baumwipfel den Hang hinaufglitten und das Grazer Becken auf dem Weg in die Natur hinter uns ließen. Er war wahrlich ein großer Bergfreund! Seine quirlige, zappelige Art wurde mir mit der Zeit immer vertrauter. Ich lernte, an seiner Körpersprache und an seinen Lauten abzulesen, in welcher Stimmung er sich befand, ob ihm etwas gefiel oder nicht, und was er mir gerne mitteilen wollte.
Am Gipfel angekommen, lief Jan sofort zu einem Naturspielplatz auf einer großen Wiese, setzte sich in eine Schaukel und zog meine Hand an den Rand des Sitzbretts. Dabei sah er mich nicht an, sondern behielt nur meine Hand im Fokus, als gehörte sie nicht zu einem Menschen. Er nutzte meine Hände wie Werkzeuge. Diese »Instrumentalisierung« ist eine typisch autistische Verhaltensweise. Der Begriff »Instrumentalisierung« bedeutet in diesem Zusammenhang, dass autistische Kinder sich in manchen Situationen so verhalten, als würden sie andere Menschen als Werkzeuge betrachten, die sie zu einem bestimmten Zweck einsetzen können. Für den »instrumentalisierten« Menschen kann sich das anfühlen, als werde er wie ein Objekt behandelt, nicht aber als soziales Gegenüber. Jan platzierte meine Hände immer dort, wo sie für ihn etwas erledigen sollten. Dazu musste er mich oft sogar an einen bestimmten Ort ziehen. Beispielsweise kam es vor, dass er mich bei sich zu Hause von der Eingangstüre in die Küche zog und dort meine Hand auf den Wasserhahn legte, weil er durstig war. Oder er schleppte mich in einem Geschäft zu einem bestimmten Regal und drückte meine Hand hinein, weil ich damit eine Süßigkeit aus dem Regal entnehmen sollte. Bei all dem blickte er mich nicht an. Ich würde aber dennoch nicht behaupten, Jan sei nicht in der Lage gewesen, in einen sozialen Austausch, eine Interaktion mit mir zu treten. Denn diese Abläufe waren ja soziale Interaktionen. Sie waren lediglich sehr ungewöhnlich – eben nicht der Norm entsprechend. Aber Jan interagierte mit mir in einem sozialen Sinn. Er zeigte mir an, wenn er mit mir über eine bestimmte Wiese den Hang hinunterlaufen wollte, indem er mich einfach dorthin zog und an meiner Hand loslief. Wollte er einen Tannenzapfen vom Baum haben, nahm er meine Hand und stieß sie nach oben in Richtung des Zapfens. Sobald meine Hand seinem Impuls folgte und nach dem Tannenzapfen griff, hüpfte er aufgeregt und voller Vorfreude zappelnd im Stand auf und ab. Bei diesen Instruktionen war er oft sehr beharrlich, manchmal auch forsch, bis ich verstanden hatte, was er von mir wollte.
Die autistische »Instrumentalisierung« anderer Menschen sollte nicht zu dem Fehlschluss führen, autistische Kinder würden in ihren Eltern oder anderen Mitmenschen so etwas wie Objekte sehen. Diese Annahme höre ich immer wieder. Sie trifft nach meiner Erfahrung aber nicht zu. Autistische Kinder interagieren auf ihre Weise mit anderen, eben auf eine »autistische« Weise, aber dennoch handelt es sich um eine Art der sozialen Interaktion, und ich war mir schon damals sicher, dass Jan den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Werkzeug sehr genau kannte, wenn auch manche Mitarbeiter in unserem Team der Auffassung waren, dass er diesen Unterschied möglicherweise nur bedingt wahrnehmen konnte.
Jan war ein Kind, das Gerüche liebte. Wenn wir auf unseren Wanderungen durch einen Wald gingen, setzte er sich oft auf den Boden und führte mit den Händen die duftenden Dinge der Natur zu seiner Nase: Humus, Laub, Zapfen, Äste, Rinde, Baumharz und so weiter. Je öfter Jan und ich gemeinsam zum Wandern fuhren, desto stärker wurde unser gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Wenn ich ihn abholte, zog er mich sofort zur Haustüre, wollte seine Schuhe und Jacke haben und wartete ungeduldig zappelnd vor dem Ausgang, um dann zu meinem Auto zu stürmen, sobald wir draußen waren. Ich versuchte nach und nach, mehr Blickkontakt zu ihm aufzubauen. Beispielsweise befolgte ich seine Anweisungen mit den Händen nicht mehr prompt, sondern signalisierte ihm, dass er mich zuerst anschauen solle, um von mir etwas zu bekommen. Im Laufe der Zeit fing er an, mir während seiner Instruktionen auffordernd in die Augen zu blicken – zuerst nur für Momente, doch allmählich immer länger. Die »Instrumentalisierungen« fühlten sich für mich zunehmend wie »echte« soziale Interaktionen an. Dass Jan die Berge und die Natur so sehr mochte, kam uns beiden entgegen. Draußen gab es für ihn immer etwas zu erkunden und zu entdecken – und damit auch jede Menge Anlässe, mit mir in sozialen Kontakt zu treten und bestimmte Handlungen und Unterstützungen von mir einzufordern. Auch meine eigene Aufmerksamkeitsspanne war durch die natürliche Umgebung, in der ich mich äußerst wohlfühlte, erhöht. Wären wir den ganzen Tag im Haus geblieben, wäre ich viel schneller ermüdet als bei unseren Wanderungen. Denn Jan konnte mich ganz schön auf Trab halten.
Der kleine Junge, der mir in seinem autistischen »Paralleluniversum« so schwer erreichbar schien, wuchs mir sehr ans Herz. Im Laufe der Zeit besuchte ich ihn auch in meiner Freizeit. Ich lernte immer besser, auf seine zaghaften Zeichen und unscheinbaren Gesten zu achten, um zu verstehen, was er wollte. Gleichzeitig gab er mir immer häufiger zu erkennen, dass er mich als Freund wahrnahm. Ich war mit meinen Gedanken auch außerhalb meines Dienstes oft bei ihm, fragte mich, wie es ihm wohl gerade gehen mochte. Es war eine berührende Erfahrung, Schritt für Schritt Zugang zu Jans Welt zu finden. Wer sich auf ihn einließ, machte mit seinem wachen Geist Bekanntschaft, der die Welt einfach ganz anders betrachtete als wir »Normalen«. Die Zeit mit Jan war kostbar und lehrreich.
Samantha
Samantha war ein äußerst stilles, ernstes und zurückgezogenes Mädchen. Ihre Eltern sagten, dass ihnen bis zu Samanthas fünftem Geburtstag wenig Ungewöhnliches an ihr aufgefallen war, außer dass sie ein exzessives Interesse an der Toilettenspülung entwickelte, die sie am liebsten jeden Tag von früh bis spät betätigt hätte, um dem Wasser dabei zuzusehen, wie es den Abfluss hinunterlief. Dass Samantha schon früh von Autos begeistert war, fand niemand seltsam. »Wir waren sogar ein wenig stolz darauf, dass unsere Tochter sich für Technik interessierte. Sie wollte alles über Autos wissen«, erzählte mir Samanthas Mutter. Auch Samanthas Sprache entwickelte sich normal, sie war sogar äußerst redegewandt. Doch als im Alter von fünf Jahren die Konflikte mit anderen Kindern häufiger wurden, suchten die Eltern psychologische Unterstützung für ihre Tochter. Samantha hatte keine Freunde und zog sich immer mehr aus ihrem sozialen Umfeld zurück. Im Kindergarten sonderte sie sich ab, und auch in privaten Spielgruppen beschäftigte sie sich stets alleine – meistens mit Spielzeugautos.
Samantha redete oft ausufernd lange über ihre Interessen und bemerkte nicht, wenn auch andere etwas sagen wollten. Ihr Gesprächsstoff engte sich zunehmend auf Autos und Automarken ein, die sie fast alle kannte. Natürlich sammelte sie Autobücher, Autokarten und Modellautos, die sich in ihrem Zimmer stapelten. Samanthas zwei Jahre älterer Bruder Thomas kam mit der manchmal etwas schroffen Art seiner Schwester meist gut zurecht und konnte sich, wenn nötig, dagegen wehren. Jedoch stand die Familie vor dem Problem, dass immer mehr Eltern aus Thomas’ Freundeskreis ihre Kinder nur noch dann zu Besuch kommen lassen wollten, wenn Samantha nicht zu Hause war. Das verletzte natürlich auch die Gefühle ihrer Eltern. Die Erzieherinnen beklagten sich bei Samanthas Eltern über ihre »provokative Art« und »fehlende Teilnahme«, wie sie es nannten. Samantha habe beispielsweise andere Kinder grundlos beschimpft und scheinbar gezielt zum Weinen gebracht. Sie habe die entsetzten und emotional verzerrten Gesichter offenbar interessant oder lustig gefunden, musste über die emotionalen Reaktionen, die sie hervorgerufen hatte, häufig sogar lachen.
Dieses Verhalten beobachtete ich später noch bei anderen autistischen Kindern und Jugendlichen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass es diesen Kindern generell schwerfällt, menschliche Mimik und Körpersprache zu deuten. Es wäre also denkbar, dass Samantha extreme, aber eindeutige Emotionen erleben wollte, weil sie diese besser interpretieren und zuordnen konnte. Außerdem ist damit die Erfahrung verbunden, dass das eigene Verhalten sich auf die Stimmung anderer Menschen auswirkt, wenn auch häufig im negativen Sinne. Aber gerade negatives Feedback kann intensiv und deutlich ausfallen. Autistische Kinder müssen oft erst mühsam lernen, dass auch andere Menschen eine subjektive Innenperspektive haben, die von ihrer eigenen getrennt ist. Jeder Mensch fühlt unabhängig. Autisten haben meistens erheblich mehr Schwierigkeiten als andere, das zu verstehen. Die emotionale Provokation könnte eine Art soziales Experimentieren darstellen. Das ist allerdings keine wissenschaftlich überprüfbare Aussage, sondern eine Vermutung, die ich auf der Basis meiner Kontakte zu Kindern mit Autismus aufgestellt habe. Autisten fordern uns zum »Andersdenken« heraus, wenn wir sie verstehen möchten.
Nichtsdestotrotz ist natürlich nachvollziehbar, dass Samanthas Verhalten den Eltern anderer Kinder – ob nun im Freundeskreis oder im Kindergarten – nicht behagte und dass sie daher versuchten, den Kontakt ihrer Kinder zu Samantha zu reduzieren. So entstand eine Art »Teufelskreis« aus sozialer Ausgrenzung und provokativem Verhalten. Das eine befeuerte das andere.
Kurz vor Samanthas sechstem Geburtstag wurde dann die Diagnose »Asperger-Syndrom« gestellt. Das ist, sofern man der Klassifikation in gängigen Lehrbüchern folgt, eine milde Form des Autismus, bei der sich die Betroffenen in der frühen Kindheit oft unauffällig entwickeln – wie das auch bei Samantha der Fall gewesen war. Deswegen wird das »Asperger-Syndrom« vom »frühkindlichen Autismus« abgegrenzt. Es tritt typischerweise erst nach dem dritten Lebensjahr in Erscheinung. Auch diese Abgrenzung ist mittlerweile umstritten. Wie bereits angekündigt, werde ich auf die Probleme bei der Diagnostik noch zurückkommen.
Für Samanthas Mutter und Vater war die Diagnose »Asperger-Syndrom« eine Erleichterung, wie sie mir versicherten. Denn sie konnten nun endlich begreifen, warum ihre Tochter in vielen sozialen Belangen Probleme hatte, sich absonderte und ausgegrenzt wurde. Dieses Wissen machte es ihnen leichter, sich von Schuldzuweisungen aus dem sozialen Umfeld abzugrenzen. Eltern autistischer Kinder stehen oft unter dem unbegründeten Verdacht, die Verhaltensauffälligkeiten durch mangelhafte Erziehungskompetenzen »verursacht« zu haben.
Samanthas Eltern sahen in der Diagnose jedoch vor allem auch einen konkreten Ansatzpunkt, um ihrer Tochter durch gezielte Förderung beim Aufbau sozialer Kompetenzen zu helfen und ihr das Leben dadurch zu erleichtern. Die Diagnose erklärte auch, warum Samanthas Interessen auf wenige Gebiete beschränkt waren – insbesondere auf Autos – und weshalb sie sich in diesen Bereichen verblüffende Kompetenzen angeeignet hatte, die nicht ihrer Altersgruppe entsprachen.
Ich lernte Samantha kennen, als sie acht Jahre alt war – mehr als zwei Jahre nach der Diagnose. Um ein Vertrauensverhältnis zwischen uns entstehen zu lassen, besuchte ich sie zunächst zu Hause. In dieser Zeit befassten wir uns fast ausschließlich mit Autos. Samantha wollte es so. Sie konnte zu jedem Modellauto und jedem Foto in ihrer Sammlung das Baujahr sowie einige technische Angaben wie PS-Zahl oder Hubraumvolumen nennen. Besonders wichtig war ihr die Antriebsweise. Sie wusste von jedem Modell, ob es sich um ein Fahrzeug mit Hinterrad-, Vorderrad- oder Allradantrieb handelte. Ihre hohe Treffsicherheit bei diesen Angaben erstaunte mich. Doch Samantha hatte sichtlich Schwierigkeiten damit, zu erkennen, wenn auch ich mich gerne zu Wort melden oder ihr eine Frage stellen wollte. Sie schien in ihre Monologe manchmal geradezu »versunken« zu sein. Nicht ohne Grund wird das »Asperger-Syndrom« im englischsprachigen Raum auch als »Little Professor Syndrome« bezeichnet. Es war für Samantha schwer, während einer Unterhaltung festzustellen, wann sie und wann der andere »an der Reihe« war. Wenn wir miteinander sprachen, sah sie mir fast nie in die Augen, sondern senkte ihren Blick.
Nach einiger Zeit unternahmen wir kleine Spaziergänge rund um das Haus. Samantha und ihre Familie wohnten am Stadtrand in der Nähe eines kleinen Flusses mit einem Stadtwanderweg. Zu Beginn kamen wir nicht weit, denn Samantha war von den vorbeifahrenden Autos in Anspruch genommen. Ich stellte fest, dass ihr Wissen über technische Fahrzeugdetails weit über ihre Modellautosammlung hinausging. Meinem Eindruck zufolge ging es ihr nicht darum, von mir Lob für ihre Kenntnisse zu erhalten. Viel wichtiger schien es ihr, bloß keinen Wagen vorbeifahren zu lassen, ohne zumindest die Marke zu identifizieren. Und sie strebte danach, ihr gesammeltes Fahrzeugwissen ständig zu erweitern. Selbst wenn es uns gelang, bis ans Ufer des Flusses zu kommen, schwärmte Samantha noch von den zuvor gesehenen Autos. Sie liebte das Škoda-Logo, den grünen Vogelkopf. Und einmal sahen wir auf dem Weg zum Fluss einen Dodge am Straßenrand stehen. Samantha war völlig begeistert von dem silbernen Kopf eines Widders mit mächtigen Hörnern, der vorne auf der Motorhaube als dreidimensionales Ornament angebracht war. Sie sprach während des gesamten Spaziergangs von diesem Auto. Bei meinem nächsten Besuch konnte sie mir genaue Angaben zu PS-Zahl und Hubraum des Wagens machen. Ich erfuhr außerdem, dass es sich um einen Fünfzylindermotor handelte und dass der Dodge über einen Allradantrieb verfügte. Alle Angaben hielten einer Überprüfung stand.
Vielleicht gab das Autothema Samantha während unserer Begegnungen auch Sicherheit. Wenn ich versuchte, das Thema zu wechseln, schwieg sie oft oder hüpfte leichtfüßig davon. Sie war sehr geübt darin, ihre Sinne scheinbar auf »Durchzug« zu schalten. Ich hatte den Eindruck, dass es ihr schwerfiel, sich auf die Unwägbarkeiten eines echten Dialogs einzulassen. Doch eines Tages fanden wir ein neues Gesprächsthema. Ich bemerkte gegenüber Samantha, dass die Bäume, die entlang des Flusses wuchsen, ebenfalls so etwas wie »Markenzeichen« trugen, ganz ähnlich wie die Autos. Damit weckte ich ihr Interesse. Daraufhin erklärte ich ihr, dass man an den Formen der Blätter und an den Mustern der Baumstämme genau erkennen konnte, um welchen Baum es sich handelte, genau wie bei einem Fahrzeug. Mit diesem Trick gelang es mir, Samanthas Aufmerksamkeit auf die Bäume zu lenken. Ich zeigte ihr die Erkennungsmerkmale von Buche, Eiche, Birke, Ahorn, Esche, Eibe und Fichte. Das waren die Arten, die wir bei unserem Spaziergang fanden. Später weiteten wir unsere Ausflüge aus und gingen meist über eine Brücke in einen Wald am anderen Ufer. Dort fanden wir noch mehr Baumarten.
Eines Tages erzählte mir Samantha, dass sie Hunde mochte. Mir kam die Idee, ab und zu mit ihr gemeinsam einen Hund durch den Wald zu führen. Ihre Eltern waren einverstanden. In der Nähe ihres Wohnhauses befand sich ein Tierheim, in dem unzählige Tiere auf Aufmerksamkeit und Zuwendung warteten. Ich wählte einen ruhigen und einfühlsamen Hund aus, den wir von nun an auf unsere Spaziergänge am Fluss und im Wald mitnehmen wollten. Es war ein Beaglerüde mit herzerwärmendem »Dackelblick« und Figurproblemen, wohl wegen des Bewegungsmangels. Samantha freundete sich von Mal zu Mal mehr mit dem Beagle an, den sie bald »Jimny« taufte.
Bei einem meiner nächsten Besuche erzählten mir ihre Eltern, dass sie an den Tagen, an denen ich sie abholen kam, immer sehr aufgeregt war und es kaum erwarten konnte, Jimny an der Leine zu führen. Über Autos sprachen wir weiterhin sehr häufig, aber wir hatten jetzt außerdem die Bäume und unseren vierbeinigen Begleiter als Gesprächsstoff. Jimny war ein lieber, genügsamer Hund, und er war sichtbar glücklich mit uns im Wald. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er mit der Zeit schlanker wurde. Es war eine Win-win-Situation für alle. Durch sein quicklebendiges und lustiges Hundewesen heiterte Jimny Samanthas Gemüt auf, versetzte sie in eine aufgeschlossene Stimmung und beruhigte sie.
Was die Wissenschaft sagt
Autismus und die Begegnung mit Tieren
Mehrere wissenschaftliche Studien über die sogenannte tiergestützte Therapie aus den vergangenen drei Jahrzehnten zeigten, dass die Interaktion mit Hunden die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten autistischer Kinder verbessert und zu einer deutlichen Reduktion von Stress und Anspannung führt.3 Der Psychologieprofessor Aubrey Fine an der polytechnischen California State University, der weltweit als Experte für tiergestützte Therapie bekannt ist, schrieb: »Individuen mit Störungen aus dem Autismus-Spektrum sind im Vergleich zu nicht-autistischen Menschen weniger bewandert im Erkennen von Absichten. Tiere, vor allem Hunde, kommunizieren ihre Verhaltensabsichten auf einfachere Weise an Autisten. Diese Kommunikation zu fördern ist eine pädagogische Chance, soziale Signale und Interaktionen einzuüben.«4