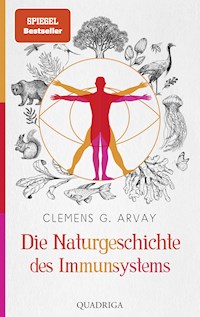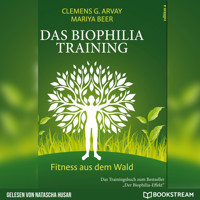Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Biologische Lebensmittel liegen im Trend, die Umsätze steigen jährlich. Den größten Teil des Kuchens sichern sich in Österreich mittlerweile die Handelsmarken der großen Supermarktkonzerne wie REWE (Billa & Co.), SPAR und HOFER. Was steckt aber wirklich hinter deren Bio-Handelsmarken? Ausgehend von den vollmundigen Versprechen der Werbung macht sich der Agrarbiologe Clemens G. Arvay in Wallraff-Manier auf die Suche nach der Realität. Anstatt auf idyllische Bio-Bauernhöfe und glückliche Schweinchen stößt er auf Tierfabriken, endlose Monokulturen und industrialisierte Landwirtschaft. Begleiten Sie den Autor auf seiner Reise durch den biologischen Massenmarkt und erleben Sie hautnah, was Sie nie hätten erfahren sollen, wenn es nach den Lebensmittelkonzernen ginge. Clemens G. Arvay zeigt aber auch echte Bio-Alternativen auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es war einmal ein riesiger gütiger Lebensmittelkonzern,der wollte nur das Beste für die Menschen und unsere Umwelt.
INHALT
Vorwort
Der Bio-Boom und wer davon profitiert
Wie ich zum Ökolandbau kam
Der BioTM-Pionier und das »traditionelle Bäckerhandwerk«
Das große Gackern im Todeskarussell
Mogelpackung BioTM
Information oder noch mehr mogeln?
Cyborgs in der Bio-Branche
Vom Schweigen der Lämmer
Die Geschichte des Ökolandbaus
Ökolandbau in den falschen Händen?
Von echten Bio-Pionieren
Der Weg zum aktiven Bio-Konsumenten
Rede und Antwort!
Danksagung
Anmerkungen
Lust auf mehr?
Wer und Wo?
Vita
Impressum
VORWORT
(Univ.-Doz. Dr. Peter Weish)
Vor rund zehntausend Jahren gingen sowohl in Eurasien als auch in anderen Regionen der Erde nomadische Völker vom Jagen und Sammeln zur Landwirtschaft über und wurden sesshaft. Jäger und Sammler, die einen relativ kleinen Anteil der natürlichen Ressourcen nutzen, finden nur bei geringer Bevölkerungsdichte ausreichend Nahrung. Bevölkerungszunahme zwang sie dazu, artenreiche Lebensräume in Kulturland umzuwandeln, auf dem sie ihre Nutzpflanzen anbauten und ihre Haustiere hielten. Wälder wurden gerodet und deren fruchtbare Böden als Acker- und Weideland genutzt. Mit wenigen Ausnahmen, wie in Ägypten, kam es früher oder später zu Bodenerosion, Verkarstung und Versteppung. Der Untergang vieler Kulturvölker steht in Zusammenhang mit der Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit. Dass die Zukunft der Menschheit von der Verfügbarkeit fruchtbaren Bodens abhängt, scheint vielen nicht bewusst zu sein. Wie wäre es sonst möglich, im Rahmen der industriellen Landwirtschaft weltweit weiterhin Raubbau am Boden zu betreiben? Zu den schlimmsten Formen zählen riesige Monokulturen der »Grünen Revolution« und »Grünen Gentechnik«, die permanent mit Bioziden behandelt werden. Bodenkultur sieht anders aus! Im Gegensatz dazu erkannten ökologisch wirtschaftende Bauern schon vor Jahrzehnten, dass ein lebendiger, humusreicher Boden die Voraussetzung gesunder Pflanzen ist. Gegen vehementen Widerstand seitens der konventionellen Landwirtschaft hat sich die »biologische« Wirtschaftsweise in vielen Varianten nicht nur behauptet, sondern auch bewährt. Aber auch angesichts der absehbaren Verknappung und Verteuerung fossiler Energieträger ist die extrem erdölabhängige industrielle Landwirtschaft nicht zukunftsfähig.
Neben einer »Energiewende« ist es notwendig, eine »Agrarwende« einzuleiten, die als oberstes Ziel eine angepasste Landbewirtschaftung im Einklang mit Mensch, Tier und Umwelt anstrebt. Die Idee des Ökolandbaus verbindet dieses Ziel mit der Kultur einer reichen Vielfalt an Nutzpflanzen und Nutztierrassen. Die Weiterentwicklung lokal angepasster Kulturmethoden ist die Basis zukunftssicherer Ernährungssouveränität. Mit dem ökologischen Landbau ist in den letzten Jahrzehnten auch das Bewusstsein über gesunde Ernährung gewachsen. Der Einstieg der großen Handelsketten in die Vermarktung hat zwar einerseits den Zugang zu Bio-Produkten erleichtert und die Nachfrage erhöht, anderseits aber die ökologische Landwirtschaft neuen Zwängen unterworfen.
Clemens G. Arvay zeigt auf, dass »Bio« in den Händen der mächtigen Handelskonzerne mit wesentlichen Prinzipien der ökologischen Landwirtschaft nicht in Einklang steht und ihre Zukunft gefährdet. Massenproduktion und die damit verbundenen ökonomischen Zwänge führen zu einem Bio-Kleinbauernsterben und tragen zur Verarmung der Sortenvielfalt sowie zu einer Verwässerung der ursprünglichen Anforderungen des Ökolandbaus bei.
Arvays an vielen gut recherchierten Beispielen vorgetragene Kritik kommt aus einem umfassenden ökologischen Wissen und seine Motivation entspringt der Verantwortung zur Bewahrung und Weiterentwicklung biokultureller Vielfalt als tragfähige Basis zukunftsfähiger Landwirtschaft und Ernährung. Der Autor führt uns mit seiner lebendigen Schilderung durch den vielfältigen Bereich der Bio-Produktion und Bio-Vermarktung, wobei die Aussagen der Beteiligten klar vermitteln, wo die Zukunftschancen für ökologisch wirtschaftende Bauern liegen und wie diese seitens der Konsumenten unterstützt werden können. Ich erwarte, dass dieses wichtige Buch dazu beiträgt, Fehlentwicklungen zu überwinden und die ökologische Landwirtschaft nachhaltig zu stärken.
Dr. Peter Weish,
Universitätsdozent für Ökologie und Umweltethik an der Universität Wien sowie an der Wiener Universität für Bodenkultur
(November 2011)
Der Bio-Boom und wer davon profitiert
Eine Einführung
Bio boomt – im Supermarkt
Die Bio-Branche in Österreich ist eine Milliarde Euro schwer1. Im Jahr 2010 gaben Privathaushalte für Bio-Produkte um sechzig Prozent mehr aus, als fünf Jahre zuvor2. Der Markt für biologische Lebensmittel wächst. Mehr noch: Er boomt! Bio ist in. Bio ist ökologisch, nachhaltig und fair. Wer Bio-Lebensmittel kauft, tut dies mit reinem Gewissen. Doch Bio ist vor allem eines, nämlich ein großes Geschäft für Lebensmittelkonzerne, die ansonsten mit ökologischen Produkten nicht viel am Hut haben. Das Geld, das von Haushalten im Jahr 2010 beim Bio-Einkauf ausgegeben wurde, gelangte zu 91,5 Prozent in die Taschen herkömmlicher Supermarktkonzerne oder Lebensmitteldiscounter. Die verbleibenden 8,5 Prozent mussten sich die österreichischen Bio-Fachgeschäfte untereinander teilen, also die Bio-Läden und Reformhäuser. Somit ist der Löwenanteil des Bio-Marktes inzwischen in den Händen der größten Lebensmittelkonzerne des Landes. Der Bio-Boom unterwirft den Ökogedanken den Gesetzen des Massenmarktes. Heute, am Beginn des dritten Jahrtausends, begegnen uns die »Bio-Pioniere« und »wahren Bioniere« nicht etwa in der Ökolandbaubewegung, sondern im herkömmlichen Supermarkt und beim Discounter. Bio ist ihr Business geworden, ihr Markenzeichen: BioTM!
Bio als Marketingtool?
Supermärkte und Discounter rühren kräftig die Werbetrommel. Sie sind beides: Auslöser sowie Nutznießer des Bio-Booms. Weil sie in den Medien stark präsent sind und großen Aufwand für den Aufbau ihres Bio-Images betreiben, fasse ich sie unter dem Begriff
BioTM
zusammen3. Um die Lesbarkeit zu verbessern, verzichte ich im Text auf die ständige Nennung des Trademark-Zeichens (TM) hinter dem Begriff »Bio«.
Die BioTM-Protagonisten
Bio-Handelsmarke
Konzernzugehörigkeit
erhältlich bei
Ja!Natürlich
Rewe AG
Billa, Merkur, Adeg, AGM, Sutterlüty, BIPA
Zurück zum Ursprung
Hofer KG
(ALDI Österreich)
Hofer
Natur*pur
Spar AG
Spar, Interspar, Eurospar, Spar Gourmet
Echt B!o
Rewe AG
Penny
Natürlich Für Uns
Pfeifer-Gruppe
Nah&Frisch, Zielpunkt, Unimarkt
Natur Aktiv
Hofer KG
(ALDI Österreich)
Hofer
BioTrend
Lidl GmbH
Lidl
Übersicht der Bio-Marken von Supermarkt- und Discountkonzernen in Österreich
Die Bio-Marken mit der größten öffentlichen Präsenz sind Ja!Natürlich (Rewe), Zurück zum Ursprung (Hofer) und Natur*pur (Spar). Diese drei Handelsmarken teilen sich den Löwenanteil des Bio-Massenmarktes in Österreich.4 Man könnte auch sagen: Die drei sind förmlich der Massenmarkt für Bio-Lebensmittel. Sie haben ihn in der Hand. In den Medien sind sie im Vergleich zu allen anderen Bio-Marken Österreichs herausragend stark präsent und rühren pausenlos ihre Werbetrommeln. Dies schlägt sich im Bekanntheitsgrad der drei Bio-Marken nieder. Umfragen zum Wiedererkennungswert von Eigenmarken des herkömmlichen Lebensmitteleinzelhandels haben gezeigt, dass Ja!Natürlich, Zurück zum Ursprung und Natur*pur in der Öffentlichkeit besonders gut positioniert sind, während alle anderen Bio-Marken weit abgeschlagen bleiben. Weil die drei genannten Handelsmarken den Bio-Massenmarkt dominieren, sind sie in diesem Buch die Hauptdarsteller. Ihre Produktions- und Zulieferbetriebe werden ebenfalls unter die Lupe genommen, sodass es zu einer repräsentativen Abdeckung des Bio-Massenmarktes in Österreich kommt. Andere Bio-Marken, deren Marktanteil und öffentliche Präsenz derzeit noch sehr gering sind, werden peripher mit behandelt.
Reality Check! – Darum geht’s in diesem Buch
Wie sorgfältig gehen herkömmliche Supermärkte und Discounter mit der Bio-Idee um? Ist diese Realität mit den Vorstellungen und Erwartungen der Bio-Konsumentinnen und Bio-Konsumenten vereinbar? Der zentrale Dreh- und Angelpunkt für dieses Buch ist die öffentliche Selbstdarstellung der Konzerne. Das trifft sich vorzüglich mit der Wahl der Hauptdarsteller, denn keine andere Bio-Marke hierzulande betreibt so exzessiv Werbung wie Ja!Natürlich, Zurück zum Ursprung und Natur*pur. Blicken Sie mit mir gemeinsam hinter die Kulissen einer perfekt inszenierten Werbewelt.
Begleiten Sie mich auf eine Reise durch das Universum des Bio-Massenmarktes, der Goliaths der Lebensmittelbranche. Lassen Sie sich in eine Parallelwelt mitnehmen, die uns normalerweise verschlossen bleibt ... außer wir sind frech genug, einfach durch die Tür hineinzuplatzen. Genau das habe ich getan.
Ausgaben für Bio-Frischprodukte (exkl. Bio-Brot) im Jahr 2010 durch österreichische Privathaushalte5
Wiedererkennungswert der drei Protagonisten des Bio-Massenmarktes im Vergleich6(So viele Menschen in Österreich kennen die jeweilige Marke)
Wie ich zum Ökolandbau kam
Ein persönlicher Rückblick
»Ich für meinen Teil verlange überhaupt von jedem Autor, dass er einfach und aufrichtig auch aus seinem eigenen Leben erzähle, und nicht nur davon, was er über das Leben anderer erfahren hat.«7
(Henry David Thoreau, Philosoph und Schriftsteller, 1817–1862)
Kindheitserinnerungen
Als ich ein Kind war – das war in den 1980er-Jahren –, lebte mein Großvater in einer Holzhütte, umringt von grünen Wäldern und Wiesen, Fischteichen und Bergen. Nicht weit von dem Häuschen entfernt, gab es eine Stelle in einem versteckten Graben, an der drei Wildbäche ineinanderliefen und sich zu einem kleinen Fluss vereinten. Deswegen nannte man diesen Ort »Dreibach«.
Die Hütte meines Großvaters bot ein bescheidenes, aber gemütliches Zuhause. Sie stand an einem Hang, leicht erhöht auf steinernem Fundament. Die dunkel verfärbten Holzstiegen im Haus knarrten jedes Mal laut, wenn jemand über sie hinwegschritt. Manchmal knarrten sie auch ohne erkennbaren Grund. Die Treppe führte in das Dachgeschoss, in dem sich ein Schlafzimmer befand, dessen Holzwände von malerischen Landschafts- und Pflanzendarstellungen geschmückt waren. In einer Ecke am Kamin lag stets ein Buch auf dem Tischchen, das alle giftigen sowie essbaren Pilze beschrieb, die in den umliegenden Wäldern wuchsen. Meinem Großvater, einem begeisterten Förster, war der Wald zum zweiten Zuhause geworden.
Mir sind meine kindlichen Erkundungen des Landlebens, gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern aus der Region, in lebhafter Erinnerung geblieben: meine Traktorfahrten – als Beifahrer, versteht sich – und meine abenteuerlichen Besuche in Kuhställen oder in dem alten Forsthaus an einer Waldlichtung. Manchmal durfte ich in Bauerngärten bei der Gemüseernte helfen oder sorgsam Bohnen in die Erde aussäen. Ab und zu fütterte ich Hühner. Ich werde den Tag nie vergessen, an dem ich zum ersten Mal beim Scheren der Schafe des Nachbarbauern dabei war. Auf dem Hof lebten auch Milchkühe und die Familie bewirtschaftete ein Stück Wald. Es gab manchmal Wolle und Fleisch, und immer gab es ausreichend Milch, die im nächsten größeren Dorf verkauft wurde – in einem angestammten Bauernladen, der schon seit Generationen in Familienbesitz war. Das Geschäft bestand aus einem einzelnen Verkaufsraum und wurde von Landwirtinnen und Landwirten aus der Region beliefert. Es war meistens das erhältlich, was gerade Saison hatte. Es gab Bauernbrot und Milch, Butter und Käse, Eier und Würste, Frischfleisch auf Bestellung, Getreide, Mehl und Sämereien, Kräuter, Säfte, Eingemachtes und Schnäpse. Natürlich gab es auch Gemüse und Obst. Erdbeeren, Himbeeren und ähnliche Köstlichkeiten waren immer dann zu haben, wenn sie hierzulande gerade geerntet werden konnten. Bananen, Kiwis, Orangen oder Zitronen gab es nie. Doch es fehlte das ganze Jahr über an nichts, um die Kundschaft gebührend zufriedenzustellen. Als ich in diesem Bauernladen in den 1980ern die wild durcheinandergewürfelten Düfte der ländlichen Lebensmittel wahrnahm und staunend vor den gefüllten Getreidesäcken stand, die so hoch wie ich selbst waren, wusste ich nicht, dass dieser Typus von Kaufladen, der mir so großes Vergnügen bereitete, hierzulande schon bald der Vergangenheit angehören würde. In der verlassenen Gegend an den drei Bächen, an denen mein Großvater lebte, gewann ich meine ersten, kindlich-naiven Eindrücke vom Bauernleben.
Das große Wachsen
Der Bauernladen an den drei Bächen ist und bleibt eine romantische Kindheitserinnerung und auch in den 1980er-Jahren war diese regionale Art der landwirtschaftlichen Vermarktung längst nicht mehr als Prototyp anzusehen. Doch immerhin: Vereinheitlichung und Zentralisierung des Lebensmittelhandels waren nicht so weit fortgeschritten, wie dies heute der Fall ist. Sogar in Europas Städten konnte man damals noch in kleinen Greißlergeschäften einkaufen, die viele von uns aus Kindheitstagen kennen und die man in Deutschland und der Schweiz als »Tante-Emma-Läden« bezeichnet. Noch gegen Ende der Achtziger investierte ich mein Taschengeld regelmäßig in Kaugummi und Schokolade, die ich mir gemeinsam mit anderen Kindern bei einem Greißler am Stadtrand von Graz kaufte, wo ich aufwuchs. Der bereits in die Jahre gekommene Besitzer saß oft selbst an der Kassa, häufig bediente er Kunden hinter der Feinkostvitrine und murmelte dabei die üblichen Kaufmannsphrasen in seinen grauen Krausebart: »Noch einen Wunsch, gnädige Frau?« oder »Darf´s ein bisserl mehr sein, mein Herr?« Der von jeglicher Konzernzentrale unabhängige Handelsmann war frei genug, seine Lieferanten selbst auszuwählen oder sogar direkt bei Landwirten aus dem städtischen Umland zu bestellen. Vielleicht war er einer der letzten seiner Spezies.
Am Übergang in die Neunziger änderte sich etwas. Es gab viele große Bauvorhaben in der Stadt und unser Greißler am Eck sperrte zu, ein neuer Besitzer versuchte sein Glück und scheiterte binnen weniger Monate. Dann kam, nach einer kurzen Pause, in der das Lokal leer stand, ein dritter. Der Laden lief nun ein paar Jahre, in denen über dem Eingang ein großes Schild mit der Aufschrift »Adeg« prangte. Diese Handelskette war schon gegen Ende der 1920er-Jahre als Einkaufsgenossenschaft selbstständiger Kaufleute in Österreich gegründet worden. Inzwischen wurde Adeg allerdings vom Rewe-Konzern geschluckt, ist also nun die »kleine Schwester« von Billa, Merkur, Penny, AGM und Bipa. Der neue Kaufladen am Eck hielt etwa bis in die Mitte der Neunziger durch, dann machte er endgültig dicht und niemand versuchte es seither dort mit einer Neueröffnung. Stattdessen nahm eine Supermarktkette in unserer Wohngegend eine weitere Filiale in Betrieb und ein zweiter Greißler schloss seine Pforten für immer, ebenso wie der Besitzer eines kleinen Gemüseladens. Diesem Beispiel folgten in den Jahren darauf eine angestammte Bäckerei, ein Fleischermeister und ein Feinkostladen. Sie alle gehören der Vergangenheit an. Dafür aber wuchs die neue Supermarktfiliale, indem man ausbaute und die Verkaufsfläche deutlich vergrößerte. Ebenfalls im Laufe der 1990er befand ich mich als Teenager in einer Handwerkslehre zum Buchbinder. Meinen Lehrabschluss konnte ich gerade noch machen, bevor unsere traditionsreiche Buchbinderei schließen musste. Bücher wurden schon längst automatisiert in industriellen Buchstraßen hergestellt, in denen man keine Buchbinderinnen und Buchbinder mehr einstellte, sondern sogenannte Maschinenführer. Kleine Handwerksbetriebe hatten es unter dem Druck der Großen zusehends schwerer. Mit ihnen wurde auch ihr Wissen und Können rund um alte Buchbindetechniken immer seltener. Meine Qualifikation als Handbuchbinder hätte mich in keine allzu rosige Zukunft geführt. Doch die Entscheidung für ein naturwissenschaftliches Studium war ohnedies schon gefällt. Mein Interesse an natürlichen Kreisläufen und ökologischer Landwirtschaft begann in dieser Zeit rapide zu wachsen und außerdem stieß ich damals auf einen alten Bio-Laden, der später zu meinem Stammgeschäft wurde.
Aufwachen
Im Jahr 1993, als ich dreizehn war, kam mir ein Buch über die Fleischindustrie in die Hände.8 Manfred Karremann, ein mehrfach ausgezeichneter Journalist, zeigte auf authentische und eindrucksvolle Weise, dass die Wirtschaftstrends der Industrialisierung und der Zentralisierung auch vor der landwirtschaftlichen Tierhaltung nicht haltgemacht hatten. Die Folge waren Intensivtierhaltung, Massentiertransporte und das Ende des Bauerntums. An dessen Stelle trat eine neue Vertragslandwirtschaft unter der Schirmherrschaft expandierender Handelskonzerne. Die schrecklichen Impressionen aus der Massenproduktion von Tieren trafen mich damaligen Dreikäsehoch hart. Weshalb hielt man diese Zustände von uns Konsumentinnen und Konsumenten fern? Wieso wusste niemand, wie unser Fleisch produziert wurde? Und weshalb hingen über den Fleischtheken der Supermärkte Bilder von Rindern auf grünen, saftigen Wiesen und glücklichen Hühnern am Bauernhof statt Abbildungen aus der Realität?
Auf Eierverpackungen hätte man Fabriken zeigen sollen, in denen Küken auf Fließbändern durch die Hallen jagen und männliche Jungtiere – automatisch und ganz nach Roboterart – zu Mus geschnetzelt werden, weil sie keine Eier legen können. Man hätte anstatt der werbewirksamen Bauernhofidylle besser Fotos von Tieren präsentiert, die im rasenden Akkord am Fließband dahingeschlachtet werden. Diese bitteren Wahrheiten entfachten nachhaltig mein Interesse an der Herkunft unserer Lebensmittel.
Es gab noch viel zu lernen und zu erfahren. Die nächsten Jahre verliefen vorerst ohne große Fortschritte. Ich war zu sehr mit der anstrengenden Aufgabe beschäftigt, ein Teenager zu sein, als dass ich mich ausführlich mit den Hintergründen der Lebensmittelwelt hätte beschäftigen können. Erst mit achtzehn, als ich an der Kippe zum Erwachsenwerden stand, erwachte mein Wissensdrang aufs Neue. Ich wusste nicht, dass ich bald alle meine Vorstellungen, die ich von Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung hatte, endgültig über Bord würde werfen müssen. Ich las mehrere Bücher über Ökologie und Agrarkunde, über die Probleme des Bauernstandes und den Druck, der auf diesem seitens des Handels und der Industrie lastete. Als ich »Der stumme Frühling« von Rachel Carson las – ein Buch über die verheerenden Folgen des landwirtschaftlichen Pestizideinsatzes für Mensch und Umwelt –, war ich schockiert darüber, dass dieses Werk bereits in den 1960er-Jahren erschienen war und die Problematik dennoch unter den Konsumentinnen und Konsumenten so wenig bekannt war. Wir kauften dies, wir kauften jenes, kaum jemand wusste, wie unsere Nahrung eigentlich produziert wurde. Die meisten Menschen hatten zum Beispiel keine Ahnung über die Herkunft unserer Milch, außer, dass sie in Getränkekartons abgefüllt wurde, die alle dieselbe Form hatten – unter welchem Markennamen auch immer man die Milch kaufte. Auch Butter und viele andere Lebensmittel trugen längst die uniforme Handschrift der Großindustrie. Unsere Nahrung war zum wachsenden Industriezweig geworden, in dem es um ein erklärtes Ziel ging: möglichst große Mengen auf möglichst kleiner Fläche möglichst schnell und unter Maximierung der Gewinnspanne zu produzieren. Nach allem, das ich in dieser Zeit las, hörte und herausfand, war mein Vertrauen in die Lebensmittelbranche völlig erschüttert. Da die Information, die wir aus der bunten und heilen Welt der Werbung erhielten, offensichtlich radikal zensiert und beschönigt war, beschloss ich, mir die Realität mit eigenen Augen anzusehen.
Ich war neunzehn Jahre alt, als ich anfing, zu den Produktionsstätten hinauszufahren, aus denen unsere Lebensmittel stammten. Das war 1999. Ein solches Vorhaben ist schwer zu realisieren, da Besucherinnen und Besucher, die unbequeme Fragen stellen, in der Lebensmittelindustrie nicht willkommen sind. Dort arbeitet man lieber hinter streng verschlossenen Türen, während man sich die Idylle versprechenden Fotos in die Auslagen hängt. Ich war selbst verwundert, als es mir zum ersten Mal gelang, eine industrielle Schweinemastanlage von innen zu besichtigen, in der für eine große Supermarktkette unter dem Schlagwort »vom Bauernhof« Tiere gehalten wurden. Wie dehnbar der Begriff »Bauernhof« ist, wurde mir erst an diesem Tag bewusst. Ein andermal verschlug es mich ins Marchfeld, das durch die Werbung als »Gemüsekammer« Österreichs bekannt geworden war. In TV-Werbespots wurden uns Bäuerinnen und Bauern präsentiert, die auf nostalgisch wirkenden Traktoren Feldwege entlangzuckelten und dabei Anhänger mit buntem Gemüse transportierten. Die Realität, die ich auf meinen Erkundungen im Marchfeld vorfand, ernüchterte mich allerdings schlagartig. Die Region erschien mir als eine Art »Hot Spot« der Agrar- und Lebensmittelindustrie. In der ebenen Landschaft lassen sich schier nie endende Monokulturen anlegen, die mit großen und schweren Maschinen nach Lust und Laune bewirtschaftet werden können. Ein Eldorado der Großindustriellen! Wer heute Ackerland von hundert Hektar im Marchfeld bewirtschaftet (das entspricht einem satten Quadratkilometer), zählt zu den Kleinsten der Region. Das Marchfeld ist ein Landstrich, der von seinen früheren Landschaftselementen weitgehend ausgeräumt wurde. Ich besichtigte damals außerdem eine Brotfabrik, die direkt neben den Gebäuden eines Stahlkonzerns angesiedelt war und die selbst den Charme eines Stahlkonzerns hatte, eine große Milchverarbeitungsfabrik, eine Käserei im Format XXL, einen Schlachthof sowie die Fließbänder einer »Produktionsanlage« für Küken.
Ich wurde Bio-Konsument
Danach hatte ich einfach keine Lust mehr, industrielle, in Massen produzierte Nahrungsmittel zu mir zu nehmen, die wie Pappkarton aus den Fabriken geschossen wurden. Ich hatte die Realität mehrfach mit eigenen Augen gesehen und gegen die idyllischen Bilder und Versprechen aus der Werbung war mir eine löwenstarke Haut gewachsen. Ich wollte Nahrungsmittel, die diese Bezeichnung noch verdienten: gesunde, vielfältige Produkte, die ökologisch und fair produziert wurden und die nicht die Handschrift immer wieder derselben Konzerne trugen. Ich wollte keine Lebensmittel-»Industrie«, sondern eine Nahrungsmittel-»Kultur«. Ich wünschte mir Transparenz und Verantwortungsgefühl seitens der Produzentinnen und Produzenten. Ich wollte nicht nur wissen, wer unsere Nahrung herstellte, sondern auch, wie dies geschah. Gleichzeitig erklärte ich mich mit jenen Bäuerinnen und Bauern solidarisch, die unter die Räder dieser Industrie gekommen waren. Der Siegeszug der Großkonzerne führte auch zu einem kulturellen Verlust, da traditionelles Wissen und Können, wie schon unter Buchbinderinnen und Buchbindern, auch in der Landwirtschaft vor allem durch kleinere und mittlere Betriebe erhalten und weitergegeben wird. Die letzten Landstriche, die für industrielle Maschinen zugänglich waren, verwandelten sich in Agrarwüsten, die Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere wurde durch Vereinheitlichung und Massenproduktion noch weiter dezimiert. All das wollte ich nicht. Ich entschloss mich, Bio-Konsument zu werden – noch konsequenter, als ich es inzwischen schon war.
Und ich wurde Bio-Insider
Nachdem ich als frischgebackener Agrarbiologe von der Uni gekommen war, pachtete ich eine landwirtschaftliche Anbaufläche im Raum Wien und führte dort wissenschaftliche Versuche zum Anbau von Bio-Gemüse durch: Sortenversuche, Experimente zur natürlichen Schädlingsbekämpfung und zur Bestimmung der optimalen Pflanzdichten verschiedener Feldfrüchte. Ich schrieb ein Fachbuch über alte Sorten in Landwirtschaft und Garten, das 2011 auf dem Buchmarkt erschien. Ich besuchte Bio-Höfe in ganz Österreich sowie im Ausland.
Einmal verschlug es mich an die wilde und gleichsam romantische Küste von Wales in Großbritannien, wo ich eine Zeit lang auf einer ökologischen Farm wohnte und mitarbeitete. »Never say you are in England!«, warnte mich ein Bauer in Wales, während er seinen neuen Hut aufsetzte und sich mit einem Stock in der Hand durch dichte Nebelschwaden auf den Weg zu seiner Schafherde machte. Die Landschaft in dieser Region war märchenhaft. Die moosbewachsenen walisischen Wälder mit ihren uralten, knorrigen Bäumen, das stürmische Meer, die Ziegen und Schafe, die mir überall unterwegs begegneten, und nicht zuletzt die Menschen auf der Öko-Farm, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzten, machten meinen Aufenthalt unvergesslich.
Später wurde ich vom Insider der Bio-Bewegung sogar zum Insider des Bio-Massenmarktes: Ich arbeitete fast ein halbes Jahr lang im Qualitätsmanagement für die Bio-Marke Zurück zum Ursprung des Lebensmittel-Discounters Hofer. Doch die Business-Welt der »Big Fishes« des Lebensmittelhandels, in der ich gelandet war, entsprach ganz und gar nicht meinen persönlichen Vorstellungen des »kontrolliert biologischen Marketings«. In dieser Zeit wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass rund um die ökologische Landwirtschaft zwei gegensätzliche Kräfte am Werk sind: nämlich eine Bio-Bewegung und eine BioTM-Branche. Es kam zu einer einvernehmlichen Auflösung meines Managerdienstverhältnisses. Seither widme ich mich wieder als unabhängiger Wissenschaftler der biologischen Landwirtschaft, ohne einen Konzern im Nacken. Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass mein Herz für den Ökolandbau schlägt. Das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, richtet sich beileibe nicht gegen die Idee der biologischen Lebensmittelherstellung an sich! Im Gegenteil: Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, die Bio-Idee zu erhalten. Und zwar in ihrer ursprünglichen Form, in der sie auch den Erwartungen und Vorstellungen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher entspricht. Als Bio-Konsumentinnen und Bio-Konsumenten müssen wir auf der Hut sein, wenn wir nicht bloß die »Zielgruppe« für das »zielgruppenorientierte Marketing« der Lebensmittelkonzerne sein möchten.
Der BioTM-Pionier und das »traditionelle Bäckerhandwerk«
Als ich zum ersten Mal hinter die Bio-Kulissen der Supermärkte blickte
»Es ist fürchterlich, wie man Bio-Brot heute produzieren darf.«
(Franz Kaschik, Bio-Vollwertbäcker, Wien)
Der Ursprungsbäcker
Idyllische Bilder aus einer wohlig warm wirkenden Backstube: Der Raum ist abgedunkelt, schummriges Stimmungslicht verwandelt den Schauplatz in eine theatrale Bühne. Aus dem dunklen Hintergrund heben sich ein paar Brotkörbe ab, die nur mehr darauf warten, gefüllt zu werden. Im beleuchteten Vordergrund knetet ein junger Bio-Bäcker sorgfältig und mit gekonnten Handbewegungen den Teig. Handarbeit scheint hier noch einen wichtigen Stellenwert zu haben. Auf dem Arbeitstisch finden wir vier rohe Brotlaibe und ein einzelnes Brotkörbchen – alles perfekt arrangiert. Die Szenerie gehört zu einem TV-Werbespot für Zurück zum Ursprung, der Bio-Marke von Hofer (so nennt man den Aldi-Konzern in Österreich). Außer dem Bäcker ist noch ein zweiter Mann im Bild. Er trägt einen urigen grauen, beinahe bergbäuerlich anmutenden Bart und stellt den eigentlichen Hauptakteur des Geschehens dar. In den Medien ist er als »Österreichs Bio-Pionier« bekannt und wird manchmal auch als »Bio-Papst« bezeichnet: Werner Lampert. Inmitten der für die Kameras in Szene gesetzten und romantisch aufgepeppten Backstube versucht er sich als Bäcker und legt selbst Hand an den Teig, um diesen zu Brotlaiben zu formen. Doch es will nicht gelingen. Der Teig bleibt erbarmungslos an den Händen des Pioniers kleben, wofür er sich beileibe nicht zu schämen braucht. Es würde vermutlich uns allen so ergehen. Also führt uns dann doch lieber der engagierte junge Bäcker vor, wie bei Zurück zum Ursprung gebacken wird: Der Arbeitstisch wird bemehlt und die Brote werden Stück für Stück von Hand geformt. Aus einem Jutebeutel bestreut sie der Bäcker anschließend mit Mehl. Ruhe und Besonnenheit dominieren hier die Bäckerkunst. Doch Sendezeit ist teuer: Schon im nächsten Augenblick erhält der BioTM-Pionier Lampert einen mehligen, aber freundschaftlichen Schlag des Bäckers auf die Schulter und teilt seine Werbebotschaft direkt aus der schummrigen Backstube dem allabendlichen Millionenpublikum mit. Seinen »Ursprungsbäckern«, so heißt es, erlaube er nur eines, nämlich »traditionelles Handwerk«. Mit diesem Versprechen endet der Werbespot zu bester Sendezeit.
»… nur traditionelles Handwerk.«
(Originalton aus der Werbung für Bio-Brot von Zurück zum Ursprung, Hofer)
Dieser TV-Spot wurde schließlich unter dem Titel »Brot backen wie früher einmal« auch im Internet über Youtube von Zurück zum Ursprung veröffentlicht.9 Als überzeugter Bio-Konsument war ich von dem Versprechen des traditionellen Bäckerhandwerks beeindruckt und auch die einprägsamen Bilder aus der romantisch beleuchteten Backstube weckten Zuneigung in mir. Hand aufs Herz: Wer isst schon gerne Industriebrot, das hergestellt wird wie Schuhkartons?
Noch am selben Tag, an dem ich den Werbespot zum ersten Mal sah, machte ich mich auf den Weg in eine der zahlreichen Wiener Filialen von Hofer. Und dort nahmen meine Erkundungen des österreichischen Bio-Massenmarktes sowie die wahre Geschichte, die ich Ihnen in diesem Buch erzähle, ihren Anfang.
Hofer kehrt »zurück zum Ursprung« – auch bei Bio-Brot
Lokalaugenschein bei Hofer in Wien. Ich schlängelte mich zwischen einzelnen in der Halle stehenden Regalen hindurch, vollgestopft mit Discount-Keksen, ließ das überaus günstige Discount-Gemüse links hinter mir liegen und steuerte direkt auf das Brotregal zu. Dort wühlte ich mich durch einen Berg von Discount-Gebäck, wobei ich lautes Knistern und Rascheln erzeugte. Es war das Plastik, in das die Ware eingeschweißt war. Endlich! Inmitten der Unmengen an Brot und Semmeln erspähte ich das einprägsame Logo von Zurück zum Ursprung. Es befand sich neben unzähligen anderen Siegeln, Zeichen und Symbolen. Ein Etikett versicherte mir, dass ich meinen ökologischen Fußabdruck – trotz herkömmlicher Plastikverpackung – maßgeblich verkleinern konnte, indem ich dieses Brot kaufte. Als ich mir das Sammelsurium an eingeschweißten Backwaren ansah, die wild durcheinandergewürfelt vor mir lagen, kam aber dennoch keine richtige Bio-Brotstimmung auf. Ich gab mir zwar Mühe, die romantischen Szenen aus der Werbung in mein Gedächtnis zu rufen – die Hingabe, mit welcher der Bäcker den Teig formte, und das urtümliche Ambiente der Backstube –, aber es half nichts. Ich hatte den Eindruck, dass sich dieses Bio-Brot in seiner Gesamterscheinung nicht wesentlich von dem konventionellen, also herkömmlichen Brot unterschied, das im selben Regal angeboten wurde. Verpackung, Form und Aufmachung wirkten auf mich wie aus ein und derselben Schmiede10. Auch die verschiedenen Bio-Backwaren – Semmeln, Weckerln, Brote – glichen einander wie ein Ei dem anderen. Ich ließ das Brot liegen und beschloss, mich als Lebensmitteldetektiv zu betätigen, so wie ich es schon in früheren Jahren praktiziert hatte. Ich wollte herausfinden, wo und wie diese Backwaren produziert wurden. Die erste Spur: »Kuchen Peter«. Der Name des Herstellers war auf der Verpackung des Brotes ausgewiesen. Mehr als die Hälfte aller lagernden Bio-Backwaren stammte aus dieser Bäckerei. Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiges Schlagwort im Marketing von Zurück zum Ursprung. Ich nahm es mit der Rückverfolgung diesmal besonders wörtlich – wahrscheinlich wörtlicher, als es das Unternehmen selbst eigentlich gemeint hatte.
Lokalaugenschein beim »Ursprungsbäcker«
Bäckerinnen und Bäcker arbeiten bekanntlich in der Nacht am intensivsten, obwohl die Produktion auf dem Massenmarkt niemals stillsteht. Es war stockdunkel, als ich auf dem Betriebsgelände der Bäckerei Kuchen Peter in Hagenbrunn, nicht weit von Wien, ankam. Ein Blick auf die Uhr: Mitternacht. Ich verdankte es zwei Tassen Kaffee, dass ich noch hellwach und aufnahmefähig war. Ich stieg aus dem Auto und schritt auf das Hauptgebäude der Bäckerei zu. Dass mich hier keine »Backstube« erwartete, wurde mir auf den ersten Blick klar. Die Fabrikhallen lagen schwerfällig vor mir und eine ganze Flotte von Lastwägen stand schon bereit und wartete darauf, die Backwaren dieser Nacht in den frühen Morgenstunden über ganz Österreich zu verteilen. Die Adresse der Firma fand ich ausgesprochen aussagekräftig. Sie lautete auf »Industriestraße«. Eine Maschinenfabrik war die unmittelbare Nachbarin der Backfabrik. Die Hoffnung, auf das in der Werbung versprochene traditionelle Handwerk zu stoßen, hatte ich bereits aufgegeben, als ich die Pforte in die Welt der Bäcker durchschritt. Auch drinnen erinnerte mich nichts an eine Backstube. Einer der Schichtführer hatte mich willkommen geheißen, durch den Sicherheitstrakt geschleust und mich an den Ort des Geschehens geführt. Wir befanden uns in »Produktionshalle Eins«, wie mir ein Schild verriet. Es dauerte eine Weile, bis ich mich in der ungewohnten Umgebung orientiert und meine Ohren sich an das rasende Betriebsgeräusch der Maschinen und Fließbänder gewöhnt hatten. Dann begaben wir uns auf einen Rundgang. Die Fabrik bestand aus drei aufeinanderfolgenden Hallen, die durch große automatische Tore voneinander getrennt waren. Das Ambiente hätte auch zu einer Papierfabrik gehören können. Bäckerinnen und Bäcker, wie ich sie mir vorgestellt hatte, würde ich in dieser Nacht keine treffen – dafür aber zahlreiche »Maschinenführer«.
Schichtführer und Maschinenschlosser waren auf Fahrrädern unterwegs! In diesem Fabrikkomplex zu Fuß zu gehen, wäre eine äußerst zeitverschwendende Angelegenheit gewesen. Und Zeit ist Geld. In einigen Metern Höhe jagte fertig gebackenes Brot auf Förderbändern in erstaunlich hoher Geschwindigkeit über meinen Kopf hinweg: Massentransport in die Packhalle.
Wir kamen an eine Maschine von beeindruckender Größe. Dass es sich bei diesem Ungetüm um einen Backofen handelte, überraschte mich jetzt nicht mehr. Man hätte einen Lastwagen darin parken können. Als ich die metallene Realität der Großindustrie innerlich mit den Illusionen der gemütlichen Bäckerstube und des »traditionellen Handwerks« verglich, die uns in der Werbung aufgetischt werden, kam ich mir irgendwie an der Nase herumgeführt vor. Ein Strom, ein ganzes Meer an noch rohen Bio-Semmeln, floss unentwegt und voll automatisiert in den monströsen Ofen, der auf etlichen Etagen übereinander buk und die fertigen Semmeln am Ende scheinbar tonnenweise wieder ausspuckte – eine nie enden wollende Flut an essbarer Industrieware. Egal wohin ich blickte, überall dasselbe Bild: Riesige Maschinen kneteten Teig, formten Brot und Wecken, drückten ihre Roboterarme im rasenden Akkord auf das Backwerk, um diesem Form und Struktur zu verleihen, als hätten Bäckerin und Bäcker Hand angelegt. Hier rieselte Sesam aus tiefen Wannen auf das vorbeiflitzende Gebäck, dort sortierte ein Roboterarm misslungene Endprodukte aus. Hie und da traf man auf Menschen. Die einen, die das Sagen hatten, fuhren auf ihren flinken Fahrrädern und Elektrowägen durch den Hallenkomplex. Die anderen – jene nämlich, die von den Fahrradfahrern umher kommandiert wurden – waren zu großen Teilen ausländische Arbeiter. Sie kamen aus Osteuropa, einige auch aus Afrika. Im Akkord führten sie die ganze Nacht hindurch immer dieselben Handbewegungen aus, auf die sie trainiert und gedrillt waren – der Mensch als Produktionsmaschine. Manche verdrehten in atemberaubender Geschwindigkeit die pausenlos vorbeiflitzenden »Bio-Ursprungsweckerln« von Hofer und brachten sie so in die Form einer Schleife. Andere schaufelten ohne Einhalt Semmelberge von einem Fließband auf das nächste. Wieder andere klebten Etiketten auf das in Plastikfolie verschweißte Bio-Gebäck und versuchten dabei, mit der Affengeschwindigkeit der Packmaschine mitzuhalten.
Alles aus einer Hand
Die von mir besuchte Backfabrik ist keine »Bio-Bäckerei«, sondern ein Betrieb, in dem hauptsächlich konventionelle, das heißt nicht-biologische Backwaren für die großen Lebensmittelkonzerne hergestellt werden. Kuchen Peter gilt beispielsweise als österreichischer Marktführer bei Krapfen. Mehr als ein Drittel der Krapfen des Landes stammt aus dieser Fabrik. Der Betrieb stellt eigenen Angaben zufolge etwa zweihundert Millionen Stück Backwaren pro Jahr her11. Bio-Gebäck für Zurück zum Ursprung (Hofer), Ja!Natürlich (Rewe) und Natur*pur (Spar) läuft nebenbei mit – in denselben Nächten, mit denselben Maschinen und auf dieselbe industrielle Weise wie herkömmliche, konventionelle Ware. Das Unternehmen gibt auf seiner Internetseite an, das Produktionsvolumen laufend zu vergrößern. Immer mehr Brot und Gebäck wird in Zukunft von immer weniger Backkonzernen hergestellt werden: bio und konventionell, alles aus einer Hand – aus einer großen, industriellen Hand. Daran können romantische Werbeversprechen nichts mehr ändern.
Bilanz für Bio-Brot von Zurück zum Ursprung
Nachdem ich das nächtliche Treiben in der Brotfabrik verlassen hatte, klang der rasende Takt der Maschinen noch eine Weile in meinen Ohren. Auf der Heimfahrt, gegen drei Uhr morgens, während ich meiner Müdigkeit mit einem weiteren Becher Kaffee entschieden entgegentrat, wuchs meine detektivische Neugier. Das Nächste, worüber ich mehr erfahren wollte, war die Herkunft der übrigen Bio-Backwaren von Hofer. Würde ich doch noch auf das traditionelle Handwerk stoßen, das der Konzern versprach?