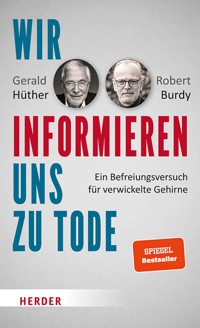23,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
»Hurra, Ferien!«, »Endlich Urlaub!« – Wir alle kennen das. Weshalb wollen eigentlich die meisten Kinder spätestens nach der ersten Klasse vom Lernen nichts mehr wissen? Weshalb nutzt der Knirps, der als Baby lustvoll die Welt entdeckt hat, spätestens jetzt seine Kreativität nur noch, um dem Lernen möglichst zu entfliehen? Weshalb empfindet kaum ein Erwachsener Lernen als Bereicherung des eigenen Lebens und als zutiefst lustvoll und beglückend? Gerald Hüthers Antwort: Weil unser Verständnis von »Lernen« historisch und gesellschaftlich verkrüppelt wurde. Weil wir Lernen in den engen Rahmen einzwängen, den die speziell zu diesem Zweck geschaffenen Einrichtungen vorgeben. Weil wir nicht mehr wissen, dass Lernen für uns Menschen lebensnotwendig ist. Das zuzulassen, war ein Fehler. Aber aus Fehlern können wir lernen. Lernen heißt nicht weniger, als lebendig zu bleiben. Wer nichts mehr lernt, ist tot.
Das E-Book können Sie in einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützt:
Veröffentlichungsjahr: 2016