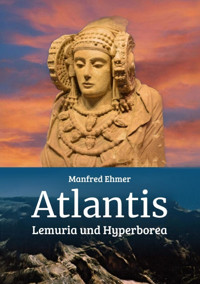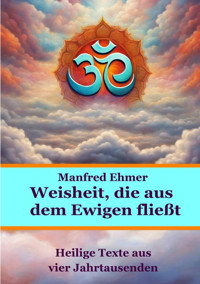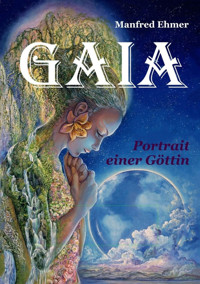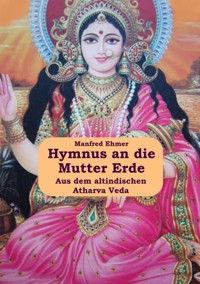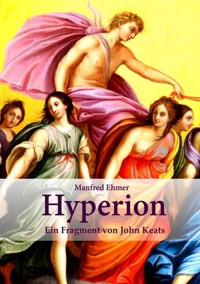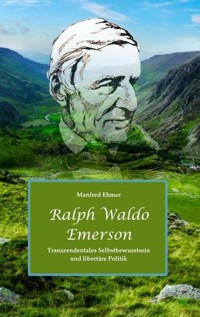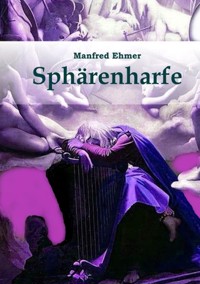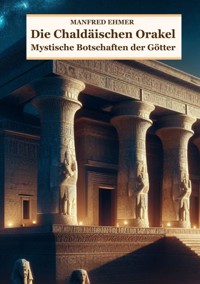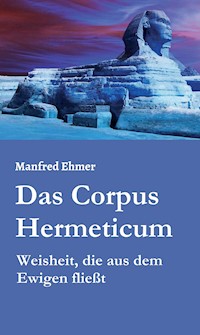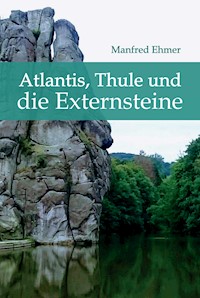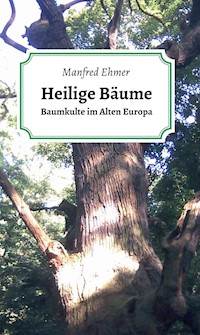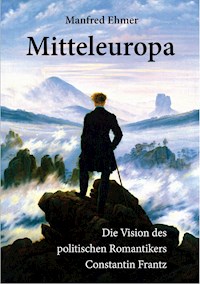
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Constantin Frantz (1817-1891), ein in der heutigen Geschichts- und Sozialwissenschaft kaum noch bekannter politischer Philosoph, entwickelte auf der Grundlage der Romantik das Konzept eines integralen Föderalismus, der von Deutschland ausgehen und sich in einem dezentral gestalteten Mitteleuropa erfüllen sollte. Dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts stellte er die Vision eines mitteleuropäischen Staatenbundes als friedenspolitische Alternative entgegen. Das vorlegende E-Book ist eine gründlich recherchierte Studie über diesen wohl profiliertesten Gegner Bismarcks. Es handelt sich um die journalistisch überarbeitete ehemalige Dissertation des Verfassers aus dem Jahr 1988-89, die im Lichte der deutschen Wiedervereinigung nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Manfred Ehmer
Mitteleuropa
Die Vision des politischen
Romantikers Constantin Frantz
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur E-Book-Ausgabe
1. Mitteleuropa – Die Vision des politischenRomantikers Constantin Frantz (1817-1891)
1.1. Mitteleuropa – politisch gedacht
1.2. Der organisch-föderative Sozialimpuls
1.3. Einige Stimmen über Constantin Frantz
1.4. Constantin Frantz' Lebenslauf
2. Die geistigen Grundlagen
2.1. Grundideen der politischen Romantik
2.2. Constantin Frantz als politischer Romantiker
2.3. Die positive Philosophie Schellings
2.4. Frantz' Anknüpfung an Schelling
2.5. Die Bedeutung des Reichsgedankens
2.6. »Neues Mittelalter« und »Drittes Reich«
3. Deutschland und Mitteleuropa
3.1. Deutschlands »föderativer Weltberuf «
3.2. Die Philosophie der Volksgeister
3.3. Staatsnation oder Kulturnation?
3.4. »Polen, Preußen und Deutschland«
3.5. Die Vision der Mitteleuropäischen Union
3.6. Bemerkungen zur deutschen Geschichte
3.7. Die Mitteleuropa-Frage im Jahre 1848
3.8. Constantin Frantz oder Bismarck?
4. Föderalistische Soziologie und Politik
4.1. Föderalismus als synthetisches Prinzip
4.2. Traditionen des sozietären Föderalismus
4.3. Ein Exkurs über Pierre-Joseph Proudhon
4.4. Familien, Gemeinden, autonome Kleinräume
4.5. Die föderativen Vertretungsorgane
4.6. Wirtschaftsföderalismus als »Dritter Weg«
4.7. Die »Geld- und Börsenherrschaft«
4.8. Das Erbe des utopischen Sozialismus
4.9. Ein Wort zum »Universalismus« Othmar Spanns
4.10. Politik im »Mittelreich der Geschichte«
5. Der geistige Auftrag Mitteleuropas
6.1. Zeittafel zu Frantz' Leben
6.2. Constantin Frantz' Werke
6.3. Sekundärliteratur
6.4. Anmerkungen und Zitate
6.5. Über den Autor
6.6. Impressum
Vorwort
zur E-Book-Ausgabe
Wer war eigentlich Constantin Frantz (1817–1891)? Es handelt sich um einen von der heutigen Geschichts- und Sozialwissenschaft weitgehend vergessenen politischen Philosophen, der aus dem Geist der Romantik und des Deutschen Idealismus die Grundlagen einer Politik des Föderalismus entwickelte, die von Deutschland ausgehen und sich in einem föderativ geeinten Mitteleuropa erfüllen sollte. Man kann ihn als einen Außenseiter bezeichnen; seine Ideen waren unkonventionell und standen dem damals herrschenden Zeitgeist entgegen. Im Millieu des deutschen Kaiserreiches betätigte er sich als ein „Rufer in der Wüste“, und in vieler Hinsicht hat er sich als ein hellsichtiger Visionär zukünftiger Entwicklungen erwiesen.
Ausgangspunkt der Frantz’schen Überlegungen war eine Kritik am europäischen Großmachtsystem seiner Zeit. Dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts, dieser gewaltigen politischen Sprengkraft, setzte er einen abendländischen Universalismus als friedens- und ordnungspolitisches Prinzip entgegen. Wie Novalis und andere Romantiker hoffte er auf ein erneuertes Christentum und auf eine Wiedergeburt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation in Gestalt eines Mitteleuropäischen Bundes.
Allen Bestrebungen, aus Deutschland einen einheitlichen Natonalstaat zu formen, stand er ablehnend gegenüber, und seine Kritik am Gründungswerk Bismarcks ist bis heute aktuell geblieben. Hellsichtig sah er voraus, dass ein zentralistischer Nationalstaat im Herzen Europas den Keim neuer Kriege legen würde. Umgekehrt wollte er seinen Mitteleuropäischen Bund als Garant eines dauerhaften Friedens in Europa und in der Welt verstanden wissen.
Dabei hat Frantz dem Wort „Föderalismus“ einen völlig neuen, erweiterten Sinn gegeben. Er versteht den Föderalismus „bündisch“, germanisch, genossenschaftlich, als ein von unten nach oben aufgebautes Sozialsystem, das Machtverteilung bewirkt und Einheit in der Vielfalt verwirklicht. Und er war davon überzeugt, dass nur ein solches dezentrales System, eher ein Staatenbund als ein Bundesstaat, für ein vereintes Europa taugen würde.
Das vorliegende E-Book ist eine leichtverständliche Neufassung meiner wissenschaftlichen Dissertation über Constantin Frantz aus dem Jahre 1988, die nun schon seit vielen Jahren vergriffen ist. Sie erschien unter dem etwas sperrigen Titel CONSTANTIN FRANTZ: DIE GEDANKENWELT EINES KLASSIKERS DES FÖDERALISMUS (Rheinfelden 1988). Die jetzige E-Book-Ausgabe unterscheidet sich von der Urfassung der Dissertation durch eine gewisse Straffung, vor allem im Bereich des wissenschaftlichen Apparates; auch die Kapitel Mitteleuropa – politisch gedacht und Der geistige Auftrag Mitteleuropas wurden nachträglich eingefügt, und sie verfolgen den Zweck, die Ideen von Constantin Frantz in einem aktuellen Licht erscheinen zu lassen.
Das vorliegende E-Book erscheint seit 2012 im Hamburger Verlag tredition GmbH und wurde schon oft heruntergeladen. Möge es dazu beitragen, das Andenken an diesen visionären politischen Denker Constantin Frantz lebendig zu halten.
Manfred Ehmer
1. Mitteleuropa
Die Vision des politischenRomantikers Constantin Frantz (1817–1891)
1.1. Mitteleuropa – politisch gedacht
Mitteleuropa ist ein in Jahrhunderten gewachsener, sprachlich-kulturell und geopolitisch bestimmbarer Lebensraum, der nicht allein Deutschland umfasst, sondern auch die Schweiz und Österreich, die Benelux-Staaten und die slawischen Nachbarn Deutschlands im Osten: Polen, die Tschechei und Ungarn. Dabei ist dieser Lebensraum Mitteleuropa als ein in sich zusammenhängender Kultur- und Wirtschaftsraum zu sehen, nicht aber als politische Einheit. Eine gemeinsame politische Organisationsform für Mitteleuropa ist bisher nie zustande gekommen, vielleicht auch nie ernsthaft versucht worden. Dennoch müssen wir uns die Frage stellen: Wie könnte ein Konzept für ein politisch geeintes Mitteleuropa aussehen?
Die Vielfalt der Völker und Kulturen in Mitteleuropa, auch der ethnischen und sprachlichen Minderheiten in diesem Lebensraum, würde eine zentral gelenkte politische Organisationsform von vornhinein verbieten. In Frage käme wohl nur eine Mitteleuropäische Föderation, eher ein Staatenbund als ein Bundesstaat, in dem alle angeschlossenen Mitglieder ihre volle Selbständigkeit bewahren würden. Nur nach außen würde dieser Mitteleuropäische Völkerbund in Erscheinung treten durch eine gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Vertretungs- und Rechtsprechungsorgane, etwa ein mitteleuropäisches Völkerparlament, sowie durch eine gemeinsame Währung – nach Innen aber wäre jedes Mitglied selbständig im Rahmen einer sehr weitgehenden politischen Selbstverwaltung.
Gegenüber den Vereinigten Staaten von Nordamerika und der ehemaligen Sowjetunion würde ein solcherart politisch geeintes Mitteleuropa als neue politische Kraft auftreten können, als „Dritte Macht“ im Dienste des weltpolitischen Ausgleichs und der internationalen Vermittlung. Denn wer würde bestreiten, dass Mitteleuropa schon seiner geopolitischen Lage wegen der Berufung zu folgen hat, die Weltgegensätze von West und Ost, Nord und Süd in sich aufzunehmen und vermittelnd auszugleichen? Im Hinblick auf Bevölkerungszahl und Wirtschaftskraft könnte die Mitteleuropäische Föderation der USA und der ehemaligen Sowjetunion durchaus ebenbürtig sein, aber sie wäre trotzdem keine „Weltmacht“ im althergebrachten Sinne, sondern eine neutrale Macht der Vermittlung und der Friedensstiftung. Mitteleuropa, durch eine gemeinsame politische Organisationsform geeint, strebt nicht nach eigener Größe, sondern dient ausschließlich dem Weltfrieden!
Seit dem Ende des „Kalten Krieges“, durch den Fall der Berliner Mauer 1989 eingeleitet, und der Wiedervereinigung Deutschlands hat Mitteleuropa als kultureller und geopolitischer Lebensraum wieder neue Bedeutung erlangt. Nach einem ganzen Menschenalter der politischen Teilung, der Aufteilung Europas in einen West- und Ostblock, ist nun erstmals die Möglichkeit einer Mitteleuropäischen Union in greifbare Nähe gerückt, falls Deutschland und seine europäischen Nachbarn die Bereitschaft aufbringen würden, eine solche Union zu bilden. Zu betonen ist aber, dass diese politische Union Mitteleuropas etwas ganz anderes darstellen würde als ein vergrößertes Großdeutschland – sie ist vielmehr ein übernationales Gebilde, ein organischer Zusammenschluss der Kulturnationen in der Mitte Europas, die durch gemeinsame Geschichte und geographische Nachbarschaft miteinander verbunden sind.
Es gehört zweifellos zu den Tragödien der europäischen Geschichte, dass in den letzten Jahrhunderten zwar immer wieder ein politischer Gestaltungsimpuls in Richtung Mitteleuropäische Union aufgetreten ist, der jedoch auf der Ebene der Politik und der internationalen Ordnung nicht Wirklichkeit werden konnte, sondern ungesehen im politischen Leben Europas versickerte. Die Kulturnationen in der Mitte Europas sind nicht den Weg der mitteleuropäischen Föderierung gegangen, nicht den Weg der Vereinigung zu einem übernationalen Völker-Organismus, sondern den Weg der nationalstaatlichen Absonderung. Sie haben autonome, in sich geschlossene Nationalstaaten gegründet, und zwar selbst die kleinsten Völkerschaften, ohne jedoch daran zu denken, sich zu einem größeren Ganzen zu konföderieren. Das nationale Sondersein war ihnen wichtiger als die Einordnung in den gemeinsamen, auch politisch geeinten, Lebens- und Kulturraum Mitteleuropas.
Der Nationalstaat, der nach außen streng abgeschlossene, im Innern streng zentralistisch geleitete, scheint in Europa seit der Französischen Revolution (1789) das Grundmuster aller politischen Bildungen zu sein, und es ist noch niemandem eingefallen, dieses nationalstaatliche Grundprinzip in Frage zu stellen. Ja gerade gegenwärtig vollzieht sich in allen Teilen der Welt, besonders aber in Osteuropa und in der ehemaligen Sowjetunion, eine Renaissance des Nationalstaates, was sich darin zeigt, dass selbst die kleinsten ethnischen und nationalen Minderheiten einen eigenen Nationalstaat wollen. Gerade die Völker Osteuropas, des Kaukasus, Innerasiens, alle mittlerweile herausgetreten aus dem Herrschaftsverband der ehemaligen Sowjetunion, setzen ihr nationales Sondersein über Alles, aber wer wollte bestreiten, dass in diesem Nationalismus eine gewaltige politische Sprengkraft verborgen ist, die – wenn erst richtig entfesselt – die Welt in einen Abgrund der Kämpfe und Bürgerkriege stürzen wird?
Es wird vielleicht eine Zeit kommen, in der das Paradigma des Nationalstaates als überholt gelten wird, und dann wird der Nationalismus der Völker Europas sich ein- und unterordnen in einen übernationalen Universalismus – nicht in den Universalismus eines seelenlosen mechanischen Weltstaates, der mit Recht als untragbar abgelehnt wird, auch nicht in den eines bürokratischen europäischen Super-Staates, der nur auf eine alles nivellierende Gleichmacherei hinauslaufen wird, sondern in den organischen Universalismus einer abendländischen Kulturgemeinschaft, deren Herz- und Lebenszentrum ein politisch geeintes Mitteleuropa darstellt.
In einer künftigen, durch den Föderalismus befriedeten Welt würden die „Vereinigten Staaten von Mitteleuropa“ östlich direkt angrenzen an eine Baltisch-Russische Föderation, und diese hätte als östlichen Nachbarn vielleicht eine von den Völkern Sibiriens gebildete Innerasiatische Föderation. Dies wäre die Alternative zu einer stets von Bürgerkriegen erschütterten Welt der Nationalstaaten. Und nur von einem politisch geeinten Mitteleuropa kann dieser Impuls des völkerverbindenden Föderalismus ausgehen; hierin liegt Mitteleuropas Beitrag zum Weltfrieden. Das wäre Mitteleuropa – politisch gedacht!
1.2. Der organisch-föderative Sozialimpuls
Es gibt einen sozialen Gestaltungsimpuls, der in Mitteleuropa seit über zwei Jahrtausenden seine Lebenskraft entfaltet hat, von der Zeit der Germanenstämme über die mittelalterliche Reichsordnung bis in die Tage der frühen Neuzeit hinein. Dieser soziale Gestaltungsimpuls aus der Mitte Europas ist der organisch-föderative, der genossenschaftliche. Die Genossenschaft oder Föderation ist etwas Organisches, eine organische Bildung im Sozialen. Solche Genossenschaftlichkeit im Sinne eines föderativen Gesellschaftsaufbaus könnte auch einer künftigen Mitteleuropäischen Union zugrundeliegen.
Das Genossenschaftliche entspringt den alten Freiheits- und Gewohnheitsrechten der Germanen. Die politische Lebensform der Germanen war – wie Tacitus im 11. Kap. der GERMANIA berichtet – die gemeindliche Urdemokratie („Über geringfügigere Anliegen beschließen die Gaufürsten allein, über bedeutendere alle Gemeinfreien…“). In den sozialen und politischen Lebensformen des Mittelalters konnte die freiheitlich-germanische Rechtstradition teilweise fortgesetzt werden. Das sich über ganz Mitteleuropa erstreckende Heilige Römische Reich (deutscher Nation)“ war ein Gebilde, das mit heutigen staats- oder völkerrechtlichen Begriffen gar nicht erfasst werden kann: ein nationübergreifender, vom Geist abendländischer Spiritualität durchdrungener politisch-sozialer Gesamt-Organismus. In den zahlreichen freien Städten, in Zünften, Innungen und Korporationen aller Art waltete ein Geist genossenschaftlicher Selbstverwaltung.
Als das herrschafts-orientierte Römische Recht in Deutschland eingeführt wurde – vor allem auf dem Reichstag zu Worms (1495) –, da mussten die Gemeindefreiheit, das Gemeineigentum an Boden und die Selbstverwaltung der Korporationen zurückweichen vor dem uneingeschränkten Privateigentum in Verbindung mit dem zentralistischen Machtstaat. Dies war eine äußerst verhängnisvolle Entwicklung. Und doch traten in der Folgezeit immer wieder Einzelne auf, die den Vorschlag äußerten, bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens doch an die Tradition der Genossenschaftlichkeit und des Föderalismus anzuknüpfen: zuerst der Rechtsgelehrte Johannes Althusius (1557–1638), dann Freiherr vom Stein (1757–1831), später Otto von Giercke (1841–1921), Constantin Frantz (1817–1891) und Artur Mahraun (1890–1950), der Begründer des Nachbarschaftsgedankens.
In den folgenden Kapiteln dieses Buches sollen ausschließlich die Ideen von Constantin Frantz behandelt werden. Frantz, von Beruf politischer Journalist, Verfasser zahlreicher Bücher, war – in wenigen Stichworten gesagt – Romantiker, Großdeutscher, Föderalist und Vertreter einer Mitteleuropäischen Union. Frantz ist heute ein Unbekannter, Vergessener, und schon zu seinen Lebzeiten wurde seine Bedeutung weithin verkannt. Richard Wagner nannte ihn jedoch einen „der umfassendsten und originellsten politischen Denker und Schriftsteller, auf welchen die deutsche Nation stolz zu sein hätte, wenn sie nur erst ihn zu beachten verstünde“1 (1867). Der von Frantz entwickelte Föderalismus, seine Vorschläge zur föderativen Gestaltung des Sozialen Organismus, schließlich seine bahnbrechende Vision von einer Mitteleuropäischen Union als Kernland eines befriedeten Europa sind von bleibendem Wert und können auch unserer Zeit zukunftsweisende Impulse geben.
Frantz war nicht nur ein Zeitgenosse von Bismarck, sondern vor allem der entschiedenste geistig-politische Antipode Bismarcks, der unerbittlichste Kritiker des preußischen Reichsgründers. Die Gegnerschaft zu Bismarck kam nicht aus einem vagen antipreußischen Ressentiment heraus, sondern ihr eigentlicher Quell war ein tieferes Wissen um die geschichtliche Rolle Deutschlands in der Vergangenheit und um den politischen Auftrag, der sich für die Gegenwart und Zukunft daraus ergibt.
Und worin sah Frantz den politischen Auftrag Deutschlands? – Nicht darin, sich in einen abgeschlossenen Nationalstaat zu verwandeln, als nationaler Machtstaat dazustehen in der Mitte Europas! Vielmehr kommt gerade Deutschland als dem eigentlichen Land der Mitte, dem Herzzentrum Europas, aus seiner Geschichte heraus der übernationale Auftrag zu, ausgleichend zu vermitteln und auszusöhnen zwischen den Weltgegensätzen von Nord und Süd, Ost und West, die in Deutschland zusammenlaufen und sich dort konzentrieren wie in einem Prisma. Die „deutsche Frage“ betrifft nicht nur Deutschland, sondern weist weit in den mitteleuropäischen, ja gesamteuropäischen Raum hinein. Dies hat Frantz schon klar erkannt und in zahlreichen Publikationen den Verfechtern eines deutschen Nationalstaates immer wieder entgegengehalten.
Im Revolutionsjahr 1848 stand Deutschland am Scheideweg, und es stellte sich die Frage: welche künftige staatliche Lebensform sollte man sich geben? Zerbrochen war der Deutsche Fürstenbund, dieses von Metternich regierte Restaurationssystem, und machtvoll war der Liberalismus als deutsche Einheitsbewegung auf den Plan getreten. Aber lange Zeit mussten die Abgeordneten in der Paulskirche darüber beratschlagen, wie denn die künftige Verfassung Deutschlands aussehen sollte. Vor allem war ja die Streitfrage, ob Österreich in den politischen Gesamtkörper Deutschlands einbezogen werden sollte oder nicht. Es war die Frage: „kleindeutsch“ oder „großdeutsch“?
Da ließ Constantin Frantz, der bis dahin noch gänzlich Unbekannte, im Jahr 1848 seine erste bedeutendere Druckschrift erscheinen: eine Broschüre von knapp 50 Seiten Inhalt, mit dem Titel: POLEN, PREUßEN UND DEUTSCHLAND. Im weiteren Verlauf des Textes stellte er dort Forderungen auf, die selbst über die Position der „Großdeutschen“ noch weit hinausgingen: Deutschland, so heißt es dort, und zwar einschließlich Österreich, soll sich föderativ ausweiten zu einer größeren mitteleuropäischen Völkerfamilie, soll Kernpunkt werden eines weitausgedehnten kontinental-europäischen Staatenbundsystems. Ein politisch geeinter Länderkomplex stand Frantz vor Augen, der sich erstrecken sollte von der Mündung des Rheins bis in das Baltikum, vom Elsass bis zur Mündung der Donau ins Schwarze Meer, von den Alpen bis an die Küsten der Nordsee. In diesem System einer Mitteleuropäischen Union würde ein föderativ gestaltetes Deutschland im Zentrum stehen, aber nicht als beherrschende Instanz, sondern vielmehr als Vermittler und Friedenswächter. Wie ganz anders wäre die deutsche Geschichte verlaufen, wenn man 1848 diesen Weg zu einer übernationalen Mitteleuropäischen Union beschritten hätte! Es wäre – vermutlich – weder zu einem Ersten noch zu einem Zweiten Weltkrieg gekommen, auch nicht zu jenen nationalistischen Entgleisungen und Gefühlsausbrüchen wie im Kaiserreich von 1870/71, und schon gar nicht zu jener großen nationalen Katastrophe des Nationalsozialismus, unter der wir als Deutsche in gewisser Weise auch heute noch zu leiden haben. Mitteleuropa, politisch geeint und föderativ gestaltet – das ist die Vision des Außenseiters und politischen Romantikers Constantin Frantz.
1.3. Einige Stimmen über Constantin Frantz
Helmut Rüdiger, 1947: „Aber die Stimme des föderalistischen Denkers Konstantin Frantz verhallte in Deutschland ungehört. Sein Werk wurde nicht volkstümlich, nur einzelne, isolierte Oppositionelle fanden in ihm Inspiration. Die konservativen, im Vergangenen wurzelnden Schichten des Volkes wollten nichts von ihm wissen, hielten ihn für antirational und für einen Feind ihrer ökonomischen Privilegien. An den materialistischen, rein klassenmäßigen und streng zentralistischen, „bismarxistischen“ Sozialismus konnte Frantz ebensowenig Anschluss finden, und einen anderen Sozialismus gab es nicht. Der Föderalist Proudhon war ein echter französischer Volksmann, der heimatlose russische Aristokrat Bakunin hatte Anschluss in einen weiten Kreis von Arbeitern und Intellektuellen lateinischer Länder, aber weder Proudhon noch Bakunin fanden größere Freundeskreise im Deutschland ihrer Zeit, wo auch ein Konstantin Frantz einsam und unverstanden blieb. Dort ging es im Zeichen Hegels, Bismarcks und der Sozialdemokratie herrlichen Zeiten entgegen. Konstantin Frantz blieb ein Prediger in der Wüste.“2
Golo Mann, 1958: „Der erfinderischste unter den Kritikern Bismarcks, Konstantin Frantz, hat damals allerlei Projekte vorgelegt, durch die das falsche Reich noch zu einem echten sollte umgewandelt werden können: ein engerer Bund westdeutscher Staaten, dem auch etwa die Schweiz und die Niederlande freiwillig beitreten würden; dieser verbündet sich mit den zwei nach Osten ausgreifenden halbdeutschen Staaten, Österreich und Preußen, die ihrerseits wieder Ungarn und Polen mit dem Westbund völkerrechtlich zu verknüpfen hätten, das Ganze ohne Hauptstadt, schwebend zwischen Bundesstaat und europäischem Völkerbund, bestimmt, den engen Begriff des Nationalstaates, der für Deutschland und Mitteleuropa nimmermehr taugte, zu überwinden. Man liest dergleichen heute mit gerührter Zustimmung, mit dem Gefühl: wünschbar wäre das allerdings gewesen. Die Frantzsche Kritik an Preußen-Deutschland, an der unhistorisch-widernatürlichen Fassade des Bundesstaates hat Hand und Fuß. Es war ja aber nicht Deutschland allein, das damals auf den Staat, den nach außen scharf abgegrenzten, nach innen allmächtigen, hinauswollte; es hat es anderen nur nachgemacht. Unter lauter Staaten konnte es kein 'Reich' geben. Der Einladung, sich Frantz' West-Bunde anzuschließen, hätten die Schweiz und Belgien gewiss schaudernd abgelehnt. Damals waren das papierene Träume. Heute ist es etwas anderes, da lohnt es sich, zu den Schriften von Frantz zurückzukehren.“3
Rudolf Rocker, 1974: „Frantz erblickte in der Einheit des Reiches unter preußischer Führung ein verhängnisvolles Zeichen für den kulturellen Niedergang Deutschlands und eine unberechenbare Gefahr für die zukünftige politische und soziale Gestaltung Europas. Er bekämpfte die politische Zentralisation und die systematische Militarisierung des Landes mit der größten Entschiedenheit und vertrat den Standpunkt, dass das neue Deutschland in der Wirklichkeit nur ein vergrößertes Preußen darstelle, das sich in offenbarem Widerspruch mit allen Überlieferungen der deutschen Stämme befand und alle Errungenschaften einer alten und großen Kultur zu Grabe läutete. Sein Name ist heute in Deutschland vergessen; doch was er voraussagte, hat sich in einem Maße erfüllt, das seine schlimmsten Befürchtungen weit in den Schatten stellte.“4
1.4. Constantin Frantz' Lebenslauf
Gustav Adolf Constantin Frantz wurde am 12. September 1817 in Oberbörnecke, einem Dorf im ehemaligen Fürstentum Halberstadt, geboren5. Er war der jüngste Sohn unter den acht Kindern des protestantischen Pfarrers Klamer Wilhelm Frantz (1773–1857), der mit der aus einer altehrwürdigen Hugenottenfamilie stammenden Karoline Katharine Auguste Catel6 (1780–1825) verheiratet gewesen war. Vom Vater hatte Constantin Frantz eine tiefe Religiosität, Sinn für Gelehrsamkeit und eine gewisse künstlerische Neigung geerbt, von der Mutter jedoch – wie Ottomar Schuchard meint – „die Zähigkeit in der Verfolgung seiner Ideen“7, also die kalvinistische Kämpfernatur. Früh schon starb die Mutter, und im Alter von 13 Jahren verließ der hochbegabte Constantin Frantz das Elternhaus, um zunächst in Aschersleben und dann in Halberstadt das Gymnasium zu besuchen. Es war eine Zeit der politischen Gärung in Deutschland. Auf dem Hambacher Fest (27. Mai 1832) meldete sich eine radikale, liberal-demokratische Opposition zu Wort. In dieser Zeit der vormärzlichen Agitation erwachte auch in dem jungen Gymnasiasten Constantin Frantz der Sinn für das Politische:
„Es war damals die Zeit des Hambacher Festes, überall ein Auflodern des demagogischen Geistes, der die Universitäten ergriff und bis in die Gymnasien drang. Damit bekannt geworden, wurde ich alsbald ein vollkommener Demagoge. Es bildete sich eine Art von Bruderschaft, man besprach Verschwörungspläne, sang Revolutionslieder und las verbotene Bücher. Ich hielt politische Reden, declamierte in der Schule revolutionäre Gedichte, suchte meine Mitschüler aufzuwiegeln, und trieb das Ding so arg, dass ich polizeilich beobachtet wurde und der Director meinetwegen viel Unannehmlichkeiten hatte.“8 Zu diesem Liberalismus gesellte sich alsbald der Rationalismus; doch die Begeisterung blieb eine vorübergehende: „Das hielt nun eine zeitlang so an. Indessen bestand meine ganze theologische und politische Kenntnis nur in einigen abstracten Begriffen, die in ihren Consequenzen bald erschöpft waren und auf die Dauer nicht genügen konnten. Mit Goethes Werken bekannt geworden, wurde ich lebhaft davon ergriffen und alsbald von meinem ganzen bisherigen Treiben abgelenkt.“9
Am 16. März 1836 bezog der junge Frantz die Universität Halle, um Mathematik und Naturwissenschaften zu studieren. Die Universität Halle war damals eine Hochburg des Hegelianismus. Frantz hörte Vorlesungen bei den orthodoxen Rechtshegelianern Erdmann und Schaller. Als „Anhänger der Althegelschen orthodoxen Lehre“10 schrieb er sich am 1. Mai 1839 an der Universität Berlin ein, wo er neben Mathematik und Physik auch Philosophie, Staatswissenschaften und Geschichte belegte. 1840 bestand er das Staatsexamen; er legte daraufhin sein Probejahr an einer Berliner Realschule ab. Am 2. Januar 1841 in Jena zum Doktor promoviert, ging anfänglich sein Streben auf die Erlangung eines akademischen Lehramtes. Als sich alle dahingehenden Hoffnungen zerschlugen, begann er, sich als freier Publizist zu betätigen. Ab 1841 trat er im Kreis der Junghegelianer mit ersten Veröffentlichungen hervor11. Ganz vom Hegel'schen Geist durchdrungen, schrieb er 1842 sein erstes Buch DIE PHILOSOPHIE DER MATHEMATIK.
Einen wirklichen Wendepunkt in seiner geistigen Entwicklung erreichte der junge Frantz um das Jahr 1843, als er sich vom Hegelianismus lossagte und sich einem an der Spätphilosophie Schellings orientierten überkonfessionellen Geist-Christentum zuwandte. Ein tief eingewurzelter, wenngleich längere Zeit unter der Kruste des Rationalismus verdeckter Wesenszug kam hier zum Durchbruch: die Neigung zu romantisch-mystischer Innerlichkeit. Über seine Wende von Hegel zu Schelling schreibt Frantz viele Jahre später in einem Brief an Richard Wagner (datiert vom 8. 2. 1867): „Auf der Universität studierte ich Physik, Mathematik und Philosophie, und wurde zuvörderst Hegelianer, habe auch ein Hegelsches Buch geschrieben (….). Was mich dann darüber hinaus brachte, war theils der Neu-Schellingianismus und noch viel mehr die Bibel, zumal Evangelium Johannes. Ich las einmal in einer glücklichen Stunde Cap(itel) XVII, und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich erkannte, wie so etwas kein Mensch aus sich selbst sagen kann, sondern es ist göttliche Einwirkung; und da war mit einem Schlage nicht nur die Hegelei sondern der ganze Rationalismus für mich todt. Ich befand mich urplötzlich in einer andern Weltanschauung, deren Elemente dann freilich lange genug in mir gährten, und diverse phantastische Schriften hervorriefen, die ich später makulirt habe, ehe ich zu einem ruhigeren Denken gelangte. Je mehr ich mich nun dem Realen zuwandte, kam ich von der Theologie auf die Politik, worin ich mich dann festgesetzt, als dem mir allein entsprechenden Gebiete.“12
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854) war wohl der bedeutendste philosophische Inspirator der deutschen Romantik. Mit anderen großen Denkern der Romantik wie den Brüdern Schlegel, Novalis und Franz von Baader stand er in regem geistigem Austausch. In seiner Spätphilosophie, die ab 1810 mit den sogenannten WELTALTER-Fragmenten einsetzt, bemühte er sich, der bisherigen „negativen“ Philosophie – d. h. der reinen Vernunftphilosophie – eine positive Philosophie entgegenzustellen, die den Sinn der Heilsgeschichte aufschlüsseln sollte. Sie sieht in der Inkarnation des Christus-Logos das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte, das – in den antiken Mysterienlehren schon angekündigt – seine endgültige Erfüllung erst in einem johanneischen Christentum der Zukunft finden wird.
1841 wurde Schelling an die Berliner Universität berufen, um – wie der damalige preußische König Friedrich Wilhelm IV. sich ausdrückte – „die Drachensaat des Hegelschen Pantheismus“ zu bekämpfen“13. Schellings Berliner Antrittsvorlesung im Wintersemester 1841 / 42 unter dem Titel PHILOSOPHIE DER OFFENBARUNG wurde ein kulturpolitisches Ereignis ersten Ranges14. Viele bedeutende Männer des 19. Jahrhunderts waren damals unter Schellings Hörern, so Jakob Burckhardt, Alexander von Humboldt, Friedrich Engels, Michael Bakunin, Sören Kierkegaard. Unter ihnen war auch der junge und gänzlich unbekannte Constantin Frantz. Mochte sich das schnellebige Berliner Publikum recht bald von Schelling wieder abwenden – seine Antrittsvorlesung war insgesamt ein Fiasko –, so hat Frantz doch zeitlebens an der positiven Philosophie Schellings festgehalten. Noch im Alter widmete er ihr ein Denkmal mit dem 3bändigen Werk SCHELLINGS POSITIVE PHILOSOPHIE (1879 /80).
Im Jahre 1843 verfasste Frantz seine große Schelling-Apologie, GRUNDZÜGE DES WAHREN UND WIRKLICHEN ABSOLUTEN IDEALISMUS, ein Werk von immerhin 320 Seiten, das er zusammen mit seinen im Folgejahr erschienenen Speculativen Studien mit einem Begleitschreiben an den damaligen preußischen Kulturminister Eichhorn sandte. Der Konservative Eichhorn, der bestrebt war, der radikalen Publizistik des Vormärz entgegenzutreten, hatte in seinem Ministerium ein „Lesekabinett“ eingerichtet, in dem Frantz schon 1844 als „referendierender Literat“ eingestellt wurde. Seine Aufgabe bestand darin, dem Ministerium über die laufend erscheinenden Zeitschriften und ihre politisch-kulturellen Tendenzen Bericht zu erstatten.
Aber die rein referierende Tätigkeit konnte Frantz auf Dauer nicht befriedigen; es drängte ihn zu einer mehr praktischen Wirksamkeit. Im Laufe des Jahres 1846 hatte sich sein Interesse eindeutig der Politik zugewandt. Von Haus aus Preuße, befasste er sich zunächst mit dem Verhältnis Preußens zu seinen slawischen Nachbarn. In einem Brief an den Geheimrat Eilers vom 16. Juni 1847 bittet er darum, für ein halbes Jahr von seinem Amt suspendiert und auf eine Studienreise geschickt zu werden, die es ihm ermöglichen soll, die slawischen Angelegenheiten unmittelbar vor Ort zu studieren. Das Ersuchen wurde bewilligt, und in der zweiten Jahreshälfte 1847 bereiste Frantz die Landstriche Böhmen, Steiermark, Kroatien, Siebenbürgen, Schlesien und Posen. Die Frucht dieser Studienreise war seine im Revolutionsjahr 1848 erschienene Denkschrift POLEN, PREUßEN UND DEUTSCHLAND.
In dieser Schrift taucht erstmals jene überwältigende Mitteleuropa-Vision auf, die Frantz sein Leben lang in zahlreichen Veröffentlichungen vertreten wird: die Vereinigten Staaten von Mitteleuropa als europäisches Föderativsystem. Frantz stellte sich zunächst eine föderative Verbindung zwischen Preußen und Polen vor; um Polen herum sollte sich dann ein „baltischer Föderativstaat“ bilden, der sich über Preußen mit dem Deutschen Bund konföderiert. Sein südliches Gegenstück sollte ein „Föderativstaat der Donauvölker“ sein, der über Österreich in ein föderatives Verhältnis zu Deutschland treten soll. Westlicherseits sollten sich dann noch die Schweiz, Holland und Belgien diesem Föderativgebilde anschließen: so entstünde ein „Mitteleuropäischer Bund“, in dessen Zentrum die Trias Deutschland / Preußen / Österreich steht. Eine politische Utopie? Die Vision eines Romantikers? Oder eine realpolitische Alternative zum Bismarckstaat? – Ein gangbarer Weg für die Zukunft gar, als Alternative zum Bürokraten-Europa? –
Das Zukunftsweisende der Frantz'schen Mitteleuropa-Vision soll später noch eingehend behandelt werden; hier aber möge der Verfasser der Denkschrift von 1848 selbst zu Worte kommen: „Also ein großes föderatives Deutschland, nach Osten hin selbst wiederum durch Preußen und Österreich mit Föderativstaaten verbunden, und demnach ein großes föderatives Ländergebiet von jenseits der Schelde bis jenseits der Düna, von den Schweizerbergen bis zum Pontus. Gewiß: Das ist etwas Größeres als ein centralisirter deutscher Nationalstaat dem es nach Osten und nach Westen hin an der natürlichen Ergänzung fehlen würde; der das Bestehende gewaltsam zerstört; die mannigfaltige Entwicklung des deutschen Lebens beschränkt; und dem Weltberufe unsrer Nation widerspricht. Deutschland, in der Mitte der Völker stehend, ist nicht dazu bestimmt sich abzuschließen und zu centralisiren wie Frankreich; es ist dazu berufen die Völkereinheit zu vermitteln, und diese Einheit selbst durch einen großen föderativen Organismus zu repräsentiren.“15
Bezeichnenderweise gebraucht Frantz hier auch den Begriff eines sozialen „Organismus“. Und was geschah, auf das Erscheinen der Denkschrift hin? Der Minister Eichhorn hatte sie am 3. März 1848 an König Friedrich Wilhelm IV. geschickt, doch dieser bekam sie gar nicht zu Gesicht. Die revolutionären Ereignisse des Frühjahrs 1848 waren dazwischen getreten: Das Ministerium Eichhorn musste zurücktreten, und damit verlor auch Frantz zunächst einmal seine Stellung. Seine Denkschrift wurde schon am 19. März 1848 zuden Akten gelegt! – Die Weltgeschichte ging über zur Tagesordnung.