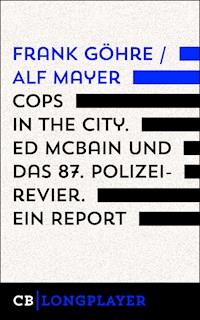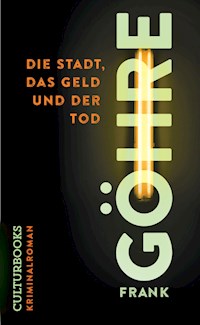6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ergänzte digitale Neuauflage. Über das Buch Friedrich Glauser (1896–1938), »Vater« der deutschsprachigen Kriminalliteratur, war seit früher Jugend süchtig. Zeitlebens war er vom Morphium beherrscht, vom »Mo«, wie er es nannte. Von seinen 42 Lebensjahren verbrachte er über acht Jahre in Irrenhäusern, psychiatrischen Anstalten und Kliniken. Dort interniert, schrieb er seine ersten »Wachtmeister Studer«-Romane. »Mo. Der Lebensroman des Friedrich Glauser« ist die literarische Aufarbeitung von Friedrich Glausers ungewöhnlicher Biografie. Frank Göhre erkundet die weißen Räume zwischen den biografischen Fakten. Er zeichnet das Bild eines in sich Verstrickten, eines Umtriebigen, dessen bewegtes Leben eine ebenso faszinierende wie tragische Suche nach innerer Ruhe, nach Beständigkeit ist und den verzweifelten Wunsch offenbart, »doch ein wenig anders leben« zu können. Frank Göhre geht mit seiner Hauptfigur respektvoll um, zeigt viel Liebe und Verständnis, ohne dabei unkritisch zu werden. In differenzierten Schilderungen und pointiert-lebendigen Dialogen wird der außergewöhnliche Mensch Friedrich Glauser sichtbar. Ein lesenswertes Lebensdenkmal! Das sagt die Presse »›Mo‹ ist ein Roman, der zutiefst berührt, weil er von nichts weniger erzählt als dem, was Ziel allen Lebens ist: Erlösung.« Volker Albers, Hamburger Abendblatt »Göhre erzählt geradezu im Stil des Film noir, in harten Schnitten und realistischen Dialogen. Er tut dies zudem mit viel Liebe und Verständnis für seine Hauptfigur. Er schildert, wie Glauser gedacht und gefühlt und gesprochen haben könnte, das ist seine Erfindung. Dabei stützt er sich auf die bekannten biografischen Daten und zieht auch einige schriftliche Zeugnisse Glausers heran (die im Text kursiv gesetzt sind).« Oliver Lüdi, Programm Zeitung »Weit mehr als eine Ehrenbezeigung«. Die Welt »Mit viel Zuneigung sieht Göhre dem unglücklichen Glauser beim Schreiben zu, beim Entzug, bei seinen Beziehungen, guten wie schlechten.« Wolfgang Bortlik, 20 Minuten, Zürich, 27.10.2009 »Eine ungemein packende Story über das zerrissene Leben des Schweizer Schriftstellers, der als ›Vater‹ des deutschsprachigen Kriminalromans gilt.« Hamburger Abendblatt, »Empathie hält der Autor für seine Figur bis zum Ende aufrecht, bleibt durchweg spannend und psychologisch differenziert in seinen Schilderungen.« www.literaturkritik.de,
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch
Friedrich Glauser (1896–1938), »Vater« der deutschsprachigen Kriminalliteratur, war seit früher Jugend süchtig. Zeitlebens war er vom Morphium beherrscht, vom »Mo«, wie er es nannte. Von seinen 42 Lebensjahren verbrachte er über acht Jahre in Irrenhäusern, psychiatrischen Anstalten und Kliniken. Dort interniert, schrieb er seine ersten »Wachtmeister Studer«-Romane. »Mo. Der Lebensroman des Friedrich Glauser« ist die literarische Aufarbeitung von Friedrich Glausers ungewöhnlicher Biografie.
Frank Göhre erkundet die weißen Räume zwischen den biografischen Fakten. Er zeichnet das Bild eines in sich Verstrickten, eines Umtriebigen, dessen bewegtes Leben eine ebenso faszinierende wie tragische Suche nach innerer Ruhe, nach Beständigkeit ist und den verzweifelten Wunsch offenbart, »doch ein wenig anders leben« zu können.
»›Mo‹ ist ein Roman, der zutiefst berührt, weil er von nichts weniger erzählt als dem, was Ziel allen Lebens ist: Erlösung.« Volker Albers, Hamburger Abendblatt
Frank Göhre geht mit seiner Hauptfigur respektvoll um, zeigt viel Liebe und Verständnis, ohne dabei unkritisch zu werden. In differenzierten Schilderungen und pointiert-lebendigen Dialogen wird der außergewöhnliche Mensch Friedrich Glauser sichtbar. Ein »lesenswertes Lebensdenkmal« (Focus)!
Über den Autor
Frank Göhre
Mo. Der Lebensroman des Friedrich Glauser
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2015, ergänzte digitale Neuauflage
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Erstausgabe Print: © Pendragon Verlag 2008
eBook-Cover: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: 01.02.2015
ISBN 978-3-944818-73-3
Inhaltsverzeichnis
Zürich 1916/17
Er ist jung, noch nicht volljährig. Er hat ein schmales Gesicht, dunkles, glattes Haar und unter den dichten Augenbrauen blicken die großen Augen ein wenig melancholisch. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Dreiteiler und darauf abgestimmter Krawatte. Seiner ersten Zimmerwirtin in der Bolleystraße 7 stellt er sich als Frédéric Glauser vor, nach Zürich gekommen, um an der nahe gelegenen Universität Chemie zu studieren.
Es ist der Januar des Jahres 1916 und die neutrale Schweiz beherbergt zu dieser Zeit sowohl Pazifisten, Anarchisten und Revolutionäre (Lenin) wie auch die internationale künstlerische Avantgarde: »Angeekelt von den Schlächtereien des Weltkrieges 1914, gaben wir uns in Zürich den schönen Künsten hin. Während in der Ferne der Donner der Geschütze grollte, sangen, malten, lebten, dichteten wir aus Leibeskräften. Wir suchten eine elementare Kunst, die den Menschen vom Wahnsinn der Zeit heilen, und eine neue Ordnung, die das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle herstellen sollte«, schreibt der deutsch-französische Maler, Bildhauer und Lyriker Hans Arp, Mitbegründer der Dada-Bewegung.
Die Erklärung des Wortes Dada ist umstritten. Die einen nennen ein französisches Wörterbuch als Quelle – dada, frz. für »Steckenpferd« –, andere ordnen es der Kleinkindersprache zu, und auch ein in diesen Jahren beliebtes Schweizer Haarwaschmittel namens DADA soll die internationale Künstlergruppe zur Namensgebung angeregt haben.
Der soeben erst in Zürich eingetroffene Frédéric Glauser hört später noch eine andere Version: »... es ist außerdem noch eine doppelte Bejahung, ›ja, ja‹ heißt es, in den slawischen Sprachen wenigstens, und ich glaube, auch in der rumänischen.«
Frédéric Glauser schreibt sich an der Uni ein und belegt die Fächer »Organische Experimentalchemie« und »Chemisch-analytisches Praktikum für Chemiker«. Doch allzu ernst nimmt er es mit dem Studium nicht. Gemeinsam mit einem Freund stellt er die erste Ausgabe einer Literaturzeitschrift – »Le Gong« – zusammen, in der natürlich auch Texte der beiden Herausgeber erscheinen sollen; von den französischen Symbolisten beeinflusste Prosaarbeiten und Nachdichtungen. Das nimmt ihn voll in Anspruch, und er ahnt nicht im Entferntesten, dass man nur wenig später »Erkundigungen« über sein Treiben einholen wird. Da ist dann protokolliert, er mache »auffallend viele ›Freitage‹, während welcher Zeit er sich nachts in leichtsinniger Gesellschaft herumtrieb und tagsüber dann in seinem Zimmer seine müden Glieder ausruhen ließ. Wegen dieser Unregelmäßigkeit seiner Lebensweise, welche oft den Nebenbewohnern ruhestörend war, wurde ihm das Logis gekündigt, und er verzog sich nach der Möhrlistr. 17 zu Hardmeier.«
Diese polizeilich durchgeführten Ermittlungen hat der Vater veranlasst, der als gebürtiger Schweizer im fernen Mannheim an der Handelshochschule unterrichtet. Er misstraut dem Sohn seit jeher, hat ihn schon als Schüler der Lüge und des Diebstahls bezichtigt und glaubt, dass er nun als Student total verlottert. Aktuell kommt hinzu, dass Frédéric ihm per Brief erklärt hat: »Wenn die Gesellschaft, an deren Rand ich wohl leben werde, so ist, wie sie mir bis heute erscheint, und wenn Du wirklich glaubst, eine ihrer Stützen zu sein, dann bedanke ich mich. Ich ziehe es vor, weiterhin in freier Luft zu atmen, wie es mir entspricht, in einer Luft, die nicht vergiftet ist, und wenn Du mich für einen Querulanten, einen Bohemien, einen heruntergekommenen Menschen hältst, so mögen das Bezeichnungen sein, die für Dein Ohr bloß beleidigend klingen; ich dagegen rühme mich ihrer ...«
Er geht nun gar nicht mehr zur Uni: »Ganze Tage blieb er im Bett, ohne krankheitshalber daran gebunden gewesen zu sein«, ist in dem Polizeiprotokoll zu lesen, »nachts ging er dann wieder seiner Gesellschaft nach, hielt sich nach seinen daselbst selber gemachten Angaben in den hiesigen Caféhäusern auf, machte Kleintheaterbesuche und Autofahrten, durch welche Veranstaltungen er nach gemachten Wahrnehmungen sehr viel Geld durchtat.«
Das »Café Odeon« (Limmatquai 2), das (nicht mehr existierende) »Café des Banques« (am Beginn des Rennweges) und das Café und heutige Restaurant »Terrasse« (Limmatquai 3) sind die Lokalitäten, in denen Glauser jetzt Abend für Abend anzutreffen ist. Er liest und schreibt ein wenig, trinkt »große Quantitäten« Alkohol, raucht Kette und macht Bekanntschaften – »Damenbekanntschaften«. Noch erhält er vom Vater monatlich 170 Franken, doch damit kommt er bei dieser Lebensführung schon lange nicht mehr hin. Er macht Schulden, schnorrt und lebt weitgehend auf Pump.
Es wird Herbst und er fasst den Plan, alles hinter sich zu lassen und nach Amerika auszuwandern. Doch just in diesen Tagen lernt er den österreichischen Maler »Mopp«, Max Oppenheimer, kennen und sitzt dann als literarisch ambitionierter und wissbegieriger »Fred« oder »Clauser« mit am Tisch der in Zürich aktiven Dadaisten Tristan Tzara und Hugo Ball, der Maler Marcel Janco und Hans Richter. Das ist ungemein anregend, und er saugt begierig auf, was bei ihnen Thema ist: »Ich muss in einer halben Stunde die Namen von etwa einem Dutzend mir vollkommen unbekannten Berühmtheiten kennen lernen und meine Unwissenheit bedrückt mich tief. Wer kannte damals Blaise Cendrars, Jakob, den Dounier, Rousseau, Picasso, Derain, Franz Marc und Kandinsky?«
Die Runde lobt und kritisiert, debattiert bis tief in die Nacht über Individualismus und die Zerstörung bürgerlicher Ideale und Normen. Gefühle und Psychologie sind aus der Kunst auszumerzen. Propagiert wird die willkürliche und zufallsgesteuerte Aktion in Bild und Wort – »Dada« eben, Spontaneität, Anti-Routine, Anarchismus. Alles muss in Bewegung sein, springen und hüpfen wie die Silben in dem Lautgedicht »Karawane« von Hugo Ball.
Die Autoren Hugo Ball und Tristan Tzara sind die Wortführer der durchzechten Nächte, in denen auch das gerade erst in Mode gekommene Kokain geschnupft wird: »Was kümmert uns der Sonnenschein? Hochaufgetürmte Tage stürzen ein ...« (Emmy Hennings).
Von Hugo Ball ist der nicht mehr Student Glauser am meisten beeindruckt: »Während die anderen mir sehr fremd bleiben (ich habe immer den unangenehmen Eindruck, dass ich es nicht wagen darf, künstlerische und literarische Urteile zu fällen, denn alles, was mir gefallen hat, wird als sentimentaler Kitsch abgetan, mit Achselzucken und verächtlichem Schnaufen durch die Nase), ist Ball der einzige, der wie ein ruhiger, älterer Bruder wirkt.« Die Sympathie ist gegenseitig.
»Glauser«, schreibt Ball an seine Lebensgefährtin Emmy Hennings, »Glauser ist ein sehr lieber Junge und ein wenig in mich verliebt. Er begleitet mich zu Fuß von Richters Wohnung bis in die Hornbachstraße (Nr. 68, Hugo Balls vorletzte Adresse in Zürich).«
An einem der nächsten Abende kommt dann auch Emmy Hennings ins »Café Odeon«: »Ein kleines, blondes Geschöpf, dem auch der grünspanige Sweater nichts von seiner Zierlichkeit rauben kann, schleppt viel kalte Nebelluft von draußen in den Rauch des Lokals ... Sie blickt mich zuerst misstrauisch an. Ihre kleine Hand mit den abgebissenen Nägeln ist fieberheiß, und diese Hitze will gar nicht zu dem weißen Gesicht passen. Sehr erregt ist diese kleine Frau, sie zittert immer ein wenig, wie eine bunte Papierschlange vor einem Ventilator.«
So notiert es Glauser, und keine Frage: Der noch Zwanzigjährige ist von der elf Jahre älteren, in Flensburg geborenen Kabarettistin nicht nur stark beeindruckt, er muss sich auch eingestehen, sich auf Anhieb in sie verliebt zu haben.
Es sind die Wintermonate 1916/17. Ende Juli ist das erst im Februar 1916 eröffnete »Cabaret Voltaire« in der Spiegelgasse 1 geschlossen worden, der »Geburtsort des Dada«. Nur ein paar Häuser weiter, in der Nummer 14, grübelte da noch der Exilant Lenin über seine Strategie für einen bewaffneten Aufstand. In dem engen Zürcher Altstadtgässchen befanden sich damit zeitgleich zwei revolutionäre Keimzellen dicht beieinander: eine politische und eine künstlerische. Jetzt suchen Ball und Tzara neue Räume für ihre avantgardistischen Ausstellungen und spektakulären Veranstaltungen. Der befreundete und sie fördernde Buchhändler und Antiquar Han Corray stellt ihnen seine Galerie in der Bahnhofstraße 19, Eingang Tiefenhöfe 12, zur Verfügung, während Glauser, der sich inzwischen den Dadaisten zugehörig fühlt, »aus gleichen Gründen, wie bezüglich seinem ersten Logis« auch eine neue Unterkunft benötigt: »Er kam dann zu Arx in die Leonhardstraße 6. Hier war er nicht mehr imstande, sich Geld zu beschaffen, trotzdem er sich (nach seinen Äußerungen) dafür bemühte. Aus diesem Grunde (er sollte das Zimmer im voraus bezahlen) schickte ihn Frau von Arx wieder fort, nachdem sie hatte konstatieren müssen, dass er zu jeder Stunde, bei Tag und bei Nacht, Damenbesuche in sein Zimmer hatte kommen lassen.« – Damenbesuche!
Die Emmy, die Hennings, die eigentlich mit Hugo Ball Liierte, munkelt man in den Künstlerkreisen, und obwohl nicht zu belegen, gänzlich von der Hand zu weisen ist es nicht. Als einen sehr hübschen und offenherzigen Jungen hält Emmy Hennings den aufgrund seiner Lebensführung gern als »praktischer Dadaist« titulierten Glauser in Erinnerung, zu dem nach und nach ein tieferes und stärkeres Interesse entstanden sei: »Er schien mir jedoch nicht das mindeste Geltungsbedürfnis zu haben. Ich glaube sogar, es fehlte ihm etwas an natürlichem Selbstbewusstsein. Er wußte oder dachte nicht daran, dass er etwas konnte ... aber was mir so gefiel an Clauser: es lag ihm mehr daran zu leben als zu schreiben. Er nahm in Unbefangenheit und gierig das Leben auf ohne an die literarische Verwertung zu denken. Er schrieb wie zum Spiel, zum Zeitvertreib, so nebenbei.«
Doch der Winter ist hart und Glausers vermeintliche Lebens- und Liebeslust wird arg gedämpft. Er hat keine warme Kleidung, streift nach wie vor in seinen dünnen Regenmantel gehüllt durch die zugigen Gassen. Weder Mütze, noch Schal und Löcher in den Sohlen – rasch fängt er sich eine üble Erkältung ein und bekommt »mitten in der Nacht eine starke Lungenblutung, musste um Mitternacht einen Arzt aufsuchen; dieser machte mir eine Morphiumeinspritzung und ließ mich konzentriertes Salzwasser trinken.«
Suchtgefährdet ist Frédéric Glauser seit früher Jugend – Sucht verstanden als Suche nach Geborgenheit, nach Zuneigung und Verständnis, nach all dem, was ihm der herrische und ihn ständig zur Rechenschaft ziehende Vater verweigert. Er hat Äther geschnüffelt, konsumiert Wein und Absinth in rauhen Mengen, raucht eine Zigarette nach der anderen und nimmt auch Kokain. Nichts aber ist vergleichbar mit dem, was jetzt das Morphium bei ihm auslöst: »Plötzlich wurde ich ganz wach. Ein sonderbares, schwer zu beschreibenden Glücksgefühl ›nahm von mir Besitz‹ (man kann es kaum anders ausdrücken). Trotzdem es mir damals materiell sehr schlecht ging, war alles plötzlich verändert, die Not hatte ihre Wichtigkeit verloren, sie war nicht mehr vorhanden, ich hielt das Glück in den Händen; es war, um einen schlechten Vergleich zu gebrauchen, als ob mein Körper ein einziges Lächeln wäre.«
Der Wunsch, dass dieser Zustand dauerhaft sei, ist eine Illusion. Dennoch aber Antrieb, sich die Droge immer wieder neu zu beschaffen, zwangsläufig auch illegal. Frédéric Glauser ist in diesen ersten Monaten des Jahres 1917 vom Morphium, dem »Mo«, angefixt. Er wird zum Junkie. Und so steht er dann am 29. März bei der Eröffnung der neuen »Galerie Dada« in der Bahnhofstraße mit Arbeiten von Kandinsky und Paul Klee neben Emmy Hennings, Hugo Ball und Tristan Tzara auf dem Podium und trägt eigene Verse vor: »Farbige Gifte sind trostreich, wenn Augen sich schielend verdrehn, und auf leuchtender Straße die Puppen springen. Weit ist leerer Schlaf. Tod winkt ... als Traum.«
Auch an den nächsten Dada-Soireen ist Glauser aktiv beteiligt. Als »Tod in blaubläulicher Maske, mit einem fahlen leuchtenden Auge« (Emmy Hennings) tritt er in der Premiere-Aufführung von Oskar Kokoschkas Stück »Sphinx und Strohmann« auf. Ein andermal »bearbeitet« er neben Hugo Ball am Klavier ein Tamburin. Die beiden intonieren einen »Negertanz« und singen ein altes arabisches Lied: »Tra patschiamo guera, tra patschiamo gonooooi ...«
Emmy Hennings, Tzara und weitere Dadaisten »in schwarzen Trikots, mit hohen, ausdruckslosen Masken bekränzt, hopsen und heben die Beine im Takt, grunzen wohl auch die Worte mit. Die Wirkung ist erschütternd. Das Publikum klatscht und lässt sich die belegten Brote schmecken, die in den Pausen verkauft werden ...« – von Glauser, der auch oft an der Kasse sitzt.
Die Zeit rast dahin – wie im Rausch, im wahrsten Sinne des Wortes. In den Augen der Künstlerfreunde scheinen Emmy Hennings, Hugo Ball und Glauser eine Ménage-à-trois zu praktizieren. Ihre Auftritte in der »Galerie Dada« sind jedenfalls sehr harmonisch. Sie sind aufeinander eingespielt, ergänzen sich und inspirieren sich auch gegenseitig. So ist es Hugo Ball, der den über »viel Sinn für dichterische Schwingungen« verfügenden Glauser anregt, sich ebenfalls an Lautgedichten zu versuchen.
»Es ist wirklich möglich«, schreibt Glauser auf diese bewegte Zeit zurückblickend, »Vokale und Konsonanten so aneinanderzureihen, dass Wohllaut und Rhythmus entstehen ... meine Spezialität war, Sprachensalat zuzubereiten. Meine Gedichte waren deutsch und französisch. Ich erinnere mich nur an einen Vers: Verzahnt und verheert sont tous les bouquins.« ... verheert sind alle alten Böcke, sind die Kriegstreiber, die Täter, die drohenden und strafenden Väter.
»F. Glauser: ›Vater‹, ›Dinge‹ (eigene Verse)«, ist auf dem Handzettel der 3. Dada-Soiree am 28. April 1917 zu lesen. »Das Lächeln grinst so grell und flüstert von roten Blättern, die der Nebel streichelt«, trägt Glauser vor und, Emmy Hennings Blick suchend: »Das Paradies ist seidenschwarze Nacht und stumme Stille ohne Stern ... doch stets noch wehen die Fetzen meines Himmels durch farbige Einsamkeiten, aus sanften Giften will ich bauen meinen Traum ...«
Ende Mai schließt die »Galerie Dada«. Hugo Ball und Tristan Tzara gehen im Streit auseinander. Emmy Hennings übernimmt die Auflösung. Die Galerieabrechnung weist ein Defizit auf.
Der Dada-Mitbegründer Hans Arp kann da nur die Schultern zucken und spricht erst viele Jahre später von »unserem Dadakassierer, dem lieben Glauser, dem Wachtmeister Studer, der ein begabterer praktischer Dadaist war als die meisten unter uns und dies auch einwandfrei unter Beweis stellte, indem er uns zu Schuldnern und Leidtragenden machte.«
Dennoch verlassen Emmy Hennings und Hugo Ball gemeinsam mit Glauser die Stadt an der Limmat – Ball, des Dadaismus überdrüssig und sich nach ländlicher Ruhe sehnend, Emmy Hennings in Vorfreude auf ein Zusammentreffen mit ihrer Tochter aus erster Ehe und Glauser aus berechtigter Furcht vor dem über sein »Schmarotzer- und Müßiggängerleben« informierten und empörten Vater. Der lässt ihn dann auch vom Waisenamt der Stadt Zürich »in Abwesenheit« rechtskräftig entmündigen.
Die ganze Geschichte ist hochgradig unschweizerisch, dachte Studer dunkel, obwohl alle Handelnden Schweizer sind.
Friedrich Glauser, »Die Fieberkurve« Geschrieben im Dezember 1935,
Fort, nur fort, weit weg ...
Er lockerte die Schlinge, ließ das Stück Kordel achtlos zu Boden fallen. Hitze schoss durch die Venen, sein Herzschlag beschleunigte sich.
Im vorderen Raum trommelte der Gnom auf bleiche Schädel.
Und die kleine Frau sang. Sie sang Man kann mitunter scheußlich einsam sein ... Sie sang mit brüchiger Stimme.
Gläser klirrten, Stühle wurden gerückt. Einige Leute verließen die Soiree. Es war spät geworden, weit nach Mitternacht.
Auch er brach jetzt auf, steckte die Spritze ein und warf sich den Mantel über. Es war ein heller, dünner Mantel, sein einziger.
Draußen wehte ein unangenehmer Wind. Finster war die Straße, wie ausgestorben die Stadt.
Zürich, satt und bieder. Und doch auch Unterschlupf für Flüchtlinge aller Nationalitäten, für Deserteure und Pazifisten, für Anarchisten und die künstlerische Avantgarde. Selbst für jemanden wie ihn.
Ihm war ein wenig schwindelig. Der Himmel still und leise ... dann nutzt es nichts, mit sich nach Haus zufliehn, klang es noch in ihm nach: Nach Haus, nach Haus ... Das Gehen fiel ihm schwer, sein Herz pochte wie verrückt. Er glaubte zu wissen, warum es diesmal so war. Er hatte auf der Bühne den Vater heraufbeschworen und ihn des großen Krieges beschuldigt, des infernalischen Gemetzels, der gnadenlosen Vernichtung. Ausgespien hatte er vor ihm, hatte getobt und gerast, und der Gnom hatte dazu Purzelbäume geschlagen und gejammert und gequäkt.
Papa! Papa!
Hat tot gemacht
auch die Mama!
Ma chère Maman!
Und nun saß ihm der Alte im Nacken und stieß ihm hart die Fersen in die Seiten, Schnapstränen im langen Bart. Seine Lungen schmerzten, jeder Schritt eine Tortur. Sein Körper, sein ganzer Körper glühte, und er keuchte ... dann ... dann nützt es nichts ... nützt es nichts, mit sich nach Haus ... nach Haus zu fliehn, und ... und falls man Schnaps ... Schnaps zu Haus hat, Schnaps zu nehmen ... nein, nein.
Ja, ja. – Dada.
Mama, Mama. Ma chère Maman.
Die liebe Mutter. Sie hatte ihn so sanft gewiegt: Hatder Bub wieder Angst? Diese Angst, ja, wenn eine Wolke die Sonne verdunkelte und das Atmen ihm Mühe machte.
Er blieb stehen, stützte sich am Geländer ab und versuchte, ruhig und tief durchzuatmen. Es gelang ihm nicht. Er musste husten, schmeckte Blut im Mund. Ihm war jetzt kalt. Eine eisige Kälte. Ein Zittern überkam ihn, und er glaubte, dass er sich nun auflöse, auseinanderfiel und seine blanken Knochen auf dem Pflaster umher tanzten. Ein Totentanz im hell auflodernden Höllenfeuer. Ein böser Schub, angefacht von dem ihm ins Ohr zischelnden Vater: Herumtreiber!Lump! Lügner! Dieb! Dann spürte er nur noch einen kurzen, stechenden Schmerz in den Schläfen, und schlagartig wurde ihm schwarz vor Augen. Er brach auf dem Limmatquai in sich zusammen.
Es war die Nacht zum Sonntag, dem 29. April 1917.
»Er wacht auf«, hörte er. »Er kommt wieder zu sich.«
Er öffnete die Augen, hob den Kopf. Blickte in das Gesicht der kleinen Frau. Sie lächelte. Der hagere Großmeister stand von seinem Schreibtisch auf. Er trat zu ihm ans Bett und nickte.
»Ich habe eine Suppe auf dem Herd«, sagte die kleine Frau. »Magst du?«
»Gib ihm erst einmal Wasser«, sagte der Hagere. »Er muss ja völlig ausgetrocknet sein.« Er zog sich einen Stuhl heran. »Du hast Glück gehabt, dass wir dich da haben liegen sehen. Wenn dich die Polizei so aufgefunden hätte, wärst jetzt schon weggesperrt. Sieh dir nur deinen Arm an.«
»Nun schimpf nicht gleich«, mahnte die kleine Frau. »Der Claus hatte sicher wieder starke Schmerzen.«
»Er hat sich an das Zeug gewöhnt. Es wird ihn noch umbringen, wenn er so weitermacht.« Der Hagere rückte näher zu ihm ans Bett und griff nach seiner Hand. »Hör zu«, sagte er eindringlich. »Eine Lungenentzündung, auch eine schwere, geht allemal mit den üblichen Mitteln vorbei. Es dauert einige Zeit, ja, und vor allem musst du dir Ruhe gönnen. Ich hätte dir den Auftritt verbieten sollen – ach, was heißt verbieten. Wir beide haben viel zu wenig miteinander geredet. Über persönliche Dinge, meine ich. Das muss ich mir vorwerfen. Denn dass dich ohnehin viel drückt, das hab ich ja sehen können. Aber gut, es ist noch nicht zu spät.« Er wartete, bis die kleine Frau mit dem Glas Wasser kam. »Ich bin mit der Lilly übereingekommen, für einige Zeit aus Zürich weg zu gehen. Wir wollen ins Tessin und wären froh, wenn du dort bei uns wärst.«
Ins Tessin. In die Sonne, ins Licht.
Er nahm einen großen Schluck. Die kleine Frau hielt ihm das Glas, und er spürte ihre Hand.
Er nickte matt.
Nach dem Nachtessen kam sie noch einmal zu ihm. Sie streifte ihre Schuhe ab.
»Rück ein wenig beiseite«, sagte sie.
»Ach, Lilly«, sagte er leise.
»Halt mich – bitte«, bat sie. Sie schmiegte sich an ihn.
Und so lagen sie eng beieinander und schwiegen. Es schien ihm eine Ewigkeit zu sein.
»Du musst keine Angst haben«, sagte sie schließlich. »Ich bin frei bei allem, was ich tue.« Sie küsste ihn.
Sie küsste ihn immer und immer wieder, bis auch er sie verlangend umarmte, ihr half, sich aus dem Sweater zu winden und den Bund ihrer weit geschnittenen Hose zu öffnen. Sie strampelte sie von sich, und er stemmte sich hoch und schloss die Augen. Danach aber hielt es ihn nicht länger im Bett.
Er sprang auf und kramte in seinen Kleidern nach dem Tabakpäckchen.
»Warte«, sagte Lilly. »Ich hab noch was für uns.« Sie huschte auf die Toilette. Er folgte ihr, nackt wie er war.
Sie hatte schon die silberne Puderdose in der Hand und öffnete sie.
»Setzen Sie sich doch«, sagte der gut gekleidete Herr. »Wir müssen uns ja nun erst einmal kennen lernen. Diese Papiere –« Er schnaubte abfällig und schob die Akte beiseite. »Ich lese so etwas immer wieder, und jedes Mal sage ich mir, so kann man doch nicht über einen Menschen urteilen, einen offenbar hilfsbedürftigen gar. Das ist – ich möchte sagen, das ist unanständig.«
»Ich habe alles bestätigt«, sagte Claus. »Aus freien Stücken«, fügte er hinzu.
»Die Fakten, nun ja. Aber es wird doch Gründe gegeben haben. Niemand kommt als Dieb auf die Welt, oder?«
»Nein, gewiss nicht. Ich hatte Not.« Er nahm nun Platz. Es war ein gepolsterter und mit lindgrünem Stoff bezogener Stuhl. Die Lehnen waren aus braunem, glatt poliertem Holz. Und ebenso glänzend war der wuchtige Schreibtisch, an dem der gut gekleidete Herr saß, ein Herr Doktor, der laut Schreiben des Bezirksrats Erster Amtsvormund der Stadt Zürich war. Ein angenehmer Mann, fand Claus. Er wollte offen zu ihm sein und nichts beschönigen.
»Obwohl«, schränkte er sogleich ein, »für die Studienbücher hat man mir nichts abverlangt. Man war sich sicher, mein Vater begleiche die Rechnung. Ein Missverständnis.«
»Ihr Herr Vater, ja, ja. Er ist Ihnen nicht gerade wohlgesonnen, Frédéric – pardon, darf ich Frédéric sagen? Oder ist es Ihnen lieber, wenn ich förmlich bleibe?«
»Frédéric oder auch Fred ist mir recht. Nur Friedrich nennt mich kaum jemand. Das ist – ich weiß nicht, es ist mir schon immer fremd gewesen. Selbst meinen deutschen Freunden geht es nicht über die Lippen. Für sie bin ich der Clauser – mit weichem C, der Claus, nun ja.« Er lächelte versonnen. »Aber halten Sie es, wie Sie wollen«, sagte er dann. »Ja, der Herr Vater hegt einen Groll gegen mich. Er kann wohl nicht anders.«
»Wie meinen Sie das?«
»Er ist tief in seinem Innersten schwach, auch nur so ein armer Hund. Aber das lässt er nicht zu, nicht bei sich und schon gar nicht bei seinem einzigen Sohn.«
»Hm, hm«, machte der Doktor. Er zog nun doch wieder die Akte zu sich heran.
»Einmal, nur ein einziges Mal hab ich ihn weinen sehen«, sagte Claus noch. »Da war die Mama gestorben, und er hat mich auf seinen Arm genommen und – darf ich rauchen?«
»Ja, selbstverständlich. Aber reden Sie weiter.«
Claus drehte sich geschickt eine Zigarette, feuchtete das Blättchen an.
»Ich hab’s bis heute nicht vergessen«, sagte er. »Weil – es erklärt vielleicht, warum er seitdem ständig hinter mir her ist.«
»Ja?«
»Ich hab ihm damals versprechen müssen, dass wir für immer zusammenbleiben.«
Der Doktor blätterte rasch in den Papieren.
»Beim Tod Ihrer Mutter, Ihrer Frau Mutter, da ... da waren Sie gerade mal vier.«
Claus nickte. Er zündete die Zigarette an, nahm einen Zug und konnte ein arges Husten nicht unterdrücken. Der Doktor hob fragend die Augenbrauen. Doch bevor er etwas sagen konnte, klopfte es an der Tür.
Seine Vorzimmerdame kam zu ihm und tuschelte ihm etwas ins Ohr. Der Doktor seufzte.
»Pardon«, sagte er. »Entschuldigen Sie mich einen Moment, Frédéric. Ein ... eine Familienangelegenheit.« Er folgte der jungen Frau, zog die Tür hinter sich zu.
Claus wartete noch einen Moment. Dann stand er auf und griff sich die Akte. Die Zigarette im Mundwinkel überflog er die Schreiben.
Dr. phil. Charles Glauser, Mannheim ... An die Buchhandlung las er. An den Advokat ... an die Justizdirektion ... die Polizeistation ... Rapport ... Rapport vom ...
Ein Rapport! Das Protokoll eines Polizeisoldaten ...
... kam 1916 nach Zürich ... wohnte zuerst bei ... ging erst noch seinen Studien nach ... aber auffallend viele ›Freitage‹ ... nachts in leichtsinniger Gesellschaft ... Unregelmäßigkeit seiner Lebensweise ... das Logis gekündigt ... verzog sich ... tat gar nichts mehr ... machte Kleintheaterbesuche ... in 34 Tagen 500 Fr. Verbraucht ... nicht mehr im Stande, sich Geld zu beschaffen ... Damenbesuche ... Zimmerverunreinigung ... verbrannte einen Tischüberwurf ... führt ein sehr leichtfertiges Leben ... wenn keine anderen Geldquellen, werden Betrügereien folgen ... Ihm stockte der Atem.
Eine Überwachung. Eine Bespitzelung, veranlasst vom Vater.
Der Zigarettenrauch brannte in den Augen. Die Augen tränten. Asche fiel auf das Parkett.
Claus drückte die Zigarette aus. Er legte die Papiere zurück auf den Schreibtisch. Seine Hände zitterten. Aufgewühlt trat er ans Fenster und sah hinaus.
Weit hinten am Horizont zeichneten sich die Berge ab.
»Das macht zumindest ein wenig Hoffnung«, sagte der Doktor zu seinem Gegenüber.
»Ja«, bestätigte der. »Er könnte durchaus ein respektables Stück Prosa zu Stande bringen. Das Zeug jedenfalls hat er dazu. Dieses Manuskript, das Sie mir haben zukommen lassen – nun, da sind Personen und Handlung im Ansatz doch schon recht individuell und auch sehr plastisch geschaut. Die Kleinmalerei vieler Stellen ist sogar ein heller Genuss, und im leichten Fluss der Sprache hat sich Ihr Schützling sehr vorteilhaft von den Franzosen beeinflussen lassen. Apropos Franzosen – sagt Ihnen der Bordeaux zu?«
»Er ist vorzüglich«, sagte der Doktor. Er tupfte sich die Lippen ab und griff nach seinem Glas. Sein Gegenüber nickte.
»Man hat hier auch eine hervorragende Käse-Auswahl«, sagte er. »Sie erlauben?« Er signalisierte schon der Bedienung, den Wagen heran zu rollen.
Die beiden Herren saßen am Fenstertisch des alten Bürgerhauses mit Blick auf die Limmat. Sie hatten Schnecken, Rösti mit Kaviar und Crème fraîche sowie ein Chateaubriand auf Béarner Art verspeist, und der Doktor hatte bereits insgeheim überschlagen, was ihn die Einladung kosten würde. Es war ein stattlicher Betrag. Aber gut. Wenn er seinen Gast dazu bringen konnte, ihm dafür ein positives Gutachten anzufertigen, hatte es sich womöglich gelohnt. Er beschränkte sich jetzt allerdings auf etwas Roquefort. Sein Gegenüber wählte mit Bedacht drei verschiedene Sorten aus, die ihm mit Trauben, Walnüssen und einem Schälchen Honig serviert wurden.
»Doch wie gesagt«, nahm er den Faden wieder auf. »Der Dichter von der mitreißenden Leidenschaft der Seele muss sich bei ihm noch mehr offenbaren. Und dazu gehört auch ein gerüttelt Maß an Fleiß. Sehen Sie, bei einem Meisterwerk, einem größeren Werk überhaupt, geht es nicht nur um die Eingebung, die Phantasie. Da müssen auch die richtigen Worte gefunden werden. Oft ist es nur eins, ein Einziges, das die Melodie eines Satzes vollkommen macht. Das kostet Mühe, das ist ein ständiges Ringen mit sich – und nur mit sich, mit sich allein. Eine gewaltige Anstrengung, verstehen Sie?«
»Ich glaube schon.«
»Ihr Schützling braucht dazu viel Kraft.«
»Ja«, sagte der Doktor. »Ja, das ist mir klar. Aber das Talent – ich meine, ein Talent fürs Schreiben würden Sie ihm schon bescheinigen?«
»Gewiss, ja, gewiss. Jederzeit. Er ist – wie alt ist er jetzt?«
»Einundzwanzig ...«