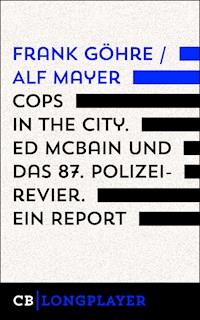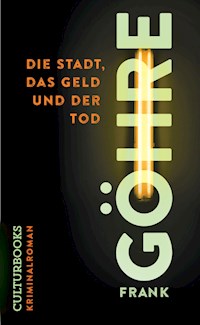9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Palermo, im Sommer 1933: Wie starb der exzentrische Dandy Raymond Roussel? Er ist Weltreisender und Erfinder des Wohnmobils, ein genialer Schachspieler und Erbe eines riesigen Vermögens. Im Juli 1933 reist er von Paris nach Palermo. Es wird seine letzte Reise sein. In Palermo wird das ausschweifende Fest der Heiligen Rosalia gefeiert, der Schutzheiligen der Stadt. Die italienische Luftwaffe überquert den Atlantik, und die Faschisten feuern ihre Munition in den nächtlichen Himmel. Es ist eine sizilianische Nacht. Es ist die Nacht, in der Roussel in seinem Hotelzimmer stirbt. Doch sein Tod bleibt rätselhaft: Ist er freiwillig aus dem Leben geschieden – oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Welche Rolle spielt seine Lebensgefährtin? Was ist mit seinem verschwundenen Chauffeur? Und welche Geschäfte haben ihn kurz zuvor mit der Mafia zusammengeführt? In seinem spannenden Roman führt uns Frank Göhre mitten hinein in ein brodelndes Palermo und erzählt von einem genialen Mann und seinem Tod in den Tagen der politischen Machtdemonstration und der Willkür, in den Tagen des Glaubens und der Hoffnung. »Sizilianische Nacht« bringt Licht in einen spektakulären realen Todesfall: den bis heute rätselhaften Tod eines bekannten französischen Dandys, Autors und Erfinders in einem Hotel in Palermo. »Dem Meister aus Hamburg macht niemand was vor.« Friedrich Ani »Göhre ist ein erzählerischer Minimalist, dem es immer wieder gelingt, mit wenigen Strichen lebendige, glaubhafte Figuren zu zeichnen und Krimi-Spannung aufzubauen.« EKZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Palermo, im Sommer 1993: Wie starb der exzentrische Dandy Raymond Roussel?
In seinem spannenden Roman führt uns Frank Göhre mitten hinein in ein brodelndes Palermo und erzählt von einem genialen Mann und seinem Tod in den Tagen der politischen Machtdemonstration und der Willkür, in den Tagen des Glaubens und der Hoffnung.
»Dem Meister aus Hamburg macht niemand was vor.« Friedrich Ani
»Frank Göhres Stimme ist einzigartig in der deutschsprachigen Kriminalliteratur.« Sonja Hartl, Zeilenkino
Über den Autor
Frank Göhre
Sizilianische Nacht
Kriminalroman
Die längste Reise aber ist die zu sich selbst.
Frei nach Michel Leiris, Ethnologe, Schriftsteller (1901–1990)
When it’s night time in Italy It’s Wednesday over here When it’s midnight in Sicily …
The Everly Brothers,
Personen
Jean-Paul Durand – Reisender und Erfinder
Die Madame (Aleksandra Wojcik) – seine Begleitung
Pierre – Chauffeur
Lucio Toretta – Hoteldirektor
Angelo Micelli – Empfangschef
Gigi – Hoteldiener
Enrico Mattei – Hotelarzt
Guido Butera, Nino Manzella – ehrenwerte Freunde
Commissario Fanfani – Ermittler
Der Neffe – Vermögensverwalter
Serge – der vorherige Chauffeur
Die Heilige Rosalia
Schutzpatronin der Stadt Palermo.
Sie wuchs im elften Jahrhundert als Tochter eines Grafen am sizilianischen Hof auf. Schon als junges Mädchen weihte sie ihr Leben einzig und allein Gott, dem Allmächtigen.
Als ihr Vater wegen einer Verschwörung gegen den Staat hingerichtet wurde, zog sie sich in eine Höhle am Monte Pellegrino in die Einsamkeit zurück. Der Überlieferung zufolge verweste nach ihrem Tod der Körper nicht. Goldglänzend bekleidet ruht die Ganzkörperreliquie hinter Glas in der Kapelle der Kathedrale in Palermo, der Öffentlichkeit nur einmal im Jahr zugänglich. Dann findet in der Stadt ein mehrtägiges Fest zu Ehren der Heiligen Rosalia statt. Verehrt wird sie als Schutzpatronin gegen die Pest und alles Übel der Welt, gegen Krankheit, Krieg und Katastrophen. Gefeiert wird sie mit einer Prozession zum Monte Pellegrino, festlichem Essen mit der Familie und Freunden sowie einem Feuerwerk. Es ist ein Fest des Lebens und der Lebensfreude. Eines Lebens über den Tod hinaus. So ist es, und so wird es sein, immerdar in Zeit und Ewigkeit.
Jean-Paul Durand, ein Mann mit Vermögen
Jean-Paul Durand war ein gut aussehender sechsundfünfzigjähriger Mann mit ovalem Gesicht und dunklem, vollem Haar. Ein sorgfältig gestutzter Schnäuzer zierte seine Oberlippe. Er trug maßgeschneiderte Anzüge, Hemden mit abgerundetem Kragen, farbige Krawatten und gepunktete Querbinder. Schmuck trug er nicht, keine Ringe, nicht einmal eine Krawattennadel, keine Einsteckuhr.
Er pflegte seine Kragen nur einmal zu tragen, seine Hemden nur ein paarmal, einen Anzug, einen Mantel, einen Hut oder Hosenträger nur fünfzehnmal und einen Schlips nur dreimal. Er verabscheute Gewaschenes. Wenn er sich völlig neu einkleidete, sagte er: »Ich schwebe … heute ist alles neu.«
Wir können uns Jean-Paul Durand als einen Karl Lagerfeld zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts vorstellen.
Eine Fotografie zeigt ihn mit seiner Mutter. Neben ihr wirkt er klein und schmächtig. Sie stehen an einem Tischchen, auf dem zwei Pekinesen aus Porzellan platziert sind.
Jean-Paul liebte seine Mutter. Er verzieh sich nie, dass er auf Weltreise war, als sie starb. In ihren Sarg ließ er ein Glasfenster einsetzen, um noch lange ihr Gesicht sehen zu können. Es war bleich und weich. Er vergoss viele Tränen.
Als Einundzwanzigjähriger wurde er wegen seiner Homosexualität erpresst. Man unterstellte ihm Pädophilie. Später versteckte er seine Homosexualität hinter den sexuellen Reizen einer Madame aus dem Milieu.
Er hatte seinen Wehrdienst absolviert und war ein hervorragender Pistolenschütze.
Sein Erbe war beträchtlich. Es bestand aus Immobilien und Grundbesitz in Paris und Umgebung und mehreren Millionen Goldfrancs. Das ermöglichte ihm, allein seinen speziellen Interessen nachzugehen.
Er liebte die Literatur, das Theater und die Oper. Er bewunderte Jules Verne und den Reiseschriftsteller Pierre Loti.
Er konstruierte und finanzierte ein Wohnmobil, lang und schmal wie ein Sarg. Es war das schwarze Gegenstück zu dem weißen Sarg seiner Mutter. Das Fahrzeug machte ihn berühmt, aber nicht glücklich.
Infolge der Weltwirtschaftskrise Ende der Zwanzigerjahre schrumpfte sein Vermögen. Es blieb dennoch beachtlich.
Jean-Paul Durand war ein leidenschaftlicher und genialer Schachspieler.
Er rauchte, er trank, und er war medikamentensüchtig.
Er nahm Schmerz- und Betäubungsmittel in großen Mengen. Seine letzte Wohnadresse war ein Hotel Garni in der Rue Pigalle, im Pariser Milieu.
Anreise
Zweimal mussten Jean-Paul Durand und seine Begleiterin die Reise nach Palermo unterbrechen. Sie nächtigten in Gasthöfen, die Durands Ansprüchen in keiner Weise genügten. Enge Treppen und zu kleine Zimmer, kein Wannenbad, zu wenig Platz für das Gepäck. Ein immenser Aufwand für den Wimpernschlag nur einer Nacht. Und dann die Mahlzeiten! Eine Katastrophe. Rind und Huhn ungenießbar. Zäh und trocken. Das Gemüse zerkocht. Als Dessert wurde Obst angeboten, überreife Birnen, nicht entkernte Pflaumen. Lediglich der Wein war zufriedenstellend.
Durand wachte morgens mit schwerem Kopf auf, schleppte sich zu dem extra für diese Reise erworbenen Peugeot und schloss im Fond des Wagens die Augen.
Erschöpft, müde.
Mit schwachen Gliedern. Das Gehen fiel ihm schwer.
Doch er reiste. Er war nach Indien und Australien, nach Neuseeland, Ägypten und Marokko gereist. Zu Land und auf dem Meer. Mit der Bahn und mit dem Automobil. Er hatte nicht alles von der Welt gesehen, aber sehr, sehr viel. Letztlich zu viel. Er hatte zigtausend Bilder gespeichert, abrufbar zu jeder Zeit. Die bewahrte er. Sie begleiteten ihn Tag und Nacht, bis in den Schlaf. Doch der Schlaf kam nur noch mithilfe diverser Tabletten.
Madame hatte ihren Platz vorn auf dem Beifahrersitz. Sie studierte die Straßenkarte und gab dem Chauffeur Anweisungen.
Durand hatte lange gezögert, diesen Mann zu engagieren. Er war jung, kam aus der Provinz. Ein Mechaniker. Seine Papiere waren auf den Namen Pierre Roché ausgestellt. Durand hatte in Paris einige Male seine Dienste in Anspruch genommen und war sehr zufrieden gewesen. Pierre fuhr zügig und dabei absolut sicher. Er war reaktionsschnell. Ein Mann, für das Automobil geboren.
Durands Zögern war seinem langjährigen Fahrer Serge geschuldet, einem ehemaligen Fremdenlegionär, der schon Durands selbst entworfenes Wohnmobil quer durch Europa gesteuert hatte. Doch Serge war erschreckend schnell gealtert, seine Sehkraft hatte nachgelassen, und er ermüdete rasch. Trotzdem hatte er sich die Reise zugetraut. Madame hatte schließlich entschieden.
Durand schmiegte sich in den gepolsterten Wagensitz, sein Kopf ruhte auf einem weichen Kissen, er lauschte den Geräuschen der Fahrt, dem Holpern der Räder, dem Wind und dem Geplapper der Passanten, an denen sie in den Ortschaften vorbeituckerten.
Es war später Nachmittag, als sie den Hafen von Genua erreichten und gerade noch auf die Fähre nach Palermo verschifft werden konnten.
An Bord zog Durand sich in eine der wenigen noch verfügbaren Kajüten zurück. Er kleidete sich um. Frische Unterwäsche, eine weite weiße Leinenhose, einen champagnerfarbenen Pullover, marokkanische Hausschuhe. Er hüllte sich in den Morgenmantel und nahm seine Tabletten, schluckte ein paar mehr. Ein Sturm war angekündigt.
Durand kroch in die schmale Koje, das Meer wogte unter dem Kiel der Fähre, wogte und wogte, wogte noch ruhig auf und nieder, und er lag da mit offenen Augen … die Wellen schlugen an den Strand von Biarritz, er träumte, er träumte … er träumte von langen Sommertagen und vom Baden im Meer, aus der Villa am Hügel klang eine Symphonie, es gab eisgekühlte Getränke … perlenden Champagner, Champagner, in gierigen Schlucken getrunken, der Vater fiel tot um … und er träumte, er träumte … er presste sein Gesicht an den Rock der Mutter … wir bleiben zusammen, für immer, versprich mir das, mein kleiner Prinz … der Schaum auf dem Kamm der Wellen zerstob, und er irrte durch die unzähligen Räume des Gebäudes, versteckte sich in hohen Schränken und trat als Pirat oder Fischer verkleidet heraus, wurde bewundert und beklatscht … er war ein hübsches Kind, eine Hand strich zärtlich über seinen Lockenkopf … er verspürte eine Erektion … und er träumte, er träumte … Stahlplatten wurden aneinandergeschweißt, Funken sprühten auf die technischen Zeichnungen und Berechnungen, ein Motor fand stotternd seinen Takt … wie ein riesiger Buckelwal tauchte das eiserne Monster in die Tiefe, Kapitän Nemo übernahm das Kommando … und er träumte, er träumte, wie er den Kapitän über die Gänge bis zum Mittelteil des Schiffs begleitete, sie reichten sich die Hand, waren sich nah, und … er tauchte ab … zwanzigtausend Meilen unter dem Meer, und er träumte … er glitt durch Korallengärten, auf dem Meeresboden Edelsteine, Waffen und menschliche Gebeine … er träumte, dass all das für ihn war, all diese versunkenen Schätze, und er rief, er rief, ich habe sie entdeckt, hört ihr, ich habe das alles entdeckt, so hört mich doch … er flehte, so spendet mir doch Applaus, die Anerkennung meiner Arbeiten, erhebt euch von euren Sitzen, ich habe euch auch unterhalten, ich habe euch amüsiert … doch er hörte nur ein einziges Händeklatschen, es hallte wider in dem ausgeräumten Salon seiner Eltern … und er sah, dass das Wasser über ihm hart und reglos wurde, fest wie eine Marmorplatte, wie ein Grabstein … Ein heftiger Ruck riss Durand aus seinen Träumereien, aus seinen mit Erinnerungen verwobenen Fantasien, seiner Furcht. Er suchte Halt, schreckensbleich.
Als Madame frühmorgens an Deck kam, sah sie Pierre an der Reling stehen, er schwankte ein wenig, war unsicher auf den Beinen. Sie stellte sich neben ihn.
»Vermissen Sie Paris?«, fragte sie. Er reagierte nicht gleich, blickte sie auch nicht an.
»Eine heftige See«, sagte er. »Das kannte ich nicht. Es ist gewaltig.« Er hatte einen leicht schleppenden Tonfall. »Nein, Madame, nein. Paris vermisse ich nicht.«
Auch sie ließ sich Zeit. Gischt sprühte ihr ins Gesicht. Sie hatte ein schmales Gesicht, fein geschnitten. Ihre Augen waren hell und wach. Das rostrote, leicht gekräuselte Haar fiel ihr unter der Kappe bis in den Nacken. Ein auf Taille geschnittener Mantel betonte ihre schlanke Figur. Sie war schön, eine schöne Frau Anfang vierzig.
»Monsieur kann sehr anstrengend sein«, sagte sie.
Pierre zuckte die Achseln.
»Er zahlt einen guten Preis«, sagte er. »Und auch noch was drauf. Das hat er mir in die Hand versprochen.«
»Ich habe es ihm nahegelegt.«
Pierre wandte sich ihr zu, leicht irritiert.
»Es wird ein größerer Betrag sein«, sagte sie. »Kein Trinkgeld.« Er hob die Augenbrauen.
»Das ist …«
»Ich denke, dass Sie sehr zuverlässig sind, Pierre. Und ich vertraue Ihnen. Ich weiß nicht, wie lange wir in Palermo bleiben werden und was uns dort erwartet. Der Monsieur lebt in seiner eigenen Welt, und er ist geschwächt. Ich bin ja auch das erste Mal längere Zeit mit ihm unterwegs und … es ist nicht leicht für mich, Pierre.« Sie legte ihre Hand auf seinen Arm, strich leicht über das glatte schwarze Leder seiner Jacke. »Ich werde Ihre Unterstützung in Anspruch nehmen müssen, Ihre Hilfe.«
Sie sah zum Bug der sich durch die Wellen kämpfenden Fähre. Vögel kreisten über ihnen. Die Küste Siziliens zeichnete sich im Dunst des Morgens ab.
Grand Hotel et Des Palmes
3. Juni des Jahres, in dem sich Adolf Hitler als neuer Reichskanzler und Führer in Berlin von Zehntausenden bejubeln ließ und Mussolini schon seit elf Jahren Ministerpräsident des Königreichs Italien war, trafen Jean-Paul Durand und die Madame in Palermo ein.
Es war das Jahr 1933.
Pierre steuerte den Peugeot im Schritttempo durch die engen Gassen, vorbei an den Ständen des angrenzenden Markts. Der Duft von geröstetem Kaffee lag in der Luft, von frittiertem Gebäck aus Kichererbsenmehl. Auf zerstoßenem Eis lag der nächtliche Fang der Fischer, lagen Garnelen und Kuttelfische, Sardinen, gestreifte Makrelen, Tintenfisch und blutroter Thunfisch. Daneben ein Stand mit Olivenöl in Literflaschen und Kanistern. Tomaten in Dosen. Gewürze. Kräuter, Oregano und Majoran, Rosmarin, Thymian, Petersilie. Chilischoten, zu Zöpfen geflochtene Knoblauchknollen. Fässer mit schwarzen und grünen Oliven, kleine und große. Und dann das Fleisch. Schweinehälften, Rippen. Lenden und Keulen, großzügig portionierte Filets, abgehäutete Ziegenköpfe, gerupfte Hühner, aufgeknüpft an ihren Krallen. Batterien von Eiern. Gemüse. Paprika, rot, grün und gelb. Zucchini und Auberginen. Zwiebeln und Lauch. Obst. Melonen, Pfirsiche und Feigen. Über alldem lautstark die rauen Stimmen der Marktfrauen, ihre Ware anpreisend, sich gegenseitig überbietend.
Die Sonne hatte ihren Zenit erreicht.
Madame fächelte sich Luft zu.
Durand hatte wie so oft die Augen geschlossen, die breite Krempe des Panamas tief in die Stirn gezogen.
Das Fahrzeug näherte sich der Hauptverkehrsstraße.
Prachtvolle Gebäude kamen in Sicht.
Villen, Paläste hinter schmiedeeisernen Toren.
»Da ist es!«, rief Madame.
Das Hotel. Das Grand Hotel et Des Palmes.
Pierre wendete und hielt am Straßenrand. Drei livrierte, junge Burschen eilten auf den Wagen zu. Einer öffnete Madame den Schlag, die beiden anderen wurden angewiesen, sich um das Gepäck zu kümmern. Pierre half Monsieur beim Aussteigen. Durand rückte den Panama zurecht und ließ sich seinen Gehstock reichen. Madame machte Anstalten, ihn zu stützen.
Er wehrte sie ab.
Er blickte an der prächtigen Fassade des Hotels hinauf, ließ den Blick auf den Fenstern ruhen, den schmalen mit Efeu und Bougainvilleen umrankten Balkons.
»Das also ist es«, sagte er schließlich. »Ein Ort mit Geschichte. Einer großen Geschichte. Wagner hat hier den ›Parzival‹ komponiert, Pierre, die Entwicklung eines Unwissenden zum Gralskönig. Richard Wagner. Er ist ein Gott!« Er nickte Pierre zu, hängte sich wie selbstverständlich bei ihm ein, drückte den Arm sanft an sich. »Aber auch Grausamkeiten gab es hinter diesen Mauern. Das ist zu spüren. Ich spüre es. Es liegt den Bewohnern dieser Insel im Blut.«
Ihre Schritte glichen sich an, das gefiel Madame nicht.
»Nun denn«, sagte Durand und ließ die Spitze des Gehstocks hart auf die Marmorplatten klacken. »Stellen wir uns dem Geschehen.«
In der Empfangshalle des Hotels saßen zwei Männer an einem niedrigen Glastisch, schwarz gekleidet, mit Krawatte und Hut. Kräftige Burschen mit glatten, harten Gesichtern. Sie tranken Espressi und rauchten. Wie auf Kommando sahen sie zu dem an ihnen vorbeigehenden Durand auf, der kurz seinen Panama lüftete.
Der Empfangschef kam hinter seinem Pult hervor.
»Willkommen, die Herrschaften, ein herzliches Willkommen. Angelo – wenn es genehm ist.« Er verbeugte sich. »Angelo Micelli. Ganz zu Ihren Diensten.«
»Besten Dank«, erwiderte Madame. »Wir benötigen zwei nebeneinanderliegende Zimmer, nicht ebenerdig und ruhig, vor allem ruhig. Und für unseren Chauffeur …«
»Wir haben Unterkünfte für das Personal, das sollte kein Problem sein.«
Zimmer 224
Ein Zimmer mit Blick vom Balkon auf eine von Palmen gesäumte Nebenstraße. Vormittagssonne. Stilvolles Mobiliar. Zwei getrennt stehende Betten, darauf goldglänzende Tagesdecken aus Brokat. Ein Kleiderschrank, ein antiker Sekretär mit einem Dutzend Schubfächern, ein Stuhl, ein Sessel mit hoher Rückenlehne.
Durand setzte sich.
Er wies Pierre an, den schweren Überseekoffer vor die Verbindungstür zum Nebenzimmer zu rücken und ihn zu öffnen. Sichtlich zufrieden verfolgte er die Aktion.
»Danke, Pierre«, sagte er. »So ist es gut. – Wenn du jetzt bitte die Handschuhe überstreifen würdest. Ich werde dir sagen, wo welche Kleidungsstücke in dem Schrank unterzubringen sind. Die Anzüge zuerst. Gibt es Kleiderbügel?«
Es gab mehr, als benötigt wurden, schwere Holzbügel mit eingravierten Initialen des Grand Hotels. Der Boden des Schranks und die Fächer waren mit gestärkten weißen Tüchern ausgelegt. Eine Zeit lang ging es zügig voran. Doch dann schien Durand schlagartig zu ermüden. Er bat um Wasser.
Er ließ sich seine lederne Schreibmappe reichen, zog einige Papiere heraus. Handtellergroße Zettel flatterten zu Boden. Sie waren eng beschreiben. Bekritzelt mit Zahlen und Skizzen.
Pierre bückte sich nach ihnen.
Durand hielt ihn zurück.
»Das sind nur Notizen«, sagte er. »Varianten. Ich seh sie mir später noch mal an.«
Pierre blickte fragend zu ihm hoch.
»Schachzüge«, erklärte Durand. »Ich suche nach einer Strategie, den König schnell zu Fall zu bringen. Spielst du Schach?«
»Nein. Nur hin und wieder ein Ecarté. Wenn ich mit dem Wagen in die Werkstatt muss.«
»Spielst du um Geld?«
»Unsereins hat nie viel in der Tasche. Es ist mehr zum Zeitvertreib.«
Durand nickte. Er blätterte die Papiere durch.
»Ich habe notiert, was ich der Madame aufgeschrieben habe. Es sollten zwei Dutzend sein, zwei Dutzend Hemden von Cavanagh, ein Ire, ein Meister seines Fachs. – Wie viele sind es?«
Pierre zählte den Stapel durch.
»Siebzehn«, sagte er. »Eins tragen Sie.«