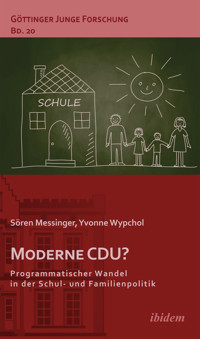
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Göttinger Junge Forschung
- Sprache: Deutsch
Die CDU unter Angela Merkel hat sich in den letzten Jahren als eine äußerst wandlungsfähige Partei erwiesen. Beispielhaft dafür stehen die familienpolitischen Änderungen unter Ursula von der Leyen und die Hamburger Schulreformen des Ole von Beust – allesamt Eingriffe an jahrzehntelangen Eckpfeilern der Parteiidentität. Umso mehr drängen sich nun die Fragen auf, wie ein solcher Wandel am Kern der Identität zustande kommen konnte und was es für eine Partei bedeutet, wenn sich derartige Traditionslinien verändern. Sören Messinger und Yvonne Wypchol blicken auf die Schulstrukturpolitik und das Familienbild der CDU, zeichnen historische Entwicklungen und programmatische Traditionen in diesen Bereichen nach, um abschließend die aktuellen Positionen im gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Die beiden Teilstudien suchen dabei stets nach Antworten auf die Frage: Ist die CDU eine zeitgemäße Partei?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Vorwort:Die Modernisierung einer Partei
Robert Lorenz / Matthias Micus
Die beiden dem vorliegenden Buch zugrunde liegenden Analysen von Sören Messinger und Yvonne Wypchol über den Wandel christdemokratischer Positionen in der Schul- und Familienpolitik befassen sich gleichermaßen mit der Modernisierung der CDU in der Ära Angela Merkel. Modernisierung ist natürlich ein äußerst schwammiger Begriff. In einem denkbar weit gefassten Verständnis fällt darunter mit Blick auf Parteien – oder auch Organisationenim Allgemeinen– die Gesamtheit der programmatischen, organisatorischen und auch personellen Anpassungen an veränderte, einem zeitlichen Wandel unterliegende und mithin neue Verhältnisse. Insofern kann man genauso gut von Organisationslernen sprechen.
Einfaches und komplexes Lernen
Was versteht man nun unter Organisationslernen?Organisationslernen im engeren Sinne bedeutet den „intendierten Wandel struktureller und kognitiver Organisationsvariablen“[1], d.h. Organisationslernen besteht aus spezifischen Wandlungshandlungen (change acts), die von konkreten Wandlungsakteuren (change agents) initiiert und begangen werden. Ein solcherart verstandenes Organisationslernen ist nichtalleinvon externen Anreizen abhängig;die Lernimpulse können auch von innen, aus der Organisation selbst kommen.
Dieses selbstgesteuerte Organisationslernen im engeren Sinne entspricht dem, was von manchen Organisationsforschern „komplexes Lernen“ genannt wird. Komplexes Lernen bezieht sich auf das Kernwissen, das Orientierungssystem der Organisation, es tangiert die Identität und Kontinuität verbürgenden Kernüberzeugungen, die kognitiven Grundannahmen und normativen Prämissen, letztlich die zentralen Ziele der betreffenden Organisation.„Einfaches Lernen“–vom komplexeren Organisationslernensemantisch bisweilen auch durch den Begriff Organisationswandelabgegrenzt–erschöpft sich ineher unkreativen organisatorischen Anpassungsprozessen an eine sich wandelnde Umwelt. Und es zielt auf Veränderungen bei den Mitteln – und nicht, wie bei komplexem Lernen, den Zwecken –, mit denen die feststehenden Ziele, die ihrerseits vom Wandel unberührt bleiben, effektiver erreicht werden sollen.[2]
Einfaches Lernen richtet sich daher zumeist auf die formalen Regeln einer Organisation, die an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst oder – noch charakteristischer – einfach nur strikter befolgt werden sollen. Das Erfolgskriterium einfachen Lernens, so könnte man sagen, ist insofern Normkonformität. Und während das Problem des komplexen LernensinseinerhohenIrrtumsanfälligkeit vor allem durch den Mangel an zuverlässigen Informationen über die Implikationen und Wechselwirkungen des sozialen, politischen und kulturellen Wandels und die Verzerrungen bei der Übersetzung von Umweltereignissen in individuelle Wahrnehmungenbesteht, führt das „einfache Lernen“ mit seiner „konservativen Reaktion auf negative Folgen der Regelbefolgung“ dazu, dass unzweckmäßige Handlungen mit umso größerer Entschiedenheit reproduziert werden.[3]
Inden beiden Analysen dieses Bucheswird ein weiter, einfache und komplexe Lernleistungen gleichermaßen umfassender Begriff des Organisationslernens verwendet–nicht zuletzt deshalb, weil der reale, empirisch beobachtbare Organisationswandel bei Parteien in der Vergangenheit eine Mischform darstellte zwischen einfachem und komplexem Lernen. Das vorherrschende Muster war (und ist?) das eines schleichenden Wandels, der zwar von einigen Akteuren befördert werden mag, der sich aber im Wesentlichen exogenen Faktoren verdankt: dem Wertewandel und Generationswechsel, dem Wandel der Ressourcenpotentiale und Veränderungen der Aufgabenstruktur.[4]
Injedem Fallist Erfahrungslernen ein weit verbreitetes Phänomen, gerade in langlebigen Organisationen mit stolzer Traditionwie der CDU. „Jede Entscheidungsregel“, so James March und Johan Olsen, „die zu irgendeinem Zeitpunkt zu einem erwünschten Zustand geführt hat, wird in der Zukunft mit größerer Wahrscheinlichkeit wieder verwendet werden als in der Vergangenheit.“[5]Bloß hat sich die Annahme als irrig erwiesen, dass eine Übereinstimmung bestehe zwischen der Situation, in der die Regeln angewandt werden, und derjenigen, in der sie entwickelt worden sind.[6]Erfahrungslernen zeitigt folglich eine Vielzahl von Problemen:Es führt erstens nicht nur zur Konservierung historischer, mittlerweile aus der Zeit gefallener Interpretationsmuster, sondern birgt auch das Risiko einer Kompetenzfalle, weil mäßige Ergebnisse, die mit suboptimalen Verfahren erzielt werden, diese vermeintlich bestätigen und von der Suche nach besseren Verfahren ablenken.[7]Dass Erfahrungslernen zweitens das Tempo und die Bereitschaft zum Organisationslernen verringert, darauf verweist die negative Korrelation zwischen Organisationsalter und Organisationslernen. Hier gilt für Kollektive dasselbe wie für Individuen:Junge sind anpassungsfähiger und veränderungsbereiter als Alte–schon allein deshalb, weil erstere unvorbelastet Neues lernen, während die Alten das früher Gelernte erst vergessen müssen, ehe sie sich das Neue einprägen können. Erinnern sie sich dabei auch noch sehnsuchtsvoll der eigenen Jugend, so sind sie erst recht abgeneigt, es auch nur zu versuchen.[8]
Die Lernverweigerung kann bis zu dem Punkt gehen, an dem – wie es der Publizist Johannes Gross genannt hat – eine Organisation „parasitär“ wird, d.h. „von einer Organisation bloß das organisatorische Gehäuse bleibt, der Glaube aber seine Gläubigen und die Ideologie ihre Kraft verloren hat“[9]. Dies ist dann der Fall, wenn das organisatorische Gehäuse bloß noch durch Privilegien und Machtmittel abgestützt wird; wenn überkommene Ansprüche überdauern, aber keine gesellschaftsstabilisierende Funktion mehr von der Organisation ausgeht, sie auch keinen Begriff vom Sinn des Lebens und der Geschichte mehr hat und sich bloß noch von der Gesellschaft unterhalten lässt, ohne Nutzen zu bieten; wenn sie also im schlimmsten Fall nicht nur nutzlos sondernauch nochschädlich geworden ist, weil nötige Anpassungen und Lernvorgänge verhindert werden und Organisationsstabilität über Effektivität gestellt wird. In solchen Fällen sprechen Organisationssoziologen auch von „pathologischem Lernen“[10]. Pathologisch ist ein Lernen dann, wenn irrige Schlussfolgerungen auf der Grundlage von Erfahrungslernen zu Handlungen führen, die einen bestehenden Fehler noch verschlimmern, und wenn Anpassungshandlungen bzw. Reformmaßnahmen die Leistungsfähigkeit einer Organisation verringern statt verbessern.
An der Gegenüberstellung und den unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten, die nicht selten gerade zwischenalten und jungen, traditionsreichen und geschichtsarmen Organisationenbestehen,zeigt sich, dass Lernen auch ganz wesentlich „Entlernen“ ist und für Kompetenzgewinne Akte des Vergessens notwendig sind. „Wissen und Lernen“, argumentiert der Organisationsberater Fritz B. Simon, „sind Gegensätze. Wo Wissen bewahrt wird, wird Lernen verhindert.“ Wissen, so Simon weiter, mache „lernbehindert“.[11]Dasselbe gilt im Übrigen für zurückliegende Erfolge. Lernbedarf wird durch Misserfolge, Niedergang, Erfahrungen des Scheiterns bewusst. Vergangene Erfolge und die Erinnerung daran dagegen tendieren dazu, die Erkenntnis von Reformerfordernissen zu blockieren. Gaston Bachelard spricht in diesem Zusammenhang von Wissensbeständen als „obstacles épistémologiques“[12].
Wissen lähmt, weil die für kühne Initiativen notwendige Unschuld und Rücksichtslosigkeit verloren gehen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Ausweitung der gesellschaftlichen Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung nicht zu einer gesteigerten politischen Steuerungsfähigkeit führt.[13]Weitere Hindernisse für organisatorisches Lernen sind zum einen die Bestandsinteressen und der daraus sich ableitende Strukturkonservatismus mindestens der etablierten Organisationen. Einen Großteil der individuellen Potentiale für komplexes Lernen können Organisationen infolgedessen nicht abrufen. Zum anderen fördert im Falle von Mitgliederorganisationen auch die Mitgliedschaft die Lernbereitschaft oftmals nicht, eher im Gegenteil. Jedenfalls sofern ihr Anschluss auf Freiwilligkeit basiert und ausgedehnte Partizipationsgelegenheiten bestehen. Konflikte aufzulösen etwa stellt in politischen Parteien mit ihren freiwilligen, werteorientierten Mitgliedschaften ein erheblich schwerwiegenderes Problem dar als in Unternehmen, wo es eindeutige Entscheidungsordnungen gibt, klare Regeln für die Auflösung von Konflikten, nicht zuletzt auch effektive Sanktionsmöglichkeiten.[14]
Und schließlich ergeben sich erhebliche Hemmnisse für Organisationslernen aus der fundamentalen Gebrochenheit und den mannigfaltigen Ambivalenzen im Verhältnis, in den wechselseitigen Einflüssen und Bedingungen zwischen den Organisationen auf der einen und ihren Umwelten auf der anderen Seite. Schon die Logik der Organisation widerspricht der Vorstellung von einem reibungslosen Verhältnis von Organisation und Umwelt–besteht doch der funktionale Sinn des Organisierens eben darin, bestimmte Sinnfiguren, Ablaufschemata und Kommunikationsformen gegen allfällige Umweltvarianzen zu stabilisieren. Organisationen müssen ein Set von Strukturmerkmalen und Sinnprämissen gegen unmittelbare Umwelteinflüsse immunisieren. Einerseits. Andererseits darf sich die Organisationaber auchkeine selbstschädigende Umweltignoranz leisten, die ihre gesellschaftliche Verwurzelung und mithin ihre Funktion als intermediäre Organisation gefährden würde. Der Organisationsprozess ist insofern – und das erschwert Organisationslernen ungemein, in die eine ebenso wie in die andere Richtung – eine Gratwanderung zwischen sturer Routinisierung und veränderungsresistenter Erstarrung einerseits und dem Risiko des Identitätsverlustes infolge allzu bereiter Umweltanpassung und allzu rascher, erratischer Kurssprünge andererseits. Jedenfalls: Nicht nur langsames Lernen kann sich als Manko herausstellen. Auch über- oder vor-schnelles Lernen ist eine riskante Strategie, da es zu Überreaktionen auf Umweltvariationen tendiert und das für das Auffinden guter Alternativen unerlässliche Experimentieren verhindert.
Ganz allgemein ist das Umweltverhältnis von Organisationen kontingent. Die Umwelt bleibt zwar auch beim komplexen Lernen die wichtigste Bezugsgröße organisatorischer Veränderungsansätze,sie hat also sehr wohl Auswirkungen auf organisationsinterne Strukturen und Abläufe, aber sie determiniert sie nicht. Nicht zuletzt deshalb, weilsämtlicheUmwelteinflüsse auf dem Weg in das Bewusstsein der handelnden Akteure in den Organisationen zunächst durch die subjektiven Wahrnehmungsfilter hindurch müssen. Welche Entwicklungen, was für Veränderungen als relevant betrachtet werden, heißt das, hängt auch von den Prädispositionen, von den Interessen, Werthaltungen und der Problemwahrnehmung der Entscheidungsträger in den Organisationen – und in unserem Falle den Parteien – ab. Dem Eigenleben und den spezifischen Gesetzmäßigkeiten formaler Organisationen kommt folglich eine unabhängige kausale Bedeutung zu.[15]
Aus den Brüchen im Wechselverhältnis zwischen Organisationen und ihren Umwelten, aus den Wahrnehmungsverzerrungen und Informationsdefiziten der Organisationsmitglieder über die externen Rahmenbedingungen resultiert ein Gutteil der Schwierigkeiten und Irrtümer beim Organisationslernen sowie der nicht-antizipierten Konsequenzen von Organisationshandeln. Auch hier haben wir es wieder mit einem schmalen Grat zu tun:Sowohl wenn sich Organisationen langsamer als die Umwelt wandeln,als auch wenn sie sich antizipativ gleichsam im Vorgriff ändern, kann der Transformationsprozess leicht seinen Anspruch auf Vernünftigkeit verlieren.„Werden Kausalverknüpfungen ignoriert[oder missverstanden, Anm.d.Verf.], weil sie neu sind, weil sie in der Vergangenheit nutzbringende Auswirkungen hatten oder weil auch der Welt Komplexität inhärent ist, so können Veränderungen […]unvorhergesehene oder verwirrende Konsequenzen haben.“[16]
So können beispielsweise Parteiführungen aus rückläufigen Stammwähleranteilen und der mindestens partiellen Entkoppelung von Parteien und Gesellschaft die Schlussfolgerung ziehen, sich umso stärker an demoskopischen Erhebungen, tagespolitischen Stimmungen und einer als ungebunden perzipierten sozialen Mitte zu orientieren;wohingegen die potentiellen Anhänger ihre Kritik gerade an der mangelnden Berechenbarkeit des Parteikurses und fehlenden Glaubwürdigkeit der Spitzenpolitiker festmachen und eine Renaissance handlungsanleitender Werte, benennbarer normativer Fluchtpunkte und unterscheidbarer langfristiger Ziele erwarten.[17]
Und nicht nur das. Erst recht können mehrere paralleleProzesse, selbst wenn jeder für sich vernünftig erscheint, zusammen und gemeinsam zu Ergebnissen führen, die von niemandem beabsichtigt sind und den involvierten Interessen konträr entgegenstehen.
Jedenfalls: Die lange Zeit gültigen Grundannahmen über organisatorisches Wahlverhalten, denen zufolge Entscheidungsprozesse erstens intentional, zweitens folgerichtig und drittens optimierend verlaufen würden–dass Entscheidungen also auf spezifischen Präferenzen, Werten und Zielen basierten, sodann auf konkreten Erwartungen über Ergebnisse in Verbindung mit der Wahl der Handlungsalternative und schließlich auf der Wahl der besten Handlungsalternative–, haben sich als weitgehend falsch herausgestellt. Der geschlossene Zyklus organisatorischen Wahlverhaltens ist eine Illusion. Subjektive Wahrnehmungen und Präferenzen von Individuen beeinflussen nicht einschränkungslos ihr Verhalten, das Verhalten von Individuen steuert nicht unvermittelt die organisatorischen Aktivitäten, letztere lösen nicht planmäßig entsprechende Reaktionen der Umwelt aus und Ereignisse in der Organisationsumwelt schlagen sich nicht ungefiltert in den subjektiven Wahrnehmungen und Präferenzen der Individuen nieder.[18]
Organisationen lernen also unter Bedingungen, in denen Ziele, Erfolg, Misserfolg ungewiss sind. Jede Erfahrung bedarf der Interpretation. „Die Welt des Absurden“,sobilanzieren James March und Johan Olsen ihre organisationssoziologischen Forschungen, „ist für unser Verständnis organisatorischer Phänomene manchmal relevanter als die Vorstellung einer engen Verbindung zwischen Handlung und Reaktion.“[19]Und sie fahren fort: „Wir benötigen deshalb Modelle der Entwicklung von Überzeugungen, die nicht notwendigerweise von einer Dominanz der Ereignisse oder der ‚objektiven Realität‘ ausgehen.“
Dies ist umso drängender, als Organisationswandel keineswegs eine Seltenheit, sondern ganz im Gegenteil alltäglich ist. Organisationen müssen sich ständig wandeln, um ihren Fortbestand in einer permanent sich verändernden Umwelt zu sichern.Dies gilt zumal für die christ- und sozialdemokratischen Volksparteien, deren Ursprünge in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegen, die in ihrer Geschichte mit einem fundamentalen Wandel allerorten konfrontiert waren, mit wiederholten Systemwechseln, einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel von der Agrar- über die Industrie- bis hin zur heutigen Wissensgesellschaft, die zahlreiche Krisen, Inflationen, enorme demografische Veränderungen erlebten und nicht zuletzt auch mit zyklischen Debatten über Parteienverdrossenheit konfrontiert waren – und die dies alles als Parteien bzw. Parteifamilien erstaunlich stabil überdauerten. Sodass die Schlussfolgerung nicht unzulässig ist, „daß Organisationen bemerkenswert anpassungsfähige, dauerhafte Institutionen sind, die auf variierende Umweltbedingungen routinemäßig und mühelos, wenn auch nicht immer in optimaler Weise reagieren“[20].
Dies zeigt sich auch bei der zeitgenössischen CDU. Seit der Übernahme des Vorsitzes durch Angela Merkel hat die Partei zum einen ihre Organisationsstrukturen reformiert. Die diesbezüglichen Parolen lauten: Dezentralisierung und mehr Basisbeteiligung in Form von Mitgliederbefragungen sowie Regionalkonferenzen. Und auch inhaltlich wurden erhebliche Innovationen initialisiert, die gemeinhin wiederum schlagwortartig auf die Begriffe Sozialdemokratisierung, Liberalisierung und Abwurf konservativen Ballasts verkürzt werden.
Fallbeispiele für Organisationslernen:DieSchul- und Familienpolitik
Die hier vonSörenMessinger undYvonneWypchol vorliegenden Fallstudien stellen einen ersten Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des oben geforderten Modells zum Organisationslernen dar. Denn eben daran mangelte es in den bisherigen Arbeiten zum Organisationslernen.Seit den 1980er Jahrenbesteht zwar ein gesteigertes Interesse anOrganisationen als (kollektiven) Akteuren.Dennoch besitzt bis heute der Befund Gültigkeit, dass dasForschungsfeld Organisationslernen im Hinblick auf vergleichende Untersuchungen einen weißen Fleck aufweise. So wird allgemein gefordert, es brauche„systematische Vergleichsstudien – am besten nach dem Muster der humanbiographischen Zwillingsforschung“[21].
SörenMessinger untersucht dabei in seiner Arbeit den Wandel des programmatischen Selbstverständnisses der CDU in der Schulpolitiksowiedie Folgen, die sich aus dem Abschied von der doktrinären Dreigliedrigkeit des Schulsystems ergeben. Konkret interessieren ihn drei Fragen: Erstens, wie Parteien Veränderungen in zentralen und identitätsstiftenden Bereichen einleiten und bewältigen? Zweitens, worin der Wandel konkret besteht, oder anders gesagt:Welches Ausmaß er annimmt, ob er vor allem an der Oberfläche, d.h. rhetorisch und strategisch, stattfindet oder in veränderten Überzeugungen gründet? Und drittens fragternach den gesellschaftlichen Interessen in Bezug auf die Schulstruktur und wie weit die Forderung nach einem dreigliedrigen Schulsystem im christdemokratischen Elektorat noch verbreitet ist?
Aus seinen Fragestellungen leitet Messinger einen ebenfalls dreigliedrigen Aufbau seiner Arbeit ab. Zunächst stellt er die historischen Positionen der CDU zur Schulstrukturfrage dar. Dann analysiert er die aktuelle Schulpolitik der Christdemokraten im Nachklang der ersten Pisa-Studie. Und schließlich widmet er sich ausführlich den Einstellungen und Präferenzen, die bezüglich der verschiedenen Schulformen in der deutschen Gesellschaft kursieren.
Heraus kommt eine kluge, durchdachte Studie, die luzide den Wandel der christdemokratischen Positionen in der Schulstrukturfrage analysiert. Dabei zeigt sich, dass sich die Schulpolitik der CDU in der deutschen Nachkriegsgeschichte beständig wandelte. Ferner, dass für die Schulpolitik im Speziellen gilt, was auch für die CDU im Allgemeinen kennzeichnend ist: dass sich nämlich die innerparteiliche Meinungsvielfalt durch eine weitgehende Autonomie der Landesverbände unter dem organisatorischen Dach der Union miteinander vereinbaren lässt.
Letztlich kommtder Autorzu dem Ergebnis, dass der jüngste Wandel zum einen so weitreichend wie vielfach angenommen gar nicht ist, da er nicht durch einen „grundsätzlichen Einstellungswandel innerhalb der CDU“ fundamentiert wird. Und zum anderen korrespondiert er in seiner Halbherzigkeit bzw. Ambivalenz mit den Erwartungen der bildungsbürgerlichen Wählerklientel der Christdemokraten, die zwar gegen Gemeinschaftsschulen an und für sich nicht mehr viel einzuwenden haben–jedenfalls dann nicht, wenn daneben das Gymnasium als exklusive Schulform unangetastet bleibt. Eben das ist die Linie der CDU in der Schulpolitik, die Messinger „pragmatisch“ nennt und die seiner Darstellung zufolge nicht auf einer neuen, durchdachten und in sich schlüssigen schulpolitischen Erzählung basiert. Doch eben darin, in dieser kurzfristig so verdeckten wie erfolgreichen Neujustierung sieht er mittelfristig ein Problem auf die CDU zukommen, da ihr dadurch die Möglichkeit verloren gehe, „ein bestimmtes, vorhandenes, soziales Interesse effektiv für sich zu nutzen“.
Yvonne Wypchol wiederum analysiert die Veränderungen des Familienbildes der CDU. Konkret gilt ihr Interesse dem Prozess, in dessen Verlauf das christdemokratische Familienbild gewandelten sozialen Verhältnissen angepasst wurde und die offizielle Parteilinie der CDU von traditionellen bürgerlichen Vorstellungen über Familie, Ehe, und der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern Abstand nahm. Ihre Fragestellung umfasst daher im Wesentlichen die Suche nach datierbaren Zäsuren dieses Modernisierungsprozesses, sie beinhaltetaber auchdie Ambition, die wichtigsten Protagonisten und AntipodendiesesWandels zu identifizieren, schließlich den Versuch, die Argumente und Motive für die familienpolitische Neuausrichtung zu gewichten.Zeitlich beschränkt sichdie Autorinauf die Zeit zwischen dem Machtverlust der CDU im Bund im Jahr 1998 und dem Ende der Großen Koalition 2009. Bemerkenswert ist außerdem, dass sie ihre Argumentation nicht bloß auf Zeitungsartikel, Programmtexte und die vorhandene wissenschaftliche Sekundärliteratur gründet, sondern zusätzlich eine Reihe von Interviews mit – wie sie es nennt – „feldinternen Experten“ geführt hat.
Wypchol gelingt es, zwei zentrale Daten auf dem Weg der CDU zu einem neuen Familienbild nach 1998 zu benennen. Zum einendas Jahr 1999, welches den BeginnderprogrammatischenErneuerungmarkiert,undzum anderendenAmtsantritt Ursula von der Leyens als Familienministerin im Jahr 2005, derdie praktisch-politische Kurskorrektur markiert. Sehr überzeugend betont die Autorin die Bedeutung, welche neben der Absicht zur Erneuerung auch den steten Anspielungen und Rückbezügen auf den Traditionsbestand des christdemokratischen Familienbildes für den Erfolg der Modernisierer zukam. Aus diesem Umstand leitet sich die Zentralstellung des Begriffes der „Wahlfreiheit“ zur Legitimation des modernisierten Familienbildes ab, da dieser sich sowohl in die Traditionslinie der Subsidiaritätsforderungen der klassischen katholischen Soziallehre stellen lässt als auch eine zukunftsgewandte Öffnung des Familienbegriffes für eine neue Vielfalt der Formen des Zusammenlebens nahelegt. Das Erfordernis, für den Erfolg der familienpolitischen Neujustierung Modernität und Traditionalität zu verknüpfen, begründete auch die SchlüsselrolleUrsulavon der Leyens, die stärker als die anderen zeitgenössischen Parteispitzen der CDU ein „traditionell geprägtes Familienbild[verkörperte]“ und die durch ihre ganze Erscheinung jene unverzichtbare Orientierung bot, die Angela Merkel in ihrem Verzicht auf jede grundsätzliche Erklärung zu stiften nicht imstande war.
Wypcholgelingtdamiteine differenzierte Erklärung für den Erfolg der familienpolitischen Neupositionierung der CDU: Angela Merkel unterstütztedie Reformen, Ursula von der Leyen fungierteals „Gesicht“ der Modernisierung des Familienbildes, den innerparteilichen Gegnern mangeltees an schlüssigen Gegenkonzepten, zudem warensie hin-und hergerissen zwischen einem traditionellen Familienbild und einer liberalen Wirtschaftsauffassung, derzufolge eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen und ein möglichst schneller Wiedereinstieg in den Beruf nach Schwangerschaftspausengrundsätzlichsinnvollseien.
In einem vorläufigen Fazitlässt sich,mithinganz unvollständig,festhalten, dass die Modernisierung (partei-)politischer Organisationen von günstigen Umständen oder auch Gelegenheitsstrukturen abhängt. Mit Blick auf die Schulpolitik sind die Probleme seit denPISA-Studien offenkundig;unzweifelhaft ist auch die Halbierung des Anteils von Arbeiterkindern, die es bis zum Studium schaffen,und mithin die verschärfte soziale Selektion des Bildungswesens. Und im Hinblick auf den Wandel in der Schulpolitik ist der Bedeutungsverlust der Katholiken und der katholischenKircheauf die Kursbestimmung der CDU eine wesentliche Bedingung. DieCDU verbietet sich mittlerweile scharf Einmischungen der Kirche in ihre Belange. Mit dem Wegzug aus dem katholischenBonn ins antiklerikale Berlin ist der religiöse Bezug vieler Abgeordneter undMinisterialer verlorengegangen. Durch die Wiedervereinigung wurde die CDUinsgesamtprotestantischer und konfessionsloser,das Verhältnis zwischenihrunddenProtestantenhattesichaber bereits in den 1960er und 1970er Jahren im Zuge von Frauenfrage und Friedensbewegung abgekühlt.Überhaupt ist das „C“als Bindegliedfür die Christdemokratieentbehrlich geworden, seitdemdasgegenseitigeMisstrauen zwischen Katholiken und Protestanten in der Bundesrepublikgeschwundenist. Ganz unabhängig davon, dass der Lebenswandel der Unverheirateten, Geschiedenen undPatchwork-Familien an der Parteispitzemit konservativ-klerikalen Dogmen schwerlich vereinbarist.
Günstige Gelegenheiten stellen Chancen dar. Diese müssen freilichaberauch genutzt werden. Denngegen weitreichende Reformabsichten formieren sich immer auch gegenläufige, veränderungsskeptische Strömungen, im Fall der jüngsten inhaltlichen Neubestimmungen der CDU ist dies etwa dasseit einiger Zeit verstärkteBedürfnisweiter Teile der CDU-BasisnachideologischerReinheitundAbgrenzung vom politischen Gegner. Hieraus erklärt sich die immer wieder aufflackernde Binnenkritikan derPrinzipienlosigkeit der Kanzlerin und Parteivorsitzenden Merkel. Dies spiegelt sich auchim neuen CDU-Programm, in demweichere Formulierungen, etwa zum EU-Beitritt der Türkei, schärferenAbsichtsbekundungen weichen mussten; desWeiteren in dereindeutigenMitgliederpräferenz pro Schwarz-Gelb;und ebenfalls darin, dass dieMitgliedergruppe der linksmittigen „gesellschaftspolitisch Liberalen“ zuletzt in internen Umfragenzugunsten der„Traditionsbewussten“, „Christlich-Sozialen“ und „Marktwirtschaftlichen“ schrumpfte. Mithin: Zu den günstigen Gelegenheitsstrukturen muss sich Führung hinzugesellen.Die Kennzeichen, Erfordernisse und Möglichkeiten der gewandelten Umfeldbedingungen müssen intuitiv erspürt, Handlungsspielräume illusionslos eingeschätzt, Mehrheiten geschickt gesammelt, Widerstände geduldig überwunden und Entscheidungen mutig vorangetrieben werden.Wie dies im Einzelfall aussieht, darüber informieren schlüssig und gedankenreich die beiden Fallanalysen dieses Buches.
Göttinger Junge Forschung
„Göttinger Junge Forschung“,unter diesem Titel firmiert eine Publikationsreihe desInstitutes für Demokratieforschung, das am 1. März 2010 an derGeorg-August-Universität Göttingengegründet worden ist. Göttinger Junge Forschung verfolgt drei Anliegen: Erstens ist sie ein Versuch, jungen Nachwuchswissenschaftlern ein Forum zu geben, auf demdiesesich meinungsfreudig und ausdrucksstark der wissenschaftlichen wie auch außeruniversitären Öffentlichkeit präsentieren können. Damit soll erreicht werden, dass sie sich in einem vergleichsweise frühen Stadium ihrer Laufbahn der Kritik der Forschungsgemeinde stellen und dabei im Mut zu pointierten Formulierungen und Thesen bestärkt werden.
Zweitens liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Sprache. Die Klagen über die mangelnde Fähigkeit der Sozialwissenschaften, sich verständlich und originell auszudrücken, sind Legion. So sei der alleinige Fokus auf Forschungsstandards „problematisch“ im Hinblick auf eine „potentiell einhergehende Geringschätzung der Lehr- und der Öffentlichkeitsfunktion der Politikwissenschaft“, durch die „Forschungserkenntnisse der Politikwissenschaft zu einem Arkanwissen werden, das von den Experten in den Nachbarfächern und den Adressaten der Politikberatung, aber kaum mehr vom Publikum der Staatsbürgergesellschaft wahrgenommen wird, geschweige denn verstanden werden kann“.[22]Viel zu häufig schotte sich die Wissenschaft durch „die Kunst des unverständlichen Schreibens“[23]vom Laienpublikum ab.
Mitnichten soll an dieser Stelle behauptet werden, dass die Texte der Reihe den Anspruch auf verständliche und zugleich genussreiche Sprache mit Leichtigkeit erfüllen. Vielmehr soll es an dieser Stelle um das Bewusstsein für Sprache gehen, den Willen, die Forschungsergebnisse auch mit einer angemessenen literarischen Ausdrucksweise zu würdigen und ihre Reichweite – und damit Nützlichkeit – soweit zu erhöhen, wie dies ohne Abstriche für den wissenschaftlichen Gehalt möglich erscheint. Anstatt darunter zu leiden, kann sich die Erkenntniskraft sogar erhöhen, wenn sich die Autoren über die Niederschrift eingehende Gedanken machen, dabei womöglich den einen oder anderen Aspekt noch einmal gründlich reflektieren, die Argumentation glätten, auf abschreckende Wortungetüme, unnötig komplizierte Satzkonstruktionen und langweilige Passagen aufmerksam werden[24]– insgesamt auf einen Wissenschaftsjargon verzichten, wo dies zur Klarheit nicht erforderlich ist. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, einen wissenschaftlichen Text weder zu simplifizieren noch zu verkomplizieren, selbst unter der Berücksichtigung, dass die schwere Verständlichkeit von Wissenschaft aufgrund unvermeidlicher Fachbegriffe vermutlich unausbleiblich ist.[25]
Dies sollte jedoch nicht die Bereitschaft mindern, den Erkenntnistransfer via Sprache zumindest zu versuchen. In der allgemeinverständlichen Expertise sah der österreichische Universalgelehrte Otto Neurath sogar eine unentbehrliche Voraussetzung für die Demokratie, für die Kontrolle von Experten und Politik. Neurath nannte das die „Kooperation zwischen dem Mann von der Straße und dem wissenschaftlichen Experten“[26], aus der sich die Fähigkeit des demokratisch mündigen Bürgers ergebe, sich ein eigenes, wohlinformiertes Urteil über die Geschehnisse der Politik zu bilden. Dass in diesem Bereich ein Defizit der Politikwissenschaft besteht, lässt sich, wie gezeigt, immer häufiger und dringlicher vernehmen. Ein Konsens der Kritiker besteht in dem Plädoyer für eine verstärkte Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine interessierte Öffentlichkeit. Hierzu müsse man „Laien dafür interessieren und faszinieren können, was die Wissenschaftler umtreibt und welche Ergebnisse diese Umtriebigkeit hervorbringt“, weshalb „komplexe wissenschaftliche Verfahren und Sachverhalte für Fachfremde und Laien anschaulich und verständlich“ dargestellt werden sollten.[27]
Der Sprache einen ähnlichen Stellenwert für die Qualität einer Studie einzuräumen wie den Forschungsresultaten, mag sich auf den ersten Blick übertrieben anhören. Und wie die amerikanische Historikerin Barbara Tuchman zu berichten weiß, ist dies zumeist „mühselig, langsam, oft schmerzlich und manchmal eine Qual“, denn es „bedeutet ändern, überarbeiten, erweitern, kürzen, umschreiben“.[28]Doch eröffnet dieser Schritt die Chance, über die engen Grenzen des Campus hinaus Aufmerksamkeit für die Arbeit zu erregen und zudem auch die Qualität und Überzeugungskraft der Argumentation zu verbessern. Kurzum: Abwechslungsreiche und farbige Formulierungen, sorgsam gestreute Metaphern und Anekdoten oder raffiniert herbeigeführte Spannungsbögen müssen nicht gleich die Ernsthaftigkeit und den Erkenntniswert einer wissenschaftlichen Studie schmälern, sondern können sich für die Leserschaft wie auch für die Wissenschaft als Gewinn erweisen.
In den Bänden der Göttingen Jungen Forschung versuchen die Autoren deshalb sowohl nachzuweisen, dass sie die Standards und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrschen, als auch eine anregende Lektüre zu bieten. Wie gesagt, mag dies nicht auf Anhieb gelingen. Doch Schreiben, davon sind wir überzeugt, lernt man nur durch die Praxis des Schreibens, somit durch frühzeitiges Publizieren. Insofern strebt die Reihe keineswegs perfektionistisch, sondern perspektivisch die Förderung von Schreib- und Vermittlungstalenten noch während der wissenschaftlichen Ausbildungsphase an.
Freilich soll bei alldem keinesfalls der inhaltliche Gehalt der Studien vernachlässigt werden. Es soll hier nicht ausschließlich um die zuletzt von immer mehr Verlagen praktizierte Maxime gehen, demnach Examensarbeiten nahezu unterschiedslos zu schade sind, um in der sprichwörtlichen Schublade des Gutachters zu verstauben. Die Studien der Reihe sollen vielmehr, drittens, bislang unterbelichtete Themen aufgreifen oder bei hinlänglich bekannten Untersuchungsobjekten neue Akzente setzen, sodass sie nicht nur für die Publikationsliste des Autors, sondern auch für die Forschung eine Bereicherung darstellen. Das thematische Spektrum ist dabei weit gesteckt: von Verschiebungen in der Gesellschaftstektonik über Anatomien von Parteien oder Bewegungen bis hin zu politischen Biografien.
Eine Gemeinsamkeit findet sich dann allerdings doch: Die Studien sollen Momenten nachspüren, in denen politisches Führungsvermögen urplötzlich ungeahnte Gestaltungsmacht entfalten kann, in denen politische Akteure Gelegenheiten wittern, die sie vermittels Instinkt und Weitsicht, Chuzpe, Entschlusskraft und Verhandlungsgeschick zu nutzen verstehen, kurz: in denen der Machtwille und die politische Tatkraft einzelner Akteure den Geschichtsfluss umzuleiten und neue Realitäten zu schaffen vermögen. Anhand von Fallbeispielen sollen Möglichkeiten und Grenzen, biografische Hintergründe und Erfolgsindikatoren politischer Führung untersucht werden. Kulturelle Phänomene, wie bspw. die Formierung, Gestalt und Wirkung gesellschaftlicher Generationen, werden daher ebenso Thema sein, wie klassische Organisationsstudien aus dem Bereich der Parteien- und Verbändeforschung.
Was die Methodik anbelangt, so ist die Reihe offen für vielerlei Ansätze. Um das für komplexe Probleme charakteristische Zusammenspiel multipler Faktoren (Person, Institution und Umfeld) zu analysieren und die internen Prozesse eines Systems zu verstehen, darüber hinaus der Unberechenbarkeit menschlichen, zumal politischen Handelns und der Macht des Zufalls gerecht zu werden,[29]erlaubt sie ihren Autoren forschungspragmatische Offenheit. Jedenfalls: Am Ende soll die Göttinger Junge Forschung mit Gewinn und – im Idealfall – auch mit Freude gelesen werden.
Einleitung
Sören Messinger/Yvonne Wypchol
Die Christlich D
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























