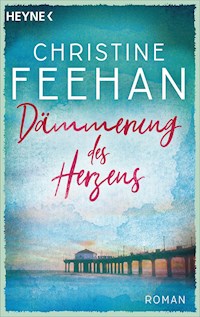4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Knisternde Lesemomente für zwischendurch
Als Jessie in das Haus des Rockstars Dillon kommt, um auf dessen Kinder aufzupassen, ist sie sofort von dem geheimnisvollen Musiker gebannt. Zwischen den beiden entspinnt sich eine leidenschaftliche Affäre. Doch in dem düsteren Gemäuer spukt es…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der amerikanischen Originalausgabe AFTER THE MUSIC Deutsche Übersetzung von Ursula Gnade
Deutsche Erstausgabe 02/2011 Redaktion: Stefanie Brösigke
Copyright © 2001 by Christine Feehan Copyright © 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-06891-2V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
Für Manda und Christinamit den besten Wünschen.Möget ihr immerÜberlebenskünstlerinnen sein.
1
Jessica Fitzpatrick erwachte schreiend, und ihr Herz stampfte im Rhythmus des Entsetzens. In der Dunkelheit ihres Zimmers war die Furcht ein atmendes Lebewesen, dessen Gewicht sie unter sich begrub. Sie lag hilflos da und konnte sich nicht von der Stelle rühren. Sie schmeckte die Angst in ihrem Mund und fühlte, wie sie durch ihre Adern strömte. Um sie herum schien die Luft so dick zu sein, dass ihre Lunge brannte und sich nach Sauerstoff verzehrte. Sie wusste, dass sich tief in den Eingeweiden der Erde etwas Ungeheuerliches regte. Im ersten Moment lag sie erstarrt da und lauschte angestrengt dem Murmeln von Stimmen, die sich hoben und senkten und Worte in einer uralten Sprache summten, die niemals gesprochen werden sollte. Glühende rote Augen sahen sich suchend im Dunkeln um und forderten sie auf, näher zu treten. Jessica fühlte die Macht dieser Blicke, als sie sich auf sie richteten und noch dichter an sie herankamen. Sie riss ihre eigenen Augen auf, denn der Drang zu fliehen war stärker als alles andere.
Der Raum um sie herum schwankte, und sie wurde aus der schmalen Koje auf den Boden geschleudert. Die kalte Luft riss sie augenblicklich aus ihrem Alptraum heraus, und sie erkannte, dass sie nicht alle geborgen zu Hause in ihren Betten lagen, sondern sich inmitten eines heftigen Unwetters in der Kajüte eines wüst schaukelnden Bootes befanden. Das Boot wurde von einer gewaltigen Welle zur nächsten geschleudert und bekam einiges ab.
Jessica kam unbeholfen auf die Füße und klammerte sich an den Rand der Koje, als sie sich mühsam zu Tara und Trevor Wentworth schleppte, den beiden Kindern, die einander mit blassen, verängstigten Gesichtern eng umschlungen hielten.Tara schrie, und ihr entsetzter Blick hatte sich auf Jessica geheftet. Auf halbem Weg zu den Zwillingen wurde Jessica vom nächsten wütenden Aufbäumen des Bootes wieder zu Boden geworfen.
»Trevor, zieh deine Schwimmweste sofort wieder an!« Auf allen vieren kriechend erreichte sie die beiden Kinder und nahm sie in die Arme. »Fürchtet euch nicht, es wird schon alles gutgehen.«
Das Boot wurde von einer Welle hochgehoben, schwankte auf dem Wellenkamm und glitt auf der anderen Seite schnell hinab, wobei die drei in alle Richtungen geschleudert wurden. Salzwasser strömte auf das Deck, raste die Stufen hinunter in die Kajüte und überzog den Boden mit einer Schicht eiskalter Nässe. Tara schrie laut auf, klammerte sich an den Arm ihres Bruders und versuchte verzweifelt, ihm beim Schließen seiner Schwimmweste zu helfen. »Das ist er. Er ist schuld. Er will uns umbringen.«
Jessica schnappte entsetzt nach Luft. »Tara! Niemand kann das Wetter kontrollieren. Es ist ein Sturm. Nichts weiter als ein ganz gewöhnliches Unwetter. Captain Long wird uns unbeschadet zur Insel bringen.«
»Er ist böse. Ein Ungeheuer. Ich will nicht hingehen.« Tara schlug sich die Hände vor das Gesicht und schluchzte. »Ich will nach Hause. Bitte, Jessie, bring mich nach Hause.«
Jessica überprüfte Trevors Schwimmweste, um sich zu vergewissern, dass ihm nichts passieren konnte. »Sag so etwas nicht, Tara. Trev, bleib hier bei Tara. Ich sehe nach, was ich tun kann, um zu helfen.« Damit die Kinder ihre Worte hörten, musste sie die Stimme erheben, um sich gegen das Heulen des Windes und das Tosen des Meeres durchzusetzen.
Tara warf sich in Jessicas Arme. »Geh nicht weg – wir werden sterben. Ich weiß es genau – wir werden alle sterben. Es wird uns so ergehen wie Mama Rita.«
Trevor schlang die Arme um seine Zwillingsschwester. »Nein, wir werden nicht sterben, Schwesterchen, weine nicht. Captain Long hat schon viele schlimme Stürme überstanden«, beteuerte er ihr. Er blickte mit seinen stechenden blauen Augen zu Jessica auf. »Stimmt’s, Jessie?«
»Stimmt genau, Trevor«, bestätigte sie. Jessica hielt sich am Treppengeländer fest und machte sich an den Aufstieg zum Deck.
Der Regen fiel in Strömen und schwarze Wolken brodelten am Himmel. Der Wind erhob sich zu einem gespenstischen Pfeifen. Jessica hielt den Atem an und beobachtete, wie Long sich damit abmühte, das Boot durch die Wogen zu steuern und sie näher an die Insel heranzubringen. Es schien der uralte Kampf zwischen Mensch und Natur zu sein. Langsam zeichneten sich die kompakten Umrisse der Insel durch den strömenden Regen ab. Salzwasser sprühte auf, und die Gischt wurde von den Felsen zurückgeworfen, doch als sie sich dem Ufer näherten, wurde das Meer ruhiger. Sie wusste, dass es dem Kapitän nur aufgrund seiner großen Erfahrung und seiner Ortskenntnis überhaupt möglich war, das Boot in diesem schrecklichen Unwetter zum Anlegesteg zu steuern.
Es schüttete wie aus Eimern. Die Wolken über ihren Köpfen waren so schwarz und schwer, dass die Dunkelheit der Nacht erbarmungslos wirkte. Dennoch erhaschte Jessica ab und zu einen Blick auf den Mond, der einen gespenstischen Anblick bot, wenn das vorbeiziehende Schwarz der Wolken sein Licht verschleierte.
»Los jetzt, Jessie«, rief Captain Long. »Bring die Kinder und euer Gepäck hinauf. Ich will euch keine Minute länger auf diesem Boot haben.« Die Worte gingen in der Heftigkeit des Sturms fast unter, aber es war deutlich zu erkennen, wie eilig er es mit seiner Aufforderung hatte.
Sie eilte nach unten und warf Trevor mehrere Bündel und Rucksäcke zu, während sie Tara auf den Stufen und dem glitschigen Deck stützte. Captain Long hob Tara auf den Anlegesteg, bevor er Trevor ans Ufer half. Er packte Jessicas Arm mit festem Griff und zog sie eng an sich, damit sie ihn hören konnte. »Das gefällt mir nicht … Jess, ich hoffe, er erwartet euch. Wenn ich weg bin, sitzt ihr hier fest. Du weißt, dass er nicht gerade der umgänglichste Mensch ist.«
»Mach dir keine Sorgen.« Sie tätschelte seinen Arm, obwohl ihr Magen rumorte. »Ich rufe dich an, falls wir dich brauchen. Willst du wirklich nicht über Nacht bleiben? «
»Ich fühle mich dort draußen sicherer.« Er wies auf das Wasser.
Jessica winkte ihm zum Abschied, wandte sich dann der Insel zu, und wartete, bis sich ihre Beine wieder an den festen Boden gewöhnt hatten. Vor sieben Jahren war sie das letzte Mal hier gewesen. Ihre Erinnerungen daran waren der Stoff für Alpträume. Als sie jetzt zu dem Bergrücken aufblickte, rechnete sie fast damit, ein flammendes Inferno zu sehen, aus dem rote und orange Flammen turmhoch in den Himmel aufragten, doch sie sah nur die schwarze Nacht und den Regen. Das Haus, das früher einmal hoch oben auf der Klippe mit Blick auf das Meer gestanden hatte, gab es schon lange nicht mehr. Nur ein Haufen Asche war geblieben.
Im Dunkeln war die Vegetation erschreckend, ein unheilverkündender Anblick. Der wolkenverhangene Mond sandte sein schwaches Licht auf den Boden, wo es ein eigenartiges, unnatürliches Muster erschuf. Die Insel war dicht bewaldet und mit undurchdringlichem Gestrüpp bewachsen ; der Wind ließ Bäume und Sträucher einen makaberen Tanz vollführen. Kahle Äste bogen sich und schabten geräuschvoll aneinander. Kräftige Tannen schwankten wie verrückt und ließen einen Schauer spitzer Nadeln durch die Luft regnen.
Jessica holte tief Atem, hob resolut ihren Rucksack hoch und reichte Trevor eine Taschenlampe, damit er vorangehen und ihnen den Weg weisen konnte. »Kommt schon, Kinder, lasst uns zu eurem Vater gehen.«
Der Regen prasselte auf sie herunter und durchnässte sie; die Tropfen bohrten sich wie spitze Eiszapfen direkt durch die Kleidung in ihre Haut. Mit gesenkten Köpfen schleppten sie sich die steilen Steinstufen hinauf, die vom Ufer zum Inneren der Insel führten, wo sich Dillon Wentworth vor der Welt verbarg.
Die Rückkehr auf die Insel ließ eine Flut von Erinnerungen an die guten Zeiten über Jessica hereinbrechen – als Rita Fitzpatrick, ihre Mutter, den Job als Haushälterin und Kindermädchen bei dem berühmten Dillon Wentworth an Land gezogen hatte. Jessica war hellauf begeistert gewesen. Sie war damals knapp dreizehn Jahre gewesen, alt genug, um den künftigen Star zu würdigen, einen Musiker, der seinen Platz unter den größten Musiklegenden einnehmen würde. Dillon hatte viel Zeit außer Haus verbracht, auf Tour oder im Aufnahmestudio, aber wenn er zu Hause gewesen war, war er meistens mit seinen Kindern zusammen gewesen oder er hatte es sich in der Küche mit Rita und Jessica gemütlich gemacht. Sie hatte Dillon in den guten Zeiten gekannt, während dieser fünf Jahre, die von unglaublicher Magie erfüllt gewesen waren.
»Jessie?« Trevors junge Stimme riss sie aus ihren Gedanken. »Weiß er, dass wir kommen?«
Der Junge sah ihr fest in die Augen. Mit seinen dreizehn Jahren musste Trevor durchaus klar sein, dass sie nicht ganz allein mitten in der Nacht durch ein Unwetter laufen würden, wenn sie erwartet worden wären. Sie wären mit einem Wagen auf der Straße am Bootshaus abgeholt worden.
»Er ist euerVater,Trevor, und Weihnachten steht vor der Tür. Er verbringt zu viel Zeit allein.« Jessica strich sich das regennasse Haar aus dem Gesicht und straffte ihre Schultern. »Das tut ihm nicht gut.« Und Dillon Wentworth war verantwortlich für seine Kinder. Er musste sich um sie kümmern und sie beschützen.
Die Zwillinge hatten ihren Vater nicht so in Erinnerung wie sie. Er war so lebendig gewesen. So attraktiv. Und vieles mehr. Sein Leben war märchenhaft gewesen. Dillon mit seinem guten Aussehen, seinem Talent, seinem ansteckenden Lachen und seinen berühmten blauen Augen – alle hatten sich um ihn gerissen. Dillon hatte sein Leben im Scheinwerferlicht verbracht, im grellen Licht der Regenbogenpresse und des Fernsehens, der Clubs und der gefüllten Stadien. Es war erstaunlich, geradezu unbeschreiblich, wie viel Energie und Kraft Dillon Wentworth bei seinen Auftritten ausstrahlte. Auf der Bühne glühte er hell und heiß, ein Mann mit dem Herzen eines Poeten und dem Talent eines Teufels, wenn er Gitarre spielte und mit seiner rauen, rauchigen Stimme sang.
Aber zu Hause … Jessica erinnerte sich auch an Vivian Wentworth mit ihrem spröden Lachen und den Fingern mit den roten Krallen an den Spitzen. An ihre glasigen Augen, wenn sie von Drogen benebelt war, unter dem Einfluss von Alkohol taumelte oder bei einem ihrer Wutausbrüche Gläser zerschmetterte und Fotos aus Bilderrahmen riss. Der langsame, grauenhafte Abstieg in den Wahnsinn des Rauschgifts und des Okkulten. Niemals würde Jessica Vivians Freunde vergessen, die zu Besuch kamen, wenn Dillon nicht da war. Die Kerzen, die Orgien, der Singsang, immer dieser Singsang. Und Männer. Unmengen von Männern im Wentworth’schen Bett.
Plötzlich schrie Tara laut auf, drehte sich zu Jessica um und warf sich ihr so stürmisch in die Arme, dass sie beinahe von den Stufen gestoßen worden wäre. Jessica packte sie mit festem Griff und drückte sie eng an sich. Beide froren so sehr, dass sie unkontrolliert zitterten. »Was ist los, Schätzchen?«, flüsterte Jessica dem Kind ins Ohr. Dort auf der steilen Treppe beschwichtigte sie das Mädchen und wiegte es in ihren Armen, während der Wind sie beide fortzublasen drohte.
»Ich habe etwas gesehen, glühende Augen, die uns angestarrt haben. Es waren rote Augen, Jess. Rot, wie die Augen eines Ungeheuers … oder eines Teufels.« Das Mädchen erschauerte und klammerte sich fester an Jessica.
»Wo, Tara?« Jessicas Stimme klang ruhig, obwohl sich ihr Magen vor Anspannung verknotet hatte. Rote Augen. Sie selbst hatte diese Augen gesehen.
»Da.« Tara deutete in die Richtung, ohne hinzusehen. An Jessica geschmiegt, verbarg sie ihr Gesicht. »Etwas hat uns durch die Bäume angestarrt.«
»Es gibt Tiere auf der Insel, Schätzchen«, sagte Jessica beschwichtigend, doch sie strengte sich an, im Dunkeln zu sehen. Trevor unternahm den löblichen Versuch, den kleinen Lichtkreis der Taschenlampe auf die Stelle zu richten, auf die seine Zwillingsschwester gedeutet hatte, doch der Lichtstrahl konnte den strömenden Regen nicht durchdringen.
»Das war kein Hund, ganz bestimmt nicht, Jessie, das war eine Art Dämon. Bitte, bring mich nach Hause, ich will nicht hier sein. Ich habe solche Angst vor ihm. Er sieht so schrecklich aus.«
Jessica holte tief Luft und atmete langsam aus. Sie hoffte, dadurch ruhig zu bleiben, denn plötzlich wollte sie selbst kehrtmachen und weglaufen. Hier gab es zu viele Erinnerungen, die sie bedrängten und mit gierigen Klauen nach ihr griffen. »Er hat sich bei einem Brand fürchterliche Narben zugezogen, Tara, das weißt du doch.« Es kostete sie Mühe, mit fester Stimme zu sprechen.
»Ich weiß, dass er uns hasst. Er hasst uns so sehr, dass er uns nie wieder sehen will. Und ich will ihn auch nicht sehen. Er hat Leute ermordet.« Tara schleuderte Jessica diese bittere Anklage ins Gesicht. Der heulende Wind griff die Worte auf und trug sie über die Insel.
Jessica hielt Tara noch fester und schüttelte sie ungehalten. »Ich will nie wieder hören, dass du so etwas Furchtbares sagst. Niemals, hast du mich verstanden? Weißt du, warum dein Vater in jener Nacht in das Haus gelaufen ist? Tara, du bist zu intelligent, um auf dummes Geschwätz und anonyme Anrufer zu hören.«
»Ich habe die Zeitungen gelesen. Es stand alles in den Zeitungen!«, jammerte Tara.
Jessie war wütend. Fuchsteufelswild. Weshalb sollte jemand nach sieben Jahren plötzlich alte Zeitungen und Klatschblätter an die Zwillinge schicken? Tara hatte das Päckchen, das in schlichtes braunes Papier eingeschlagen war, in aller Unschuld geöffnet. Die Boulevardpresse war brutal gewesen, voller Anschuldigungen, die sich um Drogen, Eifersucht und Okkultismus drehten. Die Spekulationen, Dillon hätte seine Frau mit einem anderen Mann im Bett erwischt und es sei zu einer Orgie von Sex, Drogen,Teufelsanbetung und Mord gekommen, waren viel zu prickelnd gewesen, um nicht ausführlich von den Skandalblättern ausgeschlachtet zu werden – lange, bevor die tatsächlichen Ereignisse ans Licht kommen konnten. Jessica hatte Tara jämmerlich schluchzend in ihrem Zimmer vorgefunden. Wer auch immer es für angebracht gehalten hatte, die Zwillinge über die Vergangenheit ihres Vaters in Kenntnis zu setzen, hatte mehrfach angerufen, Trevor und Tara abscheuliche Dinge ins Ohr geflüstert und darauf beharrt, ihr Vater hätte mehrere Menschen ermordet, darunter auch ihre Mutter.
»Euer Vater ist in das brennende Haus gelaufen, um euch Kinder zu retten. Er dachte, ihr wärt beide drinnen. Jeder, der heil herausgekommen war, hat versucht ihn aufzuhalten, aber er hat sich gewehrt, ist ihnen entwischt und hat sich euretwegen in ein flammendes Inferno gestürzt. Das ist kein Hass, Tara. Das ist Liebe. Ich erinnere mich noch an jenen Tag, bis in alle Einzelheiten.« Sie presste die Finger auf ihre pochenden Schläfen. »Ich kann es niemals vergessen, ganz gleich, wie sehr ich mich anstrenge.«
Und angestrengt hatte sie sich wirklich.Verzweifelt hatte sie versucht, die Klänge des Singsangs zu übertönen, den Anblick der schwarzen Kerzen auszublenden und den Geruch der Räucherstäbchen zu verdrängen. Sie erinnerte sich an das Geschrei, die erhobenen Stimmen, das Geräusch der Schüsse. Und an die Flammen, die schrecklichen, gierigen Flammen. An die Rauchschwaden, die so dicht gewesen waren, dass man nichts hatte sehen können. Auch die Gerüche vergingen nicht. Selbst jetzt hatte sie beim Aufwachen manchmal noch den Gestank von brennendem Fleisch in der Nase.
Trevor legte einen Arm um sie. »Weine nicht, Jessica. Nun sind wir schon mal hier und frieren alle, also lasst uns einfach weiterlaufen. Lasst uns Weihnachten mit Dad feiern, einen Neubeginn machen und versuchen, diesmal mit ihm klarzukommen.«
Jessica lächelte ihn durch den Regen und die Tränen an. Trevor. Er war seinem Vater so ähnlich und wusste es nicht einmal. »Wir werden ein wunderbares Weihnachtsfest verbringen,Tara.Warte ab, du wirst es sehen.«
Sie stiegen die restlichen Stufen hinauf, bis der Boden sich ebnete und Jessica den vertrauten Pfad fand, der sich durch die dichten Wälder zum Anwesen wand. Die kleine Insel im Meer zwischen Washington und Kanada war relativ abgelegen. Hier verkehrte nicht einmal eine Fähre vom Festland. So hatte Dillon es sich gewünscht, denn er wollte, dass seine Familie auf seiner eigenen Insel ungestört war. Früher hatte es Wachpersonal und Hunde gegeben. Jetzt gab es hier nur noch Schatten und quälende Erinnerungen, die ihr in der Seele wehtaten.
In den alten Zeiten hatte es auf der Insel vor Menschen gewimmelt, und es hatte reges Treiben geherrscht; jetzt war es still und nur ein Hausmeister lebte in einem der kleineren Häuser irgendwo auf der Insel. Jessicas Mutter hatte ihr erzählt, Dillon dulde auf Dauer nur einen einzigen älteren Mann hier. Selbst bei Regen und Wind war nicht zu übersehen, dass das Bootshaus schlecht instand gehalten wurde und die Straße, die in einem Bogen zum Haus hinaufführte, überwuchert war und kaum benutzt wurde. Am Landungssteg, wo immer etliche Boote gelegen hatten, war zwar jetzt keines in Sicht, doch im Bootshaus musste Dillon immer noch ein Boot liegen haben.
Der Pfad führte durch den dichten Wald. Der Wind peitschte die Äste so kräftig, dass der Baldachin, den die Bäume über ihren Köpfen bildeten, bedrohlich schwankte. Der Regen konnte die Wipfel nur mit Mühe durchdringen, doch einzelne Tropfen trafen laut platschend auf den Weg. Kleingetier verschwand raschelnd im Gebüsch, wenn sie vorüberkamen.
»Ich glaube nicht, dass wir noch in Kansas sind«, scherzte Trevor mit einem unsicheren Lächeln.
Jessica drückte ihn an sich. »Löwen und Tiger und Bären, meine Güte«, zitierte sie aus Der Zauberer von Oz und freute sich über das breite Grinsen auf seinem Gesicht.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass er hier lebt«, schniefte Tara.
»Tagsüber ist es wunderschön«, beharrte Jessica. »Warte ab, es ist ein herrlicher Ort. Die Insel ist klein, aber hier gibt es alles.«
Sie folgten einer Wegbiegung und gerieten auf dem unebenen Untergrund ins Stolpern. Der kärgliche Lichtschein, den Trevors Taschenlampe auf den Boden vor ihnen warf, diente nur dazu, den Wald noch dunkler und erschreckender wirken zu lassen. »Bist du sicher, dass du den Weg weißt, Jess? Du bist seit Jahren nicht mehr hier gewesen«, sagte er.
»Diesen Weg finde ich mit geschlossenen Augen«, beteuerte ihm Jessica. Das entsprach jedoch nicht ganz der Wahrheit. Früher war der Weg sehr gepflegt gewesen und hatte in einem Bogen zur Klippe geführt. Dieser Weg hier war überwuchert und führte durch den dichtesten Teil des Waldes stetig bergauf zum Inneren der Insel. »Wenn du bewusst darauf achtest, kannst du das Rauschen links von uns hören. Im Moment führt der Bach viel Wasser, aber im Sommer ist die Strömung nicht so stark und er ist auch nicht so tief. Am Ufer wachsen überall Farnsträucher.« Sie wollte weiterreden, weil sie hoffte, ihre eigene Furcht dadurch in Schach zu halten.
Alle drei atmeten schwer von den Anstrengungen des Aufstiegs. Unter einem Baum mit einer besonders ausladenden Krone, die ihnen einen gewissen Schutz vor dem strömenden Regen bot, blieben sie stehen, um Luft zu holen. Trevor ließ den Lichtschein an dem massiven Stamm zu dem Baldachin hinaufgleiten und beschrieb dort Muster aus Licht, um Tara aufzumuntern. Als er den Strahl wieder an dem Stamm hinabsausen ließ, fiel der kleine Lichtkreis nicht weit von ihnen auf den Boden.
Jessica zuckte zusammen und presste sich eine Faust auf den Mund, um nicht aufzuschreien. Im nächsten Moment riss sie Trevor die Taschenlampe aus der Hand und richtete sie wieder auf die Stelle, die er versehentlich angestrahlt hatte. Einen entsetzlichen Moment lang bekam sie kaum Luft. Sie war sicher, dass sie jemanden gesehen hatte, der sie anstarrte. Jemanden in einem langen schwarzen Umhang mit schwerer Kapuze. Der Umhang wirbelte um die schemenhafte Gestalt herum, als handelte es sich um einen Vampir aus einem der Filme, die sich die Zwillinge dauernd ansahen. Wer auch immer es war – er hatte sie böse angestarrt und etwas in den Händen gehalten, das im Lichtschein gefunkelt hatte.
Ihre Hand zitterte heftig, doch es gelang ihr, die Stelle, an der er gestanden hatte, mit dem kleinen Lichtkegel zu finden. Sie war leer. Dort war nichts, keine Menschen und auch keine Vampire in wallenden Kapuzenumhängen. Sie setzte ihre Suche zwischen den Bäumen fort, aber vergeblich.
Trevor umfasste ihr Handgelenk, zog ihre Hand behutsam näher und nahm die Taschenlampe wieder an sich. »Was hast du gesehen, Jess?« Seine Stimme klang ruhig.
Sie sah die beiden an und schämte sich für die nackte Panik, die sie ihr angemerkt hatten, und auch dafür, dass die Insel sie wieder zu dem zu Tode verängstigten Teenager machte, der sie einst gewesen war. Sie hatte sich so viel erhofft: alle zusammenzuführen und eine Möglichkeit zu finden, Dillon wieder in die Welt zurückzuholen. Stattdessen halluzinierte sie. Diese schemenhafte Gestalt gehörte in ihre Alpträume und nicht in ein fürchterliches Unwetter.
Die Zwillinge blickten erwartungsvoll zu ihr auf. Jessica schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, vielleicht einen Schatten. Lasst uns sehen, dass wir schleunigst das Haus erreichen.« Sie schob sie vor sich her und versuchte ihnen Rückendeckung zu geben und zu sehen, was sich vor und neben ihnen befand.
Mit jedem Schritt, den sie machte, wuchs ihre Überzeugung, dass sie keinen Schatten gesehen hatte. Sie hatte keine Halluzinationen gehabt. Sie war ganz sicher, dass irgendetwas, sie beobachtet hatte. »Beeil dich, Trevor, ich friere«, drängte sie ihn.
Als sie die Anhöhe erreichten, verschlug ihr der Anblick des Hauses den Atem. Es war riesig, verschachtelt, mehrere Stockwerke hoch und mit runden Türmchen und grandiosen Schornsteinen versehen. Das ursprüngliche Haus war bei dem Brand vollständig zerstört worden und hier, auf der Anhöhe und umgeben von dichtem Wald, hatte Dillon das Haus seiner Jugendträume gebaut. Er war in den gotischen Baustil vernarrt gewesen, die Linienführung und die Steinmetzarbeiten, die Gewölbedecken und die verschnörkelten Durchgänge. Sie erinnerte sich noch daran, mit welcher Begeisterung er darüber gesprochen und auf der Anrichte in der Küche Bilder ausgebreitet hatte, damit sie und ihre Mutter sie bewundern konnten. Jessica hatte ihn gnadenlos damit aufgezogen, dass er ein verhinderter Architekt sei, und er hatte immer gelacht und erwidert, er sei ein Renaissance-Mensch und gehöre in ein Schloss oder einen Palast. Er hatte sie mit einem imaginären Schwert verfolgt und ihr von furchtbaren Fallen in Geheimgängen erzählt.
Rita Fitzpatrick hatte geweint, als sie dieses Haus gesehen hatte, und sie hatte Jessica erzählt, wie sehr sich Dillon an seine musikalischen Träume geklammert und behauptet hatte, der Bau des Hauses symbolisiere seine Auferstehung aus der Asche. Aber während der Monate im Krankenhaus, nachdem Dillon die Schmerzen und die Qualen seiner furchtbaren Verbrennungen ertragen hatte und sich darüber klargeworden war, dass sein Leben nie mehr zur Normalität zurückkehren würde, war der Punkt gekommen, an dem das Haus für ihn und für alle, die ihn kannten, zum Symbol der Dunkelheit geworden war, die sich in seine Seele geschlichen hatte. Jetzt ließ der Anblick des Hauses die beängstigende Vorahnung in Jessica aufkeimen, dass Dillon ein vollkommen veränderter Mann war.
Sie starrten das riesige Ungetüm an und rechneten fast damit, einen Geist zu sehen, der einen der Fensterläden aufstieß und sie vertrieb. Mit Ausnahme von zwei ihnen zugewandten Fenstern im zweiten Stock lag das Haus im Dunkeln und erweckte so den Eindruck, als würde es aus zwei Augen zurückstarren. Geflügelte Kreaturen schienen an den seitlichen Hauswänden hinaufzuklettern. Das gesprenkelte Mondlicht verlieh den in Stein gemeißelten Wesen eine gewisse Lebhaftigkeit.
»Ich will da nicht reingehen«, sagte Tara und wich zurück. »Wie das aussieht …« Sie ließ ihren Satz unvollendet und hielt sich an der Hand ihres Bruders fest.
»Richtig böse«, half Trevor ihr auf die Sprünge. »Wirklich wahr, Jess, wie eines dieser Spukhäuser in den alten Filmen. Es sieht aus, als würde es uns anstarren.«
Jessica biss sich auf die Unterlippe und warf einen wachsamen Blick über ihre Schulter. »Ihr beide habt zu viele Gruselfilme geguckt. Damit ist jetzt Schluss.« Das Haus sah viel schlimmer aus als alles, was sie jemals in einem Film gesehen hatte. Es wirkte wie ein finster grübelndes Ungetüm, das stumm auf arglose Beute wartete. Wasserspeier kauerten in den Dachtraufen und starrten sie mit ausdruckslosen Augen an. Sie schüttelte den Kopf, um das Bild zu vertreiben. »Keine solchen Filme mehr. Ihr bringt mich dazu, dass ich es auch schon so sehe.« Sie rang sich ein unbehagliches, kleines Lachen ab: »Massenhalluzination. «
»Wir sind zwar nur eine kleine Masse, aber bei mir klappt es.« Eine Spur von Humor schwang in Trevors Stimme mit. »Mir ist eiskalt. Wir sollten besser reingehen. «
Keiner rührte sich von der Stelle. Sie starrten weiterhin stumm das Gebäude an und beobachteten, wie der Wind und der Mond den Steinmetzarbeiten scheinbar Leben einhauchten. Nur das Geräusch des erbarmungslosen Regens erfüllte die Nacht. Jessicas Herz schlug heftig in ihrer Brust. Sie konnten nicht umkehren. In den Wäldern trieb sich etwas herum. Es gab kein Boot, zu dem sie zurückkehren konnten, nur den Wind und den stechenden Regen. Aber das Haus schien sie mit derselben Bösartigkeit anzustarren wie die vermummte Gestalt in den Wäldern.
Dillon hatte keine Ahnung, dass sie in der Nähe waren. Sie hatte geglaubt, sie würde Erleichterung verspüren und sich sicher fühlen, sobald sie ihn erreicht hatten, stattdessen fürchtete sie sich vor seinem Zorn. Und sie fürchtete auch, was er in Gegenwart der Zwillinge sagen würde. Es würde ihm nicht gefallen, dass sie ihm ihr Eintreffen in keiner Weise angekündigt hatte, aber hätte sie ihn angerufen, hätte er ja doch nur gesagt, sie solle nicht herkommen. Er sagte ihr immer, sie solle nicht kommen. Sie hatte zwar versucht, sich damit zu trösten, dass er in seinen letzten Briefen etwas fröhlicher geklungen und mehr Interesse an den Zwillingen gezeigt hatte, doch sie konnte sich nicht vormachen, sie würden ihm willkommen sein.
Trevor setzte sich als Erster in Bewegung und klopfte Jessica aufmunternd auf den Rücken, als er sich an ihr vorbeidrängte und einen Schritt auf das Haus zuging. Tara folgte ihm, und Jessica bildete das Schlusslicht. Irgendwann war die nähere Umgebung des Hauses landschaftlich gestaltet worden, die Sträucher waren gestutzt und Blumenbeete angelegt worden, doch es entstand der Eindruck, als hätte sich schon seit einiger Zeit niemand mehr darum gekümmert. Eine große Skulptur springender Delfine erhob sich aus einem Teich am hinteren Ende des Vorgartens. An den verwilderten Rändern des Gartens waren Statuen grimmiger Raubkatzen verstreut, die aus dem dichten Gestrüpp herauslugten.
Tara rückte näher an Jessica und ein kleiner besorgter Laut entschlüpfte ihr, als sie die Schieferplatten des Gehwegs erreichten. Sie alle zitterten gewaltig, und ihre Zähne klapperten; Jessica redete sich ein, es läge am Regen und an der Kälte. Sie waren bis auf wenige Meter an die Veranda mit ihren hohen, dicken Säulen herangekommen, als sie es hörten. Ein tiefes, grimmiges Knurren. Es kam aus dem Wind und dem Regen und sein Ursprungsort ließ sich unmöglich bestimmen, doch die Lautstärke schwoll an.
Tara bohrte ihre Finger in Jessicas Arm. »Was tun wir jetzt?«, wimmerte sie.
Jessica spürte, dass das Kind unkontrolliert zitterte. »Wir gehen weiter. Trevor, halt deine Taschenlampe bereit – du könntest sie brauchen, um sie dem Ding über den Schädel zu ziehen, falls es uns angreift.« Sie ging weiter auf das Haus zu und nahm die Zwillinge mit. Ihre Bewegungen waren langsam, aber stetig, denn sie wollte das aggressive Verhalten eines Wachhundes nicht dadurch auslösen, dass sie rannte.
Das Knurren schwoll zu einem warnenden Bellen an. Unerwartet wurden der Rasen und die Veranda von Licht überflutet, und der große Schäferhund, der sie mit gesenktem Kopf und entblößten Lefzen erwartete, kam zum Vorschein. Er stand direkt neben der Veranda im dichten Gestrüpp und hielt den Blick fest auf sie gerichtet, als sie die Stufen erreichten. In dem Moment, in dem der Hund sich in Bewegung setzte, wurde die Haustür aufgerissen.
Tara brach in Tränen aus. Jessica hätte nicht sagen können, ob es Tränen der Erleichterung oder der Furcht waren. Schützend schlang sie ihre Arme um das Mädchen.
»Was zum Teufel soll das?«, begrüßte sie ein schlanker Mann mit zotteligem blonden Haar, der in der Tür stand. »Ruhe,Toby«, befahl er dem Hund.
»Vertreib sie schleunigst von meinem Anwesen«, brüllte eine andere Stimme aus dem Inneren des Hauses.
Jessica starrte den Mann in der Tür an. »Paul?« In ihrer Stimme schwang immense Erleichterung mit. Sie ließ die Schultern hängen und plötzlich brannten auch in ihren Augen Tränen. »Dem Himmel sei Dank, dass du hier bist! Die Kinder brauchen dringend eine heiße Dusche, um sich aufzuwärmen.Wir sind halb erfroren.«
Paul Ritter, ein früheres Bandmitglied und ein langjähriger Freund von Dillon Wentworth, gaffte sie und die Zwillinge fassungslos an. »Meine Güte, Jess, du bist es. Und du bist ganz erwachsen. Das sind wohl Dillons Kinder? « Er trat hastig zurück, um sie einzulassen. »Dillon, wir haben noch mehr durchgefrorene Besucher, die dringend eine heiße Dusche und heiße Schokolade brauchen!« Paul zog Jessica, nass, wie sie war, in seine Arme. »Ich kann nicht glauben, dass ihr drei hier seid. Es ist so schön, euch zu sehen. Dillon hat mir kein Wort davon gesagt, dass ihr kommt. Sonst hätte ich euch am Bootssteg abgeholt.« Er schloss die Tür gegen den Wind und den Regen. Die plötzliche Stille brachte ihn zum Schweigen.
Jessica blickte zu der schemenhaften Gestalt auf der Treppe. Im ersten Moment verschlug es ihr den Atem. Diese Wirkung hatte Dillon immer auf sie. Er lehnte an der Wand und wirkte elegant und lässig, die klassische Dillon-Pose. Das Licht ergoss sich auf sein Gesicht, das Gesicht eines Engels. Dichtes blau-schwarzes Haar fiel gewellt auf seine Schultern, so schillernd wie die Flügel eines Raben. Auf seinen markanten Gesichtszügen war die Andeutung von Bartstoppeln zu sehen. Sein Mund war ungeheuer sinnlich, und seine Zähne waren verblüffend weiß, doch das, was auf alle, einschließlich Jessica, immer wieder eine hypnotische Wirkung ausübte, waren seine Augen, umwerfende, leuchtend blaue Augen, die vor Intensität glühten.
Jessica spürte, wie sich Tara neben ihr rührte und ehrfürchtig zu ihrem Vater aufblickte. Trevor gab ein leises Geräusch von sich, das fast gequält klang. Die blauen Augen starrten auf die drei herunter. Sie sah, wie sich Freude und ein Ausdruck wohlwollenden Erstaunens auf Dillons Gesicht breitmachten. Als er vortrat und mit beiden Händen das Geländer packte, lag ein bezauberndes Strahlen auf seinem Gesicht. Er trug ein kurzärmeliges Hemd und seine nackten Hände und Arme waren so deutlich zu erkennen, als sei ein Scheinwerfer, der jedes Detail hervorhob, darauf gerichtet worden. Seine Arme, seine Handgelenke und seine Hände waren von einem Geflecht aus vernarbter Haut überzogen. Auch seine Finger waren vernarbt und gekrümmt. Der Gegensatz zwischen seinem Gesicht und seinem Körper war schockierend. Das Engelsgesicht und die entstellten, wulstigen Arme und Hände.
Tara erschauerte und warf sich in Jessicas Arme. Augenblicklich zog sich Dillon in den Schatten zurück, und das herzliche Lächeln, mit dem er sie willkommen geheißen hatte, erlosch. Die glühenden blauen Augen hatten von freudig auf eiskalt umgeschaltet. Sein Blick musterte Jessicas Gesicht eingehend, glitt über die Zwillinge und kehrte zu ihr zurück. Seinen sinnlichen Mund kniff er unheilverkündend zusammen. »Sie sind durchgefroren, Paul. Für Erklärungen ist später noch Zeit genug. Bitte zeig ihnen die Bäder, damit sie diese nassen Sachen ausziehen können. Du wirst zwei weitere Schlafzimmer herrichten müssen.« Er stieg im Halbdunkel die Treppe hinauf und achtete sorgsam darauf, dass kein Licht auf ihn fiel. »Und schick Jess zu mir hinauf, sobald sie sich einigermaßen aufgewärmt hat.« Seine Stimme war immer noch diese perfekte Mischung aus rauchig und rau, eine gefährliche Kombination, die wie die Berührung von Fingern über ihre Haut strich.
Als Jessica ihm hinterhersah, schlug ihr das Herz bis zum Hals. Sie drehte sich zu Paul um. »Warum hast du mir nichts davon gesagt? Er kann nicht spielen, stimmt’s? Mein Gott, er kann seine Musik nicht mehr spielen.« Sie wusste, wie viel die Musik Dillon bedeutete. Sie war sein Leben. Sein Ein und Alles. »Ich wusste es nicht. Meine Mutter hat mich nie mehr hierher mitgenommen. Als sie dieses eine Mal mit den Zwillingen hier war, bin ich krank gewesen. Als ich ihn allein besuchen wollte, hat er abgelehnt.«
»Es tut mir leid.« Tara weinte jetzt wieder. »Es war keine Absicht. Ich konnte nicht aufhören, seine Hände anzusehen. Sie sahen nicht menschlich aus. Es war abstoßend. Ich wollte es nicht tun, wirklich nicht. Es tut mir leid, Jessie.«
Jessica wusste, dass das Kind dringend Trost brauchte. Tara fühlte sich schuldig. Und sie war müde, verängstigt und fror. Jessica musste selbst gegen die Tränen ankämpfen, so sehr hatte ihre Entdeckung sie erschüttert. »Schon gut, Schätzchen, wir werden eine Möglichkeit finden, es wieder geradezubiegen. Du brauchst eine heiße Dusche und ein Bett. Morgen früh wird alles besser sein.« Sie sah Trevor an. Er starrte wie hypnotisiert seinem Vater hinterher. »Trev? Ist alles in Ordnung mit dir?«
Er nickte und räusperte sich. »Ja, mit mir schon, aber mit ihm nicht, wenn du mich fragst.«
2
Dampfwolken wanden sich durch das gekachelte Badezimmer und füllten wie unnatürlicher Nebel jeden Winkel aus. Der Raum war groß und schön mit seiner tiefen Wanne und den Hängepflanzen. Nachdem sie lange und heiß geduscht hatte, fühlte Jessica sich wieder menschlicher, doch der Dampf war so dicht, dass sie kaum etwas sehen konnte. Sie rieb den Spiegel mit einem Handtuch trocken und starrte in ihr blasses Gesicht. Sie war erschöpft und wollte nur noch schlafen.
Nichts wünschte sie sich weniger, als Dillon Wentworth wie ein verängstigtes Kind gegenüberzutreten. Ihre grünen Augen waren zu groß für ihr Gesicht, ihr Mund zu üppig, ihr Haar zu rot. Sie hatte sich immer ein raffiniertes, elegantes Aussehen gewünscht, doch stattdessen hatte sie das Äußere des Mädchens von nebenan abgekriegt. Sie betrachtete ihr Spiegelbild genauer und hoffte, reifer zu wirken. Ohne Make-up sah sie jünger aus als fünfundzwanzig. Jessica seufzte und schüttelte aufgebracht den Kopf. Sie war kein Kind von achtzehn Jahren mehr, sondern eine erwachsene Frau, die geholfen hatte, Tara und Trevor großzuziehen. Sie wollte, dass Dillon sie ernst nahm und sich anhörte, was sie zu sagen hatte, statt sie wie einen Teenager zu behandeln.
»Sei nicht theatralisch, Jess«, sagte sie zur Warnung laut zu sich selbst. »Benutze keine Worte wie ›Leben und Tod‹. Sei einfach nur sachlich.« Sie schlotterte, als sie eine trockene Jeans anzog, und trotz der heißen Dusche zitterten ihre Hände. »Gib ihm keine Chance, dir Hysterie oder zu ausgeprägte Fantasie zu unterstellen.« Sie hasste diese Begriffe. Die Polizei hatte sie großzügig verwendet, als Jessica sich dort Rat holen wollte, nachdem den Zwillingen die alten Schundblätter zugeschickt worden waren und die Anrufe begonnen hatten. Sie war ganz sicher, dass die Polizei gedacht hatte, sie sei scharf auf Publicity.
Bevor sie zu Dillon ging, musste sie nachsehen, ob für die Zwillinge gesorgt wurde. Paul hatte sie in ein Zimmer im ersten Stock geführt, eine geräumige Suite mit Wohnzimmer und Bad, wie in einem Hotel. Jessica konnte sich vorstellen, warum Dillon sein privates Wohnhaus so gebaut hatte. Bestimmt hatte er sich anfangs an den Gedanken geklammert, er würde wieder spielen, komponieren und Aufnahmen machen, und sein Haus würde mit Gästen gefüllt sein. Sie litt mit ihm, und es tat ihr in der Seele weh um sein Talent, das musikalische Genie in ihm, das ihn Tag und Nacht quälen musste. Sie konnte sich Dillon nicht ohne seine Musik vorstellen.
Sie schlenderte durch den breiten Flur zu der geschwungenen Treppe. Diese führte ins obere Stockwerk und nach unten ins Erdgeschoss. Jessica war sicher, dass sie die Zwillinge in der Küche und Dillon im zweiten Stock vorfinden würde. Daher begab sie sich nach unten, um das Unvermeidliche hinauszuzögern. Das Haus war wunderschön, alles aus Holz mit hohen Decken und Buntglas. Es gab zahllose Räume, die zu einer Erkundungstour lockten, doch der Klang von Taras Lachen ließ sie in die Küche eilen.
Paul strahlte sie an. »Bist du dem Schokoladengeruch gefolgt?« Er war immer noch so, wie sie ihn in Erinnerung hatte, zu dünn, zu bleich und mit diesem bereitwilligen, einnehmenden Lächeln, das in ihr stets den Wunsch weckte, ebenfalls zu lächeln.
»Nein, dem Klang von Gelächter.« Jessica gab Tara einen Kuss und zerzauste ihr Haar. »Ich höre dich gern lachen. Fühlst du dich besser, Schätzchen?« Das Mädchen sah besser aus, nicht mehr so blass und verfroren.
Tara nickte. »Viel besser. Heiße Schokolade hilft immer, stimmt’s?«
»Sie fahren beide total auf Schokolade ab«, teilte Trevor Paul mit. »Du machst dir keine Vorstellung davon, wie schrecklich es zugeht, wenn keine Schokolade im Haus ist.«
»Hören Sie nicht auf ihn, Mr. Ritter«, spottete Tara. »Er liebt Schokolade auch.«
Paul lachte. »Mich hat seit Jahren niemand mehr Mr. Ritter genannt, Tara. Nenn mich Paul.« Er lehnte sich entspannt neben Jessica an die Anrichte. »Ich hatte das Gefühl, Dillon wusste nicht, dass ihr kommt. Was hat euch hierhergeführt?«
»Weihnachten natürlich«, sagte Jessica munter. »Wir wollten Weihnachten im Kreise der Familie feiern.«
Paul lächelte, doch selbst das konnte die Schatten aus seinen dunklen Augen nicht vertreiben. Er warf den Zwillingen einen Blick zu und verkniff sich die Bemerkung, die er sonst gemacht hätte. »Wir haben im Moment so viel Gesellschaft wie seit Jahren nicht mehr. Das Haus ist voll, alles alte Bekannte, die offensichtlich dieselbe Idee hatten.Weihnachten, so, so.« Er rieb sich das Kinn und zwinkerte Tara zu. »Ihr wollt einen geschmückten Baum und alles, was dazugehört?«
Tara nickte feierlich. »Ich will einen großen Baum, den wir alle zusammen schmücken, wie wir es immer getan haben, als Mama Rita noch am Leben war.«
Jessica sah sich in der großen Küche um und war den Tränen näher, als ihr lieb war. »Hier sieht es genauso aus, Paul. Es ist dieselbe Küche wie im alten Haus.« Sie lächelte die Zwillinge an. »Erinnert ihr euch noch?« Bei der Vorstellung, dass Dillon das Reich ihrer Mutter detailgetreu wiederaufgebaut hatte, wurde ihr warm ums Herz. Sie hatten fünf glückliche Jahre in der Küche verbracht. Vivian hatte sie nicht ein einziges Mal betreten. Oft hatten sie Witze darüber gemacht, dass sie wahrscheinlich nicht einmal den Weg zur Küche kannte.Aber Tara, Trevor und Jessica hatten den größten Teil ihrer Zeit an diesem Zufluchtsort oder in seiner Nähe verbracht. Es war ein Ort der Geborgenheit und des Friedens gewesen, ein Rückzugsort, wenn Dillon auf Tour war und man sich in den anderen Räumen nicht mehr zu Hause fühlte.
Trevor nickte. »Tara und ich haben gerade mit Paul darüber gesprochen. Hier fühlt man sich wie zu Hause. Ich habe fast damit gerechnet, den Schrank zu finden, in den ich meinen Namen geritzt hatte.«
Paul nahm Jessica am Ellbogen und bedeutete ihr mit dem Kopf, ihm aus der Küche zu folgen. »Du solltest ihn nicht zu lange warten lassen, Jessie.«
Mit aufgesetzter Fröhlichkeit winkte sie den Zwillingen zu, als sie Paul widerstrebend folgte und ihr flau in der Magengrube wurde. Dillon. Nach all der Zeit würde sie ihm gegenübertreten. »Wie meintest du das, alles alte Bekannte? Wer ist hier, Paul?«
»Die Band. Dillon kann zwar nicht mehr so spielen wie früher, aber er komponiert noch. Du weißt ja, wie sehr ihm die Musik am Herzen liegt. Jemand hatte die Idee, ein paar Songs in seinem Studio aufzunehmen. Er hat sich natürlich ein supertolles Studio eingerichtet. Die Akustik ist perfekt, er hat die neuesten Geräte angeschafft, und wer könnte einem Song von Dillon Wentworth widerstehen? «
»Er komponiert wieder?« Freude wogte in ihr auf. »Das ist ja wunderbar, genau das, was er braucht. Er ist viel zu lange allein gewesen.«
Auf der Treppe passte Paul seinen Schritt dem ihren an. »Es fällt ihm schwer, Menschen um sich zu haben. Er will nicht gesehen werden. Und seine aufbrausende Art … Er ist es gewohnt, seinen Willen zu bekommen, Jessica. Er ist nicht mehr der Dillon, den du kennst.«
Etwas in seiner Stimme, ließ in ihrem Kopf die Alarmglocken schrillen. Sie warf ihm einen Seitenblick zu. »Das erwarte ich auch nicht. Ich weiß, dass du mich vertreiben willst und versuchst, ihn zu beschützen, aber Trevor und Tara brauchen einen Vater. Es mag ja sein, dass er viel durchgemacht hat, aber das gilt auch für die beiden. Sie haben ihr Zuhause und ihre Eltern verloren. Vivian war kein großer Verlust, sie kannten sie kaum und das, woran sie sich erinnern, ist nicht erfreulich, aber Dillon hat sie im Stich gelassen. Egal, wie du es drehst und wendest – er hat sich zurückgezogen, und sie waren auf sich allein gestellt. «
Paul blieb im ersten Stock stehen und blickte die Treppe hinauf. »Er ist durch die Hölle gegangen. Über ein Jahr im Krankenhaus, damit sie alles Erdenkliche für seine Verbrennungen tun konnten, all diese Operationen, die Hauttransplantationen und die Reporter, die ihm ständig im Nacken saßen. Und natürlich die Gerichtsverhandlung. Er ist so bandagiert wie eine verfluchte Mumie vor Gericht erschienen. Es war der reinste Medienrummel. Fernsehkameras wurden ihm ins Gesicht gehalten, und die Leute haben ihn angestarrt wie ein Monster. Sie wollten glauben, er hätte Vivian und ihren Geliebten ermordet. Sie wollten, dass er schuldig ist. Vivian war nicht die Einzige, die in jener Nacht gestorben ist. Sieben Menschen sind bei diesem Brand ums Leben gekommen. Sie haben ihn als Ungeheuer hingestellt.«
»Ich war hier«, rief ihm Jessica leise ins Gedächtnis zurück, während ihr Magen gegen die Erinnerungen aufbegehrte. »Ich bin gemeinsam mit zwei Fünfjährigen auf Händen und Knien durch das Haus gekrochen, Paul. Ich habe sie aus einem Fenster gestoßen und bin ihnen gefolgt. Tara ist seitlich an der Klippe hinuntergerollt und wäre beinah im Meer ertrunken. Ich konnte sie nicht aus dem Wasser ziehen und es rechtzeitig auf die andere Seite des Hauses schaffen, um Dillon Bescheid zu geben, dass sie in Sicherheit sind.« Sie war so erschöpft gewesen, nachdem sie darum gekämpft hatte, Tara zu retten, die sich kaum noch an der Wasseroberfläche hatte halten können. Sie hatte kostbare Zeit damit vergeudet, mit den Kindern am Strand zu liegen, mit rasendem Herzen und brennender Lunge. Währenddessen hatte sich Dillon von den anderen losgerissen und sich seinen Weg in das brennende Haus freigekämpft, um die Kinder zu retten. Sie presste eine Hand an den Kopf. »Glaubst du etwa, ich denke nicht jeden einzelnen Tag meines Lebens daran? Was hätte ich tun sollen? Ich kann es nicht ändern, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen.« Eine Woge von Schuld ergriff sie, bis sie sich ganz elend fühlte.
»Jessica.« Dillons Stimme wehte die Treppe herunter. Niemand hatte eine solche Stimme wie Dillon Wentworth. Wie er ihren Namen sagte, beschwor nächtliche Fantasien herauf, lebhafte Eindrücke von schwarzem Samt, der über entblößte Haut streift. Mit dieser Stimme konnte er bezaubern, hypnotisieren und Tausende von Menschen in seinen Bann ziehen. Seine Stimme war eine mächtige Waffe, und Jessica war schon immer anfällig dafür gewesen.
Sie umklammerte das Geländer und stieg zu ihm hinauf. Er erwartete sie am oberen Ende der Treppe. Es betrübte sie zu sehen, dass er sich umgezogen hatte und jetzt ein langärmeliges weißes Hemd trug, das seine vernarbten Arme verbarg. Ein Paar dünne schwarze Lederhandschuhe bedeckte seine Hände. Er war schlanker als früher, vermittelte aber immer noch den Eindruck von immenser Kraft, die sie so lebhaft in Erinnerung hatte. Seine Bewegungen waren anmutig und zeigten sein rhythmisches Gespür. Er schritt nicht über eine Bühne, er schwebte. Er war nur neun Jahre älter als sie, aber in sein Gesicht waren Falten des Leidens gemeißelt und seine Augen spiegelten tiefen inneren Schmerz wider.
»Dillon.« Sie sagte seinen Namen. So viel mehr stieg aus der Asche ihrer gemeinsamen Vergangenheit auf, so viele Worte, so viele Gefühle. Sie wollte ihn in ihren Armen halten, ihn eng an sich ziehen. Sie wollte die Hände nach ihm ausstrecken, doch sie wusste, dass er sie nicht anrühren würde. Stattdessen lächelte sie und hoffte, er würde sehen, was sie empfand. »Ich bin so froh, dich wiederzusehen. «
Ihr Lächeln wurde nicht erwidert. »Was hast du hier zu suchen, Jessica? Was hast du dir dabei gedacht, die Kinder herzubringen?«
Sein Gesicht war eine undurchdringliche Maske. Paul hatte Recht. Dillon war nicht mehr so wie früher. Dieser Mann war ihr fremd. Er sah aus wie Dillon, er bewegte sich wie Dillon, aber dort, wo früher ein bereitwilliges Lächeln und eine gewisse Sinnlichkeit gelauert hatten, trug er nun einen grausamen Zug um den Mund. Seine blauen Augen hatten immer vor Intensität geglüht, vor innerem Aufruhr, vor unbändiger Leidenschaft und purer Lebensfreude. Jetzt leuchteten sie in einem stechenden Eisblau.
»Siehst du ganz genau hin?« Er konnte seinen Worten gegen Ende eine Wendung geben, sie durch eine andere Betonung verdrehen, die nur ihm zu eigen war. Seine Worte waren bitter, doch seine Stimme war ruhig und distanziert. »Sieh dich ruhig satt, Jess, bring es hinter dich.«
»Ich betrachte dich, Dillon. Warum auch nicht? Ich habe dich seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Nicht seit dem Unfall.« Sie achtete bewusst darauf, dass ihre Stimme neutral klang, obwohl ein Teil von ihr um ihn weinen wollte. Nicht wegen der Narben auf seinem Körper, sondern wegen der weitaus schlimmeren Narben auf seiner Seele. Und er sah sie an, seine Blicke glitten wie Dolche über sie und nahmen jede Einzelheit zur Kenntnis. Jessica würde nicht zulassen, dass er sie aus der Fassung brachte. Es war zu wichtig für sie alle. Tara und Trevor hatten niemand anderen, der für sie kämpfte und sich für ihre Rechte einsetzte. Für ihren Schutz. Und es schien so, als hätte auch Dillon niemanden.
»Das glaubst du also, Jessica? Dass es ein Unfall war?« Ein humorloses kleines Lächeln ließ seine Lippen weicher werden, doch seine Augen glitzerten wie Eiskristalle. Dillon wandte sich von ihr ab und ging zu seinem Arbeitszimmer. Er trat zurück und bedeutete ihr, vor ihm einzutreten. »Du bist noch viel naiver, als ich dachte.«
Jessicas Körper streifte seinen, als sie an ihm vorbeiging, um sein privates Reich zu betreten. Sie nahm ihn so deutlich als Mann wahr, dass sämtliche Nervenenden schlagartig zum Leben erwachten. Elektrische Funken schienen zwischen ihnen überzuspringen. Er holte scharf Luft, und seine Augen wurden rauchgrau, bevor er sich von ihr abwandte.
Sie nahm sein Arbeitszimmer in Augenschein, um sich von ihm und seiner Männlichkeit abzulenken, und empfand es als angenehm. Es hatte mehr von dem Dillon, den sie in Erinnerung hatte. Viel weiches Leder, Gold- und Brauntöne, warme Farben. Kostbare Bücher standen, durch Glastüren geschützt, in deckenhohen Regalen. »Das Feuer war ein Unfall«, wagte sie erneut zu sagen, um sich behutsam vorzutasten.
Es schien, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Dieses Haus war anders und dennoch dasselbe, das sie in Erinnerung hatte. Dort gab es behagliche Orte, die von einem Moment auf den anderen verschwinden konnten. Dillon war ein Fremder, und in seinem funkelnden Blick lag etwas Bedrohliches, als er sie mit der Unerschrockenheit eines Raubtieres musterte. Voll Unbehagen nahm Jessica auf der anderen Seite des riesigen Mahagonischreibtisches Platz. Sie hatte das Gefühl, sie hätte es mit einem Feind und nicht mit einem Freund zu tun.
»So lautet der offizielle Urteilsspruch, nicht wahr? Ein komisches Wort – offiziell. Man kann fast alles offiziell machen, indem man es auf Papier schreibt und oft genug wiederholt.«
Jessica wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Sie hatte keine Ahnung, was er damit andeuten wollte. Sie verflocht ihre Finger miteinander und sah ihn mit ihren grünen Augen eindringlich an. »Was willst du damit sagen, Dillon? Glaubst du, Vivian hat das Haus vorsätzlich in Brand gesteckt?«