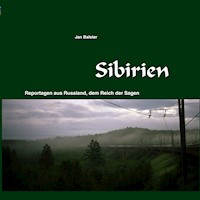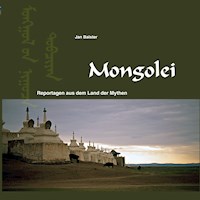
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie sich die nomadische Mongolei zu einem konsumorientierten Land verändert hat, in dem westliche Lebensart mehr zählen als die alten Tugenden. Und warum daran auch der Kult um Dschingis Khan nichts ändert. »Wenn wir, ein ganzes Volk, in gemeinsamer Anstrengung und gemeinsamem Willen, zusammenkommen, so gibt es nichts auf der Welt, was wir nicht erreichen oder lernen könne.« (Süchbaatar) Reportagen: - Der fünfte Tiger Asiens, von Urga nach Ulaanbaatar - Nomadenstaat, Aufbruch in ein neues Zeitalter - Der Buddhismus - die Erlösung, zwischen Tradition und Wirklichkeit - Wind, Sand und Kaschmirwolle, Kamelzüchter in der Wüste Gobi … Der Blick durch die Tür ist jeden Tag derselbe. Egal wo ihr Ger in der Gobi gerade steht. Eine Gebirgskette, morgens saftig gelb und mittags, blass gelbbraun, am Abend herrlich rötlich und in der Nacht pechschwarz. Auf der weiten Wüstensteppe gibt es glühende Schicksale, deren Puls die Jahreszeiten und deren Herz die Menschen in den Gers sind. Sie singen, während der Wind über das Land streift, das Lied vom Leben. Mag sein, dass die Wüstensteppe für einen Fremden nur ein karg bewachsener Sandkasten ist, für den Nomaden ist es der Gesang der Düne, der sie glücklich macht. »Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den Menschen...« (Sächsische Zeitung) »… Mongolei-Fotos von Herrn Balster sind wieder mal spitze, finde ich.« (N. Lange, Eurasisches Magazin, Kiew)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der fünfte Tiger Asiens
Nomadenstaat
Der Buddhismus – die Erlösung
Wind, Sand und Kaschmirwolle
Wort‐ und Sacherklärungen:
Literatur:
Internet:
Reisen & Reiseführer:
Über den Autor
Jan Balster, Jahrgang 1974, arbeitet als Freier Bild‐, Reisejournalist und Autor für in‐ und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Verlage.
Er lebte mit Clochards und Wanderarbeitern in Frankreich, in englischen Obdachlosenasylen, mit türkischen Gastarbeitern in London und tingelte als Straßenmusiker durch Irland. Er arbeitete als Weinleser, Fahrradkurier und Tellerwäscher, traf Fremdenlegionäre, IRA‐Sympathisanten, Schiffs‐ und Flugkapitäne.
Während er anfangs mit dem Fahrrad unterwegs war, reiste er 1998 zu Fuß und ohne Geld 3100 km von Dresden, via Mittelmeer nach Irland. Heute ist er mit Verkehrsmitteln unterwegs, die auch die Einheimischen benutzen: zu Pferd, als Tramp, mit Bus und Bahn. Immer wieder zieht es ihn nach Russland und Zentralasien.
Kinderpark im Zentrum von Ulaanbaatar (2000)
»Gier macht den Menschen allzeit arm, und die Fülle dieser Welt macht ihn nicht reich.« Mongolisches Sprichwort
Der fünfte Tiger Asiens Von Urga nach Ulaanbaatar
Hübsch im Tal liegt sie, die Stadt Ulaanbaatar, Hauptstadt der Mongolei. Deren Name ins Deutsche übersetzt »der rote Held« lautet. Gemächlichkeit und Freude strahlt sie aus, wie die Einwohner, wenn sie ihre Gastfreundlichkeit zeigen. Angenehm schwingt das Gemüt, wenn man durch die Straßen flaniert, zwischen Bäumen, die den Boden mit ihrer Beschattung frisch halten. Von jedem Punkt der Stadt aus erblickt man die Berge. Sie bilden ein Hindernis, das es erst zu überwinden gilt, will man eintreten in die stolze und zugleich paradiesische Hauptstadt der Mongolei.
Die Stadt ist mongolisch geprägt, mit russischen und chinesischen Einflüssen verziert. Ihr Zentrum ist der Süchbaatarplatz. Hier treffen sich die Menschen, begrüßen einander, plaudern ein wenig und verabschieden sich wie alte Freunde. Eine frische Prise weht, als würde man am Meer leben. So ist die bereits im Mai beginnende Hitze zu ertragen. Der Staub der kurzen Trockenperiode nach dem Frost des Winters ist beinah verschwunden. Schon zeigt sich das erste Grün an den Straßenrändern. Im Kinderpark, einen Steinwurf vom zentralen Platz entfernt, blüht die städtische Idylle. Sie lädt zum Picknicken ein. Ulaanbaatar ist eine grüne und stressfrei wirkende Stadt – so kenne ich sie.
Und genau danach steht mir der Sinn, als ich im Juni 2007 wieder einmal einreise. Der erste Anruf gilt meinem alten Freund Aza. Sieben Jahre haben wir uns nicht gesehen, Jahre in denen sich Ulaanbaatar und das gesamte Land verändert haben. Auch die Menschen haben sich gewandelt. Die einen interessieren sich stärker für Politik und Religion als jemals zuvor, die anderen haben sich von beidem vollkommen verabschiedet. Die einen versprechen sich ihr Glück von der neuen Zeit, während die anderen nun gar nichts mehr erwarten. Das zwischenmenschliche Klima ist rauer geworden.
Noch immer steht das Reiterstandbild von Damdin Süchbaatar auf dem ihm zu Ehren benannten Platz. Einst »Held der Mongolei«, gab er der Stadt selbst ihren Namen. Das ist alles, was von ihm geblieben ist. Der »Graue Palast«, wie das Regierungsgebäude im Volksmund heißt, ist verschwunden. Abgerissen wurde er nicht, stattdessen ließen die neuen Herrschenden davor ein neues Portal errichten. Es entstand ein Memorial für den legendären Führer des einstigen Mongolenreiches Dschingis Khan, welches klobiger und protziger erscheint, als die mongolische Variante des Lenin‐Mausoleums, die jetzt eingemauert dahinter steht.
»Dschingis Khan ist der neue Held der Mongolei«, sagt Aza. Das Hochgefühl, endlich wieder Mongole sein zu können, erfasste die Bewohner der Stadt im August 1990, als der 750. Jahrestag des Dschingis‐ Khan‐Reiches mit viel Pomp gefeiert wurde. »Das hatten wir uns erkämpft«, sagt Aza. Er war mit vielen anderen im März 1990 auf dem zentralen Platz in einen Hungerstreik getreten. Damit wurde der Rücktritt des Zentralkomitees der Mongolischen Kommunistischen Partei erzwungen und der neue Volksheld Dschingis Khan zur nationalen Symbolfigur erhoben. Die Euphorie schwappte weit ins Land hinein. Und der Erfolg wurde gefeiert. Zwei Monate später erschien »Die geheime Geschichte der Mongolen« im Buchhandel nicht nur in kyrillischer, sondern auch wieder in altmongolischer Schrift.
Im Jahr 1921 hatte man in Urga, wie Ulaanbaatar damals hieß, mit dem Aufbau eines flächendeckenden und einheitlichen Schulsystems begonnen. Anfangs absolvierten die Schüler noch sechs Klassen. Erst ab 1939 entstanden Schulen mit sieben bis acht Klassen, die zwölf Jahre später um zwei weitere Klassenstufen erweitert wurden. Zu diesem Zeitpunkt war das Schulsystem an das der anderen damaligen Ostblockstaaten angepasst worden. Zahlreiche Mongolen nutzten ihre Chance, im Ausland einen Beruf zu erlernen oder zu studieren. »Allein mehr als 25.000 Mongolen gab es in der damaligen DDR«, berichtet Aza.
Das mongolische Bildungssystem versetzte selbst die Asian Development Bank, welche 1992 eine Studie hierzu anfertigte, in Erstaunen. Das Nomadenland Mongolei wies lediglich ein Prozent Analphabeten auf. Dann wurde plötzlich alles anders. Der erste direkt gewählte Präsident Punsalmaagijn Otschirbat verkündete lauthals, die Mongolei wolle »der fünfte Tigerstaat Asiens« werden. Damals glaubten die Mongolen nicht recht daran, sie fassten seine Worte als Scherz auf. Ehe sie noch recht begriffen, fiel das bisher so erfolgreiche Schulsystem der neuen politischen Ausrichtung zum Opfer. Es sei volkswirtschaftlich nicht mehr tragbar, lautete die Begründung.
Bei dieser Gelegenheit ordneten die neuen Demokraten auch gleich an, die altmongolische Schrift zur Staatsschrift zu erheben. »Das war ein Faustschlag gegen das Volk«, bemerkt Aza, »denn die Kinder können sich nun mit den Erwachsenen nicht mehr schriftlich verständigen. Zudem gibt die altmongolische Schreibweise nicht die exakten Laute der heutigen mongolischen Sprache wieder.« Die Folgen wurden zehn Jahre später ersichtlich. Junge Leute schrieben kaum einen Satz fehlerfrei, die Zahl der Analphabeten stieg massiv an. Letzteres lag allerdings nicht nur an der Schulreform: »Das hat auch mit der zunehmenden Armut zu tun«, ergänzt mein Freund. »Viele Landbewohner können sich die Ausbildungszentren für ihre Kinder nicht mehr leisten.«
Der Ruf nach einem Führer, einem Retter der Nation wurde immer lauter. Erneut wurde das »Dschingis‐Khan‐Fieber« von oben herab angeheizt. Da reichte es nicht, dass der beste Wodka der Mongolei bald den Namen der historischen Gestalt trug. Rockbands besangen den großen Feldherren in schrillen Rhythmen und entschuldigten sich in ihren Texten für eine 70jährige Fehlentwicklung in ihrem Land. T‐Shirts, hergestellt in der Inneren Mongolei (China), wurden mit dem Konterfei Dschingis Khans bedruckt und unter die Massen gebracht. Selbst sein Grab suchte man mit immensem finanziellem Aufwand. Gefunden wurde es nie. Immer heftiger forcierte der Staat den Kult um den großen Führer. »Das Übrige besorgte ein bis dahin verbotenes Buch«, berichtet Aza. »Unmittelbar vor den Wahlen des Jahres 2000 erschien Hitlers ‚Mein Kampf’ in mongolischer Übersetzung.«
Fast hektisch eilt Aza mit mir im Schlepptau über den Süchbaatarplatz, als könnte er etwas verpassen. Ab und an bleibt er abrupt stehen, weist mit seiner Hand auf ein Dach, wo einst die Worte »Mir ‐ Frieden ‐ Paix« zu lesen waren. »Frieden brauchen wir nicht mehr«, kommentiert er zynisch. Ein anderes Mal zeigt Aza auf den Fußgängerüberweg, den es vor 15 Jahren noch nicht gab. »Brauchten wir damals nicht«, gähnt er: »bei 200 Privatautos. So viele Fahrzeuge werden heute an einem Tag in Ulaanbaatar zugelassen.« Dann weist er auf die Menschen. Genau hier standen 1991 die ersten freien Unternehmer. Der Beweggrund auf den Platz zu kommen, hatte sich damit geändert: Von nun an galt es, Geld zu verdienen.
Fotografen buhlen um die Gunst der Leute. Ab und an ein Porträt und wieder ein Familienfoto vor dem Reitermonument Süchbaatars. Händler versuchen, Obst, Gemüse und Schnittblumen unter das Volk zu bringen. Die Zeiten, als die lockere Unterhaltung mit dem Nachbarn noch im Vordergrund stand, sind vorbei. Der Platz ist der zentrale Treffpunkt der Stadt geblieben. »Sehen und gesehen werden, heißt das heute«, sagt Aza, während ein Skateboardfahrer zwischen uns hindurchrauscht. »Das heißt auch, dass hier anderer Pomp als früher dominiert. Zwischen Weihnachten und Neujahr entsteht auf dem Platz neuerdings eine Stadt aus Eis. Reiter, Festungen, ganze Szenerien werden gebildet. Eigentlich viel zu teuer für einen Staat, in dem die Armut überproportional wächst.«
Den Kleinunternehmern folgten die Banker und Börsenmakler. Sie scheinen weltweit vernetzt, protzen mit Edellimousinen, die einem Nomaden seine gesamte Herde kosten würden. Die neuen Reichen verwirklichen sich ihren Traum vom eigenen Landhaus vor den Toren der Stadt ‐ dort, wo es noch nach Steppe riecht. Und sie sind es auch, die ausländische Investoren ins Land ziehen.
Ulaanbaatar ist der Schrittmacher, das kulturelle, politische und wirtschaftliche Herz der Mongolei. Da zeigt man sich westlich hellhäutig, mit blond gefärbten Haaren, als asiatisch. Schnell stiegen die Wohnungspreise in schwindelerregende Höhen, wurden die letzten Baulücken an finanzstarke Investoren vergeben. Ein neuer Markt wurde entdeckt, seit der Privatbesitz an Grund und Boden erlaubt ist. Ein Segen für Spekulanten.
Mit dem Zuzug von Kapital wurde ein neuer Generalbebauungsplan für Ulaanbaatar ins Leben gerufen. »Derer hatten wir schon einige«, erzählt Aza: »den Ersten entwarf eine mongolisch‐russische Planungskommission 1954. Gleich darauf folgte der mongolisch‐ chinesische Plan.«
»Entstanden damals Gebäude, wie die dort drüben?«, frage ich. »Ja, in so einem Komplex habe ich auch mal mit meinen Eltern gewohnt«, berichtet Aza. »Komfortabel sind sie angelegt, nur im Winter froren ständig die Leitungen ein. Da herrschten oft Minusgrade in der Wohnung. Heute lebe ich zwar in einem modernen Wohnblock, aber die Leitungen frieren auch dort regelmäßig ein.« Ich versuche zu scherzen: »Dafür sind sie aber hübscher angestrichen…«
Wir schlendern hinüber zur großen Hauptstraße, der Enkh Tayvan, die dunkler erscheint, seit die Häuser in die Höhe wachsen. Und staubiger ‐ seit die Bäume verschwunden sind. Ulaanbaatar hat sich herausgeputzt, hat sich aufgebläht zu einer Metropole, in der es alles gibt. Die Stadt ist die Stein gewordene Entscheidung gegen den nomadischen Grundsatz, ein einfaches Leben ohne Ballast zu führen ‐ einfach kommen und gehen zu dürfen, wie es beliebt. Heute rollen hier Geländewagen aus Japan, mit Ersatzteilen aus Hongkong oder Shanghai. Ober‐ und Mittelklassewagen kommen aus Deutschland, ebenso die sauren Gurken und die Schokolade in den Supermarktregalen. Gleich um die Ecke steht der Rotwein aus Frankreich, die Konserven kommen aus den USA. Das Büchsenbier