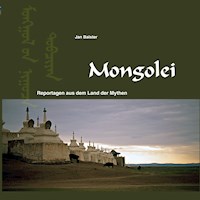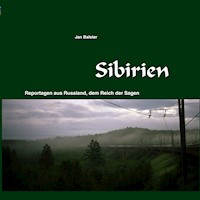Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
2. Auflage: 3100 Kilometer legte Jan Balster zurück - auf Schusters Rappen, wie man so sagt. Vom Ufer der Elbe bis an den Atlantik, quer durch Westeuropa via Schweiz, Frankreich, Großbritannien und Irland. Das Besondere war nicht nur die Art des Reisens, sondern auch die Umstände: Jan Balster hatte keinen Euro in der Tasche. Sein lebendiger, anschaulicher Bericht über eine ungewöhnliche Entdeckungstour ist mehr als nur Mitteilung über ein Abenteuer. Es ist auch eine überzeugende Einladung, mal über den deutschen Tellerrand zu schauen. Balster ermuntert und ermutigt mit seinem Beispiel, aus dem alltäglichen Trott auszubrechen. Dazu bedarf es keines gefüllten Kontos, sondern nur etwas Mut und Selbstvertrauen. Und Freunde finden sich überall, die einem weiterhelfen. weitere Informationen: https://editioneurasien.de »Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den Menschen ...« (Sächsische Zeitung) »... ein echter Weltenbummler ...« (Dresdner Morgenpost)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.«
Gandhi
Über den Autor
Jan Balster, Jahrgang 1974, arbeitet als freier Bild-, Reisejournalist und Autor für in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Verlage.
Er lebte mit Clochards und Wanderarbeitern in Frankreich, in englischen Obdachlosenasylen, mit türkischen Gastarbeitern in London und tingelte als Straßenmusiker durch Irland. Er arbeitete als Weinleser, Fahrradkurier und Tellerwäscher, traf Fremdenlegionäre, IRA-Sympathisanten, Schiffs- und Flugkapitäne.
Während er anfangs mit dem Fahrrad unterwegs war, reiste er 1998 zu Fuß und ohne Geld 3100 km von Dresden, via Mittelmeer nach Irland. Heute ist er mit Verkehrsmitteln unterwegs, die auch die Einheimischen benutzen: zu Pferd, als Tramp, mit Bus und Bahn. Immer wieder zieht es ihn nach Russland und Zentralasien.
»Don't let nothing get you plumb down ...«
Woody Guthrie (1912 ‐ 1967), »Bound for Glory«, 1943
Inhaltsverzeichnis
Es geht los
Schweiz
Zum Ursprung der Schweiz
Über den Furkapass ins Tal der Rhône
Übernachtung im Bahnhof von Martigny
Frankreich
Barbecue mit zwei Belgiern
Georges
Die Frauen von Lyon
Richtung Süden
Nur weg hier
Überfall am Fête Nationale
Minigolf am Mittelmeer
Auf dem Güterzug durch das Zentralmassiv
Magenkrämpfe
Pennerleben
Als Gast auf einem Schlepper
Paris
Festgenommen am Tour de Eiffel
Cèline
Père-Lachaise et Notre-Dames
Gewohnheiten
Großbritannien
Am Leuchtturm von Eastbourne
Fahrradkurier und Tellerwäscher
Der wunderliche Steinkreis
Obdachlosenheim in Bristol
Linda und Sonny
Irland
Aus Liebe zur Natur
Zwischen Containern
Harte Brötchen für den Osten
Cliffs of Moher
Als Tramp nach Osten
***
Es geht los
Einen Blick in den Spiegel. Rasieren, Haare kämmen. Von heute ab, kann ich darauf verzichten. Durch Europa wandern, tobt in meinem Kopf. Zähne putzen, waschen, wann werde ich diese Dinge wieder an so einem feinen Becken vornehmen.
Sonnenstrahlen breiten sich auf meinem Gesicht aus. Mit geschlossenen Augen versuche ich die Zeit, zwischen Traum und Wirklichkeit zu verlängern. Doch meine Gedanken sind längst nicht mehr hier. In diesem Haus, wo ich seit drei Jahren nur an den Wochenenden, kurz zu Besuch gekommen, genächtigt habe.
Schon als Kind wollte ich reisen. Irgendwohin. Da gab es Tage, an denen ich mich in mein Zimmer verkroch und las. Auf dem Schreibtisch stapelten sich die Bücher zu Türmen. Ich las sie alle. Ich saugte sie in mich ein, ohne dabei den leisesten Hauch langer Weile zu spüren. Sie trugen mich in eine andere, neue Welt, die mich miterleben ließ. Ich fühlte mich als Held, der Abenteurer bestand und am Ende in den Sonnenuntergang ritt. Aber sie versetzten mich auch in eine Welt, von der ich niemals glaubte, dass sie mich selbst so sehr betrifft. Das ich alle Gefühle, die ich damals nur als Leser kannte, am eigenen Leib widerfahren würde…
Lautlos fällt die Tür ins Schloss. Beiläufig werfe ich den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten. Los geht es. Mein erster Weg führt mich an die Elbe, die sich westlich an dem Städtchen Coswig, meinem Wohnort, vorbeischiebt. Sie fließt ruhig, und es ist ausgesprochen still, heute. Komisch, dass mir das früher nie aufgefallen ist. Der Himmel beglückt mich an diesem, meinem ersten Tag mit Sonnenschein, und so folge ich dem Elbradweg nach Dresden. Zwanzig Kilometer sollen es werden. Nur so zur Probe. Weiß ich, ob ich den so selbstlos aufgebürdeten Strapazen der folgenden Monate standhalten werde? Allerdings sollte ich vorsichtig sein, schließlich gilt ab heute auch meine Krankenversicherung nicht mehr. Was für mich bedeutet, dass ich Deutschland so schnell wie möglich verlassen muss. Denn ich habe nur für den Notfall eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen.
Am Ortsausgangsschild verweile ich kurz. Die Riemen meines Rucksackes habe ich nicht optimal auf meine Körpergröße abgestimmt. Sie reiben. Der Wille weiterzugehen ist da. Was habe ich auch davon, wenn ich jetzt umkehre. Natürlich kenne ich Leute, doch gehen sie ihre eigenen Wege. Wir trafen uns, meist abends in den Kneipen, im Stadtzentrum von Schwerin, schwatzten und lästerten über unsere Kollegen, die abwesend waren. Wir ergötzten uns an der Dummheit der anderen und wurden selbst nicht klüger dabei. Ich habe es satt. Deshalb beschloss ich zu reisen. Wohin? Auf jeden Fall wollte ich ans Meer.
Am meisten stören mich die nie abreißenden Gespräche über das Geld. Es betrübt mich zu sehen, wie wichtig es in unserer Gesellschaft geworden war und in welche Aussichtslosigkeit die Freundschaft mitunter wankte ...
Erneut schnalle ich den 40 kg schweren Rucksack auf meinen Rücken. Die Erdanziehungskraft schlägt zu und zwingt mich in die Knie. Verdammt noch mal, jetzt fällt mir noch die blaue Bergsteigerflasche auf den Gehweg. Ich habe sie mir erst bei meinem letzten Aufenthalt in Leipzig gekauft. Von nun an ziert eine Beule die Literflasche am Boden. Ich laufe weiter. Die Boote am kleinen Hafen in Radebeul wiegen in den Wellen der Elbe, sie sind befestigt am Steg. Ein Großvater führt seinen Enkel über die Elbwiese zum Ufer. Es rauscht ein wenig, die Stille hat sich verflüchtigt. Lärm dringt von der nicht weit entfernt vorbeiführenden Landstraße herüber. In der Ferne erkenne ich den Turm des Dresdner Schlosses, den Tabakkontor und die Brücken, die sich über die Elbe schwingen.
Ich wähle die Flügelwegbrücke, die erste der Dresdener Bücken. Alles ist in Bewegung, der Arbeitstag neigt sich dem Ende. Die Autokolonnen schieben sich mühselig aus der Stadt. Menschen passieren einander, ohne sich wahrzunehmen. Was mag uns verloren gegangen sein, damals, als wir noch Zeit hatten. Der Stress ist uns Menschen schon tief in den Falten auf der Stirn eingehauen. Mir gruselt es bei dem Gedanken, jetzt von der Arbeit zu kommen, im festen Wissen daran, morgen wieder hinzumüssen. Vielleicht denken die Leute genau das gleiche von mir. »Der muss doch nicht ganz dicht sein«, sagten meine Freunde, wenn ich ihnen von meinen Flausen erzählte.
Und ich marschiere doch von Dresden nach Dublin.
Ich packte ein paar Sachen zusammen, zwei Hosen, Unterwäsche zum Wechseln, Socken und zwei Pullover, um der Kälte zu entweichen. Sorgsam wurde der Schlafsack eingerollt, das Zelt platzsparend verschnürt und der Fotoapparat, der eigentlich zu Hause bleiben sollte, landete dann doch in meinem Rucksack. Zu guter Letzt wickelte ich, beinah liebevoll mein Banjo in seine wasserdichte und leicht gefütterte Hülle. Im Kopf einen winzigen Funken Hoffnung, mein Eis zu zerbrechen, das gefrorene Meer der Einsamkeit, vor dem ich am meisten Angst bekomme, wenn ich an die mir bevorstehenden Kilometer der Landstraße denke. Doch eins habe ich zu Hause gelassen, eins ohne das zuvor nichts ging, an dem wir krampfhaft festhalten, sofern wir es besitzen und noch fester halten, je mehr wir besitzen: das heiß geliebte Geld.
Müde schlürfe ich über den Asphalt. Öde Straßen, Zigarettenkippen auf den Bürgersteigen, Papier weht durch die Luft, wenn ein Auto an mir vorbeifährt. Die Zeit vergeht schnell. Da steht er, einst prächtig, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeweihte Dresdner Bahnhof. Wie viele Menschen haben bei seinem Bau wohl ihren Schweiß oder gar ihr Leben gelassen, damit ihre Familie den ganzen Monat etwas auf dem Tisch hatte? Wie viele Züge kamen hier im Laufe der Jahre an und verließen ihn wieder? Und wie viele Male verabschiedeten sich hier Freunde? Hatten sie eine Träne in ihren Augen, als sie sich zum Gruß die Hände reichten?
Es ist spät, und ich suche mir eine geeignete Bank, um die Nacht zu verbringen.
Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe
so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.
Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt ein großer Wille steht.
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein
Rainer Maria Rilke (1875 ‐ 1926), »Neue Gedichte«, 1907
Schweiz
Beinah hätte ich den Zug direkt zum Atlantischen Ozean genommen, doch ich will laufen, und so springe ich in Konstanz aus der Bahn. Einen Tag habe ich in den Waggons der Deutschen Bundesbahn verlebt. Es dämmert längst und deutlich begreife ich jetzt, die Endlosigkeit der Straße. Die Schweiz ist erreicht. Von hier aus will ich jeden Kilometer vorerst zum Mittelmeer und von dort zur irländischen Atlantikküste zu Fuß zurücklegen.
Der Drang umzukehren, ist verflogen. Die Heimat ist vergessen. Es nieselt. Die Ausfallstraße in Richtung Will ist unbefahren, und ich träume in die Nacht hinein. Ohne es zu merken, lege ich noch 35 Kilometer zurück. Freudig, als ich meinen Schlafsack in der Nähe von Sirnach auf einer Kuhweide ausrolle. Erschöpft schlummere ich ein.
Trotz des Regencapes rinnt das Wasser, des heftiger gewordenen Regens in meinen Schlafsack. Meine Füße schwimmen darin. Ich fühle mich schlapp, aber was hilft alles jammern, ich muss hoch und weiter. In Windeseile stopfe ich meine Sachen zusammen. Klatsch, und ich liege im Dreck. Ein stechender Schmerz durchzieht meinen rechten Arm. »Verdammt, das Gepäck ist aber auch schwer«, denke ich.
Meinen Daumen hat es erwischt, er ist gestaucht.
Mühsam lege ich die zwei Kilometer zum Sirnacher Bahnhof zurück. Alles klitschnass: der Schlafsack, den ich über die Schultern gelegt habe, und die Sachen aus dem unteren Rucksackfach. Zum Glück bekam das Banjo von dem Regen nichts ab. Bald zeigt sich die Morgenröte, und der Himmel lässt mich eine Auflockerung für den heutigen Tag erahnen. Meine Sachen sind noch klamm, trotzdem, ich marschiere weiter.
Es ist Sonntag. Vor mir erstreckt der Ort Fischingen. Die Schule hat geschlossen. Ich setze mich auf eine Bank und beobachte die Kühe, die gegenüber des Schulgebäudes auf der anderen Straßenseite weiden. Die Glocken um ihren Hals gelegt, bilden sie die einzige Geräuschkulisse. Betrübt blicke ich in die leeren Wasserflaschen. Gibt es in der Nähe einen Bach? Nein. Da lässt sich nichts machen. Ich schnappe meine Flaschen, überquere die Straße und steuere einen Bauernhof an, bleibe stehen, schelle an der Tür und warte. Es rührt sich nichts. Was mache ich ohne Wasser, vor allem ohne Geld. Ich schaue in den Hof: »Grüezi«, ruft mir ein mittelgroßer kräftiger Mann zu. »Suchen Sie etwas?«, fragt er in einem mir unverständlichen Deutsch.
»Meine Flaschen sind leer. Vielleicht haben sie etwas Wasser für mich.«
Ohne zu antworten, nimmt er mir die beiden Flaschen ab und füllt sie reichlich. »Woher kommst du? Aus Deutschland?«
»Sieht man mir das an? Ich möchte zum Mittelmeer zu Fuß wandern.«
»Auf Wanderschaft, das ist gut, Junge. Mein Großvater hat das auch mal gemacht.«
Ich bedanke mich höflich und kehre zur Schule zurück.
Mein Ziel heißt Zürichsee. Der Drang, ein Dach über den Kopf zu haben, lässt mich kaum noch rasten. Die Leute werden mich erwarten. Wie wird sie mich aufnehmen, die Gastfamilie? Ihre Adresse habe ich im Adressbuch der SERVAS-Gesellschaft1 gefunden. Auf 500 Briefen hatte ich zwölf Antworten bekommen und zwei Zusagen. Es half nichts. Aus der Not heraus geboren wurde meine Reise. So habe ich nur zwei Anlaufpunkte. Festes Essen, einmal richtig Waschen und nette Menschen kennenlernen, um deren Lebensgewohnheiten zu entdecken, ein wenig teilzuhaben an ihrem Leben. Doch nichts sollte daraus werden. Vielleicht waren alle im Urlaub im Juni, Juli, August und September dieses Jahres 1998? Ich wollte preiswert reisen, nicht komfortable, mich trieb es hinaus. Man kann nicht alles im Voraus planen. So beschloss ich, überwiegend an der Straße zu schlafen und mir ein- oder zweimal in der Woche einen Zeltplatz zu suchen. Ich möchte Leben wie ein Tramp, ein wenig arbeiten, mein Banjo in der Stadt erklingen lassen und vor allem die Menschen beobachten.
An meiner linken Verse schart der Strumpf wie ein Reibebrett. Noch einen Ort weiter, denke ich, und dann rasten.
Mühlrüti, Steg, Fischenthal, endlich Rüti.
Ich pausiere.
Mein Finger schmerzt. Ich bin erschöpft, fertig, ausgelaugt. Ich werfe den Rucksack von mir. Er drückte und zog mich zu Boden. Ich ziehe den Schuh von meinem linken Fuß. Blut sickerte durch den Strumpf und klebt an der Ferse fest. Ein stummer Schrei folgt, und runter ist er vom Fuß. Die Blase hat sich aufgerieben. Ich wickle eine Binde darum, schlüpfe zurück in den Strumpf. Und wieder die Hauptstraße, entlang an einem kleinen Flüsschen, das gemütlich ins Tal hinab plätschert.
Es hat aufgehört zu regnen, und die Sonne bricht hinter den Wolken hervor. Eine Bahn rattert über die Brücke, welche die Straße kreuzt. Und leise säuselt der Wind durch die Bäume am Waldrand abseits des Ortes. Gemächlich zieht sich die Straße durch das Tal hinauf zu den Bergkuppen, um auf der anderen Seite wieder hinab zu schlängeln. Wund vom Gehen sind die Füße taub. Dabei bin ich noch gar nicht viel gelaufen, gerade einmal 100 Kilometer in drei Tagen.
1 SERVAS (Esperanto: du dienst) wurde 1948 von dänischen Studenten gegründet. Seit 1972 ist die Organisation international tätig, dessen Ziel es ist, durch zwischenmenschliche Kontakte, Vorurteile zwischen den Völkern abzubauen und einen Beitrag zum Weltfrieden zu leisten.
Zum Ursprung der Schweiz
Dort unten liegt Stäfa, in dem einst der Dichter Goethe auf seiner Italienreise zwei Wochen weilte. Wohin soll ich gehen? Ich ahne nicht, welche Richtung ich einschlagen muss. An einer Haltestelle raste ich. Ein Bus hält, die Türen öffnen sich.
»Wo soll es hingehen?«, fragt der ältere Fahrer in kaum verständlichem Schweizerdeutsch.
Ich grüße zurück und antworte: »Ich suche die Häldelistraße hier im Ort. Vielleicht könnten sie mir sagen, wie ich dort hinkomme?«
»Steig ein. Ich halte am Bahnhof. Von dort aus sind es noch fünf Minuten zu Fuß.«
»Aber ich habe kein Geld. Ich komme zu Fuß aus Dresden und möchte hier ein paar Leute besuchen.«
»Steig ein, ich bringe dich hin.«
Das Abfahrtssignal ertönt, und der Bus rollt in die Stadt. So schnell hätte ich mir den Weg nicht träumen lassen. Was werden die Leute denken, wenn ich jetzt schon auftauche. Beim Aussteigen bedanke ich mich ausgiebig. Der Fahrer freut sich, meine Bekanntschaft gemacht zu haben und wünscht mir gute Füße für meine weitere Tour. Ich springe aus dem Bus.
Moni grüßt mich aus dem Kräuter-Garten. Dort steht ein dreigeschossiges Einfamilienhaus mit einer großen Terrasse zur Straße.
»Wie war die Reise? Hast du unser Haus gleich gefunden? Wie lange bist du schon unterwegs? Ach so, du möchtest dich sicherlich etwas ausruhen? Und bevor ich es vergesse, heute Abend kommen noch ein paar Freunde vorbei. Wir möchten unseren gemeinsamen Urlaub in Jugoslawien planen. Ich denke, dass macht dir nichts aus?«
Sie scheint kaum Luft zu holen, oder auf Reaktionen meinerseits zu warten. Ist auch gut so, ich könnte jetzt sowieso nicht antworten. So traue ich mir vorerst nicht, sie nach einem Schaschlikstab zu fragen, um meinen angebrochenen Daumen zu schienen. »Du kannst dich dann auf den Balkon setzen, wenn du dich eingerichtet hast. Ich habe noch etwas vorzubereiten«, rät sie mir und schließt die Tür hinter sich.
Das ist ein kleines Zimmer unter dem Dachboden, gemütlich ausgebaut für die Gäste, wie sie sagt, die sie öfter besuchen. Doch SERVAS-Gäste seien etwas selten. Vielleicht liegt es daran, dass sie früher etwas weiter entfernt vom Bahnhof in einer Wohngemeinschaft lebte. So ist sie nicht erstaunt, als ich ihr sage, wie viele Briefe ich schrieb und wie viele Antworten ich darauf erhalten hatte. Eine Stunde später stehe ich in der Küche, die gleich an die Wohnstube grenzt, frisch geduscht, die Haare gekämmt und ein wenig erholt. Da betritt Gerhard, ihr Freund, die Wohnküche und überschüttet mich mit genau denselben Fragen, die mir Moni bereits stellte. Meine Sprachlosigkeit hat sich gelegt, und wir tauschen uns über meine vergangenen Tage aus.
»Wie lange möchtest du bleiben?«, fragt sie.
»Bis übermorgen, wenn es euch nichts ausmacht? Ich habe zwar Zeit, bis Weihnachten vielleicht, aber bevor es Winter wird, gedenke ich, schon wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen.«
Es läutet an der Tür. Die ersten Freunde treffen ein. Ich begrüße sie mit einer ebenso großen Leidenschaft, wie ich es bei meinen Gastgebern tat. Wir stellen einander vor. Doch ich merke mir die Namen nicht, es sind zu viele. Ein Abend, geprägt mit Plaudereien über deren und meine Reise. Obgleich mir der Berner Dialekt bereits aus dem Radio vertraut ist, kann ich dem überwiegenden Teil ihrer Gespräche kaum folgen.
Den Vormittag vertreibe ich mir in der Stadt. Beide müssen wieder arbeiten, er fliegt für die Swiss Air, und sie arbeitet in einem Kindergarten in Wädenswil auf der anderen Seite des Zürichsees.
Gegen 14 Uhr kehrt Moni zurück.
»Willst du mitkommen? Ich habe mich mit zwei Kollegen zum Baden verabredet.«
»Natürlich«
Der Zürichsee liegt in leichten Wellen schwingend und glasklar. Eine Entenfamilie schwimmt vorbei, und ich begnüge mich damit die Leute zu beobachten und den Gesprächen, der drei Kollegen zu lauschen. Warum sagen sie immer Kollegen zueinander. Die Antwort sollte ich später erhalten. Vorerst vertiefen wir uns in ein Gespräch über die ehemalige Deutsche Demokratische Republik (DDR).
»Höre ich da etwa eine Stimme der Melancholie heraus?«, fragt mich der junge schmächtige Herr mit tiefschwarzem Haar, ein Kollege von Moni, der ebenfalls im Lehrerberuf tätig ist.
»Nun ja, auch wenn in der DDR nicht alles richtig gelaufen war, so muss ich doch nicht alles, als falsch ansehen. Zumindest hat in der DDR jeder, der arbeiten gehen wollte, eine Arbeit erhalten. Es gab Kindergartenplätze, die medizinische Betreuung erfolgte unentgeltlich, und die Kultur war, trotz ihrer Einseitigkeit, sehr gut.«
Ich versuche ihnen nicht zu erklären, dass mir nicht der Zusammenhalt, den es unter den Menschen gegeben hat, fehlt. Diesen hatte ich zu selten verspürt. Eher suche ich nach einer Sicherheit an Arbeitsplätzen. Und den Blick aus dem Fenster in die Gesichter der Menschen, die einfach glücklicher lächelten. Eigentlich habe ich die DDR nicht bewusst wahrgenommen. Ich lebte dort als Kind, war glücklich wie die meisten Kinder auf der Welt. Diktatur? Wie sollen sie es begreifen? Sie leben in einer Neutralität, womit die Menschen in diesem Land gut durch ihre 700-jährige Geschichte gekommen sind, bis heute, und es deutet auch nichts darauf hin, dass sich daran irgendetwas ändern könnte. Sie sind auch nicht mit allem zufrieden, die inländischen landwirtschaftlichen Produkte seien überteuert, versichern sie mir.
»Die Pizza kommt«, sagt Monis Kollegin.
»Kann man sich bei euch eine Pizza zum Strand bringen lassen? Müsst ihr da nicht eure Telefonnummer hinterlassen, wenn ihr den Pizzadienst bestellt?«, frage ich.
»Nein, bei uns bringen sie die Pizza überall hin«, antwortet Moni.
»In Deutschland haben wir ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Wir leben in einer Vorschussgesellschaft.«
»Was muss ich mir darunter vorstellen, unter Vorschussgesellschaft«, fragt mich der schwarzhaarige Herr.
»Das ist jetzt vielleicht nicht der passende Vergleich gewesen, doch wenn man bei uns etwas haben möchte, so muss man es im Voraus bezahlen, nur der Lohn, der kommt immer zu spät.«
Schnell vergeht der Abend. Gerhard verabschiedet sich gegen 10 Uhr von mir, und Moni erklärt mir, dass der Begriff Kollegin nähere Bekannte bedeutet und sie den Begriff Freunde nur für besondere Menschen gebraucht wie für ihren Gerhard.
Sonnenstrahlen dringen ins Zimmer. Ich rekle mich aus dem Bett, konzentriere mich auf meinen Weg, der noch vor mir liegt. Es kommt mir vor, als sei ich schon eine Ewigkeit unterwegs. In der Küche breite ich den Rucksackinhalt aus und reduziere das Gepäck um 12 kg. Ich entnehme mir zwei Äpfel aus der Schale, die auf dem Küchentisch steht, schnüre den trocknen Schlafsack zusammen und trete auf den Balkon. Ab heute verzichte ich auf den Kocher und zugehörige Utensilien. Von nun an werde ich vorwiegend kalte Speisen zu mir nehmen. Ich schnalle den Rucksack auf, der sich deutlich leichter anhebt, hänge den Schlüssel an die vereinbarte Stelle und begebe mich zur Fährstelle.
Ruhig liegt der See, und die Sonne brennt auf meinen Kopf. Die Anlegestelle bebt ein wenig, während die Fähre anlegt. Ich steige ein, genau wie die vier Fahrgäste neben mir. Leicht weht der Wind ums Gesicht, als die Fähre schwankend zum anderen Ufer schwimmt. Die Überfahrt kostet drei Franken.
Ich haste zum Bahnhof. Bahnhöfe werde ich immer wieder angehen und wie erwartet, finde ich hier einen Stadtplan, um aus der Stadt heraus zu finden. Doch der ist zerrissen. So spreche ich den Herren an, der sich gerade eine Zeitung gekauft hat: »Ich möchte nach Brunnen, welchen Weg kann ich aus der Stadt nehmen?«
»Warum nehmen Sie nicht den Zug?«
»Nein«, unterbreche ich ihn, »ich möchte zu Fuß dorthin.«
»Zu Fuß. Das ist ein ganzes Stück Weg. Wo kommst du her?«
»Aus Dresden. Ich bin zu Fuß zum Mittelmeer unterwegs.«
»Du bist allein unterwegs? Fühlst du dich da nicht manchmal allein, wenn du so durch die Welt ziehst?«
»Ich spreche von Zeit zu Zeit mit den Menschen. Ich unterhalte mich mit ihnen.«
Er erklärt mir den Weg, ich bedanke mich und wechsle die Straßenseite. Die Häuser sehen alle so sauber aus, beinah frisch geputzt. Alles sieht neu aus, ich fühle mich wohl. Die Straße steigt leicht und schwingt sich von links nach rechts auf den Hügel. Ich gönne mir eine Pause an einem See, der an die Fahrbahn grenzt, hinter ihm der Wald, in dem der Wind leicht durch die Äste zieht. Ich blicke ins Tal, hinunter auf den Zürichsee, träume ein wenig und vernehme das Rattern der Autos, welche die Straße hinauf fahren.
Die Sonne hat bereits ihren Höchststand erreicht, als ich mich aufrappele. Mücken plagen mich. Ich trotte weiter, genieße die frische Luft, rein und klar dringt sie durch meine Nase in die Lungen ein und lässt die Kilometer leichter verrinnen.
Drei Stunden später erreiche ich die Schweizer Bundesstraße 8. In jeder Richtung erstrecken sich zwei Fahrspuren. Autos rauschen vorbei. Sie haben keine Zeit, die Menschen. Ich fühle mich klein, nicht zugehörig zu dieser Welt. Dabei bin ich erst fünf Tage unterwegs. Wie schnell man sich an die gegebenen Umstände gewöhnt. Ich versuche die Straße zu überqueren. Nichts zu machen, die Autokolonne schießt Stoßstange an Stoßstange an mir vorbei. Einen Kilometer weiter nochmals. Es gelingt, geschwind schlängle ich mich zwischen den Fahrzeugen hindurch. Zu sehr beschleunigt, kann ich kaum abbremsen und falle ins Gras. Es riecht würzig. Ich setze mich unter einen Kirschbaum, nachdem ich mich an seinen blutroten Früchten sattgegessen habe. Nochmals sehe ich mich schüchtern um. Vielleicht hat mich jemand gesehen. Ich habe gestohlen. Dabei hatte ich Hunger, und wer Hunger hat, der darf das.
Die Brücken schwingen sich geschickt über die Täler, je weiter ich gehe, desto müder werde ich. Überanstrengt habe ich mich nicht. So schleppe ich mich bis zur nahe gelegenen Tankstelle.
Wasser ist das Einzige, was ich jetzt brauche. Ein Blick in meine Geldbörse verrät mir, zwei Franken. Die kann ich doch nicht für Wasser ausgeben. Versprach ich mir, dass ich diese Reise ohne Geld machen werde. Sollte ich bei meiner ersten größeren Probe schon versagen. Ich betrete die Tankstelle. Kein Kunde befindet sich im Verkaufsraum. Nur ganz am Ende auf der anderen Seite des länglich gehaltenen Ladens, wühlt ein Mann in der Eistruhe.
»Haben Sie etwas Wasser für mich?«
»Ja, unten im Regal auf der linken Seite stehen die Getränke, nehmen Sie sich etwas«, ruft er mir zu, ohne sich dabei von seiner Arbeit unterbrechen zu lassen.
»Ich habe aber kein Geld«, reagiere ich etwas zurückhaltender. Ruckartig bäumt er sich auf, blickt mich an und lächelt: »Hinter der Tankstelle ist ein Wasserhahn, aber drehe ihn wieder zu, wenn du fertig bist.«
Ich bedanke mich und renne aus dem Laden, halb verdurstet hänge ich meinen Kopf unter das Wasser. Das tut gut. Ich fülle die Flaschen ab, zwei Liter trage ich immer mit mir herum, wenn ich auf der Straße bin.
Lang zieht sie sich durch die Täler, über die noch verhältnismäßig kleinen Berge hinweg. Die Sonne brennt mir im Nacken, und die Füße schmerzen unentwegt. Es bleibt mir kaum Zeit, nicht an sie zu denken. Ich stoppe, setze mich an den Straßenrand, verfolge die Autos mit meinen Blicken und sinne in den Tag. Vier bis fünf Kilometer weiter folgt das gleiche Spiel, und ich treibe mich vorwärts. Sollte ich aufgeben? Gerade jetzt, wo ich so weit gekommen bin? Und während ich so darüber nachdenke, verzieht sich der Himmel in einen dunklen Schein. Der, welcher den ganzen Tag wolkenlos blieb, verhängt sich innerhalb weniger Minuten und beginnt den großen Regenguss vorzubereiten. Schon zu Beginn meiner Reise ist es mir ein Graus gewesen, daran zu denken, wenn es regnet.
In Ecco Homo biege ich links ab. Und als ich den Stadtkern von Schwyz erreiche, schüttet es. Erschöpft sinke ich vor dem prachtvoll, Renaissance-Rathaus aus dem Jahre 1642 nieder. An den Säulen des Rathausganges bahnt sich der Regen seinen Weg und bildet auf dem Bürgersteig eine Pfütze. Der Platz ist gefüllt mit Fahrzeugen und Menschen, die in gewohnten zügigen Gang die Platzseite wechseln. In der Mitte des Platzes prunkt ein Denkmal, wahrscheinlich ein Ritter aus der Zeit vor dem Bau des Rathauses. Oder sollte es ein Abbild Wilhelm Tells sein, der hier einst lebte? Hinter der Stadt erhebt sich, beinah beschützend, die Hochfluh mit ihren 1699 Metern.
Es dunkelt. Der Regen lässt nach und so mache ich meine letzten Kilometer an diesem Tag. Ein Zeltplatz ist angezeigt. Nur welchen Weg soll ich wählen, den nach links oder eher doch den rechten? Ich entscheide mich für den Linken, der Zeltplatz wird wahrscheinlich am See liegen. Eine Eisenbahnbrücke überspannt meinen Weg. Dahinter zeigt sich die Pension, die zu diesem Zeltplatz gehören soll, wie mir ein Einheimischer sagte. Zuerst biege ich in die falsche Straße ein, verliere Zeit, bis ich auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Armes dieses Sees einige Wohnwagen erkennen kann. Kurz entschlossen kehre ich um. Wenige Minuten später stehe ich vor der Anmeldung: »Eine Nacht, bitte.«
»Brauchen Sie Strom für ihren Wohnwagen?«, fragt mich der Herr, der mich noch nicht einmal ansieht.
»Ich habe keinen Wohnwagen. Ich bin zu Fuß unterwegs und möchte hier gern übernachten.«
»Nur mit Wohnwagen, keine Zelte!«, reagiert er ruppig, weil er auf ein Geschäft verzichten muss.
»Aber es regnet, und ich brauche ...«
»Ich sagte doch schon: Es ist nichts mehr frei.«
Der Regen verwandelt die Wege in kleine Bäche, das Wasser umspült meine Füße. Mein Körper reagiert auf jeden äußeren Reiz träge. Der schmale asphaltierte Weg, gleich neben einer Schnellstraße, von dieser nur getrennt durch einen knapp zwei Meter hohen Maschendrahtzaun, zieht sich endlos dahin. Als sich der Weg von der Straße entfernt, entdecke ich in einem Felsspalt ein Kreuz mit der Jungfrau Maria. Vielleicht wird sie mich erleuchten? Oder eher nicht, mit meiner metaphysischen Weltanschauung werde ich das doch nicht vereinbaren können. Es riecht nach Schweinedung. Ich schleppe mich noch einen oder zwei Kilometer, bis ich mich in einen einsam gelegenen Bauernhof wage. Die wohlgenährte Eigentümerin zeigt mir eine Unterkunft. Der Pferdestall besitzt sogar ein eigenes Bad. Ohne sich nochmals umzuwenden, wünscht sie mir eine Gute Nacht und verlangt abschließend, ich solle den Platz morgen sauber verlassen.
Kurze Zeit nach meinem Aufbruch finde ich einen Wegweiser mit der Aufschrift »Jakobsweg«. Dieser alte Pilgerpfad wird mich zum Vierwaldstättersee bringen, etwas abseits von der Straße, ohne den Gestank von Benzin in meiner Nase. Kein Mensch ist zu sehen. Gemütlich weiden die Kühe auf den Wiesen, die den Weg säumen. Eine beruhigende Stille ist eingetreten, die nur durch das Schellen der Glöckchen an den Hälsen der Kühe unterbrochen wird, so als ob sie mich begrüßen wollen, den einsamen Wanderer. Vereinzelt treffe ich auf einen reich mit Blumen verzierten Bauernhof. Schon vor mehr als tausend Jahren zogen hier die Pilger zu ihren Städten bis zum spanischen Santiago vorbei. Und allmählich bedecken sich meine Schuhe mit Staub.
Denn so wie ihre Alpen fort und fort
Dieselben Kräuter nähren, ihre Brunnen
Gleichförmig fließen, Wolken selbst und Winde
Den gleichen Strich unwandelbar befolgen,
so hat die alte Sitte vom Ahn
Zum Enkel unverändert fortbestanden ...
Haben sich die Zeiten geändert, seit Schillers Tell das Volk in eine neue Idylle führte? Ein Bauer begrüßt mich mit dem mir bereits vertrauten »Grüezi« von seinem Traktor, mit dem er über den Feldern seine Runden dreht, während ich die frische Luft genüsslich in mich einsauge. Die Kinder unterbrechen für einige Minuten ihr Fußballspiel und schauen mir verwundert nach. »Ein Wanderer«, rufen sie. Ich grüße mit der gleichen Freude zurück und nehme einen kräftigen Schluck aus meiner Flasche. Das gefällt mir. Ich bin ein Wanderer, tönt es mir noch eine Weile in den Ohren.
Nebelschwaden hängen über dem Vierwaldstättersee. Die Sonne hat keine Chance, und ein leichter Regen feuchtet die Luft zusätzlich an. So kann ich das andere Ufer, wo Tell einst seine Überfahrt wagte, nur erahnen. Dort ist der Mythenstein mit dem Schillerdenkmal und etwas weiter hinten liegt Rütli, dessen Name noch heute die Eidgenossen durch den Schwur verbindet: »Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr.«2
Windstille. Leise schlägt das Wasser gegen die Rümpfe der Schiffe, die ruhig im kleinen Hafen liegen. Nachdenklich verlasse ich die Anlegestelle und entscheide mich für die leicht ansteigende Straße, die direkt in die Hochalpen führt.
»Altdorf 16 km«, lese ich im Vorbeigehen auf dem Verkehrsschild und einige Meter weiter »Brunnen«. Der Ortsausgang ist erreicht.
Die Straße ist eng, eine Fahrspur hin, eine andere wieder zurück. Für den schmalen Bürgersteig ist kaum Platz, und so donnern die 20- und 30-Tonner, dazwischen vereinzelt ein PKW, ohne Rücksicht an mir vorbei. Scheiß-Strecke, Scheiß-Strecke, schimpfe ich. Doch das stört hier niemanden, selbst den Radfahrer nicht, der mich gerade streift. Immer wieder bringen mich die schweren Transporter aus dem Gleichgewicht, der Sog, wenn sie direkt neben mir auftauchen, ist so stark, dass ich mich an der Straßenbegrenzung festhalten muss. Scheiß-Strecke, Scheiß-Strecke, schimpfe ich immer wieder und wünsche mir, bald in Flüelen zu sein.
Ein Tunnel, der erste auf dieser Straße, 475 m lang. Ein kurzer Blick nach hinten, nichts zu sehen. Wie auch bei diesem Dunst, der wie Pech am Asphalt zu kleben scheint. Ich husche hinein. Wenigstens regnet es hier nicht hinein. Plötzlich erfüllt ein ohrenbetäubendes Geräusch die Röhre. Geschwind drehe ich mich um. Scheinwerfer blitzen auf. Ich renne los, springe mit letzter Kraft in eine Nische, presse die Handflächen gegen meine Ohren und warte bis es vorbei ist. Scheiße, Scheiße, immer wieder nur Scheiße, brülle ich durch den Tunnel. Was mache ich hier nur, wo der ganze Transitverkehr durch brettert? Verdammte Blechkisten, verdrecken die Luft und nehmen keine Rücksicht auf die Fußgänger.
Doch alles scheint vergessen, als ich das liebliche Leuchten am Ende des Tunnels entdecke. Die Sonne hat sich mir erbarmt. Glühend strahlt sie von wolkenlos gewordenen Himmel und heizt den Asphalt an. Begeistert hüpfen meine Blicke zur anderen Uferseite und entdecken den langersehnten Ort Rütli.
Noch immer schmiegt sich die Straße eng an die steilen Felswände, als ich Sisikon in einer Bucht erblicke. Ein Zug rattert an mir vorbei, hält im Bahnhof und verschwindet einige Minuten später wieder im Inneren der Felslandschaft. Im Ort pausiere ich. Genussvoll rinnt mir das Wasser aus dem dörflichen Brunnen durch die Kehle. Kinder spielen im Hof und die Autos verringern ihre Geschwindigkeit. Diesmal bin ich schneller. Vor mir der Große und gleich hinter ihm der Kleine Axenberg. Rechts ragt die Tellskapelle hervor und in der Mitte stauen sich die Autos auf der Fahrbahn.
Gegen 19 Uhr erreiche ich Flüelen. Wieder hat sich der Himmel eingetrübt und wieder schlägt das Wasser leicht gegen die Planken der Schiffe. Es nieselt, doch das stört mich nicht. Ich habe den Tag überstanden. Genüsslich schiebe ich mir ein Stück hartes Brot in den Mund. Ein Zug fährt ein, Leute springen hinaus, begrüßen sich förmlich oder fallen sich um die Hälse und wieder anderen, stehen die Tränen in den Augen, weil sie einander verlassen müssen. Das Abfahrtssignal ertönt, Türen schlagen und kreischend verlässt der Zug den Bahnhof. Langsam leert sich der Bahnsteig, der Regen schlägt gegen die Scheiben des Warteraumes, und der Wind treibt das Wasser über den Bahnsteig.
Flüelen, Göschenen, Andermatt, ich nehme die Orte im Eiltempo, 20, 30, 50 km, nichts kann mich halten, ich möchte in die Berge. Bis Göschenen bleibt es flach, dann legt die Straße mächtig zu. Ein Anstieg löst den anderen ab, sodass ich mich bald entschließe, wenn ich an den Furkapass denke, mein Gepäck, in Andermatt mit der Bahn nach Brig vorauszuschicken. Im Bahnhof habe ich ein leichtes Spiel. Scheinbar will die freundliche Dame in der Gepäckannahmestelle schnell nach Hause. Sie willigt sofort ein, ich könnte mein Gepäck erst in Brig zahlen.
Der Abend ist herrlich, eine traumhafte Sonnenröte breitet sich am Himmel aus und taucht die Landschaft in einen goldroten Glanz. Meine Füße, die den ganzen Tag vor sich hin jauchzten, erholen sich bei dem von mir veranschlagten langsamen Schritt ein wenig. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und schlendere die Bundesstraße 19 weiter in Richtung Realp. Freier fühle ich mich, so ohne Gepäck. Lediglich das Banjo, Regencape und den Schlafsack habe ich zurückbehalten. Die zwei Franken klappern jetzt bei jedem Schritt in meiner Hosentasche und ziehen sie dabei leicht nach unten.
Wie scheußlich würde ich jetzt aussehen, ich kurz behost am Strand von Mallorca liegend, von Zeit zu Zeit die Seite wechseln, damit ich rundherum richtig knusprig werde. Und am Abend treibt es mich in die Clubs an der Hauptstraße von La Palma, wo die Animateure sich die Hälse verrenken, damit die Touristen beschäftigt werden. Die wollen unterhalten werden für ihr Geld. Sie zahlen für ihre eigene Unfähigkeit, sich selbst nicht beschäftigen zu können. Dabei sabbern sie die Fußböden der Kneipen und Discos voll und johlen, wenn der Morgen graut, auf Straße erbrechend, dem Hotel entgegen.
Doch manchmal, wenn sie Zeit haben, dann trauern sie ihrem Geld hinterher, wenn sie die Villen der verdammten Prominenz sehen, die sie bei der letzten Wahl votierten.
»Verfluchtes Pack«, grölen sie durch die Straßen und warten heute schon auf den Urlaub im nächsten Jahr, in dem es sie erneut nach La Palma treibt.
Halleluja, ihr Flegel, grüße ich in Gedanken.
2 Friedrich Schiller (1759 ‐ 1805), »Wilhelm Tell«, 1804
Über den Furkapass ins Tal der Rhône
Als die Sonne ihre morgendlichen Fühler ausbreitet, habe ich bereits Realp, 1538 m über Null, passiert. Der Aufstieg ist nicht ungefährlich, die Straße ist mit reichlichen Schlaglöchern gespickt und die Leitplanken fehlen. Einen Meter zu weit nach rechts oder links getreten und mein Blick verliert sich im Abgrund.
Über 1600 m wird es spürbar kühler. Immer noch windet sich die Straße zu ihrem höchsten Punkt hinauf. Ich gehe einen Kilometer nach rechts und den anderen nach links, zwischendurch immer wieder schlucken, damit der Druck auf den Ohren nachlässt, und schon folgt die nächste Spitzkehre. Verdammt sind die eng, denke ich als eine Dreiton-Fanfare ertönt. Ein Postbus brettert in waghalsigem Stil die Straße hinab, Fahrzeuge quetschen sich an die Ränder der Fahrbahn und stoppen, bis er vorbei ist. Dann heulen die Motoren auf, Räder kreischen, Bremsen quietschen, und ich schnaufe wie eine Dampflok den Pass hinauf. In jeder Kehre lege ich eine Pause ein, stütze mich auf einen Straßenpfeiler und atme schnell durch. Weiter geht es und immer bergauf.
1800 m, die Baumgrenze ist erreicht. Für einige Minuten, die ich im Gras verweile, genieße ich die Aussicht und lasse meine Blicke über die sanften Gipfelregionen gleiten, die uns die letzte Eiszeit beschied. Ein Sattelschlepper stoppt neben mir. Der Fahrer winkt mich heran.
»Willst du ein Stück mit«, ruft er herunter.
»Danke, nein. Ich laufe lieber«, erwidere ich, beinah verneigend und beiße die Zähne zusammen. Ich muss hinauf und das zu Fuß. Ich bleibe hart und nichts soll mich davon abbringen.
Geschafft, 14 % Steigung, die steilste eines Schweizer Passes, auf eine Höhe von 2431 m. Wie klein und nichtig alles von hier oben betrachtet aussieht. »Ich hab’s geschafft«, schreie ich ins Tal. Meine Stimme schallt durch die Berge und es klingt, als antworten sie mir.
»Hallo, sie sind doch der Europawanderer?«
Geschwind drehe ich mich in die Richtung des Rufenden: »Sie sind schon ganz schön weit gekommen.«
»Ja«, antworte ich, »der Aufstieg war verdammt hart, aber er hat sich gelohnt.«
»Jedes Mal, wenn ich den Furkapass entlang fahre, raste ich hier. Das gehört schon dazu. Ich genieße die Aussicht. Besonders in den felsigen Höhenlagen sorgen die Wiesen und Weiden für lieblichen Kontrast.«
»Zwei Fünftel der Schweiz bestehen aus Wiesen und Weiden, habe ich gelesen.«
Vor drei Tagen trafen wir uns in der Nähe von Schwyz an einer Tankstelle.
»Sie haben sicherlich Hunger«, erkundigt er sich. Und ohne eine Antwort abzuwarten, öffnet er den Kofferraum seines Audis, entnimmt eine Decke und breitet sie am Rand der Straße aus. Genau an der Stelle, von wo aus man den besten Blick auf den Furkapass hat. In wenigen Minuten ist die Abendbrotstafel gedeckt: Erdbeeren, Äpfel, ein Stück Käse und reichlich Brot.
»Langen sie zu. Meine Frau gibt mir immer zu viel mit. Ich kann nicht alles verspeisen. Außerdem freut sie sich, wenn alles weg ist, und ich nichts zurückbringe.«
»Fahren sie jetzt wieder nach Hause?«
»Ja, wir, also meine Frau und ich, machen dann Urlaub. Wir möchten nach Norwegen. Dort sind die Temperaturen angenehmer. Im Auto komme ich leicht auf 45° C. Und außerdem, man kann nicht immer arbeiten.«
»Ja, da haben sie wohl recht. Allerdings gibt es auch Menschen, die arbeiten wollen, aber keine bekommen.«
Er reagiert nicht auf meine Antwort. Stattdessen zündet er sich eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug und lässt den Rauch durch die Nase entweichen.
»Ich bin noch nie in Skandinavien gewesen. Wohin soll es genau gehen?«
»Nach Hammerfest, an die Fjorde.«
»Nach Hammerfest«, wiederhole ich erstaunt. »Mein Großvater war aus mal dort, nach dem Krieg bei den Amerikanern im Lager.«
Wir genießen die lauen Windzüge, die über den Pass streifen. Genüsslich brennt er sich seine zweite Zigarette an und erzählt von seiner Frau, wie sehr er sie liebt und dass sie gern Kinder haben würden. Doch leider wäre er nicht zeugungsfähig und so suchen sie jetzt nach einer anderen Möglichkeit.
Am Himmel ziehen einige Wolken vorüber und langsam verschwindet die Sonne am Horizont in den Bergen, als er mich verlässt. Sein Audi wird mit jeder Kurve, die er ins Tal rollt, immer kleiner, bis er von mir nur noch als Punkt wahrgenommen wird.
Ich denke an einen heißen Tee. Ein Feuer täte mir sicher auch gut. Doch hier darf kein Licht sein, dies würde man in diesem baumlosen Terrain kilometerweit sehen. Und ich möchte keinen Menschen auf mich aufmerksam machen. Ihren Fragen könnte ich unmöglich entweichen.
Die einsetzende Nachtkälte hält mich wach. Ich schlüpfe in den letzten Pullover, den ich tagsüber um meine Hüften gebunden trage und ziehe den Schlafsack am Kopfende vollkommen zu. Die Luft erwärmt sich nur langsam. Wie kalt mag es nur sein? Sind es vielleicht schon Minusgrade? Vielleicht. Ich höre noch die großen Trucks, welche die Nächte nutzen, um ihr Frachtgut an einem zum anderen Ort zu transportieren, als ich einschlummere.
Mit klammen Fingern pelle ich mich aus meinem Schlafsack. Die Nacht war kalt und hat meine Knochen steif werden lassen. Mühevoll zünde ich eine Kerze an und wärme meine Hände an der kleinen Flamme. Die erste Woche in freier Natur, an der Straße, ohne ein Dach über dem Kopf. Ein starkes Gefühl übermannt mich. Wie müssen sich die Menschen vorkommen, in ihren Häusern, hinter ihren Mauern, eingepfercht auf ihren wenigen Quadratmetern? Ich fühle mich frei, überlegen hier auf der Straße. Was soll mir jetzt noch passieren?
Meine Lebensmittelvorräte sind erschöpft, nur ein kläglicher Rest Wasser bleibt mir noch in einer meiner beiden Flaschen. Doch Durst verspüre ich jetzt weniger. Die Wasserversorgung an der Westrampe ist optimal, ein Bach stürzt die felsige Wand hinab und schneidet die geraden Rampen der Straße. Vielmehr breitet sich ein besorgniserregendes Hungergefühl in meinem Körper aus. Das Abendessen des Schwyzers von gestern war eher eine Gefälligkeit als eine Bettelei.
Etliche Serpentinen hinab erblicke ich an der Straße das Hotel »Belvedere«. Ein PKW rauscht hupend an mir vorbei, vor Scheck springe ich zur Seite und platsche in eine Pfütze. Ich schimpfe ihm hinterher. Da meldet sich mein Magen wieder. Vorsichtig schaue ich mich nach allen Seiten um. Beobachtet mich jemand? Niemand ist zu sehen. Drei Fahrzeuge parken vor dem Hotel. Ich sehe zu den Mülltonnen hinüber. Noch einmal hinter mich, niemand. Dann renne ich, reiße den Deckel der Mülltonne hoch, greife nach der Tüte, die der Küchengehilfe vor wenigen Minuten hineingeworfen hat und schlage ihn lautlos hinunter. Unschuldig kehre ich zur Straße zurück. So etwas habe ich noch nie getan? Ich blicke in den Plastikbeutel. Es riecht nicht. Scheint noch essbar zu sein?
Bald treffe ich rechtsseitig auf den Rhône-Gletscher. Hier an der Straße ist er bereits zu einem milchig-blauen Bächlein geworden, das sich leicht und geschmeidig seinen Weg durch die Landschaft bahnt. Mein Blick fällt zurück auf das Hotel. Es wirkt klein, nichtig gegenüber dem gewaltig erscheinenden Gletscher, der Quelle der Rotten, wie die Rhône in der Schweiz genannt wird. Ich setze mich an den Straßenrand. Zwei Autos rollen vorbei. Ein Hupen dröhnt durch die Stille. Gespannt betrachte ich meine Ausbeute: zwei Äpfel, mit einigen Aufprallstellchen, fünf halb abgenabelte Hähnchenschenkel und drei harte Brötchen. Da lässt es sich doch eine Party feiern. Niemals hätte ich mir früher träumen lassen, einmal stolz darauf zu sein, eine Mülltonne geplündert zu haben. Eben noch ein schlechtes Gefühl und jetzt schon im größten Glück taumeln. Wie man sich verändert, wenn einem nichts anderes übrig bleibt, wenn man glaubt am Ende zu sein. Ich hatte noch niemals zuvor Hunger verspürt. Hunger, der wehtut, der den Magen zerreißt.
Dieses Gefühl sollte ich auf meiner Wanderung noch öfter erleben.
Gegen Mittag donnern einige Motorradfahrer an mir vorbei. Sie sind wohl etwas zu sportlich eingestellt. Der ihnen entgegenkommende VW-Golf muss stark bremsen, während die Fahrer der heißen Öfen galant ausweichen, als wären sie durch nichts gestört. Der Furkapass schwingt sich jetzt 11 % hinab. Meine Schritte werden schneller. Ich gehe flotter auf dem Asphalt und greife die Fröhlichkeit des Tages.
An einer zerfurchten Bergflanke verlassen mich die Serpentinen, die mich seit zwei Tagen begleiteten. Die Straße wird gradlinig, als ich Gletsch erreiche. In diesem kleinen Ort macht das Rhônetal einen Knick. Während ich der immer noch abfallenden Straße nach Brig folge, schlängelt sich der Grimselpass in engen Kurven auf 2108 m an der Alpenkette nach oben. In den Hochalpen breitet sich ein friedliches Land aus. Bergflüsse durchstreifen die Erde, deren Gras frisch und würzig duftet und erfüllen die Umwelt mit ihrem leicht plätschernden Gesang.
Der Abstieg geht mir leicht von den Füßen, ab 1500 m erwärmt sich die Luft wieder. Und während ich die ersten Kleidungsstücke ablege, zeigen sich die typischen Waliser Häuser, unterhalb aus Steinen, oberhalb aus Holz gebaut, die meist in schwarz oder braun getüncht sind, am Straßenrand. Idyllisch. Ich, der flüchtige Betrachter könnte meinen, hier sei das Paradies. Ja, von Weitem, doch auch hier, wenn ich den Häusern näher trete, bröckelt der Putz von den Wänden. Und wenn ich mir erlaube, an einer Tür zu schellen, oder gar nur in die Nähe eines Grundstückes komme, werde ich vom böswilligen Kläffen eines Hundes vertrieben.
Ich bemerke im wahrsten Sinne des Wortes die Abneigung gegenüber Fremden, mit der die Menschen hier existieren. Ich frage mich, wie sie nur so viele Touristen in die Berge ziehen können, um von ihnen zu leben. Es mögen vielleicht die Berge selbst sein, die den Touristen ein Gefühl von Freiheit vorgaukeln, wenn sie im Winter die Skipisten unsicher machen oder im Sommer, wenn sie mit ihrem Bike die Wanderpfade aufwühlen. Am Abend freuen sie sich dann auf die immer lächelnde, jedoch nie ein persönliches Wort an den Gast richtende Kellnerin, die sich ansehnlich in walisischer Tracht zwischen den Tischen hin und her schlängelt. Großzügig geben sich die Touristen, kompensieren Schönheit mit Freundlichkeit, freizügig hinsichtlich des Trinkgeldes. Die Welt des Kapitals schlägt zu, sie zerschlägt unsere Wahrnehmung erbarmungslos und brutal.
Ich genieße den Ausblick über die Berge, hinüber zur steilen Meienwand. Sind hier auch schon Bergsteiger abgestürzt? Wie viele? Ich schmunzle. Eine alte Redensart sagt doch: Nicht der Absturz tötet den Bergsteiger, sondern der Aufprall. Es folgt ein Tunnel mit einem Seitendurchbruch, der wohl für Nachschub, in der sich noch immer dünnen Luft, sorgt. Und ohne es in meinen Füßen wahr zu nehmen, eher in den Knien, vom Bremsen, bin ich in Oberwald. Die zivilisierte Städtchenwelt hat mich wieder. Zwar noch nicht so eng, jedoch deutlich merkbar, als ich ein stark anschwellendes Beben unter den Füßen wahrnehme. Erschrocken wende ich mich um. Was geschieht? Geht die Welt unter?
Zu meiner linken Seite dröhnt ein Zug der Furka-Oberalp-Bahn, die seit 1984 zwischen Oberwald und Gletsch verkehrt, aus einem Eisenbahntunnel. Aus dem nichts ist sie aufgetaucht, sie bringt mir die gewohnte Geräuschkulisse zurück. Sie hat uns den Fortschritt gebracht, den Beginn des Industriezeitalters. Und gerade hier und jetzt, inmitten der von einem Mosaik kleinen Äckern geprägter Landschaft, verdeutlicht sie mir ihr gewaltiges Maß an Überlegenheit. Schnell ist der Reisende an einem anderen Ort, schnell hat er die Vergangenheit hinter sich gebracht und ist in die Zukunft eingestiegen. Ebenso wie diese Motorradkolonne, die gerade den Bergpass bezwingen will. Wieder erscheinen sie mir für einen Augenblick und wieder frage ich mich, ob sie die Landschaft überhaupt registrieren können. Ich werde das nie begreifen. Ja, ich bin altmodisch.
Ich erreiche Ulrichen in 1347 m Höhe. Aus dem schmalen Wildbach Rhône ist inzwischen ein träger kleiner Fluss geworden. In Fiesch unterschreite ich die 1000 m-Grenze, die Straße wird breiter, und das alpine Hochgefühl verschwindet im Tal, in dem ich Brig erkenne. Mit jedem Schritt werden meine Füße leichter und bald tragen sie mich, ohne, dass ich noch das kleinste Anzeichen eines Schmerzes empfinde, in die Stadt hinein.
Am Bahnhof drängen sich Autos vor der Laderampe, Fahrer warten davor, rauchen eine letzte Zigarette, vor der großen Fahrt durch den Alpentunnel nach Bern, wechseln belanglose Worte mit ihren Vorder- und Hintermännern. Mich kümmert das wenig. Ich suche die Gepäckaufbewahrung. Einmal nach links, einmal nach rechts gehe ich durch die Wartehalle. Leute hasten zu ihren Zügen, irren zu Bahnsteigen, andere studieren die Fahrpläne, Kinder lärmen. »Gepäckstück Nummer 1818 aus Andermatt«, sage ich dem vollbärtigen Herrn mit der platten Nase, dessen Statur mich an Bud Spencer erinnert.
Es ist etwas Besonderes. Ich bekomme mein Gepäck zurück, Zelt, Waschzeug, Sachen zum Wechseln. Ich stinke bestimmt, beschnuppere die Luft, fürchterlich dieser Gedanke. Eitel kämme ich mir die Haare mit meinem Fünffingerkamm. Sehe ich gut aus? Es lässt sich nicht viel erkennen im Spiegelbild, das die Glasscheibe gegenüber zurückwirft.
»Das ist aber schwer«, meint der Herr.
»Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich komme von Dresden und werde zur Atlantikküste wandern. Aber für den Furkapass war es dann doch zu schwer«, entgegne ich und krame verlegen in meinen Hosentaschen.
»13,60 Franken, bitte.«
Ich schrecke zusammen. Ich besitze doch nur noch zwei. Sollte ich ihn um eine Galgenfrist bitten, bis heute Abend 18 Uhr? Ich schaue zur Bahnhofsuhr. Gleich 15 Uhr.
»13,60 Franken, bitte«, wiederholt er.
»Ich, ich habe doch nur zwei«, stottere ich. Da lächelnd er, reicht mir den Rucksack herüber und antwortet: »Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und gute Reise.«
Ohne mich nochmals umzuwenden, verlasse ich das Gebäude. Die Sonne heizt in den Straßen, und ich begebe mich geradewegs zum Marktplatz. An der Ecke »Sherlock’s Bar«, ein graues Gebäude mit einem Rundturm der zur Hauptstraße weist. Einige Leute sitzen davor an den Tischen, rauchen ihre Verdauungszigarette, unterhalten sich ein wenig und lassen ihre Blicke über den Platz wandern. Beinah gegenüber, mehr links gehalten, steht eine kleine Kirche, davor ein Brunnen, der mir das Trinkwasser spendet. Erschöpft sinke ich auf die Bank neben den Blumenkästen. Gedankenlos packe ich mein Banjo aus und entlocke ihm die ersten Töne. Im selben Augenblick verstummt das Geschrei hinter mir, die Kinder schauen neugierig herüber und einige wippen mit ihren Füßen im Takt.
Ich lächle zurück und versuche einen ersten Kontakt herzustellen. Das funktioniert fast immer, zuerst die Kinder in seinen Bann ziehen, danach folgen die Eltern ganz von selbst. Der Hunger treibt mich dazu. Wenn man Geld hat, kann man sich etwas zu Essen kaufen, und so spiele ich einige Lieder. Die Kinder klatschen. Die Eltern zücken ihre Portemonnaies, und ich verdiene innerhalb einer Stunde ein ansehnliches Sümmchen von knapp 20 Franken. Damit lässt es sich gut leben.
Wieder windet sich die Straße, die zum Simplonpass führt, den Berg hinauf. Ich schwitze, der Rucksack reißt an meinen Schultern, und ich jammere mit jedem Schritt vor mich hin. 50 km habe ich heute zurückgelegt. Wütend werfe ich den Rucksack an den Straßenrand und sacke daneben. Warum musste ich mich ausgerechnet heute, dazu entschließen einen Zeltplatz aufzusuchen. Brig-Ried, steht auf dem Ortseingangsschild. Los jetzt, treibe ich mich an, hier kann ich sowieso nicht nächtigen. Weiter geht es, und die Straße steigt weiter und weiter.
Endlich, dort ist der Zeltplatz. Er ist leer. »Sie wollen hier campieren«, spricht mich der ältere Platzwart an. »Für eine Nacht, denke ich.«
»Sie können auch länger bleiben. Jetzt, Anfang Juni, sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Sie werden sehen, im August ist hier alles voll.«
»Was kostet denn eine Nacht?«