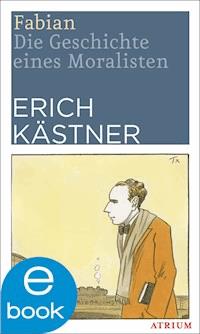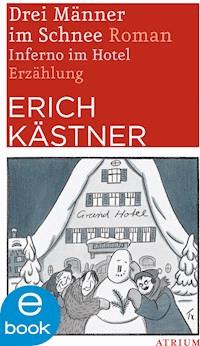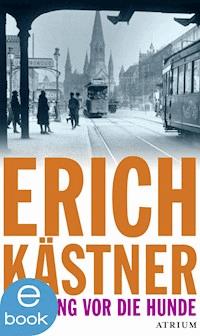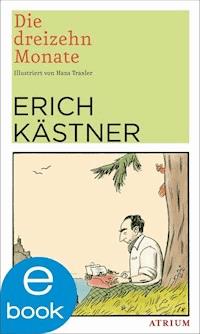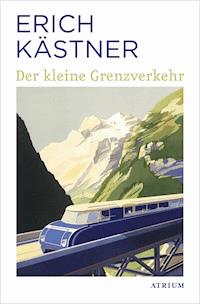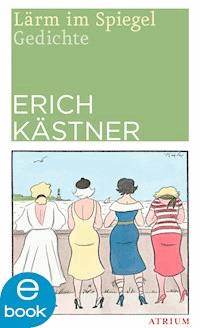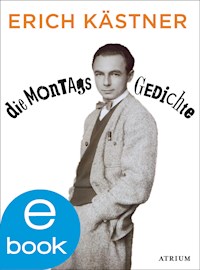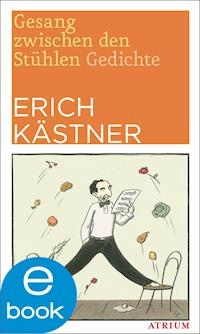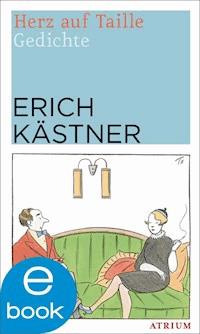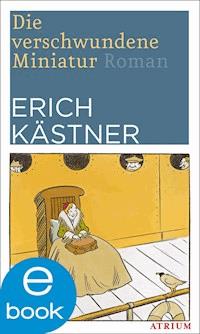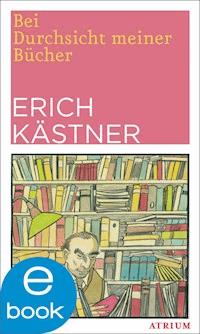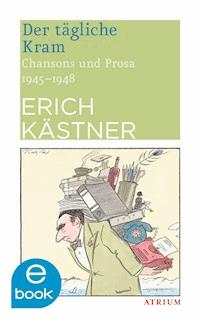10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG Zürich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erich Kästner über die wundersame Spezies "Mann" Dieser Geschenkband, herausgegeben von der Kästner-Expertin Sylvia List, versammelt Geschichten und Gedichte von Erich Kästner über sich selbst und andere Männer – ironisch, bissig und erschreckend wahr. Das Cover hat Christoph Niemann illustriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Erich Kästner
Monolog in der Badewanne
Erich Kästner über die Männer
Herausgegeben von Sylvia List
Man ist ein Mann
»Man ist ein Mann«, sagt Erich Kästner und nicht etwa »Mann ist Mann« wie sein Schriftstellerkollege Bertolt Brecht. Nein, hier geht es nicht um die Austauschbarkeit der Männer, sondern um ihre Verschiedenheit und ihre Eigenarten, kurz, um die Vielfalt männlicher Charaktere und Verhaltensweisen.
Schon die prägenden Männergestalten in Kästners Kinderzeit hätten kaum unterschiedlicher sein können: hier der Onkel Franz Augustin, dieser berserkerhafte Macho und erfolgreiche Pferdehändler, und da der still-heitere Vater Emil Kästner, dessen ruhige handwerkliche Sorgfalt dem Sohn zum Vorbild wurde (Das lebensgroße Steckenpferd).
Eine Hommage an die Familie seiner Mutter, die Augustins, ist auch die Figur des Papa Külz aus Die verschwundene Miniatur. Dieser liebenswerte Familienmensch und Fleischermeister, ein Bär von Mann, Oberhaupt einer beachtlich großen Sippe von Fleischern, ist von zu Hause ausgerissen, weil er endlich einmal leben und sich nicht immer nur als Wurstmaschine fühlen wollte. Dass ausgerechnet er vor einer dänischen Aufschnittplatte kapitulieren würde, hätte er sich gewiss nie träumen lassen.
Sich selber sieht und beschreibt Kästner eher als Einzelgänger und Eigenbrötler. Im ersten der Briefe an mich selber konstatiert er, »dass man nirgendwo so allein sein darf wie in den zitternden Häusern der großen Städte«, wobei hinter das »darf« wohl ein kleines Fragezeichen zu setzen wäre. Viele der Gedichte (z.B. Apropos, Einsamkeit!, Wiegenlied für sich selber, Sentimentale Reise) zeigen das Alleinsein als eher bedrückende Erfahrung.
Was aber tut man gegen die Einsamkeit, mit der man es schließlich »nicht übertreiben« soll? Man begibt sich auf die Suche nach einem weiblichen Gegenpart. Ein Lösungsversuch, der seine eigenen Probleme birgt. Das Aufeinandertreffen Mann-Frau verläuft ja nie nach Schema F; es gibt vielerlei Möglichkeiten, und Kästner führt eine ganze Reihe davon vor: vom Draufgängertum (Es gibt noch Don Juans) bis zum kläglichen Scheitern (Melchior hat Pech bei Frauen), von primitiver Anmache (Arthur spricht ein Fräulein an) bis hin zu erotischer Beschwingtheit (Nachtgesang des Kammervirtuosen), von so hartnäckigem wie hoffnungslosem Bemühen (Der Kümmerer), nagender Eifersucht (Stehgeigers Leiden) bis zum endgültigen Aus, das mit Schulterzucken aufgenommen werden kann (Der Geizhals geht im Regen) oder aber mit Bedauern (Hotelsolo für eine Männerstimme) und im Extremfall zum Selbstmord aus Liebeskummer führt (Marionettenballade). Trost findet Mann im Alkohol (Kleine Besäufnis), der aber auch in Momenten der Euphorie Wirkung tut (Abschied von Salzburg).
Dass Kästner bei alledem seinem Geschlecht ein mangelndes Talent zur Treue zuschreibt, mit dem die Frauen nur schwer fertig werden, ist nachzulesen in Paulines kluger Analyse (Zweikampf auf Umwegen) und in der meisterhaften Erzählung Verkehrt hier ein Herr Stobrawa?. Auf weibliche Treulosigkeit wiederum so zu reagieren wie der Rechtsanwalt Dr. Felix Moll, dürfte nicht jedem gegeben sein. Der versucht, typisch Jurist, seine pathologisch polygame Frau mittels eines Vertrags einzuhegen – eine herrlich bizarre Episode aus Der Gang vor die Hunde.
Moll ist nicht der einzige Sonderling im männlichen Personal Kästners in dieser Auswahl. Es treten noch auf Ferdi Kulp, der Strolch auf Widerruf, der urlaubsunfähige Buchhalter Klein (Die missglückte Auferstehung), und Arthur, der alle Leute ärgert. Ein Sonderling, wenn auch ein sehr lustiger, ist Onkel Ringelhuth, der seinem Neffen Konrad hilft, den Magen abzuhärten.
Und sonderbar, fast schrullig, ist eigentlich auch der Plan von Geheimrat Tobler, im Grandhotel Kitzbühel als armer Schlucker Eduard Schulze auftreten zu wollen. Aber man sympathisiert mit dieser Maskerade, nicht nur weil man Toblers Motiv nachvollziehen kann, sondern vor allem wegen der daraus entstehenden komischen Verwicklungen. Tobler, ganz Großunternehmer, der davon ausgeht, in diesem Quiproquo die Fäden in der Hand zu haben, wird in Drei Männer im Schnee von den Ereignissen bekanntlich fast überrollt werden.
Ein Kaleidoskop unterschiedlichster Männergestalten also, das Kästner, für manche vielleicht unerwartet, als echten Männerversteher zeigt. Ja, wieso auch nicht? Warum sollte er sich denn mit seinesgleichen nicht besser auskennen als mit den »ganz besonders feinen Damen«, über die er so gerne lästerte?
München, Herbst 2018
Sylvia List
Monolog in der Badewanne
Da liegt man nun, so nackt, wie man nur kann,
hat Seife in den Augen, welche stört,
und merkt, aufs Haar genau: Man ist ein Mann.
Mit allem, was dazugehört.
Es scheint, die jungen Mädchen haben recht,
wenn sie – bevor sie die Gewohnheit packt –
der Meinung sind, das männliche Geschlecht
sei kaum im Hemd erträglich. Und gar nackt!
Glücklicherweise steht’s in ihrer Hand,
das, was sie stört, erfolgreich zu verstecken.
So früh am Tag, und schon so viel Verstand!
Genug, mein Herr! Es gilt, sich auszustrecken.
Da liegt man, ohne Portemonnaie und Hemd
und hat am ganzen Leibe keine Taschen.
Ganz ohne Anzug wird der Mensch sich fremd …
Da träumt man nun, anstatt den Hals zu waschen.
Der nackte Mensch kennt keine Klassenfrage.
Man könnte, falls man Tinte hätte, schreiben:
»Ich kündige. Auf meine alten Tage
will ich in meiner Badewanne bleiben.«
Da klingelt es. Das ist die Morgenzeitung.
Und weil man nicht, was nach dem Tod kommt, kennt,
schreibt man am besten in sein Testament:
»Legt mir ins kühle Grab Warmwasserleitung!«
Die missglückte Auferstehung
Herr Klein ging am Ostersonnabend mit kurzen hüpfenden Schritten die Ludwigstraße entlang. Er trug einen hellkarierten Sportanzug, einen schwarzen Filzhut und einen niedlichen Rucksack. Ängstlich hielt er hinter seiner Brille Umschau. Aber es lachte ihn niemand aus. – Herr Klein war das erste Mal in München. Ja, Herr Buchhalter Klein befand sich überhaupt das erste Mal auf einer Erholungsreise!
Er ging also die Ludwigstraße entlang. Und fand, dass man, um solche grauen Paläste und solche mit dem Lineal gezogenen Straßenzüge zu sehen, auch sehr gut in Berlin hätte bleiben können. Allerdings – die Theatinerkirche war ganz niedlich. Und der Hofgarten auch. Aber es war doch sehr unpraktisch, nur deswegen so weit zu fahren …
Auf der Brücke vor dem Maximilianeum blieb er stehen und schaute – wie die andern auch – in die lehmbraune, lärmende Isar hinunter. Dann kehrte er um. –
Die freundlichen Wiesenwege des Englischen Gartens waren recht voller Menschen. Herr Klein stand einigermaßen verdutzt vor dem Monopteros und saß dann am Chinesischen Türmchen nieder, um seinem Chef eine Ansichtskarte zu schreiben.
Dann ging er bald in sein Hotel an der Kaufingerstraße, denn er war sehr müde …
Schon frühzeitig saß er am ersten Osterfeiertag in einem schrecklich überfüllten Zug nach Garmisch. Die Landschaft zog trüb und verärgert an den Fenstern entlang. Herr Klein hielt den Regenschirm zwischen den Knien, stützte seinen Kopf auf den Schirmgriff und dachte nach.
Es war reichlich unvernünftig gewesen, dem Drängen des Chefs so ohne weiteres nachzugeben. Aber schließlich, war Herr Steinkopf nicht beinahe zudringlich geworden? »Herr Klein«, hatte er gesagt, »Sie müssen mich den ganzen Sommer über vertreten. Denn auf wen soll ich mich sonst verlassen, ja? Also fahren Sie geschwind drei Wochen in die bayrischen Alpen. Denn der Sommer wird harte Arbeit bringen …«
Mein Gott! Wer weiß, wie es jetzt im Büro drunter und drüber ging! Der Ehrenberg würde sicher viel zu nachlässig arbeiten.
In Garmisch regnete es. Und Herr Klein sah beim besten Willen nichts weiter als etliche Villenstraßen, die von einer grauweiß wallenden Nebelmauer umzingelt waren. Herr Klein spannte den Regenschirm auf und ging mit kurzen hüpfenden Schritten durch den frostigen Kurort …
Entsetzlich! Hier sollte er drei Wochen wohnen? Nicht um die Welt! Wenn er wenigstens die Pelzweste mitgebracht hätte, wie ihm die Wirtschafterin zugeredet hatte! Es war fürchterlich kühl in diesen Bergen, die man nicht sah, wenn man nicht gerade vor einem Postkartenladen stehen blieb.
Nach mancherlei Umwegen und bereits erkältet kam Herr Klein zum Bahnhof zurück, setzte sich in die Wirtschaft und spannte den Schirm zum Trocknen auf. Er aß etwas, machte sich Notizen in seinen Block, rechnete aus, was er bis jetzt ausgegeben habe, und fuhr, als der Regen nachließ, mit der Kleinbahn nach Niedergrainau.
Links und rechts unerbittliche Nebelwände. Herr Klein marschierte mit kurzen hüpfenden Schritten zwischendurch und fröstelte. Er stieß den Schirm herzhaft gegen den Boden und versuchte zu singen. Aber es machte ihm keine Freude. Eigentlich fiel ihm auch gar nichts ein, was auf seine Situation gepasst hätte.
Am Eibsee setzte er sich in die Veranda des Hotels und schaute in den flatternden Nebel hinaus. Voller Erwartungen, die sich nicht zu erfüllen schienen. Er zählte bis drei. Er ließ sich vom Kellner belehren, dass der Nebel unmöglich lange anhalten könne.
Aber der Nebel hielt trotz des Kellners an. Auch das Zählen blieb ohne Wirkung. –
Die Zugspitze pflege sonst da drüben sichtbar zu sein! Herr Klein starrte ehrfurchtsvoll nach links hinüber. Nach einem fast schwarzen Nebelfleck, auf den der Kellner mit dem Finger wies. So, dort dahinter.
Am Abend war Herr Klein schon wieder in München. Und es regnete noch immer. Am zweiten Feiertag war er schon wieder in Berlin.
Dienstag früh ging der Buchhalter Klein durch die Stadt. Und ohne dass er sich übermäßig gewundert hätte, fand er sich plötzlich in der Kommandantenstraße. Vor dem Büro.
Aber er kehrte wieder um; denn er war noch sehr erkältet.
Doch am Mittwoch war er endlich wieder in seinem Geschäftszimmer. Die andern Angestellten waren sehr verwundert. Sie schüttelten die Köpfe und versicherten einander, wie forsch sie losgezogen wären! Solch einen Urlaub hätte man ihnen einmal anbieten sollen – Und Herr Steinkopf, der Chef, verstand erst nach längerer Unterhaltung, wieso Klein schon wieder zurück wäre. »Nja«, sagte Herr Steinkopf und zog ernst an seiner Zigarre, »nja, Klein, da wollen Sie also allen Ernstes gleich wieder mit der Arbeit anfangen?«
»Wenn ich darum bitten dürfte, Herr Steinkopf«, sagte Buchhalter Klein.
»Nja, aber mit dem größten Vergnügen, Klein! Sie sind vielleicht ein komischer Kerl! – Will keine Ferien haben!«
Herr Klein sah vor sich hin und sagte leise, als ob er das eben erst erkannte: »Die Ferien sind zehn Jahre zu spät gekommen …«
»’n Morgen!«, knurrte der Chef und ging ins Privatkontor.
»Guten Morgen, Herr Steinkopf!«, sagte Klein.
Und sah die Post durch.
Franz Augustin wird Millionär
Die Hechtstraße war eine schmale, graue und übervölkerte Straße. Hier hatten, weil die Läden billig waren, Onkel Franz und Onkel Paul als junge Fleischermeister begonnen, ihr Leben zu meistern. Und obwohl die beiden einfenstrigen Geschäfte, nur durch die Fahrstraße getrennt, einander gegenüberlagen und die zwei Inhaber gleicherweise Augustin hießen, geriet man sich nicht in die Haare. Beide Brüder waren geschickt, fleißig, munter und beliebt, ihre Jacken und Schürzen blütenweiß und ihre Wurst, ihr Fleischsalat und ihre Sülze vorzüglich. Tante Lina und Tante Marie standen von früh bis spät hinter ihren Ladentischen, und manchmal winkten sie einander, über die Straße hinweg, fröhlich zu.
Tante Marie hatte vier Kinder, darunter den von Geburt an blinden Hans. Er war immer fidel, aß und lachte gern und kam, als Tante Marie, seine Mutter, starb, in die Blindenanstalt. Dort wurde er im Korbflechten und als Klavierstimmer ausgebildet und, noch sehr jung, von Onkel Paul mit einem armen Mädchen verheiratet, damit er jemanden hatte, der sich um ihn kümmere. Denn der Vater selber hatte für den Sohn mit den blinden, pupillenlosen Augen keine Zeit.
Die drei ehemaligen Kaninchenhändler – auch der älteste, der Robert Augustin in Döbeln – waren robuste Leute. Sie dachten nicht an sich, und an andre dachten sie schon gar nicht. Sie dachten nur ans Geschäft. Wenn der Tag achtundvierzig Stunden gehabt hätte, hätten sie vielleicht mit sich reden lassen. Dann wäre womöglich ein bisschen Zeit für Nebensachen und Kleinigkeiten übriggeblieben, wie für ihre Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern oder für ihre eigene Gesundheit.
Doch der Tag hatte nur vierundzwanzig Stunden, und so waren sie rücksichtslos. Sogar gegen ihren Vater. Er litt an Asthma, besaß kein Geld und wusste, dass er bald sterben würde. Doch er war zu stolz, um seine drei ältesten Söhne um Hilfe zu bitten. Er entsann sich wohl auch des Sprichworts, ein Vater könne leichter zwölf Kinder ernähren als zwölf Kinder einen Vater.
Die Döbelner Schwestern, arm wie die Kirchenmäuse, schrieben meiner Mutter, wie schlimm es um meinen Großvater stehe. Meine Mutter lief in die Hechtstraße und beschwor ihren Bruder Franz, etwas zu tun. Er versprach es ihr und hielt sein Wort. Er schickte ein paar Mark per Postanweisung und eine Ansichtskarte mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für die väterliche Gesundheit. Das heißt: Er schrieb die Karte nicht etwa selbst! Das erledigte seine Frau. Der Sohn hatte für den Gruß an den Vater keine Zeit. Zum Begräbnis des alten Mannes, kurz darauf, reiste er allerdings persönlich. Da ließ er sich nicht lumpen. […]
Franz Augustin und Paul Augustin residierten in der Hechtstraße auch noch, nachdem sie ihre Fleischerläden mit Gewinn verkauft hatten und endgültig Pferdehändler geworden waren. In den Hinterhöfen war für Pferdeställe Platz genug, für Onkel Paul schon gar, weil er nur Warm- und Vollblüter kaufte und verkaufte, nur Kutsch- und Reitpferde, nur das Feinste vom Feinen. Schon nach wenigen Jahren durfte er sich ›Königlicher Hoflieferant‹ nennen. Er ließ den Titel auf das Firmenschild überm Haustor malen und war nun etwas ähnlich Nobles wie der Hofjuwelier. Dieser handelte nur mit den schönsten Brillanten und Perlen, und Onkel Paul bot die edelsten Pferde an. Dafür genügten ihm zehn Ställe. Manchmal kam der König selber! Stellt euch das vor! In die schmale, mickrige Hechtstraße! Mit den Prinzen und dem Hofmarschall und dem Leibjäger! Zu meinem Onkel Paul!
Trotzdem trieb ich mich tausendmal lieber und hundertmal häufiger im Hof und in den Stallungen auf der anderen Straßenseite herum. Onkel Franz war zwar saugrob, und zum Hoflieferanten hätte er bestimmt kein Talent gehabt. Wer weiß, was er Friedrich August III. von Sachsen alles gesagt und wie mächtig er ihm auf die Schulter geklopft hätte! Mindestens der Hofmarschall und der Adjutant à la suite wären in Ohnmacht gefallen. Aber der saugrobe Onkel Franz gefiel mir besser als der hochnoble Onkel Paul, den die Geschwister aus Jux ›Herr Baron‹ nannten. Und zwischen seinen Knechten und Pferden fühlte ich mich wie zu Hause.
In den braunen Holzställen, die sich an den Längsseiten des schmalen Hofs hinzogen, war für etwa dreißig Pferde Raum, für die Dänen und Ostpreußen, für die Oldenburger und Holsteiner und für die flämischen Kaltblüter, die gewaltigen Brabanter mit den breiten Kruppen und ihren hellen Riesenmähnen. Zentnerweise schleppten die Knechte Heu, Hafer und Häcksel heran und hektoliterweise, Eimer für Eimer, frisches Wasser. Die Gäule futterten und soffen, dass man nur staunen konnte. Sie stampften mit den klobigen Hufen, peitschten mit den Schweifen die Fliegenschwärme vom Rücken und wieherten einander, von Stall zu Stall, herzliche Grüße zu. Wenn ich näher trat, wandten sie den Kopf und schauten mich, fremd und geduldig, aus ihren unerforschlichen Augen an. Manchmal nickten sie dann, und manchmal schüttelten sie die riesigen Häupter. Aber ich wusste nicht, was sie meinten. Rasmus, der hagere Großknecht aus Dänemark, der kein S sprechen konnte, ging prüfend von Stall zu Stall. Und Onkel Bruno hinkte neben dem dicken Tierarzt geschäftig übers Kopfsteinpflaster. Der dicke Tierarzt kam oft.
Pferde haben ähnliche Krankheiten wie wir. Manche, wie Influenza und Darmkolik, haben den gleichen Namen, andre heißen Druse, Mauke, Rotz und Spat, und alle miteinander sind sehr gefährlich. Wir sterben nicht an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Mumps oder Bauchgrimmen. Bei den Pferden, diesen vorgeschichtlichen Vegetariern, ist das gar nicht so sicher. Sie fressen zu nasses Heu, und schon blähen sich ihre Bäuche wie Ballons, schon wühlen Schmerzen wie Messer im Leib, schon können sich die Därme verschlingen, und der Tod klopft an die Stalltür. Sie sind erhitzt und saufen zu kaltes Wasser, und bald beginnen sie zu husten, die Drüsen schwellen, die Nüstern triefen, das Fieber steigt, die Bronchien rasseln, die Augen werden stumpf, und schon wieder hebt der Tod den Knöchel. Manchmal kam der dicke Tierarzt beizeiten. Manchmal kam er zu spät. Dann rumpelte der Wagen des Abdeckers in den Hof und holte den Kadaver fort. Die Haut, die Hufe und das Rosshaar waren noch zu gebrauchen.
Das Ärgste an solch einem Pferdetod war der Geldverlust. Im Übrigen hielt sich der Schmerz in Grenzen, und das war kein Wunder. Die Pferde gehörten ja nicht zur Familie. Eher glichen sie vierbeinigen Hotelgästen, die, ein paar Tage und mit voller Verpflegung, in Dresden übernachteten. Dann ging die Reise weiter, auf ein Rittergut, zu einer Brauerei, in eine Kaserne, je nachdem. Oder, mitunter, zur Abdeckerei. Hoteliers weinen nicht, wenn ein Gast stirbt. Man trägt ihn heimlich über die Hintertreppe.
Die ungemütliche, kleinbürgerlich möblierte Wohnung lag über dem Fleischerladen, worin längst ein anderer Meister Koteletts hackte und mit der Breitseite des Beils flachklopfte. In der Wohnung regierte Frieda, das schmale Mädchen aus dem Erzgebirge, das stille und energische Dienstmädchen. Frieda kochte, wusch, putzte und vertrat an meiner Kusine Dora Mutterstelle. Denn die Mutter selber, Tante Lina, hatte keine Zeit für ihr Kind.
Sie war, ohne jede kaufmännische Vorbildung, Geschäftsführerin geworden und saß von früh bis spät im Büro. Mit Schecks, Lieferantenrechnungen, Steuern, Löhnen, Wechselprolongationen, Krankenkassenbeiträgen, Bankkonten und ähnlichen Kleinigkeiten gab sich Onkel Franz nicht ab. Er hatte gesagt: »Das erledigst du!«, und so erledigte sie es. Hätte er gesagt: »Spring heute Abend um sechs von der Kreuzkirche!«, wäre sie gesprungen. Womöglich hätte sie, droben auf dem Turm, einen Zettel hinterlassen. »Lieber Franz! Entschuldige, dass ich acht Minuten zu spät springe, aber der Bücherrevisor hielt mich auf. Deine Dich liebende Gattin Lina.« Glücklicherweise kam er nicht auf die Idee, sie springen zu lassen. Sonst hätte er ja seine Prokuristin verloren! Das wäre dumm von ihm gewesen, und dumm war er nicht, mein Onkel Franz.