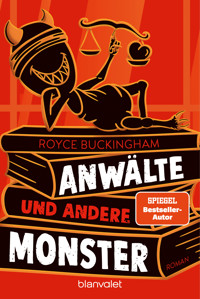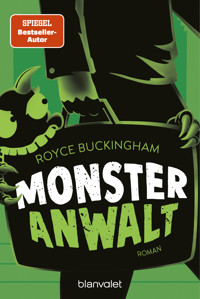
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Monsteranwalt Daniel Becker
- Sprache: Deutsch
Daniel Becker ist der Anwalt, dem Monster vertrauen! Der zweite Band der neuen Urban-Fantasy-Serie von SPIEGEL-Bestsellerautor Royce Buckingham.
Rechtsanwalt Daniel Becker würde zu gerne auch normale Menschen vor Gericht vertreten. Doch seit er sein persönliches Monster-unter-dem-Bett vor dem Gefressenwerden durch den noch monströseren Richter bewahrt hat, suchen immer skurrilere Gestalten seine Kanzlei auf. Als Daniel einen Auftrag der Bürgermeisterin von Seattle erhält, hofft er, endlich in der normalen Welt den Durchbruch als Anwalt zu schaffen. Leider ist auch ihr Anliegen übernatürlicher Art – und es hat auf höchst unbürokratische Weise mit Tentakeln zu tun ...
Die skurrilen Fälle von Monsteranwalt Daniel Becker:
1. Im Zweifel für das Monster
2. Monsteranwalt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Rechtsanwalt Daniel Becker würde zu gerne auch normale Menschen vor Gericht vertreten. Doch seit er sein persönliches Monster-unter-dem-Bett vor dem Gefressenwerden durch den noch monströseren Richter bewahrt hat, suchen immer skurrilere Gestalten seine Kanzlei auf. Als Daniel einen Auftrag der Bürgermeisterin von Seattle erhält, hofft er, endlich in der normalen Welt den Durchbruch als Anwalt zu schaffen. Leider ist auch ihr Anliegen übernatürlicher Art – und es hat auf höchst unbürokratische Weise mit Tentakeln zu tun …
Autor
Royce Buckingham, geboren 1966, begann während seines Jurastudiums an der University of Oregon mit dem Verfassen von Fantasy-Kurzgeschichten. Sein erster Roman »Dämliche Dämonen« begeisterte weltweit die Leser*innen und war insbesondere in Deutschland ein riesiger Erfolg. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen lebt Royce Buckingham in Bellingham, Washington. Er arbeitet zurzeit an seinem nächsten Roman.
Die skurrilen Fälle von Monsteranwalt Daniel Becker:
1. Im Zweifel für das Monster
2. Monsteranwalt
Royce Buckingham
Monsteranwalt
Roman
Deutsch von Hans Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Alexander Groß
Umschlaggestaltung: Anke Koopmann | Designomicon
Umschlagmotive: © Elm Haßfurth | birbstudio.com
HK · Herstellung: Len
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-29903-3V001
www.blanvalet.de
»Auch in der übernatürlichen Welt gelten eherne Gesetze, und wo es Gesetze gibt, gibt es auch Anwälte.«
Bild
Kapitel 1
Kostenlose Beratung
Wer wissen möchte, was es für mich heißt, Rechtsanwalt zu sein: Es bedeutet, dass ich Menschen helfe. Außerdem helfe ich auch anderen fühlenden Wesen, die streng genommen keine Menschen sind. Unsere bescheidene, nur zwei Räume umfassende Kanzlei in diesem klotzigen, nicht erdbebensicheren Backsteinbau aus den 1970er-Jahren in Seattles historischem Belltown-Viertel könnte man also als »sehr generalistisch« ausgerichtet bezeichnen. Wir bearbeiten auch spontane Anfragen von unangemeldeten Besuchern und übernehmen in straf- und zivilrechtlichen Fällen die Vertretung menschlicher und … nicht so menschlicher Mandanten. Und das seit über einem Jahr, genauer gesagt: seit ich das Berufsleben in einer Großkanzlei hinter mir gelassen, dieses Haus gefunden und draußen mein Schild aufgehängt habe:
Daniel Becker
Monsteranwalt
Unser neuester Mandant beispielsweise ist der Geist einer Mutter aus der Babyboomer-Generation, die ihren letzten Willen durchgesetzt sehen will, an den sich ihre Tochter nicht hält; der fragliche Sprössling verschwendet sein Geld aus dem College-Treuhandfond für rauschende Partys, für die die junge Frau Promis engagiert, damit sie sich als ihre Freunde ausgeben. Außerdem hat sie ihren verstorbenen Zwerg-Papillon klonen lassen. Zweimal. Mich hat die Erscheinung der Seele ihrer verstorbenen Mom beauftragt, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.
Ich bin gern mein eigener Chef. Klar, wenn ich Mühe habe, die Hypothek für dieses verfallene Gebäude aufzubringen, vermisse ich das große Geld meiner vorherigen Kanzleikarriere. Das Finanzielle ist schon eine Herausforderung. Ich kann Dennis, meinen Rechtsanwaltsgehilfen, nur mit knapper Not bezahlen, und das Gleiche gilt für Phil, meinen studentischen Praktikanten. Und manchmal muss auch Lucy, meine Tochter, aushelfen, obwohl sie noch ein Teenager ist. Ich befasse mich inzwischen hauptsächlich mit privatrechtlichen, persönlichen Problemen der Art, die ebenso bedeutungsvoll wie lebensverändernd sind, aber nicht viel Geld abwerfen. Das ist okay, irgendwie gefällt es mir, mit den schrägen Vögeln zu tun zu haben, den randständigen Existenzen, den Außenseitern der Gesellschaft. Ich verurteile nicht. Ich folge keiner Agenda. Ich versuche nicht, die Probleme der Welt zu lösen. Aber manchmal finden einen die Probleme der Welt auch uneingeladen.
Wir haben Montag. Und Montag in Seattle bedeutet Regen. Es gibt im tristen Seattle mehr als ein Dutzend Wörter für Regen – so, wie es viele Begriffe für die verschiedenen Spielarten von Schnee in Alaska gibt. Heute ist es ein »sporadischer Sprühregen«, der irgendwo zwischen »schwerem Nebel« und »Dauernieseln« liegt und einem die Entscheidung schwer macht, ob man sich die Kapuze seiner REI-Jacke, die einem die Haare durcheinanderbringt, überziehen soll oder nicht. Unser Dach ist undicht, und die Dekovase in einer Ecke meines Büros sorgt dafür, dass mich die Monotonie der herabfallenden Tropfen immer daran denken lässt:
Plitsch! Plitsch! Plitsch!
Ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, um meine Solokanzlei in Schwung zu bringen, aber es war schwer, zahlende menschliche Mandanten zu finden, und die nicht menschlichen sind schwierig. Anwaltshonorar und Kostenerstattung von einem schwer fassbaren Mandanten zu erhalten, kann problematisch sein – der zuvor erwähnte Geist musste mir im Traum erscheinen und mich in sein ehemaliges Zuhause einbrechen lassen, um nach Geld zu suchen, das er in einem Lüftungsschacht versteckt hatte. So konnte ich zumindest mein Pauschalhonorar bekommen.
Der stete Rhythmus der Tropfen treibt mich in den Wahnsinn und erinnert mich daran, dass ich meine verrottenden Dachsparren reparieren muss. Außerdem versuche ich, meine Scheidung über die Bühne zu bringen, während Lucys Mutter, meine Exfrau, eine einmonatige stationäre Therapie macht, um den Verlust ihrer ermordeten Geliebten zu verarbeiten – fragen Sie nicht. Und meine Fast-Freundin Bev ist – ausgerechnet – in den Libanon aufgebrochen, für irgend so eine Ärzte-ohne-Grenzen-Sache. Mein Dad hat mir geraten, mich nach einer brillanten, liebevollen Frau umzusehen. Diesen Rat habe ich beherzigt und bin jetzt solo. Wahrscheinlich liegt es an mir. Bev und ich haben einander versprochen, in Verbindung zu bleiben, aber … die Entfernung. Es ist das Beste so; meine Ein-Mann-Kanzlei in dieser düsteren Stadt wird mit jedem neuen bizarren Mandanten komplexer. Stellen Sie sich konzentrische Kreise vor.
Plitsch! Plitsch! Plitschediplumps!
Dennis liest die Seattle Times, versieht den Telefondienst der Kanzlei und überzieht unser Hinterzimmer nebenbei mit einem Flaum von Irish-Setter-Fell. In der Times steht ein Artikel über eine breite öffentliche Bewegung in Seattle, die sich dafür einsetzt, ein Profi-Eishockeyteam in die Stadt zu holen. Dennis gefällt die Vorstellung, dass Menschen auf dem Eis einem runden Gegenstand hinterherjagen. Montags braucht er meist nicht so zu tun, als sei er ein richtiger Hund, weil er und ich dann allein in der Kanzlei sind. Phil, unser Praktikant, ist dann an der juristischen Fakultät der University of Washington, und meine Tochter hat bis drei Uhr Schule. Dennis kann also ruhig sprechen, auf den Hinterbeinen laufen oder, wenn er mag, das heutige Sudoku lösen. Das gilt natürlich nur, bis ein potenzieller Mandant durch die Tür kommt. Dafür haben wir eine Klingel.
Klingeling!
Da kommt jemand! Dennis und ich schauen auf und blicken zur Tür. Es ist immer wieder ein Moment, der mein Herz höherschlagen lässt – ich bin gespannt auf den nächsten großen Fall, und mich reizt die intellektuelle Herausforderung, anderen zu helfen, ein vielschichtiges neues Problem zu lösen, das triumphale Gefühl, ein Unrecht wiedergutzumachen, und die stets schwer greifbare Möglichkeit, bezahlt zu werden. Ich richte meine Krawatte und eile in die Lobby, um zu begrüßen, wer oder was auch immer dort auf mich wartet.
Unser Angebot einer kostenlosen Erstberatung hat sich durch Mundpropaganda in der paranormalen Gemeinschaft herumgesprochen; die Unterwelt von Seattle weiß, dass ich an jedem ersten Montag des Monats Wesen, die ein Problem haben, einen sicheren Raum biete. Außerdem ist das für mich die beste Werbung. Während der freien Erstberatung kann ich feststellen, ob ich es mit potenziellen Mandanten mit einem berechtigten Rechtsanspruch zu tun habe oder einfach nur Wesen, die sauer sind. Oder verrückt. »Kommen Sie herein und erzählen Sie mir, was passiert ist, und ich sage Ihnen, ob ich Sie in Ihrem Fall vertreten kann«, das ist mein Angebot. Wir brauchen die Kundschaft, und sie braucht oft meine Hilfe. Manche Geschöpfe wissen tatsächlich nicht, an wen sie sich sonst wenden sollen.
Meine erste potenzielle Mandantin heute ist eine höfliche ältere Dame namens Claire Snyder, die in einer Plastikbox ihren Ehemann mitbringt, Raymond Snyder. Normalerweise würde eine Frau, die ihren Ehemann in einer Box mit sich herumträgt, bei mir die Alarmglocken läuten lassen, aber ich habe während meiner relativ kurzen Zeit als Vertreter von Monster-Mandanten schon einige seltsame Dinge erlebt. Daher gebe ich Claire Gelegenheit, zu erklären, warum sie mir ihren in einer Box befindlichen Gatten mitgebracht hat. Es stellt sich heraus, dass Raymond das Opfer eines Unfalls in einer nahe gelegenen Lackfabrik namens Puget Sound Paint ist. Ich bitte Claire, mir von dem Unfall zu erzählen, und sie schildert ein klassisches »In-einen-Bottich-mit-Chemikalien-gefallen-Szenario«. Nur dass Raymond nicht in Farbe gefallen ist. Er ist in Abbeizer gefallen, ein unglaublich starkes Lösungsmittel. Bei dieser speziellen Marke handelt es sich um Strip Ease, ein bekanntes knallorangefarbenes Gel, das bei Kontakt Farbe auflöst. Anscheinend löst Strip Ease auch Menschen auf, denn als Claire den Plastikbehälter öffnet, um mir ihren Ehemann vorzustellen, ist der Behälter voll von kürbisfarbenem Glibber.
»Es hat ihn geschmolzen«, sagt sie, woraufhin ich ihr mein Beileid ausspreche.
Die Überraschung kommt, als der amorphe Matsch aus der Box auf meinen Schreibtisch quillt und wie eine Amöbe herumzugleiten beginnt. Ich möchte nicht unsensibel erscheinen, aber ich will auch nichts von »Raymond« auf meinen Anzug – oder auf die Haut – bekommen. Ich springe auf.
»Tut mir leid«, entschuldigt sich Claire und fördert eine steife, platte und offensichtlich von einem Auto totgefahrene Katze zutage, auf die ihr gallertartiger Mann daraufhin zuschwappt. Sie lässt die tote Katze über der Box baumeln, bis ihr Gemahl wieder in seinen behelfsmäßigen Transportkasten zurückfließt, die Katze umhüllt und sie vor meine Augen zu verdauen beginnt. Dann sieht Claire mich an. »Ich will die Farbenfabrik verklagen«, verkündet sie.
»Verständlich.«
Das rechtliche Problem der Snyders ist, dass alle glauben, ihr Mann sei tot, und eine tote Person ist viel weniger wert als eine Person, die ständige Zuwendung braucht. Claires in Glibber verwandelter Mann wird individuelle Pflege benötigen, deren Kosten noch gar nicht absehbar sind, und möglicherweise einen lebenslangen Nachschub an zuvor verstorbenen Katzen. Doch um den Snyders zu helfen, eine angemessene Entschädigung zu erhalten, werde ich beweisen müssen, dass Raymond in diesem Gelee immer noch lebt. Ich kann mir vorstellen, dass jedes Unternehmen dies gern geheim halten würde, und nach meiner anwaltlichen Einschätzung sollten Claire und Raymond in der Lage sein, eine schnelle außergerichtliche Regelung zu erzielen, wenn ich Raymond diskret dem richtigen leitenden Angestellten des Unternehmens vorstelle. Ich werde diesen Fall also annehmen. Ich schüttele Claires kleine alte Damenhand, und wir unterschreiben eine Standard-Vertretungsvereinbarung, in der ich mich verpflichte, mich nach Kräften zu bemühen, den beiden die ihnen zustehende Entschädigung für ein Honorar von fünfundzwanzig Prozent der Summe zu verschaffen.
Mein zweiter Termin gehört in die »Oder verrückt«-Kategorie. Ich kann die Wahnvorstellungen des Burschen spüren, als er hereinkommt; er antwortet bereits auf imaginäre Stimmen und erzählt mir, er sei ein außerirdisches Wesen aus der fünften Dimension – anscheinend hat er die vierte, die meiner Meinung nach die Zeit ist, übersprungen, also kommt er weder aus der Zukunft noch aus der Vergangenheit. Außerdem werde er von der Regierung mithilfe eines Mikrofons, das seiner Aussage zufolge in seinen Kopf implantiert wurde, überwacht. Ich rufe Dennis herein, um den Mann heimlich einem Geruchstest zu unterziehen. Dennis schnuppert einmal und schüttelt hinter dem Mann kräftig den Kopf. Geht man nach Dennis’ Nase, ist der Bursche durch und durch menschlich, und ich rechne aus, dass die seltsamen Gedanken des Mannes mit einer achtundneunzigprozentigen Wahrscheinlichkeit nur eingebildet sind. Ich erkläre ihm höflich: »Wir vertreten eigentlich keine Außerirdischen, so wie Sie einer sind; meine kreative Werbung für ›außerirdische‹ Fälle ist eher ein Marketing-Gag.« In Wahrheit würden wir auf jeden Fall einen Außerirdischen vertreten, wenn der richtige vorbeikäme und eine funktionierende Kreditkarte vorweisen könnte, und angesichts der Unendlichkeit des Universums ist es numerisch unmöglich, dass es keine Aliens gibt. Der Mann sackt in sich zusammen und sagt, er verstehe das, und ich fühle mich mies seinetwegen. Der Bursche braucht Hilfe, nur nicht meine. Ich lege ihm eine Hand auf die Schulter und begleite ihn die Straße entlang zu der Praxis für kognitive Gesundheitsdienste. Sie werden schon wissen, was sie mit ihm machen müssen. Ich setze ihn mit einem Händedruck dort ab, wünsche ihm viel Glück und kehre ins Büro zurück.
Eine Stunde später kommt sie herein.
Noch bevor sich die Tür hinter ihr schließt, weiß ich, dass diese Frau Ärger bedeutet. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich ihren Fall übernehmen werde. Es ist seltsam, wie man etwas bereuen kann, noch bevor man es tut, und dann tut man es trotzdem. In der Juristensprache bezeichnen wir das als einen »ununterdrückbaren Impuls«. Laien nennen so etwas vielleicht »Motte zum Licht«- oder »Neugier ist der Katze Tod«- Szenarien, in denen ich die Motte beziehungsweise die Katze wäre. Wie auch immer man es nennt, jeder weiß, was ich meine; es ist so, als würde man sich sagen, dass man diesen Donut nicht essen sollte, aber …
Ich eile aus meinem Büro in die Lobby, um sie zu begrüßen, denn heute haben wir niemanden am Empfang sitzen. Sie ist groß, vielleicht einen Meter achtzig. Hoch gewölbte Augenbrauen. Ihr Haar ist so streng zurückgekämmt, dass die Haut ihres Gesichts straff gespannt ist – glatt, flach. Sie bewegt sich fließend. Funkelnde gelbe Augen.
»Hallo«, sage ich. Logik und Vernunft in mir hoffen, dass sie einfach die falsche Tür erwischt hat und eigentlich woanders hinwollte.
Der Rest von mir hofft, dass sie reich ist. Und ich gebe zu, dass ich auch ein klein wenig fasziniert bin.
»Ich suche einen Mr Becker.«
Scheiße, das bin ich. »Großartig, das bin ich. Kommen Sie doch rein. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser anbieten?«
»Nein, danke. Ich bin auf der Suche nach einem Anwalt, nicht nach Wasser.« Sie rauscht durch die Lobby, umwogt von ihrem langen Regenmantel, sodass ihre Füße verborgen bleiben und es aussieht, als würde sie schweben. Ich kann ihren ausgeprägten Akzent nicht einordnen; er klingt beinahe spanisch, aber nicht ganz.
Dennis linst aus dem Büro zu uns herüber, doch er mag keinen Ärger, und ich sehe, dass er im Begriff steht, sich davonzuschleichen. »Hey, Denny, komm her. Komm her, mein Junge.« Für diese herablassende Aufforderung wird er mich umbringen, aber wir müssen die Illusion aufrechterhalten, dass er ein ganz normaler Hund ist. Unwillig tappt er an meine Seite. Ich beuge mich herunter und flüstere meinem Hunde-Rechtsanwaltsgehilfen einige Worte zu, während unsere Besucherin ihren Mantel abschüttelt.
»Sei so gut und überprüf sie, ja?«
»Schnüffeltest?«
»Ja. Aber weder ihren Schritt noch ihren Hintern.«
»Du machst es schwieriger, als es sein müsste.«
»Höflich, bitte.«
»Na schön.«
Ohne zu fragen, schlendert sie aus dem Empfangsbereich in mein Büro und hängt ihren Mantel neben meinen an den antiken Garderobenständer mit seinen zwei Haken. Ihr Bleistiftrock reicht bis zum Boden – na ja, eher ein Bleistiftkleid mit einer Rüsche am Saum, die ihre Knöchel eng umschließt. Ich kann ihre Füße immer noch nicht sehen. Einen Moment später eile ich hinter ihr her, um ihr den Mandantenplatz anzubieten. Sie schenkt mir ein dünnes Lächeln und rollt sich auf dem Stuhl zusammen, während ich mich an meinen Schreibtisch setze. Mein Stuhl ist leicht erhöht, sodass Mandanten über meinen riesigen, neu lackierten, antiken Schreibtisch, der aus einem einzigen Baumstamm gearbeitet wurde, zu mir aufschauen müssen. Es ist eine Anwaltstaktik, die Ehrfurcht oder zumindest Respekt einflößen soll – aus dem gleichen Grund sitzen Richter auf einer erhöhten Bank.
»Also, ich bin Daniel Becker, Rechtsanwalt.« Ich warte darauf, dass sie sich ihrerseits vorstellt. Tut sie nicht. »Was führt Sie heute bei diesem Regen hierher?«
»Mein Problem ist … unnatürlich«, sagt sie. »Können Sie mir helfen?«
Nein, wenn Sie ein Donut sind, will ich antworten. Stattdessen erwidere ich: »Ich denke, Sie sind hier genau richtig. Das Seltsame, das Ungewöhnliche und das Unnatürliche sind mein Metier.«
»Weil Sie der ›Monsteranwalt‹ sind?«
Mein Ruf eilt mir voraus. In Wahrheit ist es die lächerliche Werbung, die Dennis auf Lookbook für unsere Kanzlei geschaltet hat. »Für eine unnatürlich gute Vertretung Ihrer Interessen«, steht in einer der Anzeigen, »rufen Sie den Monsteranwalt.« Dennis hat einen Haufen Schlüsselsuchbegriffe wie »magisch« und »Geist« eingegeben, um die Werbetrommel für übernatürliche Angelegenheiten zu rühren. Es scheint funktioniert zu haben. Braver Hund.
Dennis kommt wie aufs Stichwort hereingetrabt und täuscht ein dämliches Hundegrinsen und eifriges Schwanzwedeln vor, das die Leute beruhigt. Er macht das gut, und er hasst es. Dennis geht dazu über, sich an meine potenzielle Mandantin zu schmiegen und draufloszuschnüffeln. Ihre Augen drehen sich nach unten, aber sie streichelt ihn nicht – sie ist geschäftlich hier.
»Das reicht, Den-Den«, sage ich gutmütig, und er zieht sich mit einem ernsten Ausdruck auf seinem Fellgesicht zurück. Ich habe keinen Schimmer, was er in diesem Moment denkt. Ich bin kein Hund, und es fällt mir immer noch schwer, sein Mienenspiel zu deuten. Doch er kann nicht in ihrer Anwesenheit reden und wird mir später erzählen, was er herausgefunden hat.
»Entschuldigung«, sage ich zu ihr, »er ist sehr zutraulich.«
»Ja, und etwas neugieriger, als gut für ihn ist, nicht wahr?«
»Also, ich habe Ihren Namen nicht verstanden.«
Sie bedenkt mich mit einem angespannten Lächeln. »Ich habe ihn nicht genannt.«
Ich erwidere ihr Lächeln. »Diskretion. Okay. Ich verstehe. Das ist in Ordnung bei einer Erstberatung. Und Sie können in diesem Vorgespräch gern in Hypothesen sprechen. Möchten Sie mir vielleicht verraten, wie Sie auf meine Kanzlei gekommen sind?«
»Eine Ein-Mann-Kanzlei?« Ihr Sarkasmus ist unüberhörbar, trotz des starken Akzents.
»Sie haben recht. Es ist eine Einzelkanzlei.«
Ohne zu blinzeln, lässt sie den Blick durch den Raum schweifen. Sie macht sich ein Bild von mir, von meiner unechten Pflanze, dem unechten Fisch in dem Aquarium hinter meinem Schreibtisch, meinem Diplom von der juristischen Fakultät. Vielleicht denkt sie, dass das ebenfalls nicht echt ist.
»Sind heute nur Sie und der übertrieben zutrauliche Hund hier?«
»Jepp. Aber wir bearbeiten fast alle juristischen Angelegenheiten, selbst die seltsamen. Vor allem die seltsamen. Es ist eine Allgemeinkanzlei. Was für ein Anliegen möchten Sie besprechen?«
»Eine Internetsicherheitslücke«, sagt sie.
Nicht das, was ich erwartet habe. »Okay.«
»Wissen Sie, was ein ›Zoom-Raider‹ ist?«
Ich nicke. Ein Zoom-Raider ist jemand, der sich in eine Online-Videokonferenz hackt. Normalerweise zeigen solche Typen spießigen Geschäftsleuten oder Beamten Pornos. Ich weiß nicht, warum. Sie tun es einfach. Vielleicht gilt es in der Welt der Hacker als witzig. Oder es ist eine Mutprobe wie das Flitzen in den 1970er-Jahren.
Sie redet immer noch. »Nehmen wir an, ich wollte jemanden aufspüren, der, hypothetisch gesprochen, ein hochrangiges Onlinemeeting der Organisation, die ich vertrete, belauscht hat.«
»Und die Organisation ist …?«
»Anonym.«
»Verstehe.«
»Wie würde ich es anstellen, diese Person zu finden und ihre Identität in Erfahrung zu bringen?«
»Hm. Onlinetracking ist eine technische Frage, und für das Aufspüren einer Person braucht man einen Privatdetektiv. Sie haben Glück! Phil, mein Praktikant, kennt sich mit Technik aus, und ich habe eine sehr fähige Privatdetektivin unter Vertrag. Aber es gäbe in Ihrem Fall auch rechtliche Fragen. Da komme ich ins Spiel. Wenn wir Ihren Lauscher identifizieren, könnten wir eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung erwirken, die Computeraufzeichnungen beschlagnahmen lassen und dann eine Kontaktsperre beantragen, um diese Aktivitäten dauerhaft zu unterbinden.«
Sie bewegt den Kopf vor und zurück – sie denkt angestrengt nach. »Dauerhafte Unterbindung klingt gut.«
»In Ordnung. Obwohl ich an dieser Sache bisher nichts Unnatürliches finde. Rechtlich betrachtet ist das alles relativ normal.«
Mein Telefon klingelt. Ich wende den Blick nicht von meinem faszinierenden Gast ab. Keine Ahnung, warum.
»Sie dürfen das Gespräch ruhig annehmen«, sagt sie, als gäbe sie mir die Erlaubnis dazu.
Ich schaue auf das Telefondisplay. Es ist Dennis. »Entschuldigen Sie mich bitte kurz, ich werde dem Anrufer nur mitteilen, dass ich mich in einer wichtigen Besprechung befinde.« Dennis ruft mich aus dem Nebenzimmer mit dem für hündische Bedürfnisse angepassten Telefon an. Ich antworte, als wäre es ein Anrufer von außerhalb.
»Rechtsanwalt Daniel Becker am Apparat.«
»Dan, komm da raus.«
»Ja, hallo. Ich bin gerade in einem wichtigen Meeting mit einer Mandantin. Kann ich Sie zurückrufen?«
»Sie ist kein Mensch.«
Ich schaue auf. Sie sieht menschlich aus. Und sie hört zu. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. »Wir vertreten häufig genau diese Art von Mandanten. Das ist unser Metier.«
»Aber sie riecht nach Schlange.«
»Wie Sie wissen, fällen wir kein Urteil über unsere Mandanten. Wir sind ethisch dazu verpflichtet …«
»Ich meine das nicht im übertragenen Sinne, Dan. Das hier ist keine biblische Anspielung, und es geht nicht um Ethik. Ich sage dir, sie riecht buchstäblich wie eine Schlange, Mann. Und ich hasse Schlangen. Ich haue ab.«
»Wir vertreten extrem unterschiedliche Mandanten. Tatsächlich rühmen wir uns …«
»Ich. Werde. Nicht. Hierbleiben.«
Dann ist die Leitung tot. Dennis ist weg. Er kann nicht allein zur Eingangstür hinausgehen – Türklinke, Pfoten, keine opponierbare Daumen. Aber er hat eine Hundeklappe, die er beschönigend als »Fluchtweg« bezeichnet, damit er jederzeit wegkann. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt.
Plötzlich bin ich beunruhigt. Wenn Dennis ein gewöhnlicher Mann wäre, wäre er der vernünftigste Mann, den ich kenne. Was ist, wenn er recht hat? Ich blicke auf. Meine Besucherin sitzt zwischen mir und der Tür. Verdammtes Feng-Shui.
Ich tue so, als würde ich das Gespräch mit der toten Telefonleitung beenden. »… der Inklusion. Es freut mich, dass Sie dem zustimmen. Auf Wiederhören.«
Mein Gast stellt mit seinen glitzernden Augen Blickkontakt zu mir her. »Mandantenproblem?«
Ich starre mein Gegenüber an und kann mich des Gedankens nicht erwehren: Was für eine lange Zunge du hast. Sie schießt aus ihrem Mund, während sie spricht. Und so schmale Lippen. Sie leckt sie sich nicht direkt. Es ist mehr wie ein … Zungenschnippen. »Die Probleme meiner Mandanten zu lösen, ist mein Job.«
»Nun, dann könnten wir ja jetzt vielleicht meines lösen.«
»Auf jeden Fall. Ich stehe Ihnen zu Diensten.«
Sie erhebt sich, und jetzt sieht sie nicht mehr zu mir auf. Ich sehe zu ihr auf. Sie lispelt.
»Exsss-zellent. Also, was diese dauerhafte Unterbindung angeht …«
Sie gleitet anmutig heran, ohne zu schwanken. Sie gleitet tatsächlich. Ich sehe ihr wie gebannt zu. Und dann taucht sie über meinem Schreibtisch auf, der zum Glück so groß ist, dass ich, als sie angreift, gerade noch genug Zeit habe, mich rückwärts von meinem Stuhl fallen zu lassen. Ihr auf mich zuschießender Kopf verfehlt mein Gesicht nur um Haaresbreite.
»Heilige Scheiße!«
Ich krabbele panisch von ihr weg, und mein Kopf ist plötzlich ganz klar. Sie kriecht hinter mir her. Nein, sie kriecht nicht, sie schlängelt sich. Ich reiße das Aquarium hinter mir herunter, und es kracht zu Boden, sodass Glassplitter und Wasser aufspritzen. Aufziehbare Fischattrappen winden sich auf den Holzdielen. Niemand schlittert gern über Glasscherben; ich habe mir einen Moment Zeit erkauft, um mich aufzurappeln und umzudrehen.
Sie steht hoch aufgerichtet mir gegenüber auf der anderen Seite des Schreibtisches und wiegt sich hin und her, mit großen goldenen Augen, die in die dunklen Tiefen meiner …
Verdammt, nein! Jetzt falle ich auf diesen Trick nicht mehr herein. Ich schaue weg.
An der Wand hängt mein Feng-Shui-Spiegel. Sie ist darin zu sehen. Dennis hatte recht. Sie entkringelt ihren gewundenen Leib, der unter ihrem grünen Kleid verborgen war. Oder vielleicht war das ihr grünes Kleid. Ich weiß nicht, wie sehr ich von ihr betört war. Sie hat auch Dennis’ Augen getäuscht, aber nicht seinen Geruchssinn. Das habe ich davon, dass ich an dem vernünftigsten Burschen gezweifelt habe, den ich kenne.
Meine Gedanken rasen. Manche Strafverteidiger haben eine Waffe in ihrer Schreibtischschublade. Ich nicht – ich habe irgendwo gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, zehnmal höher ist, wenn man eine Waffe in seinem Zimmer aufbewahrt. Blöde Statistiken. Ich habe keine Waffen, daher schnappe ich mir den nächstbesten schweren Gegenstand, den Garderobenständer, und ich tue das Offensichtliche – ich werfe die Mäntel nach ihr. Aber das hier ist kein Film, und ich bin kein Actionheld. Die Mäntel fallen auf den Boden, und sie schlängelt sich an ihnen vorbei auf mich zu. Kurz frage ich mich, ob sie eine Gift- oder eine Würgeschlange ist. Dann öffnet sie den Mund, und ich erblicke glänzende Reißzähne.
Die Illusion von Menschlichkeit ist verschwunden. Ich sehe jetzt eine Schlange vor mir. Höre eine Schlange – das Gleiten ihres rauen Leibes über den Boden ist in der entsetzlichen Stille meines Büros deutlich zu vernehmen. Ich kann die Schlange sogar riechen – diesen trockenen Reptiliengeruch. Ich schreie nicht um Hilfe. Es ist niemand hier, der mir helfen könnte. Sie hat sich ausdrücklich erkundigt, ob jemand da sei, bevor sie angegriffen hat, und ich habe ihr die Antwort gegeben, die sie hören wollte. Nein. Sie wollte mich in aller Ruhe fressen. Das tun Schlangen. Ich löse juristische Probleme; Schlangen fressen Dinge. Wir alle haben unsere Rolle.
Ich bin verzweifelt. Wenn ich nichts unternehme, werde ich sterben. Sehen wir den Tatsachen ins Auge, ich werde wahrscheinlich so oder so sterben. Und dann ist sie über mir.
Es geht doch nichts über einen Hund, der sich die Seele aus dem Leib bellt, um deine Aufmerksamkeit zu erregen. Dennis erscheint im Türrahmen, seine gebleckten Zähne knirschen wild, als ob er Löcher in die Luft reißen würde. Seine langen Beine sind durchgestreckt und stocksteif; er ist selbst nicht ganz überzeugt, aber er ist hier, wider besseres Wissen. Danke, mein Freund! Er steht weit genug weg, um zu fliehen, aber nah genug, dass die Schlange für den Bruchteil einer Sekunde den Kopf dreht.
Als Kind habe ich Jimmy Maroni, den stärksten Jungen im Jahrgang über mir, dafür bezahlt, dass er mir verrät, was ich tun soll, wenn ich in einen Kampf gerate, den ich wahrscheinlich verlieren würde. Er hat meine fünf Mäuse genommen und gesagt: »Sei unberechenbar.« Es ist erstaunlich, woran man sich alles erinnert, wenn das Gehirn im Panikmodus ist. Ich reiße den Garderobenständer hoch und fange wie durch ein Wunder den schuppigen Hals der Riesenschlange mit dem gegabelten Ende des antiken Dings ab. Und hier kommt der Punkt, an dem ich versuche, unberechenbar zu sein – statt sie einfach nur abzuwehren, stürze ich mich auf sie und treibe sie rückwärts vor mir her. Ich trete über, in und um ihre sich kringelnden Windungen herum, und ich hoffe bei allen Göttern, dass es sich bei ihr nicht doch um eine Würgeschlange handelt. Denn ich konzentriere mich ganz darauf, diese langen gebogenen, vermutlich Gift absondernden Zähne so weit von mir wegzuhalten, wie es einem Anwalt mit einem Garderobenständer möglich ist.
Es ist schwer für eine Schlange, Halt zu finden – sie hat keine Füße –, und als ich den keilförmigen Kopf wie die Scheibe eines Shuffleboards über den Holzboden stoße, rutscht der zappelnde Leib hinterher. Ich stürme los, meine eigenen Füße bewegen sich rasend schnell, bis zu dem alten Heizkörper, wo die Gabel des Garderobenständers sich mit ihren Zinken verklemmt und den Kopf der Schlange dort fixiert. Ich drücke den Ständer mit meinem ganzen Gewicht immer fester gegen den Heizkörper. Schwere Schlingen winden sich um meine Beine und drücken zu, zerquetschen mich jedoch nicht. Sie ist keine Würgeschlange. Danke, ihr Götter. Es ist verdammt unheimlich, dass sich eine Schlange um mich herumgewickelt hat, aber nicht lebensbedrohlich. Ich halte den Druck aufrecht und lehne mich kräftig nach vorn. Der Heizkörper ist heiß, und ich kann riechen, wie das Reptilienfleisch zu kochen beginnt. Es ist ein widerwärtiger Geruch, so als würde Styropor über einer Flamme schwarz werden und sich wölben.
Ich versuche nicht, mit ihr darüber zu reden. Ihre Absichten sind mittlerweile klar geworden. Und sie kann ohnehin nicht reden – der Garderobenständer drückt ihr die geschuppte Kehle zu. Ich bin mir ohnehin nicht sicher, ob sie mehr als ein Zischen herausbringen würde, denn all ihre menschlichen Eigenschaften sind verschwunden. Sie ist jetzt ganz und gar Schlange – eine fast drei Meter lange, zornige und vielleicht hundertfünfzig Pfund schwere, sich windende Schlange. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich weiter auf den Garderobenständer zu stützen und ihn fest gegen ihre Kehle zu pressen.
Ich weiß nicht, wie lange wir dort in unserem Kampf auf Leben und Tod verharren, während Dennis’ Heulen unseren Tanz begleitet, und ich bin mir nicht sicher, ab welchem Zeitpunkt meine Gegnerin sich nicht mehr rührt, aber nicht einmal danach lasse ich locker. Sie – das Tier – könnte das mühelos vortäuschen. Ich hocke mit angespannten Muskeln da, bis ich einfach zu erschöpft bin, um weiterzumachen. Dann falle ich auf Hände und Knie und lasse den Garderobenständer los.
Als die Schlange sich auf den Rücken dreht, macht mein Herz einen Satz, aber es ist nur ein Reflex. Sie erhebt sich nicht. Ich krieche von ihr weg, ziehe den Ständer vorsichtshalber hinter mir her, und die Schlange bleibt liegen wie ein sehr dickes, sehr schlaffes Seil. In diesem Moment der Reflexion denke ich: Scheiße, was ist da gerade passiert?
Tiefschürfende Gedanken sind ein Problem, wenn man vor allem versucht, sein Leben zu retten. Der Instinkt übernimmt, und nur grundsätzliche Gehirnfunktionen werden aufrechterhalten. Kämpfen oder fliehen. In diesem Fall hieß es Kämpfen, denn Fliehen war keine Option. Aber jetzt ist der Kampf vorüber, und ich habe eine riesige tote Schlange in meinem Büro. Sobald mein Herz aufhört zu rasen, muss ich meinen Juristenverstand auf dieses Problem richten. Außerdem muss ich Martina anrufen, meine gerissene Ermittlerin. Sie wird wissen, was zu tun ist.
Während ich darauf warte, dass mein Gehirn alles verarbeitet, nehme ich mir einen Moment Zeit, um die Spuren unseres Kampfes zu begutachten – Glasscherben, Wasser, umgekippte Stühle, meine Lieblingshose, die an einem Knie zerrissen ist, und eine zusammengerollte Bestie aus tausend Albträumen liegt tot neben …
Doch als ich wieder hinschaue, ist die Bestie verschwunden. Natürlich nicht komplett verschwunden – sie ist noch da –, aber sie ist keine Schlange mehr. Sie ist wieder ein Mensch, nehme ich zumindest an. Und sie atmet. Den Göttern sei Dank! Das Letzte, was ich in meiner Anwaltskanzlei brauche, ist eine lebendige Schlange oder eine tote Mandantin, und im Moment ist sie keins von beidem. Doch mein Anwaltsgehirn – übrigens, willkommen zurück – erinnert mich daran, dass ich nicht weiß, warum sie sich verwandelt hat oder wie lange das anhalten wird.
Dennis traut dem Frieden ebenfalls nicht. »Ich will ja nichts sagen, aber …«, brummt er vom sicheren Türrahmen aus.
»Du hast es mir prophezeit?«
Er nickt und schleicht davon, denn er will nichts mehr mit dieser Angelegenheit zu tun haben. Aber er war da, als ich ihn brauchte. Braver Hund. Ich werde mich später mit meinem Hundefreund besprechen. Jetzt muss ich erst einmal diese Frau fesseln und sie befragen, wenn sie zu sich kommt. Das wird ein ganz anderes Gespräch, als ich es geplant habe.
Kapitel 2
Mandantenkontrolle
Innerhalb von zwanzig Minuten erscheint Martina im Empfangsbereich. Ihre Nase zuckt, während von ihrem abgewetzten Anglerhut Regentropfen auf meinen Holzboden fallen. Diesmal lasse ich es ihr durchgehen. Es ist ein Notfall.
»Wo ist die verdammte Schlange?«, fragt meine taktlose Ermittlerin anstelle einer Begrüßung. Sie sieht sich um, ihr Blick schießt hin und her, und ihre wachsamen Augen suchen oben, unten, in jeder Ecke. Ich höre die Verachtung in ihrer Stimme und einen Hauch von Besorgnis. Es ist ein Instinkt, etwas Urtümliches. Sie ist halb Ratte, und Ratten hassen Schlangen.
»Sie ist keine Schlange mehr. Ich glaube, sie ist eine Gestaltwandlerin.«
»Das lass mich mal feststellen. Ich wiederhole: Wo ist das Vieh?«
»In meinem Büro. Ich war gerade mit ihr im Gespräch, als sie sich verwandelt hat.«
»Verstehe.«
Martina huscht zur Bürotür, späht in den Raum und schnuppert. »Es stinkt tatsächlich nach Schlange.«
»Das hat Dennis auch gesagt.«
»Wo ist der Köter?«
»Dennis gönnt sich einen langen Spaziergang.«
Ich weiß nicht, wann Dennis zurück sein wird, aber er muss vorsichtig sein, damit ihn die Tierschutzbehörde nicht einsammelt. Ich zahle Hundesteuer für ihn, doch er hasst es, ein Halsband mit klimpernden Marken zu tragen, und die Implantation eines Ortungschips hat er abgelehnt – er sagte, das sei ihm zu »Orwell«-mäßig.
»Schlauer Hund«, sagt Martina. Dann verschwindet sie in meinem Büro.
Ich folge ihr und spähe über ihre Schulter wie ein Kind, das sich hinter seinen Eltern versteckt, wenn sie sein Zimmer nach dem schwarzen Mann absuchen. Unsere Besucherin liegt auf dem Boden. Bis zu ihrem jetzt menschlichen Hals steckt sie in einem Wäschesack aus schwerem Segeltuch, der oben mit einer Kordel fest zugezogen ist. Nur ihr hübscher Kopf schaut heraus. Meine Hemden liegen dort, wo ich den Wäschesack in aller Eile ausgekippt habe, auf einem Haufen.
»Du hast die Schlange in einen Sack gesteckt«, sagt Martina.
»Ja, ich habe gehört, dass man das machen soll.«
»Man soll auch den Kopf in den Sack stecken.«
»Es erschien mir nicht richtig, weil sie doch jetzt ein Mensch ist.«
Unsere Besucherin ist wach und beobachtet uns. Martina umkreist sie schnuppernd, geht aber nicht allzu nah an sie heran. Es ist gut, sie hier zu haben. Es ist gut, irgendjemanden hier zu haben, denn ehrlich, ich habe Angst, dass die Frau jederzeit wieder einen auf Schlange machen könnte. Außerdem ist Martina eine Ermittlerin; sie hat eine gute Verhörtechnik und stellt Fragen, auf die ich nie kommen würde.
»Wer bist du, du schlangenhaftes Miststück?«
Okay, was ihre erste Frage betrifft, bin ich mir nicht so sicher.
Aber die Frau im Sack antwortet. Sie schaut sich suchend um und wirkt verwirrt, als tauche sie aus einem Nebel auf. »Katarina«, sagt sie schließlich.
»Und der Nachnahme …?«
»Silva.«
Wie gesagt, Martina ist gut. Die Befragte macht kein Geheimnis mehr aus ihrer Identität, wie sie es während unseres Gesprächs getan hat. Vielleicht ist Martinas Herangehensweise effektiver als meine. Vielleicht liegt es aber auch an dem Sack; unsere Gefangene ist jetzt jedenfalls weniger stur, als man es von einer in einen Sack gesteckten Person erwarten sollte.
»Warum haben Sie versucht, meinen Kollegen zu töten, Katarina?«
»Was töten?«
»Sie haben meinen Kollegen angegriffen. Warum?«
»Ich habe niemanden angegriffen. Wie auch? Ich stecke in einem Sack!«
»Das ist der Grund, warum Sie in einem Sack stecken«, erkläre ich.
»Wo bin ich? Außer in einem Sack.«
Ihr Akzent ist jetzt nicht mehr so stark wie bei ihrem Erscheinen in meiner Kanzlei. In meinen Ohren klingt er immer noch spanisch, aber viel verständlicher und jetzt eher hektisch als schwül erotisch.
»Sie sind in meinem Büro.«
»Und Sie sind …?« Katarina Silvas Verwirrung ist entweder echt oder aber extrem gut gespielt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe in meinem Leben schon viele Lügner kennengelernt, und ich bin ziemlich gut darin, sie als solche zu enttarnen. Doch ich bin auch klug genug, um zu wissen, dass selbst ich getäuscht werden kann. Ich meine, diese Frau hätte mich fast umgebracht, als ich vorhin auf ihre »Ich bin nur eine harmlose potenzielle Mandantin«-Nummer hereingefallen bin.
Ich wende mich an Martina. »Als sie reinkam, wusste sie noch, wo sie war, und ich habe mich mit Namen vorgestellt, also kannte sie auch den. Sie war auf der Suche nach dem ›Monsteranwalt‹.«
»Aus deiner blöden Annonce.«
»Ähm, genau.«
Martina nickt. »Manchmal sind Gestaltwandler ein wenig desorientiert, wenn sie sich zurückverwandeln. Ich habe mich mal in meine menschliche Form verwandelt und mich nackt in einem Supermarkt wiedergefunden. Im Gang mit dem frischen Fisch. Sehr kalt.« Sie betrachtet Katarina Silva mit zusammengekniffenen Augen. »Was haben Sie gemacht, bevor Sie herkamen, Lady?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das so wichtig ist«, flüstere ich Martina zu. »Vielleicht sollten wir eher der Frage nachgehen, warum sie versucht hat, mich zu töten?«
Aber sie/es antwortet Martina. »Ich habe mich um meine eigenen sackfreien Angelegenheiten gekümmert und mein eigenes sackfreies Leben gelebt. Das habe ich getan, Frau, die ich ebenfalls nicht kenne.«
»Und was waren das für Angelegenheiten?«
Martina ist gut. Sie bringt diese Frau zum Reden und verführt sie dazu, Informationen auszuspucken wie ein quietschender Ballon, aus dem die Luft entweicht. Sie wirkt frustriert und aufrichtig verwirrt. Fast tut sie mir leid, nur dass sie gerade versucht hat, mich zu vergiften.
»Ich hatte etwas zu erledigen.« Sie ächzt, als ob es ihr schwerfiele, die Erinnerung heraufzubeschwören. »Aber jetzt bin ich hier. In diesem Büro in …?«
»… in der Innenstadt«, ergänze ich.
»Der Innenstadt von Recife?«
»Von Seattle.«
Sie starrt mich an. »Seattle?«
»Recife?« Ich bin ebenfalls verwirrt. »Seattle in Washington«, stelle ich klar und warte ab.
»Estados Unidos«, sagt Martina.
»In den Vereinigten Staaten?«
»Ja, genau.«
»Nein. Das kann nicht sein. Ich träume.«
Oder ich träume. Der verwunderte Gesichtsausdruck der Frau ist aufrichtig, und ihre feuchten Augen sind echt. Ihre kämpferische Fassade bekommt Risse. Es wird Zeit, dass Martina und ich ein Gespräch unter vier Augen führen.
»Wir sind gleich wieder da, Miss Silva«, sage ich höflich.
Martina und ich ziehen uns in den Empfangsbereich zurück. Eigentlich fasse ich sie sogar am Arm und zerre sie aus dem Raum. Sie hält sich am Türrahmen fest, um weiter unsere in meinen Wäschesack steckende Gefangene im Blick zu behalten.
»Ich glaube, sie sagt die Wahrheit«, sage ich zu meiner Werratten-Verbündeten.
»Sie ist keine Gestaltwandlerin.«
»Sie hat ihre Gestalt geändert. Das schwöre ich.«
»Aber sie ist nicht so wie ich. Sie ist nicht dauerhaft zum Teil Schlange. Sie riecht nicht mehr nach Schlange. Könnte sie eine Schreckensbestie sein? Wie dein Arschlochfreund Brett?«
»Nein. Schreckensbestien töten nicht; sie versuchen, dich zu erschrecken, indem sie als das erscheinen, was dir am meisten Angst macht, damit sie sich an deiner Furcht laben können. Schlangen sind nicht meine größte Angst – sie sind etwa die Nummer sieben auf meiner Liste. Und diese Frau hat wirklich versucht, mich kaltzumachen.«
»Dann steckt etwas anderes dahinter.«
»Was zum Beispiel?«
Martina senkt die Stimme. »Magie.«
»Warum sagt jeder das Wort ›Magie‹ auf diese Weise?«
»Auf welche Weise?«
»Auf die Weise, wie meine Mom früher die Wörter ›Scheidung‹ und ›Krebs‹ geflüstert hat, wenn sie sie am Esstisch erwähnte.«
»Warum hat deine Mom geflüstert?«
»Weil diese Dinge zu ihrer Zeit tabu und beängstigend waren.«
»Aus demselben Grund.« Martina wirft Miss Silva von der Tür aus einen langen Blick zu. »Ich glaube, diese Frau kam hierher, um sich in eine bestimmte Gestalt zu verwandeln und eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.«
»Die darin bestand, mich zu töten.«
»Offensichtlich.«
Meine Gedanken überschlagen sich. »Eine Attentäterin.«
»Eine magische Attentäterin. Sie sagt, sie käme aus Recife – das ist in Brasilien –, und ihr Akzent passt dazu. Wen kennst du in Südamerika, der Magie wirken kann und deinen Tod will, Anwalt?«
»Ich kenne niemanden dort, der das will.«
»Ich stimme dir vorerst widerstrebend zu; ich denke, sie sagt die Wahrheit. Sie erinnert sich nicht an ihre Mission. Hast du ihre Augen gesehen? Totale Überraschung, als ich den Mordanschlag auf dich erwähnt habe.«
Ich habe ihre Augen gesehen, und sie waren tatsächlich überrascht. Jetzt sind sie grün, nicht mehr schlangengelb. Sie ist ein ganz anderes Wesen als das Ding, das mich angegriffen hat.
»Wir müssen sie aus dem Sack lassen«, entscheide ich.
Nach einer heftigen Debatte und mit größter Vorsicht ziehen wir Miss Silva aus meinem Wäschesack und setzen sie auf meinen Schreibtischstuhl. Ich bleibe an der Tür stehen für den Fall, dass ich die Flucht ergreifen muss. Martina kauert in Nagetierstellung am Boden, jederzeit bereit, aktiv zu werden. Wir vertrauen dieser Frau nicht, dieser Miss Silva – das wäre töricht –, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass sie sich nicht jederzeit auf Abruf in ein schlängelndes Kriechtier verwandeln kann.
Martina ist immer noch skeptisch. »Selbst wenn wir recht haben, könnte sie nach wie vor voller Magie sein. Sie könnte versuchen, ihre Mission zu erfüllen.«
»Mich zu töten.«
»Ganz genau.«
Ich rufe Katarina quer durch den Raum zu: »Miss Silva, praktizieren Sie Magie oder besitzen Sie irgendwelche magischen Gegenstände?«
Sie überlegt. »Ich gehe nicht unter Leitern hindurch, und ich trage ein Kruzifix zum Schutz vor Unglück.«
»Das zählt nicht wirklich als Magie«, entgegne ich.
»Ich kann keine Kaninchen aus dem Hut zaubern, falls Sie das meinen.«
Ich drehe mich wieder zu Martina um. »Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr im Einsatz.«
»Für den Moment vielleicht. Aber nehmen wir an, die Person, die sie dazu gebracht hat, sich zu verwandeln, kann es wieder tun. Oder vielleicht gibt es einen Auslöser.«
»Wie ein Zauberwort? ›Abrakadabra, du bist eine Schlange‹?«
»Keine Ahnung. Ich bin auch keine verdammte Magierin.«
Ich gehe auf und ab und denke nach. »Sollten wir sie gehen lassen? Denn es macht mich nervös, jemanden gegen seinen Willen festzuhalten. Das ist nach menschlichem Recht absolut illegal.«
»Wenn du sie gehen lässt, könnte sie ihren Auftraggeber kontaktieren, der sie dir vielleicht erneut auf den Hals hetzt. Oder er merkt, dass sie versagt hat, und schickt jemand anderen los.«
»Vielleicht ist es wichtiger, dass wir herausfinden, wer der Auftraggeber ist.«
Martina nickt. »Einverstanden. Wir müssen uns etwas Zeit verschaffen, um Ermittlungen anzustellen. Du willst sicher nicht, dass sie sofort jemanden anruft. Ich kann zu meinem regulären Stundensatz ihre Vergangenheit checken.«
Ich weiß, dass das teuer wird, aber ich habe keine andere Wahl – es ist wahrscheinlich wichtig zu wissen, wer mich umbringen lassen will. »In Ordnung. Und was machen wir in der Zwischenzeit mit ihr?«
Kapitel 3
Übernachtungsgast
Die Fahrt aus Belltown durch Queen Anne nach Northlake zu mir nach Hause führt geradewegs auf den Highway 99 und über die Aurora Avenue Bridge. Rechts von mir landen einmotorige Wasserflugzeuge auf dem Lake Union. Sie schießen herab wie Möwen, die sich vom Wind tragen lassen, dann landen sie mit einem Spritzen und pflügen auf Pontons durchs Wasser. Yachten tuckern umher, und Segelboote gleiten über den See, wobei sie den Landebereich der Flugzeuge meiden – eine chaotische Mischung von Multimillionären aus Seattle und ganz normalen Bootsliebhabern, die sich ihren eigenen Weg bahnen. Wie ich, metaphorisch gesprochen. Es war ein Risiko, eine private Kanzlei zu eröffnen, um Kreaturen in Not zu verteidigen, aber was ich jetzt tue, ist noch verrückter – ich nehme Katarina Silva, meine Möchtegern-Attentäterin, mit zu mir auf mein Hausboot.
Ich weiß, ich weiß – gar keine gute Idee. Glauben Sie mir, deswegen hat Dennis mir bereits ausgiebig in den Ohren gelegen.
»Die Frau mit nach Hause zu nehmen, die versucht hat, dich zu töten, ist genau die Art von Dummheit, die nur ein menschliches männliches Wesen besitzt«, hat mein hündischer Rechtsanwaltsgehilfe vor sich hin gebrummt, »abgesehen von einigen Insekten.« Er hat mich auch darauf hingewiesen, dass sie hier in den Staaten kein Geld hat, mit dem sie uns bezahlen kann, wenn wir ihr helfen.
Immer praktisch, dieser Hund.
Aber ich habe im Moment ein größeres Problem als die Bezahlung von Rechnungen – ich kann diese Frau nicht gehen lassen. Sie würde sich womöglich bei den Leuten zurückmelden, die meinen Tod wollen. Martina geht der Sache nach und versucht herauszufinden, wie sie hierhergekommen ist und warum. Katarina selbst ist ein wenig panisch und desorientiert, und ihr für ein oder zwei Tage einen sicheren Ort anzubieten, sollte sie versöhnlich stimmen, aber ich muss sie im Auge behalten. Während Martina Katarinas Leben unter die Lupe nimmt, wird es meine Aufgabe sein, noch mehr Informationen aus ihr herauszupressen. Doch Vertrauen zwischen einer Attentäterin mit Gedächtnisverlust und ihrem Bewacher aufzubauen, verspricht eine heikle Angelegenheit zu werden.
Wir sind auf dem Weg zu der Marina, wo mein schon etwas in die Jahre gekommenes Hausboot liegt. Ich habe daran gedacht, Katarina allein auf dem Boot schlafen zu lassen. Ich könnte mit Lucy auf dem Queen Anne Hill – bei meiner Exfrau in meinem Exhaus – übernachten, während Eve verhindert ist. Aber diese Frau wäre allein an einem fremden Ort und ziemlich schutzlos. Außerdem könnte sie denjenigen, der sie in meine Kanzlei geschickt hat, kontaktieren, sobald ich sie mit einem Telefon oder einem Computer allein lasse. So oder so, sie braucht einen Babysitter. Ich werde der mysteriösen Miss Silva die Kabine überlassen, wo ich sie unter Kontrolle habe, und selbst auf dem überdachten Teil des Decks übernachten. Das gleichmäßige Plätschern des Regens, das mich im Büro immer so nervt, hilft mir auf dem See normalerweise einzuschlafen – Regen ist auf seine Weise so launisch wie der triste, aber verlässliche Freund, den jeder hat und der einen manchmal auf die Palme bringt, dafür aber immer für einen da ist.
Katarina sitzt still neben mir auf dem Beifahrersitz, die Stirn mit den dicken Augenbrauen gefurcht. Martina schwört, ihr Akzent sei brasilianisch. Sie ist weit weg von zu Hause und fragt sich sicherlich, was mit ihr geschehen wird. Ich habe versprochen, sie weder der Einwanderungsbehörde noch der Polizei zu übergeben – ich habe ohnehin keine gute Begründung, warum man sie festhalten sollte. Trotz des Regens lässt sie das Beifahrerfenster herunter, als wir auf die Brücke fahren. Ich weiß, warum. Sie war in meinem Büro in einem Schlangenkörper gefangen, dann habe ich sie in einen Sack gesteckt, und jetzt ist sie in meinem Auto eingesperrt und wird an einen ihr unbekannten Ort gebracht. Sie hat das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Sie will aber das Gefühl haben, aus dem Wagen springen zu können, wenn es nötig ist. Mal ganz abgesehen davon, dass die Brücke über dem Lake Union gut fünfzig Meter hoch ist und der Sturz sie töten würde, Menschen mögen es nicht, sich gefangen zu fühlen, das ist das Tier in uns. Ich kann ihr keinen Vorwurf daraus machen, und ich bringe es auch nicht übers Herz, sie zu bitten, das Fenster wieder zu schließen, damit der Regen nicht das Lederinterieur des Ersatzlexus durchnässt, den ich mir von meinem ehemaligen Mandanten, dem Gebrauchtwagenhändler Victor Gianopoulos, ausgeliehen habe. Victor wird stinksauer sein.
Auf Höhe des Fremont-Trolls – einer sieben Meter hohen Steinstatue eines anderen ehemaligen Mandanten von mir unter der Brücke – fahren wir vom Highway 99 ab und biegen in mein Viertel ein. Schon bald weise ich auf die Sea Wolf Bakery mit ihren Kürbis-Croissants und das RoRo-Barbecue hin, wo es eine ausgezeichnete Rinderbrust in einem mit Maismehl bestäubten Brötchen gibt. Katarina hört aufmerksam zu, und ihren großen grünen Augen entgeht nichts. Wir fahren an der leuchtend gelben Tür von Davidson Custom Bicycles vorbei, wo die langhaarigen Jungs und Mädels nach Schweiß und glutenfreiem Shampoo riechen, dessen Zweck sich mir nicht erschließt. Dann ist da noch der mittelmäßige Teriyaki-Laden mit den weißen Plastiktischen, wo ich immer zu Mittag esse, wenn ich in Eile bin.
»Der königsblaue Bau dort ist eine Kletterhalle«, sage ich zu ihr. »Und das Fiasco ist mein derzeitiger Lieblingsitaliener.«
Ich bin mir zu achtundachtzig Prozent sicher, dass sie das alles kein bisschen interessiert, aber ich versuche, ihr ein Gefühl von normaler Gastlichkeit zu vermitteln, als wäre sie lediglich eine Besucherin aus einer anderen Stadt. Wir fahren an der Sportbar The Dock vorbei, wo ein Reklameschild am Gebäude die Passanten dazu auffordert: »Holt die Kraken nach Seattle!« Die Begeisterung, mit der die Idee befürwortet wird, ein Profi-Eishockeyteam nach Seattle zu locken, grenzt an Wahnsinn. Letzten Monat hat eine Menschenmenge auf der Überführung der Interstate 5 vorbeifahrenden Autos mit Eishockeyschlägern zugewinkt und einen als Torwart verkleideten Mann in einem Netz über dem Highway aufgehängt, bis die Polizei und die Feuerwehr anrückten und ihn mittels eines Krans herunterholten. Das Büro der Bürgermeisterin will einen zwanzigjährigen Pachtvertrag für die Climate Pledge Arena finanzieren, um die Eigentümer der Eishockeymannschaft davon zu überzeugen, sich in Seattle niederzulassen. Das hieße, eine Menge Steuergelder müssten ausgegeben werden, und die Eishockeyfans machen der Bürgermeisterin deswegen mächtig Druck. Ihre Entscheidung wird sich auf ihre Wiederwahl auswirken, daher vermute ich, dass sie die Schatzkammern der Stadt öffnen und die Kohle ausspucken wird. Ich habe in meiner Großkanzleizeit auch ein wenig Kommunalrecht praktiziert. Wenn ich immer noch dort wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich genau damit zu tun und würde gut bezahlt werden. Und wahrscheinlich würde niemand einen Mordanschlag auf mich verüben.
Meine Adresse ist 1000 North Northlake Way. Meine Tochter nennt die Straße »Doppel-North«. Ich stelle den Wagen auf dem Parkplatz am Wasser ab und rede Katarina gut zu auszusteigen. Sie verlässt den Lexus vorsichtig und prüft ihre Umgebung wie ein Erdhörnchen, das aus seinem Bau kommt. Sie vertraut mir noch nicht. Und warum sollte sie auch? Mein Vater hat immer gesagt: »Vertrauen wird verdient, nicht verschenkt.« Ich muss mir ihr Vertrauen erst verdienen.
»Ich wohne am Ende des Anlegers.«
»Ihre Wohnung ist ein Boot?«
»Richtig.«
Sie nickt hoffnungsvoll, als wir im Schatten der Aurora Avenue Bridge an Millionen-Dollar-Yachten und prächtigen Hausbooten vorbeigehen, bis wir zu einem betagten kleinen Kajütboot kommen, auf dessen Heck in Regenbogenfarben der Name »LUCY« gemalt ist. Mein Boot. Die Miene meines Gastes lässt keine Anzeichen von Enttäuschung erkennen. Katarina neigt nur den Kopf zur Seite und liest den Namen des Bootes laut vor.
»Lucy?«
»So heißt meine Tochter.«
»Sie haben Ihr Wohnboot nach Ihrer Tochter benannt?«
»Ja. Und ich musste die Buchstaben selbst aufs Heck malen. Ich gebe zu, dass ich meine Sache nicht besonders gut gemacht habe, aber es kam mir falsch vor, jemanden dafür zu bezahlen, Lucys Namen für mich zu schreiben.«
Sie mustert mich von Kopf bis Fuß, dann nickt sie. »Vielleicht sind Sie doch ein guter Mensch, trotz des Sacks.«
»Ich gebe mir Mühe.«
»Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Sie kein Serienmörder sind.«
»Puh, danke. Wie haben Sie das herausgefunden?«
Ich glaube, sie hat die Ironie meiner Frage nicht verstanden, denn sie erklärt sachlich, warum ich nicht den Anschein eines gruseligen Mörders erwecke, so als ob sie in dem Zusammenhang eine Liste erstellt hätte. Wahrscheinlich hat sie das auch getan.
»Sie tragen einen Anzug. Sie haben eine eigene Anwaltskanzlei. Sie arbeiten mit einer weiblichen Partnerin zusammen. Sie scheinen beide zu denken, dass ich die Gefährliche von uns bin. Und Ihr Hund ist süß, obwohl ich den Eindruck habe, dass er mich aus irgendeinem Grund nicht mag.«
Das liegt an der Sache mit der Schlange.
Sie spricht weiter. »Der Sack kostet Sie natürlich viele Punkte, und ich ziehe noch ein paar mehr ab, weil Sie allein auf einem alten Boot leben. Aber Sie ehren mit dem Bootsnamen Ihre Tochter, und es liegt in Rufweite vieler anderer bewohnter Boote. Alles in allem halte ich es für unwahrscheinlich, dass Sie mich hergebracht haben, um mich zu töten. Ich werde an Bord gehen.«
Nachdem sie solchermaßen ihr Urteil über mich gefällt hat, zieht Katarina ihr lächerliches Kleid etwas hoch, streckt ein langes Bein über das Wasser und klettert auf das Deck der Lucy.
Meine Liebe zu meiner Tochter – das ist es, was am meisten Vertrauen in ihr weckt.
Ich folge ihr auf mein Boot. Es ist wahrscheinlich wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich kein kompletter Idiot bin. Ich habe einen riesigen Brieföffner in meiner Tasche, und mein Handy ist sowohl für Martina als auch für die Wildtierkontrolle von Seattle auf Autodial gestellt.
Ich begleite meinen Gast nach unten zur Kabine und zeige ihr das winzige Bad.
»Mehr ist leider auf einem Boot dieser Größe nicht möglich«, erkläre ich ihr. »Ich hoffe, Sie kommen trotzdem zurecht.«
Das ist nervöses Geplapper von der idiotischen Sorte, in das man verfällt, wenn man seit einer Weile keiner Frau mehr sein Schlafzimmer gezeigt hat. Ich winde mich innerlich angesichts meiner Unbeholfenheit und beschäftige mich damit, mir die paar Sachen zurechtzulegen, die ich brauche, um auf Deck zu schlafen: eine noch aus dem Jurastudium stammende Decke, einige Sofakissen und ein schmuddeliges gelbes Smiley-Dekokissen.
»Sicher«, erklärt Katarina und wirkt dabei kein bisschen verlegen. »Ich habe nur keine Kleider zum Wechseln.« Es scheint, dass sie ohne Ausweis, Geld oder Gepäck in meine Kanzlei gekommen ist. Falls sie irgendetwas nach Seattle mitgebracht hat, erinnert sie sich nicht daran, wo die Sachen sich jetzt befinden.
Aber da kann ich Abhilfe schaffen. »In der dritten Schublade von oben finden Sie ein paar Frauensachen.«
Sie zieht die Schublade auf. Darin sind Blusen und Hosen und ein Sweatshirt. Katarina wirft mir einen prüfenden Blick zu. »Sie sammeln Frauenkleidung?«
»Nein, nein. Lucy verbringt drei von vier Wochenenden bei mir. In letzter Zeit ist sie noch häufiger hier, weil ihre Mom … äh … nicht da ist.«
»Wird sie nichts dagegen haben?«
»Nein. Sie ist sehr großzügig. Bedienen Sie sich.«
Katarina nickt und beginnt, sich aus ihrem Kleid zu befreien. Es fällt zu Boden, bevor ich eine Chance habe, wegzuschauen.
»Ich gehe dann mal nach oben«, sage ich, bevor ich allzu viel zu sehen bekomme.
»Sie werden mich nicht bewachen?«
Das ist ein Test, um festzustellen, ob ich wie ein Gentleman oder wie ein perverser Entführer reagiere. Sie ist schlau. »Nun, ich behalte Sie im Auge, ja. Aber Sie sind nicht in Gewahrsam, nicht gesetzlich. Keine Ahnung, es ist eine Grenzsituation. Versprechen Sie mir einfach, sich nicht in irgendetwas zu verwandeln.«
»Ich schwöre feierlich, dass ich mich in nichts Gefährlicheres verwandeln werde als in eine Frau mittleren Alters, die wie ein Teenager angezogen ist.« Sie wirft mir einen ernsten Blick zu, dann grinst sie. »Obwohl auch das riskant sein kann.«
Es ist ihr erstes Lächeln. Ein nettes Lächeln, und es löst die Anspannung unserer unglaublich seltsamen Situation.
»Okay, ich gehe jetzt hoch.«
Ich verlasse die Kabine. Katarina schlüpft in die Kleider meiner Tochter, ohne sich in ein Monster zu verwandeln, und kommt dann zu mir an Deck. Sie trägt ein rot-schwarz geblümtes Oberteil und dazu eine Stretchjeans, die an ihren langen Beinen so kurz ist, dass sie wie eine Caprihose aussieht. Irgendwie schafft sie es trotzdem, das Outfit an sich gut aussehen zu lassen. Und Lucy trägt die geblümte Bluse nicht oft, darum habe ich, wenn ich Katarina darin sehe, nicht das Gefühl, als hätte sich mein süßes Teenie-Mädchen auf verstörende Weise in eine verführerische erwachsene Frau verwandelt. Ich habe kalten Braten und zwei Sorten Käse auf einem Holzbrett angerichtet. Das Essen sieht auf meiner lachsförmigen Platte recht vornehm aus, aber in Wahrheit handelt es sich bei dem Fleisch um einen raffiniert aufgeschnittenen Rest vom Mittagessen, und zwei Käsesorten kann ich auch nur anbieten, weil sich der eine Käse unvermutet noch ganz hinten in meinem Kühlschrank fand, als ich das heute gekaufte Stück dort deponierte. So eine Mahlzeit lässt sich schnell herrichten, ist einfach und erspart mir das Kochen. Ich habe an Deck einen Plastiktisch mit zwei Gartenstühlen, den Blick auf den Lake Union inklusive. Wir setzen uns.
»Wasser?« Ich halte ihr eine Plastikflasche von Seattle Springs hin. In Seattle gibt es keine Quellen, und auf dem Etikett steht, dass das Wasser in Ephrata, einer kleinen Stadt zweihundert Meilen östlich von hier, abgefüllt wurde. Aber es ist kühl, klar und nass, und diesmal nimmt Katarina Silva es. Sie dreht die Flasche in ihrer Hand.
»Das habe ich Ihnen angeboten, kurz bevor Sie versucht haben, mich zu töten«, sage ich.
»Ich würde mich ja entschuldigen – wirklich, das würde ich –, aber ich weiß nicht, was passiert ist oder wie ich hierhergekommen bin. Manchmal frage ich mich immer noch, ob ich träume. In einem Moment verlasse ich mein Zuhause, und im nächsten stecke ich Tausende von Meilen entfernt in einem Sack. Es ist wie …«
… Magie. Das ist es, was passiert ist. Martina hält Katarinas wundersame Verwandlung in eine Schlange für Magie, und ich bin geneigt, ihr zuzustimmen. Was heute in meiner Kanzlei passiert ist, war ganz finstere Scheiße. Ich bin kein Experte, aber ich habe schon früher böse Magie gesehen. Vor einem guten Jahr hatte ich einen Fall mit einer echten Hexe, die versucht hat, mich auf der Space Needle zu töten. Also ja, ich habe so etwas schon gesehen. Ich habe sie gespürt, und das heute hat sich für mich stark nach bösartiger Zauberei angefühlt. Wohlgemerkt, nicht alle übernatürlichen Ereignisse werden aus der Dunkelheit beschworen. Meiner Erfahrung nach sind einige Dinge einfach von Natur aus übernatürlich, so wie Feen, Gnome und sogar mein Feind-Freund Brett Bremen, die Schreckensbestie, die mich als Kind gequält hat. Aber Menschen, die dunkle Kräfte beschwören und Zauber wirken, sind nicht natürlich. Sie können das nicht allein tun. Um diese Kräfte zu beschwören, braucht man eine Quelle – eine mystische Batterie, wenn man so will, einen verzauberten Gegenstand, einen heiligen Ort oder einen alchemistischen Trank. Oder schlimmer noch, einen paranormalen Financier – einen zwielichtigen, übernatürlichen Sponsor, der eine Gegenleistung für seine Investition sehen will. Man hat mir erzählt, dunkle Magie werde von Dämonen und zornigen Halbgöttern gehortet und Menschen nur zu einem immens hohen Preis zur Verfügung gestellt – echt jenseitiges Zeug, mit dem man nichts zu tun haben will. Martina beschrieb einen bösartigen Geist, der Elfen frisst, nur um ihre übernatürliche Essenz zu absorbieren. Ich habe einen Mandanten, der ein Elf ist, und er ist ein wirklich anständiger kleiner Kerl, weshalb mich diese Geschichte sehr berührt hat.
»Es fühlt sich an, als wäre ich hierher teleportiert worden«, sagt Katarina. »Aber Anwälte glauben natürlich nicht an derart absurde Aussagen.«
»Ich habe mit angesehen, wie Sie sich in eine Schlange verwandelt haben. Ich bin für so ziemlich jede Erklärung offen.«
»Stimmt. Das ist genauso seltsam.«
Dies ist eine Chance, ihr Vertrauen in mich zu stärken und sie aus der Reserve zu locken. Am liebsten würde ich diese Chance ergreifen. Ich würde ihr am liebsten sagen: Ja, ich glaube an Magie. Lassen Sie mich Ihnen all meine übernatürlichen Geheimnisse erzählen!
Stattdessen sage ich: »Ich glaube Ihnen, dass Sie glauben, Sie seien teleportiert worden.«
Das genügt ihr. Sie blickt mich mit ihren großen hellen Augen interessiert an. »Wirklich?«