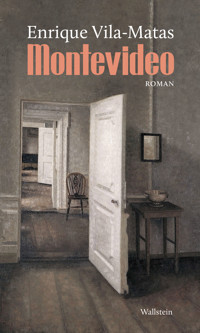
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Da haben wir`s, dachte ich, schon wieder eine wahre Fiktion, als zöge ich es an […]" Mit dem anachronistischen Ziel, ein Schriftsteller der 20er-Jahre zu werden, reist der Erzähler dieses Buches 1974 nach Paris. Anstatt dort aber zu schreiben, betätigt er sich zunächst als Drogendealer auf schlecht beleuchteten Straßen und besucht billige Partys, bis er beginnt, an Türen und Nebenräumen Symbole und Signale zu erkennen. Diese verbinden nicht nur weitere Orte miteinander - Paris, Montevideo, Reykjavík, Bogotá, St. Gallen -, sondern führen ihn auch zum Wesen seines Schreibens sowie seinem Wunsch nahe, Erfahrungen in lebendige Seiten zu verwandeln. - Und wenn das Leben das ist, was uns passiert, weil wir Literatur haben? "Montevideo" ist eine wahre Fiktion, eine großartige literarische Erzählung über die Mehrdeutigkeit und das Spiegelkabinett unserer Welt. Vila-Matas findet hier einen Weg, über Dinge noch einmal ganz neu zu schreiben, über die bereits alles gesagt schien - über den zentralen Kern seines Werks, über die Modernität des Romans. Über Autofiktion, die es gar nicht gibt: "da alles autofiktional ist, denn was man schreibt, kommt immer von einem selbst".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Vila-Matas
Montevideo
Roman
Aus dem Spanischen
von Petra Strien-Bourmer
Wallstein Verlag
für Paula de Parma, es bebt mein verliebtes Herz
Inhalt
Umschlag
Title
Montevideo
Impressum
PARIS
1
Im Februar 74 reiste ich nach Paris in der anachronistischen Absicht, ein Schriftsteller der 20er-Jahre zu werden, Typ »verlorene Generation«. Mit diesem, sagen wir mal, eigenwilligen Ziel brach ich auf, und als ich anfing, die Stadt zu erkunden, entging mir trotz meiner jungen Jahre nicht, dass Paris noch völlig selbstvergessen seinen letzten Revolutionen nachhing, so dass mich eine ungeheure Trägheit, eine immense Lethargie befiel beim bloßen Gedanken, ich sollte dort zum Schriftsteller werden und obendrein ein Löwenjäger à la Hemingway.
Zum Teufel mit allem, konkret mit meinen Ambitionen, sagte ich mir eines Abends unterwegs auf dem Pont Neuf. Ich muss etwas tun, um diesem Schicksal zu entgehen, dachte ich an dem Tag alle zwei Minuten, ohne zur Ruhe zu kommen. Schließlich landete ich auf einer schlecht beleuchteten Straße, wo ich ein Leben als Krimineller startete, was mich gewissermaßen in ein pubertäres Lebensgefühl zurückkatapultierte, das ich überwunden geglaubt hatte: die klassische Stimmungslage des verzweifelten Jugendlichen, der in der »Unbehaustheit seiner Seele« und dem Wort »Einsamkeit« zwei Achsen sieht, um die sich große Dichtung drehen sollte, die er aber, da zu sehr mit den krummen Geschäften rund um Drogen beschäftigt, nie schreiben wird.
Jedenfalls war ich in Paris nicht so hirnrissig, mich von der absoluten Leere täuschen zu lassen, denn das ging mir schon seit frühster Jugend gegen den Strich, und so ließ ich mich lediglich von einer kontrollierten Sinnlosigkeit, an der Grenze zum Fiktiven, fesseln, indem ich mich darauf beschränkte, mich ausschließlich der gründlichen Erkundung des proletarischen Paris zu widmen, des brutalen Paris, aber auch des genialen Paris, das Luc Sante in The Other Paris beschreibt (Viertel voller Flaneure, Ganoven, Chanson-Stars, Clochards, mutigen Revolutionären und Straßenkünstlern), das Paris der Ausgegrenzten, der antifranquistischen Exilspanier mit ihrem gut organisierten Drogen-Verkaufsnetz, das Paris der Gescheiterten, das Paris des großen gesellschaftlichen Taumels.
Ein Paris, das viele Jahre später zur Kulisse meiner Chronik jener Lebensphase werden sollte, in der ich mich dem Dealen mit Haschisch, Marihuana und Kokain verschrieben hatte und mich unmöglich auch nur eine Minute dem Schreiben widmen konnte, wobei noch mein plötzliches Desinteresse an Kultur allgemein beitrug; ein Desinteresse, das mich auf lange Sicht nicht nur teuer zu stehen kommen sollte, sondern sich selbst noch im Titel meiner Chronik jener unrühmlichen Tage widerspiegelt: Eine eigene Garage.
Für mich war das Paris jener ersten zwei Jahre meines Aufenthalts dort lediglich ein Ort, an dem ich mich ausschließlich als Drogenverkäufer betätigte und während einer kurzen Phase von drei Monaten, die wie im Flug vergingen, abhängig von Lysergsäure (LSD) war, was mir die Erkenntnis bescherte, dass, was wir »Realität« nennen, keine exakte Wissenschaft ist, sondern vielmehr ein Pakt zwischen vielen Leuten, vielen Verschworenen, die eines Tages zum Beispiel in deiner Heimatstadt beschließen, die Avenida Diagonal sei eine Promenade mit Bäumen, während du in Wirklichkeit, wenn du LSD nimmst, einen von wilden Tieren und Papageien bevölkerten Zoo sehen kannst, alle völlig frei lebend, manche auch hoch oben auf den Bäumen.
Mein Leben in diesen zwei Jahren meines ersten Parisaufenthalts konzentrierte sich auf ein begrenztes Revier, in dem kleinkriminelle Dealer vorherrschten und hin und wieder eine Party mit heruntergekommenen Spaniern stattfand, billige Partys, aber mit reichlich Rotwein, von denen ich nur behalten habe, dass ich mir angewöhnt hatte, mich ausnahmslos von allen Pseudofreunden oder Bekannten mit den Worten zu verabschieden:
»Wisst ihr schon, dass ich aufgehört habe zu schreiben?«
Und fast immer beeilte sich einer von ihnen, mich umgehend zu korrigieren:
»Aber du schreibst doch gar nicht!«
Und tatsächlich, ich schrieb nicht, besser gesagt, ich hatte seit den Tagen der Veröffentlichung meines ersten und einzigen Buchs nicht mehr geschrieben, einer Stilübung, die ich in Militäreinheiten der nordafrikanischen Stadt Melilla unter dem Titel Nepal fertiggestellt hatte, worin es unterschwellig um die Zerstörung der bürgerlichen Familie ging und darum – gesegnete Unschuld, noch hatte ich keinen Fuß nach Paris mit seinen schlecht beleuchteten Straßen gesetzt –, dass ich mir vornahm, mein Leben lang mir selbst absolut treu zu bleiben, das heißt verliebt in die gesunden Hippie-Tendenzen, die es mir dermaßen angetan hatten, bis ein paar gnadenlose, libertäre und pazifistische Kulturgegner mich dazu brachten, bei einer Rübenernte mitzuhelfen, und sich schlagartig alles änderte.
In Paris wusste niemand – warum auch? –, dass ich nach meiner Rückkehr aus Afrika ein Buch geschrieben und publiziert hatte, einen kleinen Roman, vorgeblich in Kathmandu geschrieben und in einer derart experimentellen Prosa gehalten, dass meine Kritik an der bourgeoisen Familie unbemerkt blieb. Von jenen Tagen, die ich in Melilla verbracht und mich wie Gary Cooper in von Sternbergs Marokko (Herzen in Flammen) gefühlt hatte (obwohl mir alles dazu fehlte, nicht zuletzt Marlene Dietrich), hatte niemand auch nur die leiseste Ahnung, was mir unter anderem die Gelegenheit bot auszuprobieren, ein anderer zu sein, mir eine neue Identität zu erfinden, obwohl ich am Ende immer einsehen musste, dass ich, auch wenn ich viele Personen und an vielen verschiedenen Orten geboren sein wollte, es keinen Tag gab, an dem ich nicht irgendwann merkte, dass wir zu sehr wir selbst sind und Gefahr laufen, es letztlich auch zu bleiben.
2
In Paris war es ungewöhnlich, nicht zu schreiben, um das hier einmal klarzustellen. Cioran beschrieb dieses Phänomen, als er notierte, was ihm eines Tages die Concierge seines Wohnhauses gesagt hatte: »Die Franzosen wollen nicht arbeiten, sie wollen alle schreiben.«
»Aber du schreibst doch gar nicht!«, korrigierte man mich immer, wenn ich die Party mit einer explosiven Ladung Wein und Haschisch intus verließ. Gleichwohl verabschiedete ich mich einige Tage später wieder auf die gleiche Art; es amüsierte mich zu verkünden, ich hätte aufgehört zu schreiben, um dieses großartige »Aber du schreibst doch gar nicht!« zu vernehmen, wobei ich mir angewöhnte, so zu tun, als hörte ich es nicht, auch weil ich so die nächsten Male leichter wieder meinen Spruch zum Abschied aufsagen konnte.
Heute glaube ich zu verstehen, dass ich schon lange bevor ich schrieb – oder bevor ich Nepal schrieb, was in dem Fall auf dasselbe hinauslief, denn das war kein wirkliches Schreiben, nicht mal eine Stilübung –, auf eine nahezu unwiderstehliche Weise das Schreiben hinter mir lassen wollte und dass ich gut daran getan habe, dies nie aus dem Blick zu verlieren. Tatsächlich war es diese Poetik, die darin bestand, das Werk aufzugeben, bevor es überhaupt existierte, die dazu führte, dass ich ein Experte darin wurde, im Kreis der fünf erzählerischen Tendenzen von einem Extrem ins andere zu pendeln, wobei ich immer meinte oder ahnte, dass es eigentlich sechs Tendenzen geben müsste, obwohl ich auf die sechste bis heute nicht komme.
Eine Zeit lang reiste ich wie ein Verrückter durch diesen Kreis der fünf erzählerischen Tendenzen, obwohl ich nie die vierte Position aufsuchte, die Gott und Kafkas Onkel vorbehalten blieb, besser bekannt als »Onkel aus Madrid«, ein beeindruckendes Paar, obwohl man nie weiß, wo sie erscheinen.
Stürmische Reisen durch vier der fünf Positionen. Denn anfangs befand ich mich in Barcelona, als ich noch sehr jung war, einer derer, »die nichts zu erzählen haben« (erste Tendenz) und folglich nur Kieselsteine durch die Straßen ihrer eigenen endlosen Langeweile kicken. Später sprang ich über zur zweiten Tendenz und entwickelte mich zu einem Experten im Verschweigen gewisser Aspekte der Geschichten, die ich erzählte, eine Strategie, die ich mir so weit zunutze machte, bis ich virtuos das Schreiben von Erzählungen beherrschte, in denen bewusst nichts erzählt wird. Diese Phase ebnete mir den Weg zur dritten Tendenz, wo sich schon mehr Menschen tummeln, vorherrschend solche, die hier und da in der Geschichte, die sie erzählen, ein loses Ende lassen in der Hoffnung, Gott oder statt seiner Kafkas Onkel würde sie eines Tages ergänzen, die einzigen Herren und Meister der vierten Tendenz, legendäre Größen – mehr der erste als der zweite –, von denen es immer hieß, sie seien allzeit befähigt, etwas Vernünftiges zu sagen, doch am Ende äußern sie sich nie, als wären sie jeglicher Art von Beredsamkeit abhold. Was künftige aktive Hacker betrifft, bleibt zu hoffen, dass sie mit der Zeit lernen zu arbeiten, als gehörten sie dem nordamerikanischen Spionagesystem an, einem System, das seinerseits, so seltsam es scheinen mag, einiges gemein hat mit den Junggesellenmaschinen (Machines célibataires), die der geniale Raymond Roussel zum Schreiben seines Œuvres benutzte.
Diese Erfindung des Autors von Eindrücke aus Afrika – Genie, das seiner Zeit voraus war, und Pionier der digitalen Ära – spie unermüdlich Sprache aus, indem sie mit einer erstaunlichen Kreativität endlos Geschriebenes auswarf und sicherstellte, dass die »Textmaschine« nie verstummte.
Kurzum, ich pendelte von einer Seite zur anderen, wobei ich manche Tendenzen besser kennenlernte als andere, doch mit der Zeit gewann ich in allen eine gewisse Erfahrung, außer in denen der Feinde der Beredsamkeit, eine Position, die ich, wenn ich mich nicht irre – denn in Montevideo hatte ich die Befürchtung, mich ein paar Schritte zu weit in die Dunkelheit vorgewagt zu haben –, nie betreten habe.
Hier eine Auflistung der fünf Tendenzen:
1)
die derer, die nichts zu erzählen haben.
2)
die derer, die bewusst nichts erzählen.
3)
die derer, die alles erzählen.
4)
die derer, die hoffen, dass Gott eines Tages alles erzählt, einschließlich dessen, warum alles so unvollkommen ist.
5)
die derer, die sich der Macht der Technologie ergeben haben, die alles zu transkribieren und zu registrieren scheint und so das Metier des Schriftstellers entbehrlich macht.
Die erste Position, die einzige, die ich im Paris der 70er-Jahre durchschritten habe, hat mich am Ende immer in eine graue Landschaft des Nachkriegs-Barcelona zurückversetzt, mit einer einsamen Gestalt im Zentrum der Szenerie, mitten auf dem Paseo Sant Joan, ein magerer, schrecklich langweiliger Schuljunge, kurzum, ich selbst. Eine einsame Gestalt, die ich heute mit einer Bemerkung von Ricardo Piglia über seine Jugend und die ersten Jahre seines Tagebuchs assoziiere (»Denn dort kämpfe ich gegen die totale Leere an, eigentlich passiert nie was. Was sollte auch passieren?«) und auch mit dem Tagebuch von Paco Monteras, dem einzigen Schulkameraden, dem es gelungen war, so zu tun, als hätte er Spaß, und der mir Jahrzehnte später seine Seiten zu lesen gab, nicht ohne mich zu warnen, sie seien »schrecklich langweilig«, so ocker, sagte er mit besonderer Betonung auf »ocker« (was ich noch nie gehört hatte), dass die dort aufgeführten Details lediglich Einblick in das Wetter der minutiös analysierten Tage böten.
3
Eine weiträumige Zone des Montparnasse, aber speziell die sehr kurze Rue Delambre, wo unter anderem Gauguin, Breton, Duchamp gelebt haben, bildete in meinen zwei Pariser Jahren den Schwerpunkt meiner pseudokommerziellen Aktivitäten: bescheidene, aber mühselige Drogenverkäufe auf der Straße, Exklusivverkäufe an bestimmte Kunden, die von der Rosebud-Bar kamen oder vom Hotel Delambre. Die Straße des Hungers nannte ich sie, und manchmal empfand ich sogar Genugtuung, den passenden Namen für diese Zone gefunden zu haben, wo ich egal was verkaufte, um essen – besser gesagt, um überleben – zu können, wohl wissend, dass, wie ein spanischer Kollege sagte, der genauso arm dran war wie ich, dass dem einfachen Soldaten auf dem Schlachtfeld nichts bleibt als das Überleben.
Das Rosebud war eine Bar und zugleich der Jazzkeller in Paris, der in jenen Tagen als letzter schloss. Eines Tages werde ich ins Rosebud zurückkehren, aber als Gast, sagte ich mir manchmal, immer bemüht, nicht den Mut zu verlieren. Erschwingliche Preise für die professionellen Nachtschwärmer und gern frequentiert von den amerikanischsten Amerikanern – übersetzt, wenn man so will, die eifrigsten Hemingwayaner – der Stadt. Noch heute ist das Rosebud täglich geöffnet und hat sich kaum verändert, wie ich neulich noch feststellen konnte, nur dass es jetzt früher schließt und man zum Rauchen auf die Straße gehen muss. Auch die Cocktails sind dort noch die gleichen wie früher und klingen wie aus einer anderen Zeit. Tatsächlich wären es heutzutage geradezu archaische Namen (Sidecar, Sling …), hätte Don Draper sie nicht in Mad Men wieder in Mode gebracht.
4
Ich musste lachen beim Gedanken, dass ich nach Paris gegangen war, um mich in einen Nordamerikaner von früher zu verwandeln, und am Ende den damaligen Nordamerikanern dort Drogen verkauft hatte.
Das geschah ganz in der Nähe des Rosebud, in der Nummer 25 ebendieser Straße des Hungers, in der legendären Dingo American Bar, wo sich heute die Pizzeria Auberge de Venise befindet. Es war ein Abend, an dem ich mehr Mühe hatte als sonst, meine Ware für diesen Tag loszuwerden. Und dabei lernte ich einen militanten Verfechter der vierten Position kennen (Typ Gott, nur dem Anschein nach ohne dessen angeblich unanfechtbare Position), einen Erzähler mit dem Anspruch, der vierten Tendenz anzugehören, aber mit irrigen göttlichen Allüren. Für den Fall, dass sich ein Polizeispitzel in der Nähe herumtrieb, guckte ich gerade in den Himmel und tat so, als führte ich nichts Unrechtes im Schilde, da trat »der Allwissende« an mich heran, ein hochbetagter Mann mit Sonnenbrille, ein wenig absonderlich, da mitten im Winter rigoros weiß gekleidet, und wollte von mir wissen, ob ich mich am Himmel orientierte. Ich dachte, er sei ein V-Mann der Polizei oder dergleichen, doch meine Furcht erwies sich als völlig unbegründet.
»Junger Mann, Sie blicken nach oben und orientieren sich, wie ich sehe, aber Sie müssen wissen, dass ich es war, der den Himmel erschaffen hat«, sagte der Alte. Da er nicht betrunken war, musste er wohl ein komplett verrückter Uropa sein. Ich ging darauf ein und fragte ihn, ob er auch den Mond erschaffen habe. »Und die Sterne«, sagte er, »keiner ist mir fremd, und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen alles erzählen.«
»Alles?«
»Ja, die gesamte Schöpfungsgeschichte«, sagte er. »Hat Ihnen schon je einer in aller Vollständigkeit erklärt, wie die Erschaffung der Welt vonstattengegangen ist?«
Nichts, was mich hätte erstaunen können. Denn, wie viele hatte ich nicht schon gesehen – wohl wissend, dass sie nicht mal ein Tausendstel dessen ermessen konnten, was sich mindestens seit der Altsteinzeit auf der Welt getan hatte –, die unter jeglichem Vorwand versuchten, mir alles zu erzählen? Aber bekanntlich wimmelt die Welt nur so von Menschen, die dem großen Ganzen nachjagen, manche von einer unschätzbaren Tugend und Tatkraft, wie Herman Melville, an den ich denke, wenn ich mich in der Welt der Erforscher des allumfassenden Ganzen umschaue. Ich fand immer, mit Moby Dick habe er eine unermessliche Metapher des Unermesslichen entworfen, der Unermesslichkeit unseres Im-Dunkeln-Tappens.
Auf dem riesigen Woodlawn-Friedhof in der Bronx fragten mein Freund Lake und ich einmal, als es schon dunkel wurde und wir immer noch nicht Herman Melvilles Grab gefunden hatten, bei der »Cemetery Police« (zwei Puerto Ricaner mit Pistolen fast wie aus einem Western, bewaffnete Gesetzeshüter im Streifenwagen) nach, wo wir dieses Grab finden könnten, und nachdem wir unseren riesigen Plan ausgebreitet hatten, dachten sie, vielleicht weil sie noch nie von Melville gehört hatten, wir suchten das Grab von Moby Dick und zeigten uns einen gigantischen, leicht verworrenen Fleck, einen grünen Punkt, auf dieser Karte, wo angeblich der berühmte Walfisch begraben lag.
Oh mein Gott, dachten wir, diese Polizisten glauben, wir suchten das monumentalste Grab am Ort, vielleicht zu dem Zweck ersonnen, die gesamte Welt aufzunehmen. Und beim Gedanken an die Erforscher des großen Ganzen kam mir an dem Tag Miklós Szentkuthy in den Sinn, noch einer, der vermutlich das Absolute begreifen wollte, dieser ungarische Genius, der sagte, er wolle sehen, lesen, denken, träumen, alles verschlingen, absolut alles. Und natürlich fiel mir auch der unersättliche Thomas Wolfe ein, der in seinem Verlangen, alle Geschichten der Welt zu erfassen, an der Flut von Material erstickte, das seiner Kontrolle zu entgleiten schien. Und dieses Verlangen, die Zeit zu beherrschen, zeigte sich bei Wolfe in seinem ersten bahnbrechenden Roman Schau heimwärts, Engel!, wo er etwas schreibt, was mir immer wieder überlegenswert erschien, vielleicht sogar der mögliche Dreh- und Angelpunkt meiner Poetik:
»Uns sprachlos erinnernd suchen wir die große, vergessene Sprache, den verlorenen Himmelspfad […] Die Summe dessen, was wir sind, hat keiner von uns je ermessen; man versetze uns zurück in Blöße und Nacht und wird vor vierzigtausend Jahren auf Kreta die Liebe keimen sehen, die gestern in Texas ihr Ende fand.«
5
Genau auf diesen Versuch, mich vierzigtausend Jahre zurückzuversetzen, konzentrierte ich mich gestern Abend, als ich mir fasziniert den Dokumentarfilm ansah, den Werner Herzog in der Chauvet-Höhle gedreht hat, dieser Grotte in der Ardèche im Süden Frankreichs: eine öffentlich nicht zugängliche Kathedrale der Altsteinzeit. Ich kann nicht leugnen, dass ich ihn mir voller Begeisterung angeschaut habe, denn nach meiner Rückkehr aus Melilla hatte ich mich lange der Erforschung der Steinzeit gewidmet und auch nach vielen Jahren mein Interesse an dieser Epoche nicht verloren, im Gegenteil, zahlreiche Erinnerungen an meine Beschäftigung mit dieser unerschöpflichen Materie hatten sich mir zutiefst eingeprägt. Darunter ein lange vor Herzogs Dokumentarfilm geschriebener Satz aus Die Tränen des Eros von Georges Bataille; ein Satz, den mir seinerzeit der Schriftsteller Juan Vico offenbarte: »Tatsache ist jedoch, dass diese düsteren Höhlen in erster Linie dem geweiht waren, was, in seiner reinsten Form, das Spiel ist – das Spiel als Gegenpol zur Arbeit, dessen Sinn primär im Verführen und Verführtwerden, in der Hingabe an die Leidenschaft liegt.«
Lediglich die Archäologen und die Paläontologen, die vor Ort arbeiteten, um die Funde zu dokumentieren, hatten Zutritt zu der Enklave von Chauvet, die Herzog mit einer für sich und eine reduzierte Filmcrew erwirkten Sondergenehmigung betreten durfte. Unter seinen Begleitern befand sich der Paläontologe Jean-Michel Geneste, den ich einmal die Ehre hatte persönlich kennenzulernen, und er war es auch, dessen erhellende Worte am Ende des Dokumentarfilms ich mir notiert habe. Ich habe sie mir notiert, weil ich das Gefühl hatte, zum ersten Mal in meinem Leben einen überzeugenden Hinweis auf das zu bekommen, wonach ich so lange schon gesucht hatte: »die große, vergessene Sprache, den verlorenen Himmelspfad«, von dem Wolfe und so viele andere geredet hatten.
Von diesem »verlorenen Himmelspfad« schien mir Geneste in aller Ausführlichkeit zu reden, als er gegen Ende des Dokumentarfilms erklärte, die Menschen von vor vierzigtausend Jahren, die Steinzeitmenschen, hätten wahrscheinlich zwei Grundkonzepte gehabt, die von unserer heutigen Wahrnehmung der Welt ziemlich abweichen: das Konzept des Fließenden und das des Durchlässigen. Das Fließende würde laut Geneste bedeuten, dass die Kategorien, die wir benutzen – Frau, Mann, Pferd, Baum, Tür – sich verändern, verwandeln können. So wie ein Baum das Wort ergreifen kann, kann ein Mensch sich unter gewissen Umständen in ein Tier verwandeln und umgekehrt.
Das Konzept des Durchlässigen wiederum entspricht der Vorstellung, dass es sozusagen keine Schranken gibt in der Welt der Geister. Ich weiß nicht recht, aber ich denke, diese zwei von dem Archäologen Geneste genannten Konzepte würden perfekt zu Italo Calvinos Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend passen, das für mich immer wie eine Bibel war. Es wäre toll gewesen zu sehen, wie die Sechs Vorschläge dank der Ergänzung durch diese zwei von Geneste genannten Konzepte auch noch eine alte, fließendere Wahrnehmung mit integriert hätten.
Eine Wand, sagt uns Geneste, kann zu uns sprechen, uns annehmen oder uns ablehnen. Ein Schamane etwa kann seinen Geist in eine übernatürliche Welt schicken oder von übernatürlichen Geistern besucht werden. Verbinden wir Fließendes mit Durchlässigem, begreifen wir, wie enorm sich das Leben damals von unserem heutigen unterschieden haben muss. Wir Menschen sind schon auf viele Arten definiert worden. Der Homo Sapiens ist eine davon, aber uns selbst so zu definieren ist lachhaft, vor allem weil es irgendwie selbstgefällig klingt, wo wir letztlich nicht einmal zu der Erkenntnis gelangen, dass wir wissen, dass wir lediglich wissen, dass wir nichts wissen. Homo Spiritualis hingegen wäre wohl eine korrektere Definition dessen, was wir sind. Oder gelingt es Werner Herzog in seinem Film über die französische Chauvet-Höhle etwa nicht, dass wir von ferne den Ursprung der Seele des modernen Menschen ausmachen? Gestern Abend ließ mich das Gefühl, ihn – diesen in der Chauvet-Höhle auf gewisse Weise so sichtbaren Ursprung – beinahe erahnt zu haben, den »verlorenen Himmelspfad« beschreiten, denselben, auf dem ich manchmal voranschreite oder glaube, voranzuschreiten, was dann geschieht, wenn ich mich von einer aufmunternden Stimme angespornt fühle, die mich buchstäblich dazu treibt, meine Seele zu suchen: »Na los, wir haben noch eine lange Strecke vor uns.«
6
An Thomas Wolfe, einem der Pioniere des letzten Jahrhunderts, die diesen »verlorenen Himmelspfad« ins Gespräch brachten, faszinierte mich sein Ehrgeiz, alles zu erfassen, sein unermüdliches Bestreben, selbst den letzten Ziegel, den letzten Pflasterstein aller und jeder einzelnen Straße, die er durchquert hatte, jedes Gesicht aus jeder noch so wirren Menge sämtlicher Städte, jede Straße, jedes Dorf, jedes Land, ja alle Bücher der Bibliothek, deren vollgepfropfte Regale er vergeblich versucht hatte, sich an der Universität einzuverleiben, in seinem Gedächtnis zu speichern.
Wer hatte etwas von einem mit gewissen göttlichen Gaben beseelten Romancier, wenn selbige denn einen Teil der Seele eines Erzählers ausmachen können. Das erste Mal, dass ich etwas Feindseliges gegenüber dieser Art von allumfassenden Autoren las – die engen und leicht verzweifelten Rivalen Gottes –, war auf einem Kolloquium, an dem Antonio Tabucchi teilnahm, den ich erst seit Kurzem wegen Die Frau von Porto Pim bewunderte, eines Buches im Grenzbereich, erschienen in Palermo und im Februar 1984 in Barcelona ins Spanische übersetzt, ein disparates und zugleich einheitliches Buch, das auf wenigen Seiten kurze Erzählungen, Erinnerungsfetzen, philosophische Tagebucheintragungen, persönliche Notizen, eine kurze Biographie von Antero de Quental versammelt und Bruchstücke einer zufällig auf Deck eines Schiffs aufgeschnappten Geschichte, erfundene Erinnerungen, Landkarten, Biographisches, abstruse Gesetzestexte, Liebeslieder: eine ganze Reihe von Bestandteilen, manche auf den ersten Blick im Widerstreit miteinander, vor allem aber im Widerstreit mit der Literatur, und doch durch einen festen literarischen Willen in reine Fiktion verwandelt.
Was mir an Die Frau von Porto Pim besonders gefiel, war die völlig ungewöhnliche Anordnung der Texte, ihre Struktur, die – zumindest aus meiner Sicht – so sehr der von Schlaflose Nächte ähnelt, einem anderen Buch im Grenzbereich mit einem weitgefassten Spektrum und nicht minder disparat und zugleich einheitlich, wo Elizabeth Hardwick in Form von Erinnerungsfetzen und persönlichen Notizen das Porträt einer selbst gemachten Literaturschaffenden mit einigen offensichtlichen Einflüssen zeichnet, doch im Grunde genommen einer einzigartigen Literaturschaffenden, stets ein wenig erschöpft wie eine Billie Holiday der Literatur, umgeben von Musikern, noch übermüdeter als sie, Sonnenbrillen, aschfahle Schlaflosigkeit, schwere Mäntel und die Musikerfrauen, alle so blond und so ermattet.
Es gibt Seiten von Hardwick, die ich am liebsten auswendig wüsste, wie etwa die, wo sie uns erzählt, im Gedanken an unglückliche Menschen, die sie kennengelernt habe, komme es ihr so vor, als ähnelte ihnen alles, was sie umgibt: Die Fenster klagten über ihre Gardinen; die Lampen über ihre Stoffschirme; die Tür über ihr Schloss; der Sarg über die Schmutzschicht, die ihn erdrückt.
An Die Frau von Porto Pim ist mir, neben anderen Dingen, besonders die poetische Leichtigkeit in Erinnerung geblieben, wenn es um schwierige, komplexe Fragen geht, so dass sie an Schwere verlieren. Es ist, als dächte Tabucchi, nur durch Leichtigkeit sei der wahre Charakter der Dinge zu vermitteln und alles Bleierne blende den Leser und halte ihn vom Lesen ab. In seinem Buch bietet Tabucchi uns, natürlich unausgesprochen, einen Moby Dick in Miniatur an.
Ich habe sein schmales, großartiges Reisebüchlein zu einer Zeit gelesen, als ich, nachdem bereits zehn Jahre seit meiner Rückkehr aus Paris verstrichen waren, soeben entdeckt hatte, dass meine besten Freunde in Barcelona längst ein gut situiertes Leben führten, während ich völlig in ihm verloren war. Und, wenn ich mich nicht irre, war es kurz nach meiner Lektüre von Die Frau von Porto Pim, als ich meinte, eine Art Erleuchtung zu erfahren, und – mit einer unglaublichen Freude und dem Gefühl einer immensen Erleichterung – am Ende beschloss, wieder mit dem Schreiben anzufangen, als könnte das mich vor was auch immer retten, mindestens aber vor dem abgrundtiefen Keller, in den ich mich dummer- und unnötigerweise gestürzt hatte.
Bemüht, nicht wie diese Typen zu enden, bei denen die Fenster über ihre Gardinen klagen, war es für mich ein Segen, dass ich in den Bericht einer spanischen Zeitung über ein Kolloquium vertieft war, an dem Tabucchi höchstpersönlich teilgenommen hatte. Es ging um ein Treffen verschiedener italienischer Erzähler in Rom. Dort hatte Tabucchi auf einmal gesagt, der Romancier des 19. Jahrhunderts ähnle zu sehr Gott (der bei allem präsent war, alles sah und Alles war), und dann sagte er noch, das verweise ihn auf etwas stark Verstaubtes längst vergangener Zeiten. Und als solches sei es unbedingt einzustampfen, schloss leichthin ein vergnügter Tabucchi.
Zwei Tage lang konnte ich gar nicht mehr aufhören zu lachen, denn diese Schlussfolgerung ging mir nicht aus dem Kopf, besser gesagt, dieses unerwartete Verb zum Schluss: einstampfen.
Als ich Wochen später aus reiner Neugier nach Italien reiste, um mir Vecchiano anzusehen und ein paar Tage in dem fröhlichen Albergo del Sole auf der Piazza della Rotonda, am Pantheon, in Rom zu verbringen, las ich in einer Zeitung, die ich an der Rezeption des Albergo gefunden hatte, mitten in einem Artikel über Fußball einen Satz von Voltaire, der mich überraschte, vielleicht einfach weil ich ihn im Sportteil nicht erwartet hatte:
»Das Geheimnis der Langeweile ist, alles sagen zu wollen.«
Das gab mir zu denken. Die Fußballspiele beispielsweise sagen alles und sind trotzdem sehr oft alles andere als langweilig. Wurden die Verlängerungen für die Partien erdacht, die keine Lösung für den bisherigen Spielverlauf finden?
»Das Geheimnis der Langeweile ist, alles sagen zu wollen«, sagte Voltaire. Allerdings scheint der junge Kafka anderer Meinung gewesen zu sein, als er in einem seiner frühen Texte, Beschreibung eines Kampfes, verlangte, dass ihm alles, absolut alles erzählt werde: »Und nun schrie ich: ›Los mit den Geschichten! Ich will nichts mehr in Brocken hören. Erzählen Sie mir alles, von Anfang bis zu Ende. Weniger höre ich nicht an, das sage ich Ihnen. Aber auf das Ganze brenne ich.‹«
7
Die Bemerkung, das Geheimnis der Langeweile sei, alles sagen zu wollen, war für mich immer eine willkommene Form, mit einem einzigen Federstrich dem Erzähler des neunzehnten Jahrhunderts und seiner erdrückenden Version von Allwissenheit den Garaus zu machen. Doch dann erkannte ich eines Tages, dass es eine Art von allwissenden Erzählern gibt, die absolut nichts Penetrantes haben, im Gegenteil. Herman Melville, der Autor von Moby Dick, zum Beispiel. Ich machte mir eine Notiz in ein Heft, hochzufrieden, weil ich mit meiner absurden, jahrzehntelangen Routine abgeschlossen hatte, systematisch und ohne Unterschied gegen den Erzählertyp des neunzehnten Jahrhunderts zu wettern, eine Manie, der ich, wie ich zwar spät, aber nicht zu spät erkannte, schleunigst ein Ende setzen musste.
Mir diesen routinemäßigen Spruch über die Erzähler des neunzehnten Jahrhunderts abzugewöhnen, eröffnete mir Horizonte und brachte mich in den Genuss der Kunst, zwischen zwei Extremen zu pendeln, wie ein Schiff auf hoher See schwankt, und hier und da den wunderbaren Kontrast, etwa zwischen dem extrem Verwinzigten in Tabucchis Frau von Porto Pim und dem Riesenhaften in Moby Dick abzugleichen, wo alles monumental ist, nicht zuletzt die Wale. Und der unbestreitbar und auf bestrickende Weise mit Herman Melvilles ungeheurem enzyklopädischen Wissensdrang brilliert, etwa wenn wir in seinem Buch erfahren, dass die weltbesten Walfischfänger von der imposanten Azoreninsel Pico zu stammen pflegten.
Monate nach meinem Abstecher nach Vecchiano und Rom lernte ich Tabucchi auf einer Feier in Barcelona im Hotel Colón neben der Kathedrale persönlich kennen. Ich wollte ihm gerade erzählen, dass ich seine Geburtsstadt Vecchiano besucht hatte, doch, ohne mich auch nur anzusehen, schlug er mir vor, ihm an die Bartheke am anderen Ende des Saals zu folgen. Eine goldene Theke, zu der man sich durch eine dichte Menschenmenge drängeln musste. Ich schloss mich Tabucchi an, der sich mit erstaunlichem Geschick wie mit einer Machete den Weg durch diesen Urwald trinkender Gäste bahnte.
Und irgendwann auf dieser beschwerlichen Strecke zum anderen Ende des Saals fragte er mich in einer Mischung aus Italienisch und Portugiesisch:
»Amigo, perché verfolgen Sie mich?«
Ich begriff sofort den Grund dieser Frage: Natürlich wusste er, dass ich in einem meiner Zeitungsartikel seine Beschreibung von Peter’s Bar in Teilen wortwörtlich abgeschrieben hatte, ein berüchtigtes Lokal auf den Azoren, das ich zwar sehr bald selbst kennenlernen sollte, aber bereits zuvor dank Die Frau von Porto Pim hatte so beschreiben können, als verkehrte ich dort schon mein Leben lang.
Während wir an dem Tag auf dem Weg zur nächstgelegenen Bartheke den Saal wie einen Urwald durchquerten, tat ich so, als hätte ich seine Anspielung (quasi seine Visitenkarte) nicht verstanden, und erzählte ihm, dass ich in Paris das Schreiben aufgegeben, aber später, zurück in Barcelona, wieder unbesonnen und wie wild angefangen hätte, Geschichten zu schreiben, so sehr, dass mein Leben in der Gosse gelandet sei.
Sie wollen mir wohl sagen, Sie haben das Leben in Literatur verwandelt, sagte Tabucchi, weil Sie denken, allein die Tatsache, dass Sie mir erzählen, Sie hätten in Paris mit dem Schreiben aufgehört, sei schon Literatur, und diesem Gesetz können wir uns nicht entziehen, weder Sie noch ich, nicht wahr?
8
Der Typ, von dem ich jetzt erzählen möchte, wirkt wie einer Weihnachtsgeschichte entsprungen, aber er ist auch eine sehr reale Person, ein Clochard, der sich gegen Ende des letzten Jahrhunderts jeden Tag vor der Tür einer Pariser Buchhandlung auf dem Boulevard Saint-Germain gegenüber von einem historischen Zeitungskiosk niederließ. Die Buchhandlung gibt es nicht mehr, von dem Clochard habe ich seit Jahren nichts mehr gehört, nur der Zeitungskiosk steht noch dort.
Der Mann, der sich auf dem Erdboden niederließ – der Erdboden ist noch da; ihm schenke ich einen kurzen Blick, sooft ich in Paris bin –, war einer der kultiviertesten, die ich je kennengelernt habe, nicht nur wegen seiner gepflegten Umgangsformen, nicht nur, weil er den Passanten, die vor dem Kiosk stehen blieben oder die Buchhandlung betraten, einen guten Tag wünschte, sondern weil er die Klassiker las, dort auf den Pappkartons, die er fein säuberlich auf dem Boden ausgebreitet hatte, um hin und wieder dem üblichen weltlichen Treiben zuzusehen. Gelegentlich habe ich beobachtet, wie er plötzlich in Che-Guevara-Manier aufstand, um auf fast arrogante Weise, den Blick in die Ferne gerichtet, eine riesige Havanna zu rauchen, zur Verwunderung von mehr als einem Passanten.
Wenngleich ich ihn schon einige Male während meines ersten Parisaufenthalts als Mieter eines Garagenabschnitts im Norden von Paris gesehen hatte, begegnete ich ihm auch weiterhin, wenn ich hin und wieder zu den verschiedensten Anlässen nach Paris zurückkehrte. Doch wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass mir der Autor Antonio Tabucchi eines Tages in Florenz von diesem Havannas rauchenden Clochard erzählen würde.
Wir saßen auf der sommerlichen Terrasse eines Cafés am Arno, als mir Tabucchi erzählte, er habe sogar einmal mit diesem allseits beliebten Clochard auf dem Boulevard SaintGermain gesprochen. Die Szene, die er mir dann schilderte, ereignete sich eines Nachmittags in Paris bei starkem Schneefall, als Tabucchi sich allein in der Stadt aufhielt und, da er sich in seinem kleinen Apartment in der Rue de l’Université deprimiert fühlte, beschloss, eine Runde durchs Viertel zu drehen, wo er niemandem begegnete, bis er auf seinen Freund, den Clochard, stieß, dem er von seiner absoluten Unrast hinsichtlich des Lebens und der Ungemütlichkeit dieses Wintertages berichtete.
Als Antwort lud der Mann ihn lediglich ein, sich neben ihm auf den Pappkartons niederzulassen, die auf dem Bürgersteig ausgebreitet waren, und die Welt von dieser schlichten Position vom Boden aus zu betrachten. Tabucchi zögerte nicht, der Aufforderung zu folgen, und so saßen sie lange Zeit schweigend dort vor dem Eingang der Buchhandlung und blickten von unten auf die eiligen, bisweilen verirrten, aber immer teilnahmslosen Schritte der winterlichen Passanten, bis der Clochard das Schweigen brach, um Tabucchi etwas zu sagen, was ihm auf ewig im Gedächtnis haften blieb.
»Sehen Sie, mein Freund? Von hier aus kann man es gut sehen. Die Menschen hasten vorbei und sind nicht glücklich.«
Wieder zurück aus Florenz, fiel mir im Gedanken an diesen Satz des Clochards, dessen Namen ich nie erfuhr, ein, was Augusto Monterroso und Bárbara Jacobs im Vorwort ihrer 1992 zusammengestellten Anthologie trauriger Erzählungen, Antología del Cuento Triste, behaupteten: »Wenn es stimmt, dass sich in einer guten Geschichte das ganze Leben konzentriert und dass, wie wir glauben, das Leben traurig ist, wird eine gute Geschichte immer traurig sein.«
In diesem Vorwort hieß es natürlich auch, der fröhliche Teil des Lebens basiere manchmal auch auf dem traurigen Teil und umgekehrt, was mich oft hat denken lassen, dieser Pariser Clochard habe auch etwas von einem glücklichen Tier, konkret etwas von diesen glücklichen Walen, die in einer Erzählung von Die Frau von Porto Pim die Menschen beobachten und sie beschreiben: In dieser Erzählung meinen die Walfische mit tragischer Rührung, die Menschen, die sich ihnen näherten, »werden schnell müde, und wenn es Abend wird, strecken sie sich auf der kleinen Insel aus, die sie trägt, und vielleicht schlafen sie ein oder betrachten den Mond. Sie gleiten lautlos davon, und man versteht, dass sie traurig sind.«
Manchmal sind die Kurzgeschichten (was bei Tabucchi leicht zu erkennen ist) Projektionsflächen des Lebens mit einer seltsamen Realitätsverbundenheit, vor allem wenn sie von glücklichen Personen oder Walen erzählt werden, die die Traurigkeit zum Leben wie zum Sterben brauchen: »Mich sterben sehen inmitten trauriger Erinnerungen«, heißt es bei Garcilaso de la Vega.
9
Ein Blitz zuckt in Barcelona nieder, und sogleich versetzt mich die Erinnerung vor das Théâtre Marigny an den Champs-Élysées.
Als ich in jenes Paris der Drogen und meines Verzichts aufs Schreiben nach annähernd fünfzehn Jahren zurückkehrte, erkannte ich, dass ich mich in dem Moment mit der Stadt versöhnt hatte, in dem ich – nie hätte ich gedacht, dass mir dergleichen geschehen könnte – inmitten eines elektrisch aufgeladenen Gewittersturms Gott dankte, noch am Leben zu sein. Es war ein apokalyptischer Augenblick dort unter dem Vordach des Théâtre Marigny. Das Vordach war mein Regenschirm und wurde mir plötzlich auch zum Horror, als ich begriff, dass ich an einem Ort Schutz gesucht hatte, wo der Tod ein gut fundiertes Prestige besaß.
Ich kann mich noch so genau an diese Momente der Panik erinnern, dass ich es wohl besser so schildern sollte, als geschähe es jetzt in diesem Augenblick; letztlich sind es Momente, die mich immer begleiten.
Bevor ich mich angesichts des drohenden Regengusses in den Eingang des Marigny geflüchtet habe, bin ich ganz euphorisch die Champs-Élysées hinuntergeeilt in der Annahme, die Freude, die mich an dem Tag begleitete, sei nicht zu bremsen. Und das tatsächlich aus gutem Grund, denn endlich habe ich eine französische Übersetzung des Tristram Shandy von Laurence Sterne in der Tasche, ein Buch wie ein guter Geist, das sich für mich nach zahlreichen Bewährungsproben als mein Glücksbringer erwiesen hat. Unabhängig davon, dass es ein unendlich amüsantes Buch ist, hat es mir immer eine außerordentlich spirituelle Kraft verliehen. Das ist der Grund, warum ich trotz des harten Tages und eines bedrohlichen Unwetters, das über Paris heraufzieht, mit einem euphorischen Glücksgefühl die Champs-Élysées entlanglaufe.
Plötzlich halte ich inne, als mir einfällt, dass man der Glückseligkeit besser nicht trauen sollte und es klüger ist, sie flüchtig sein zu lassen und sie nicht zu sehr umklammern zu wollen. Also dämpfe ich selbst die Wucht meiner Freude und stelle mir vor, wie sich langsam mein Gesicht verfinstert, während ich noch beflügelter weitergehe: ein Spiel, dem ein weiteres folgt und noch eins, bis ich angesichts des drohenden, heftig aufgeladenen Gewitters wieder Vernunft annehme und endlich einsehe, dass ich mich vor dem Regen in Sicherheit bringen muss. Die finde ich unter dem herrlichen Vordach des Marigny, bis mir der größte Schreck des Jahres in die Glieder fährt, als ich begreife, dass ich mich ausgerechnet an den Ort geflüchtet habe, an dem Ödön von Horváth in einer tragischen Nacht ewig auf den Filmregisseur Robert Siodmak gewartet und, als er sah, dass dieser nicht kommen würde, beschlossen hatte, den Rückzug anzutreten, wobei ihm ein Ast auf den Kopf fiel, der sich exakt vier Schritte von diesem Vordach entfernt von einem voll vom Blitz getroffenen Kastanienbaum gelöst hatte.
Ich sehe mir den Baum direkt vor mir an und stelle noch entsetzter, soweit möglich, fest, dass es sich tatsächlich um eine Kastanie handelt, woraufhin ich in der Tasche nach meinem Glücksbringer taste und mich mit dem Gedanken an die unglaubliche Geschichte des armen Horváth abzulenken versuche, der einmal bei einer Alpenüberquerung auf einen Mann gestoßen war, der schon offensichtlich vor Monaten gestorben sein musste, denn von der Leiche war nur noch das Skelett übrig, obwohl neben ihm eine noch vollkommen intakte Tasche lag sowie eine Postkarte, die der Tote geschrieben hatte und auf der zu lesen stand: »Ich verbringe eine herrliche Zeit.« Als seine Freunde Horváth fragten, was er mit der Karte gemacht habe, sagte er: »Ich habe das nächstliegende Postamt aufgesucht und sie abgeschickt. Was hätte ich sonst tun sollen?«
Es wäre gar nicht so schlecht, mitten auf den Champs-Élysées zu sterben, sage ich mir, vom Blitz getroffen, das wäre ein hübscher Abschluss meiner Shandy-Biographie, aber Tatsache ist auch, dass ich nichts überstürzen sollte, noch kann meine Stunde nicht geschlagen haben. Also richte ich meine Gedanken auf den jungen Ernst Jünger, als er sich in Bapaume direkt an der Front zwischen einer Schlacht und der nächsten mit Shandy-Freude der Lektüre des Tristram widmete, für ihn ein Quell der Ablenkung und Energie inmitten des desaströsen Kriegsgeschehens.
In dem Fall, der uns beschäftigt, war es zwar kein Ast einer Kastanie, sondern eine Kugel, die den jungen Ernst Jünger traf, obwohl es in seinem Fall nicht gravierend oder gar tödlich war und er in einem Feldlazarett erwachte, wo er den Faden seiner Tristram-Lektüre wieder aufnahm, da das Buch noch in seiner Kartentasche steckte, mehr noch, dort hatte es praktischerweise die Kugel abgefangen, die versucht hatte, ihn zu töten. Für ihn war es, als wäre alles Dazwischenliegende (der Schuss mitten im Kampf, die Verletzung, das Feldlazarett, die Krankenschwester, das Wiedererwachen in der Realität und in diese Marswelt hinein), wie er später erzählte, nur ein Traum gewesen oder gehörte zum Inhalt des Buches selbst, als eine Einschaltung besonderer geistiger Kraft.
Ich verharre immer noch unter dem Vordach in der Gewissheit, dass, mich darunter hervorzuwagen, mich das Leben kosten könnte, und widme mich mehr denn je dem fesselnden Kult des Shandyismus, meinem Talisman. Kein Zweifel, dass dieser Kult von weither kommt, sage ich mir, und dass er es verdient hat, in diesem Versuch einer »Biographie meines Stils« aufgenommen zu werden, von der ich glaube, dass ich soeben anfange, sie zu schreiben.
Ein Blitz zuckt nieder.
Und das tut er so, als wollte er mir zu verstehen geben, dass ich keineswegs dabei bin, eine »Biographie meines Stils« zu schreiben, allenfalls eine unzeitgemäße Prosa





























