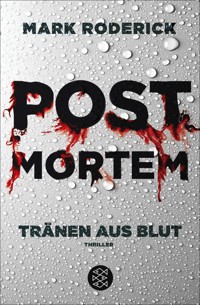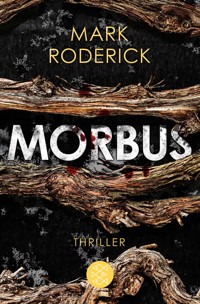
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Er ist böse. Er tötet. Er sucht Erlösung. Der erste Standalone von Bestseller-Autor Mark Roderick – knallharte Spannung vor idyllischer Kulisse. Die Dinge liefen immer mehr aus dem Ruder. Eine spurlos verschwundene Schülerin. Ein fünfzig Jahre altes Skelett im Keller. Und jetzt der Mord an ihrer besten Freundin Sabine. Es gab keinen Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen … Nur ihren Umzug auf den alten Gutshof. Als würden erst durch sie die toten Seelen in diesem Haus hervorgelockt. Das alte, idyllisch gelegene Gutshaus in den Weinbergen strahlt Behaglichkeit aus, im Dorf geht es noch familiär zu. Für die Journalistin Mara Flemming genau der richtige Ort, um ihrem alten Leben in der Großstadt zu entfliehen. Doch warum sprechen die Einwohner immer vom "Unglückshaus"? Und was geschah mit den beiden Mädchen, die dort vor einigen Jahren spurlos verschwanden? Zunehmend beschleicht Mara das Gefühl, dass da noch jemand im Haus ist. Dass jemand sie beobachtet. Auf sie wartet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Ähnliche
MARKRODERICK
MORBUS
THRILLER
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Während sein Blick langsam über den Bahnsteig von Kaiserslautern wanderte, beschlich Ottfried Gollinger ein ungutes Gefühl. Besser gesagt, eine Vorahnung – das sichere Gespür dafür, dass etwas Schreckliches passieren würde.
Ottfried war kein Hellseher. Er hatte keine Visionen, keine metaphysische Begabung, keine unerklärliche, spirituelle Wahrnehmungskraft oder etwas in der Art. Simple Statistik nährte seine düsteren Gedanken.
Es war der 26. Dezember 1958. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Wer unglücklich war oder zu Depressionen neigte, war über die Feiertage besonders anfällig, das galt doppelt für Alleinstehende. Bei geschiedenen, verwitweten oder anderweitig verlassenen Menschen schien sich die Einsamkeit durch die weihnachtliche Feststimmung nicht zu lindern, sondern nur noch weiter zu verstärken. Wer mit dem Gedanken spielte, seinem trostlosen Leben ein Ende zu bereiten, gab seiner Neigung in dieser Zeit am häufigsten nach. Das hatte Ottfried Gollinger in einer Illustrierten gelesen.
Außerdem war Vollmond – ein nicht zu unterschätzender Faktor. Er wirkte wie ein Gefühlsverstärker, auch wenn wissenschaftlich noch nicht genau erforscht war, wie er das tat. Manche Menschen wurden bei Vollmond innerlich unruhig, manche schliefen schlecht, manche bekamen bei Vollmond reale körperliche Beschwerden.
Und manche fassten dabei den unumstößlichen Vorsatz, Selbstmord zu begehen.
Noch dazu das trübe Wetter! Bereits seit Wochen war der Himmel von einer dichten, grauen Wolkenschicht bedeckt. Meistens regnete es, einmal hatte es auch schon geschneit. Nur die Sonne wollte nicht mehr scheinen. Wen die Einsamkeit und der Vollmond nicht schafften, dem gab das verfluchte deutsche Winterwetter den Rest.
Ottfried Gollinger stellte den Kragen seiner Schaffneruniform nach oben und rückte seinen Schal zurecht. Er hätte jetzt einen heißen Kaffee vertragen können, obwohl das Thermometer heute sogar Plusgrade anzeigte. Aber wenn man wie er die meiste Zeit des Tages an der frischen Luft war, kroch einem die Kälte irgendwann in alle Glieder.
Ottfried war auch alleinstehend. Und einsam, zumindest manchmal. Vielleicht konnte er sich deshalb viel besser in die Gefühlswelt anderer Menschen hineinversetzen als seine Kollegen. Die belächelten ihn oft wegen seiner Vorahnungen. Nie nahmen sie ihn ernst, wahrscheinlich weil bisher noch keine seiner düsteren Prophezeiungen eingetreten war.
Aber heute würde es geschehen, das spürte er in jeder Faser seines Körpers. Alle Anzeichen deuteten auf ein Unglück hin!
Deshalb war er an diesem Tag besonders aufmerksam.
Erneut schweifte sein Blick über den Bahnhof. Wie ein Radar. Überall standen Menschen herum, obwohl die morgendliche Stoßzeit schon längst vorbei war. Die meisten warteten wohl auf den Regionalexpress nach Homburg oder auf die Bahn von Saarbrücken nach Mannheim, die heute an Gleis 3 halten würde.
Paare und Familien mit Kindern interessierten Ottfried nicht. Die mochten zwar auch ihre Probleme haben, aber wenn einer von denen die Absicht gehabt hätte, sich etwas anzutun, wäre er bestimmt nicht in Begleitung gekommen.
Nein, Ottfried Gollinger achtete nur auf Personen, die allein am Bahnsteig standen.
Ein Mann, etwa sechzig Jahre alt, mit Lederjacke und Hut, fiel ihm ins Auge. Er hatte keinen Koffer dabei – verdächtig. Die meisten Fahrgäste reisten mit Gepäck. Aber vielleicht war er auch nur hier, um jemanden abzuholen.
Ottfrieds Blick blieb auf der großen Bahnhofsuhr haften. Noch zehn Minuten, bis der Regionalexpress einfahren würde. Zehn Minuten Schonfrist, die ihm blieben, um den Selbstmordkandidaten zu identifizieren – falls er vorhatte, sich vor diesen Zug zu werfen.
War es doch der Kerl ohne Koffer? Er wirkte so teilnahmslos, geradezu lethargisch. Wie jemand, der mit dem Leben abgeschlossen hatte. Je mehr Ottfried darüber nachdachte, desto sicherer wurde er, dass dieser Mann nur aus einem einzigen Grund hier war: Er bereitete sich auf sein Ende vor.
Ein paar Minuten lang beobachtete er ihn weiter, aus der Distanz, um ihn heimlich zu studieren. Etwas Besseres hatte er ohnehin nicht zu tun. Einmal fragte ihn ein älteres Ehepaar nach der Bahnhofstoilette, und Ottfried beschrieb ihnen den Weg. Danach widmete er sich wieder seinem potentiellen Selbstmörder.
Wie kann ich ihn von dem tödlichen Sprung abhalten?
Darüber hatte er sich schon oft seine Gedanken gemacht. Er würde sich eine Zigarette in den Mund stecken und ihn um Feuer bitten. Normalerweise rauchte Ottfried Gollinger nicht, wenn Züge einfuhren, weil er dann damit beschäftigt war, den Fahrgästen beim Ein- und Aussteigen zu helfen oder ihnen Auskünfte zu erteilen. Dabei störte eine Zigarette nur.
Jetzt war sie ein willkommenes Mittel, um ein unverfängliches Gespräch zu beginnen und eine große Dummheit zu verhindern.
Noch drei Minuten bis zum Eintreffen des Regionalexpresses.
Zeit, sich in Position zu begeben.
Ottfried Gollinger nahm seinen Mut zusammen und kam näher. Er hatte sich schon oft ausgemalt, wie es wäre, als Schutzengel aufzutreten, aber er hatte nicht damit gerechnet, dass er dabei so aufgeregt sein würde. Ängste und Bedenken schossen plötzlich wie lähmende Giftpfeile durch seinen Kopf. Würde er die richtigen Worte finden? Würde er es tatsächlich schaffen, diese verlorene Seele zu retten?
Oder würde er am Ende versagen?
Mehr denn je empfand er sein feines Gespür für die Selbstmordabsichten anderer als schwere Bürde, aber er wusste auch, dass er sich dieser Herausforderung stellen musste. Sonst würde er morgen nicht mehr in den Spiegel schauen können.
Er nahm die HB-Schachtel aus seiner Jackentasche, zog mit zwei Fingern eine Zigarette heraus und steckte sie sich in den Mund. Gerade als er seine Mission starten wollte, schrillte ein Pfiff über den Bahnsteig.
Der Mann neben ihm schreckte auf und sah sich um. Schließlich erkannte er einen jüngeren Mann, der gerade aus dem Bahnhofsgebäude trat und zu ihm herüberwinkte. Mit einem freudigen Lächeln eilten die beiden aufeinander zu und fielen sich in die Arme – offenbar Vater und Sohn.
Ottfried war erleichtert über diese unerwartete Wendung. Gleichwohl hielt das ungute Gefühl in der Magengegend unverändert an.
Die Gefahr ist noch nicht vorüber!
Oder bildete er sich doch nur wieder etwas ein? Heute hatte er seinen Kollegen wohlweislich nichts von seinem schrecklichen Verdacht erzählt, aus Angst, sich einmal mehr zum Gespött zu machen. Aber vielleicht hätte er sie doch lieber warnen sollen. Hier gab es viel zu viele Menschen, um sie alle allein im Auge behalten zu können.
Noch zwei Minuten bis zur Einfahrt des Zugs. Wieder wanderte Ottfrieds Blick über die Bahnsteige, diesmal hektischer, weil er spürte, wie ihm die Zeit davonlief. Er fühlte sich gehetzt. Was, wenn er sein Opfer nicht rechtzeitig identifizieren konnte? Dann würde er Zeuge eines grauenhaften Vorfalls werden!
Eine Frau stach ihm ins Auge, etwa vierzig Jahre alt. Sie trug ein zerschlissenes, blaues Kleid und darüber einen ebenso zerschlissenen, grauen Filzmantel. Beides wirkte viel zu groß für eine so zierliche Person und hing schlaff an ihr herab, als habe sie stark abgenommen. Oder als seien die Klamotten eigentlich gar nicht für sie bestimmt.
Wahrscheinlich eine Landstreicherin.
Trotz der Entfernung konnte Ottfried Gollinger deutlich ihr Gesicht erkennen. Sie wirkte scheu, beinahe ängstlich, ihre Augen zuckten unruhig hin und her, und ihre Miene schien den Sinn der Welt in Frage zu stellen.
Genau so stellte er sich den Gesichtsausdruck eines Selbstmörders vor!
Mit einem schrillen Pfiff rollte der einfahrende Zug heran. Der Blick der Landstreicherin wanderte unentwegt zwischen der Lokomotive und den Gleisen hin und her. Mit zaghaften Schritten näherte sie sich der Bahnsteigkante.
Zwischen ihr und dem Abgrund befanden sich jetzt nur noch zwei Personen: ein Geschäftsmann mit einer Aktentasche in der Hand und eine junge Frau mit einer schwarzen Kaschmirjacke und einer schwarzen Wollmütze auf dem Kopf. Unter dem Arm trug sie eine kleine Damenlederhandtasche, ebenfalls schwarz, genau wie ihr Rock. Sie sah aus, als trüge sie Trauer.
Die Landstreicherin rückte einen weiteren kleinen Schritt auf. Sie schien jetzt nur noch Augen für den einfahrenden Triebwagen zu haben. Ottfried Gollinger wusste: Wenn er jetzt nicht handelte, wäre es zu spät.
Zielsicher marschierte er auf die Landstreicherin zu. Die Zigarette befand sich noch in seinem Mundwinkel. Er fragte sich, ob die Frau überhaupt ein Feuerzeug besaß? Egal! Wenn nicht, musste er improvisieren. Hauptsache, er konnte sie von ihrem Vorhaben abhalten.
Pures Adrenalin jagte durch seine Adern, während er seinen Schritt beschleunigte. Der Zug war jetzt höchstens noch hundert Meter entfernt – ein zischender Vorbote aus dem Jenseits.
Beherzt eilte Ottfried weiter. Er lief nicht mehr, nein, er rannte. Nur noch wenige Schritte trennten ihn von seinem Ziel, als die Landstreicherin plötzlich stehen blieb, dicht hinter den beiden anderen Passanten.
Dem letzten Schutzwall vor dem Sturz in die Hölle.
Sie zögerte.
Wartete.
Ottfried Gollinger sprach sie an.
»Sie haben nicht zufällig Feuer für mich? Ich muss meine Streichhölzer verlegt haben.«
Die Landstreicherin sah ihn verwirrt an. Damit hatte sie offenbar nicht gerechnet.
Sehr gut! Zumindest habe ich sie abgelenkt.
Trotz des trüben Wetters fiel Ottfried die Blässe in ihrem Gesicht auf. Ihre Haut war kalkweiß, wie bei einem Kranken oder bei jemandem, der unter extremer Angst litt.
Aber da war noch etwas anderes. Etwas, das überhaupt nicht zu dem passte, was Ottfried Gollinger erwartet hatte. Eine Kleinigkeit in ihrem Blick, der ihn schaudern ließ.
Entschlossenheit.
Eiserne Entschlossenheit sogar.
Nein, mehr noch. Aber was?
Während er verzweifelt versuchte, die Miene der Frau richtig zu interpretieren, trat sie einen Schritt zur Seite, weg von ihm.
Sie springt!
Dessen war Ottfried Gollinger sich jetzt hundertprozentig sicher. Heute hatte sein Instinkt ihn nicht betrogen!
Er setzte nach, griff nach dem Arm der Frau, versuchte, sie an sich zu ziehen. Doch sie riss sich mit erstaunlicher Kraft von ihm los.
Von da an spielte sich die Szene für Ottfried Gollinger wie in Zeitlupe ab.
Die einfahrende Lokomotive …
Die Landstreicherin, die ins Taumeln geraten war …
Ihre spinnenartigen Finger, die nach der jungen Frau in der Trauerkleidung grabschten …
Als habe sie es sich in letzter Sekunde doch noch einmal anders überlegt …
Für einen winzigen Moment sah es sogar so aus, als habe sie gar nie vorgehabt, sich selbst vor den Zug zu werfen, sondern die andere Frau, die in diesem Augenblick einen Entsetzensschrei ausstieß, weil sie die Gefahr erkannte.
Ottfried Gollinger stand nur eine Armeslänge daneben. Während der Schrei ihm beinahe das Trommelfell platzen ließ, traf ihn die Erkenntnis so hart, dass er zu Stein erstarrte.
Hass!
Das war es, was er gerade eben in den Augen der Landstreicherin hatte auflodern sehen.
Blindwütigen, abgrundtiefen Hass.
Worauf und warum? Das spielte jetzt keine Rolle! Fest stand nur, dass diese unerwartete Wendung ihn mit Angst erfüllte – denn die Frau verhielt sich nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Im Gegenteil, sie schien nun völlig unberechenbar geworden zu sein. Ihre Finger bekamen die schwarze Kaschmirjacke zu fassen.
Krallten sich darin fest.
Schienen sie nie mehr loslassen zu wollen.
Der Schrei der Frau in Schwarz änderte sich. Er klang jetzt beinahe unmenschlich – wie ein schriller Laut aus einer jenseitigen Welt. Ein solches Geräusch brachte man nur über die Lippen, wenn der kalte Hauch des Todes einem entgegenschlug.
Erst als der Schrei – oder was immer das war – im nächsten gellenden Pfiff der heranstampfenden Lok unterging, löste sich Ottfrieds Schreckensstarre. Rasch klammerte er sich an die schwarz gekleidete Frau, um sie vor dem Sturz zu bewahren, doch die Landstreicherin, die inzwischen schräg an der Bahnkante hing, zog von der anderen Seite wie ein Bergsteiger an einer Steilklippe.
Es war wie ein Tauziehen zwischen Leben und Tod.
Als die Landstreicherin sich mit einem plötzlichen Ruck ins Hohlkreuz legte, wusste Ottfried Gollinger, dass er verloren hatte. Beide Frauen stürzten auf die Gleise, er selbst taumelte wie betäubt hinterher. Bis zur letzten Sekunde versuchte er, die Frau mit dem Kaschmirmantel und der Wollmütze zu retten – vergeblich. Er musste sie loslassen, sie ihrem Schicksal überantworten.
Einsehen, dass die Macht der Vorsehung stärker war als er.
Seine Finger lösten sich. Menschen schrien. Der bremsende Zug verursachte ein grässliches metallisches Quietschen, das ihm durch und durch ging. Aber er wusste genau, dass das stählerne Monster nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen würde.
Er wollte einen Schritt zurücktreten, wurde aber nach vorne gezogen.
Was um alles in der Welt …?
Etwas zerrte an ihm: die Hände der Frau in Schwarz. Sie lag noch gar nicht auf den Gleisen, sondern hatte sich voller Panik in seine Uniform gekrallt!
Obwohl er mit aller Gewalt dagegen ankämpfte, kippte Ottfried Gollinger vornüber wie ein gefällter Baum, über ihm die kreischende Menschenmenge, unter sich die beiden schreienden Frauen. Das Letzte, was er sah, war die Front des Triebwagens, die wie eine Urgewalt auf ihn zurollte und ihn unter sich begrub.
Kapitel 1
»DAS ist es? Du willst mich auf den Arm nehmen!«
Im Rückspiegel sah Mara Flemming die großen Augen ihrer Freundin Barbara. Sogar der Mund stand ihr offen.
»Das ist ja fast eine Burg!«
Mara musste unwillkürlich lächeln. »Du übertreibst. Aber ich freue mich, wenn es dir gefällt.«
Sie bog von der Serpentinenstraße in die geschotterte Einfahrt zu ihrem neuen Wohnsitz ein. Unter den Reifen knirschten die Steine.
Der Parkplatz befand sich, ebenso wie das Haus, auf einer großen, künstlich angelegten Bergterrasse. Mara hielt ihren Škoda links neben dem Waldrand, damit der Umzugswagen, der in Kürze hier eintreffen würde, genug Platz zum Rangieren hatte.
Die Frauen stiegen aus. Mara trug Jeans, Turnschuhe und Pullover. Ihr schulterlanges, brünettes Haar hatte sie nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Selbst Barbara war heute leger gekleidet. Als Chefredakteurin der FAZ trug sie auch in ihrer Freizeit selten etwas anderes als Blusen, Röcke und Stöckelschuhe, aber heute hatte sie anlässlich des Umzugs ein Baumwollhemd und eine Latzhose angezogen.
»Die Aussicht ist ja der Hammer!«, rief sie mit echter Begeisterung in der Stimme. Sie überquerte den Parkplatz bis zur Terrassenkante, von wo aus man freie Sicht über die Weinberge hatte, vor allem an einem wolkenfreien Tag wie diesem. »Es ist der reinste Frevel, sich nur zum Schreiben hierher zurückzuziehen. Du solltest ein Hotel eröffnen!«
Mara schmunzelte. Bei der ersten Besichtigung des Anwesens waren ihr genau dieselben Gedanken gekommen.
»Ich hoffe, du wirst hier so glücklich, wie Barbara es im Moment ist«, sagte Sabine, Maras zweite Begleiterin an diesem Tag.
»Ich denke, das war die beste Entscheidung meines Lebens«, antwortete Mara. »Vermutlich werde ich dir ewig dafür dankbar sein. Ohne dich wäre dieser Traum nicht in Erfüllung gegangen.«
Sie wollte Sabine damit ein Kompliment machen, aber die wirkte eher distanziert. Vielleicht war sie traurig, weil Mara so weit von Frankfurt wegzog. Ein bisschen wehmütig machte sie das auch. Sie würde Sabine, Babsi und alle anderen bestimmt schon bald vermissen.
»Hättest du mir nicht den Prospekt gegeben, hätte ich dieses Haus nie besichtigt«, fuhr Mara fort. »Dann wäre ich immer noch in der Großstadt und würde Leni vernachlässigen. Ich bin sicher, dass ich hier eine bessere Mutter für sie sein kann. Außerdem laufe ich in Naunheim nicht ständig Gefahr, meinem Trottel von Exmann über den Weg zu laufen.«
Sabine hatte ihr den Immobilienprospekt vor zwei Monaten zugesteckt, kurz nach der Scheidung, weil sie genau gespürt hatte, wie dringend Mara einen Tapetenwechsel brauchte. Die beiden kannten sich schon eine Ewigkeit, vertrauten sich blind und wussten genau, wie die andere fühlte. Mit dem Prospekt und allem, was darauf folgte, hatte Sabine es geschafft, Mara aus der schlimmsten Krise ihres Lebens herauszuziehen.
»Du bist meine beste Freundin, das weißt du, nicht wahr?«, raunte Mara leise, so dass Babsi sie nicht hören konnte. »Der Umzug wird daran nichts ändern.«
Sie nahm Sabine in den Arm und drückte sie an sich, merkte aber, dass ihr das unangenehm war. Verunsichert ließ sie wieder von ihr ab.
»Was ist los mit dir? Du warst schon die ganze Fahrt über so ruhig.«
Sabine wich Maras Blick aus und schwieg.
»Stress mit Hannes?«
Hannes war Sabines Göttergatte – zumindest hielt er sich dafür. In Maras Augen war er nur ein sportbegeisterter Schwätzer mit völlig übersteigertem Selbstwertgefühl. Natürlich hatte sie das Sabine gegenüber noch nie so deutlich erwähnt, aber meistens lag es an Hannes, wenn Sabine schlechte Laune hatte.
»Ich bin nur ein bisschen müde«, sagte Sabine. »Es war eine anstrengende Woche.«
Mara nickte. Obwohl sie ahnte, dass das nur eine Ausrede war, beschloss sie, nicht weiter darauf einzugehen. Wenn Sabine im Moment nicht darüber sprechen wollte, musste sie das akzeptieren. Vielleicht ergab sich später die Gelegenheit für ein klärendes Gespräch.
Barbara kam wieder zu ihnen zurück, immer noch mit dem Ausdruck überschwänglicher Begeisterung im Gesicht.
»Welche Bank hast du überfallen, um dir das hier leisten zu können?«, fragte sie.
»Wir sind auf dem Land, Babsi«, antwortete Mara. »Das kannst du nicht mit Frankfurt vergleichen.«
»Aber geschenkt kriegst du so was hier auch nicht. Also raus mit der Sprache: Was hat das alles gekostet? Eine Million, wette ich – Minimum.«
»So viel Geld hätte ich im Leben nicht zusammenbekommen.«
Barbara machte ein skeptisches Gesicht. »Gehören dir auch die Weinberge?«
Mara schüttelt den Kopf. »Nein, die sind an die örtlichen Winzer verpachtet. Mir gehört nur das Haus, der Garten, der Parkplatz und ein bisschen Land drum herum. Genaugenommen gehört es gar nicht mir, sondern der Bank. Noch mindestens zwanzig Jahre lang.«
»Mitleid bekommst du von mir keines. Nicht dafür«, sagte Babsi. »Du bist wirklich ein unverschämter Glückspilz!«
Mit den Kartons und dem Putzzeug aus dem Kofferraum marschierten die drei Frauen über den Schotterplatz zum Haus – einem trutzigen Gemäuer mit einem dicken, unverputzten Steinsockel und einem imposanten Walmdach, dem man das Alter deutlich ansah. Doch genau das war es, was Mara so gut daran gefiel. Das Haus war nicht von der Stange, kein am Reißbrett entworfenes Gebäude ohne Charme und Charakter, sondern ein historischer Bau mit Ecken und Kanten, mit Patina an den Wänden und mit Fenstern, die im Verhältnis zur Stärke der Mauern viel zu klein wirkten. Im Winter strahlte dieses Haus wahrscheinlich ein gewisses Maß an Düsternis aus, das konnte Mara sich zumindest gut vorstellen, aber bei klarem Himmel und Sonnenschein, so wie heute, verströmte es mit seinem sandsteinfarbenen Teint eine heimelige Freundlichkeit, die bei ihr ein Wohlgefühl auslöste.
Dieses Haus atmete den Geist alter Tage. Vom ersten Moment an hatte es Mara inspiriert.
Der Parkplatz ging nahtlos über in einen sauber angelegten Gemüse- und Blumengarten rund ums Haus. Hübsche, mit Rabattsteinen versehene Wege führten durch die Beete. An einer Stelle stand, flankiert von zwei Holzbänken, eine Vogeltränke aus verwittertem, weißem Marmor.
Wenn man den Blick schweifen ließ, gab es bergauf nur Wald, ins Tal hinunter nur Weinreben. Einzige Zufahrt zum Anwesen war die Serpentinenstraße, über die sie gekommen waren. Sie schlängelte sich in engen Windungen von Naunheim herauf und führte oben am Berg weiter bis ins fünf Kilometer entfernte Maikammer.
Der Eingang des Hauses war mit einem kleinen Vordach versehen. Mara schloss die schwere Eichenholztür auf, und die Frauen traten ein. Nach dem Garderobenbereich folgte ein großer Wohnraum, der Mara schon ab dem ersten Moment an einen mittelalterlichen Festsaal erinnert hatte. Dunkle Holzmöbel bestimmten das Bild, von der Decke hing ein alter Kronleuchter herab. Rechts ging der Raum in die offene Küche über. Links befand sich in einiger Entfernung ein großes Panoramafenster, das durch den zugezogenen Samtvorhang im Moment allerdings nur zu erahnen war.
»Du musst mir unbedingt alles zeigen, bevor der Umzugswagen ankommt!«, sagte Babsi. »Das ist ja die reinste Geistervilla!«
Mara nickte amüsiert. »Willst du auch noch mal eine Runde mit uns drehen?«, fragte sie Sabine, die schon bei der ersten Besichtigung vor sechs Wochen dabei gewesen war.
»Ich fange lieber schon mal an, die Küchenschränke auszuputzen, bevor die Kartons mit dem Geschirr ankommen«, antwortete Sabine. Offenbar zog sie es vor, allein zu sein.
»Dann bis gleich.«
Mara wandte sich wieder an Babsi und versuchte dabei, sich ins Gedächtnis zu rufen, was die Maklerin bei der Besichtigung erzählt hatte.
»Die Außenmauern und ein Teil der Innenmauern stammen noch aus dem neunzehnten Jahrhundert«, sagte sie. »Damals wurde das Gebäude von einer Winzerfamilie aus der Region errichtet. Der obere Teil des Hauses, also das erste Stockwerk und das Dachgeschoss, wurde erst in den 1960ern ausgebaut und vor etwa zehn Jahren saniert. Aber ich denke, wir sollten bei unserem Rundgang mit dem Keller beginnen. Der wird dir gefallen. Dort ist es wirklich gruselig!«
Durch die Küchentür neben dem Kühlschrank gelangten sie zur Kellertreppe, die über zwei Absätze zu einem düsteren, alten Gewölbe führte, so groß, dass man dort eine ganze Kompanie hätte unterbringen können. Durch eine Reihe kleiner, vergitterter Fenster fiel Sonnenlicht herein. Feiner Staub schwebte in der Luft, als sie den weitläufigen Raum betraten. Übermannshohe Holzfässer reihten sich entlang der Wand bis nach hinten, wo sich der Raum irgendwo im Halbdunkel verlor.
Obwohl hier unten alles mit den alten Sachen des Vorbesitzers vollgestopft war, konnte Mara sich bildlich vorstellen, wie früher in diesem Keller gearbeitet worden war. Sie verstand nichts vom Keltern, doch der leichte Eichenholzgeruch, den die Fässer immer noch absonderten, vermischt mit den Aromen von schwerem Rotwein, beflügelten ihre Phantasie.
»Du hast nicht zu viel versprochen«, murmelte Babsi, während ihr Blick durch den Raum glitt. »Ich komme mir vor wie in einem alten Dracula-Film. Es würde mich nicht wundern, wenn hier unten ein Vampir in einem Sarg herumliegt.«
»Na toll! Jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich in den Keller muss, an Christopher Lee denken!«, sagte Mara. Sie schüttelte amüsiert den Kopf, wünschte sich jedoch insgeheim, dass Babsi die Bemerkung unterlassen hätte. Nicht, dass sie an Vampire glaubte, aber aus irgendeinem Grund trieb ihr die Vorstellung einen Schauder über den Rücken.
Das Obergeschoss, das sie nach dem Keller besichtigten, wirkte im Vergleich dazu wie eine andere Welt. Hier befanden sich modern eingerichtete, helle Zimmer sowie ein schönes, großes Bad.
»Leni und ich werden vorwiegend hier wohnen«, sagte Mara. Leni war ihre fünfjährige Tochter, die übers Wochenende bei ihrer Kindergartenfreundin Jule in Frankfurt übernachten durfte, um ihr den Abschied zu erleichtern.
Sie gingen wieder nach unten ins Erdgeschoss.
»Das Beste kommt jetzt«, sagte Mara auf der Treppe.
»Ich bin gespannt, wie du das noch toppen willst.«
Mit einem breiten Grinsen im Gesicht führte Mara ihre Freundin durchs Wohnzimmer in einen daran angrenzenden, beeindruckend großen Raum.
»Voilà – die Hausbibliothek«, sagte sie mit ausgebreiteten Armen.
An den weiß gekalkten Wänden standen deckenhohe, offene Regale aus schwarzem Holz, in denen sich unzählige Bücher reihten. Mara hatte sie nicht gezählt, aber es mussten Tausende sein – moderne Taschenbücher unterschiedlicher Genres, Romane wie Sachbücher, gebundene Jahrbände, diverse Klassiker in edlen Sonderausgaben, sogar ein paar historische Folianten mit goldenen Lettern auf dem Rücken befanden sich darunter. Ein Lederohrensessel und ein massiver Schreibtisch aus geöltem Holz vervollständigten das Bild. Man kam sich vor wie vor hundert Jahren.
»Hier werde ich mein Arbeitszimmer einrichten«, sagte Mara. »Kannst du dir einen besseren Ort vorstellen, um ein Buch zu schreiben?«
Babsi sagte nichts, aber man konnte ihr an den Augen ablesen, wie beeindruckt sie war.
»Jetzt gibt es nur noch die Terrasse«, sagte Mara. »Dann ist unsere Führung beendet.«
Im Wohnzimmer schob sie den schweren Samtvorhang beiseite und führte Babsi durch eine Glastür nach draußen. Die Vormittagssonne strahlte ihnen warm ins Gesicht, Vögel zwitscherten in den Weinbergen, ein Schwarm Fruchtfliegen tanzte in der Luft. Über die gusseiserne Brüstung hinweg hatte man einen Bilderbuchblick ins Tal hinab, besser als auf jeder Postkarte. Die Weinreben und Wälder rings um sie herum schimmerten in den leuchtendsten Herbstfarben. Am Fuß des Bergs lag das Örtchen Naunheim. Im Wasser des Argenbachs, der träge durchs Tal mäanderte, glitzerte das Sonnenlicht wie ein Meer aus Diamanten. Von hier oben erinnerten die Häuser an kleine, weiß-rote Bauklötze in einer liebevoll gestalteten Spielzeuglandschaft.
Es war ein friedliches Idyll, wie in Maras Kindertagen.
Hinter sich hörte sie ein Geräusch. Als sie sich umdrehte, stellte sie fest, dass Sabine ihnen auf die Terrasse gefolgt war.
»Ohne diese Frau wären wir heute nicht hier«, betonte sie noch einmal, in der Hoffnung, Sabine damit aufzumuntern, denn die schaute immer noch nicht besonders glücklich drein. »Komm her und lass uns noch ein bisschen die Sonne genießen, bevor die Arbeit beginnt!«
Mit diesen Worten schnappte sie Sabines Hand, um sie zu sich zu ziehen, doch die zuckte regelrecht zusammen – nur einen winzigen Augenblick, aber zu auffällig, um es einfach zu ignorieren.
»Was ist los?«, fragte Mara und ließ von ihr ab.
»Nichts …« Sabine rieb sich das Handgelenk. Mara bemerkte, dass es unter dem dicken Armreif bläulich verfärbt war.
»Bist du verletzt?«
»Nein.«
»Hat Hannes das getan?«
Sabines Miene verdüsterte sich noch mehr. »Hannes ist nicht so schlecht, wie du denkst«, zischte sie. »Und jetzt kein Wort mehr davon, hörst du?«
Es entstand eine unangenehme Pause, in der Mara spürte, wie ihr die Hitze ins Gesicht stieg.
»Wenigstens scheint die nächste Shoppingmöglichkeit meilenweit entfernt zu sein«, sagte Babsi, als würde sie sich darüber freuen, endlich etwas zum Meckern gefunden zu haben. Mara ahnte allerdings, dass sie damit nur die peinliche Situation überspielen wollte. »Da unten gibt es wahrscheinlich nur einen Bäcker und einen Metzger und vielleicht noch eine Apotheke, hab ich recht?«
»Dort gibt es alles, was man fürs tägliche Leben benötigt«, entgegnete Mara dankbar. Sabine war heute wirklich nicht besonders gut drauf! »In Naunheim gibt es sogar einen Arzt, einen Edeka und einen Sportverein. Und wenn man mal etwas Abwechslung will, sind Landau und Neustadt nicht weit entfernt.«
Babsi schüttelte fassungslos den Kopf. »Du wohnst künftig also in einem riesigen Haus in perfekter Lage, und das Ganze zu einem Spottpreis. So viel Glück kann es im echten Leben doch gar nicht geben! Mein Reporterinstinkt sagt mir, dass irgendetwas an dieser Sache nicht stimmt. Raus mit der Sprache, was ist es?«
»Muss denn immer alles einen Haken haben?«, erwiderte Mara und winkte ab. »Tut mir leid, aber es gibt keinen.«
Höchstens einen, aber der hat mit dem Haus nichts zu tun: Theodor Flemming, mein Vater.
Bei dem Gedanken an ihn wurde ihr eiskalt ums Herz.
Kapitel 2
Eine Viertelstunde später traf der Umzugswagen ein – ein dreiachsiger Sattelschlepper, vollgepackt bis oben hin. Dank des großen Parkplatzes konnte der schwerfällige Transporter so rangieren, dass er mit der Laderampe direkt vor dem Haupteingang zum Stehen kam. Das würde Kraft und Zeit sparen.
Die Packer – ein Deutscher und zwei Polen – begannen sofort mit dem Ausladen.
»Alles, was einen roten, gelben oder grünen Punkt trägt, kommt nach oben. Weiß und Schwarz bleiben im Erdgeschoss«, erklärte Mara. Im Vorfeld hatte sie alle Kartons und jeden unverpackten Gegenstand farbig markiert, damit das Ausladen schnell von der Hand ging. »An die Türen der entsprechenden Räume habe ich Buntpapier geklebt. Gelb kommt zu Gelb, Rot zu Rot und so weiter. Wenn irgendwo ein Klebepunkt abgefallen sein sollte, geben Sie mir bitte Bescheid, dann sage ich Ihnen, wo das hinkommt.«
Das System hatte sie von ihrer Tante Agathe übernommen, bei der sie als Jugendliche aufgewachsen war. Tatsächlich klappte das Entladen damit wie am Schnürchen. Nur bei den Sachen, die in den Keller gehörten, musste Mara koordinierend eingreifen, weil dort noch alles vollstand. Der Vorbesitzer hatte ihr nicht nur die wunderschöne Bibliothek hinterlassen, sondern auch die vollgestopfte Müllhalde einen Stock tiefer. Im Moment konnte sie nur alles in eine Ecke stellen lassen und hoffen, dass es nicht übermäßig einstaubte. Sobald sie die Malerfolien fand, würde sie die Sachen damit provisorisch abdecken.
Babsi und Sabine putzten in der Zwischenzeit die Räume. Wenn Mara nichts anderes zu tun hatte, half sie ihnen dabei. Alle waren so in die Arbeit vertieft, dass die Zeit nur so verflog.
Als die beiden anderen sich auf der Terrasse eine Zigarettenpause gönnten, beschloss Mara, einen Kaffee durchzulassen. Nebenher wollte sie die Post der letzten Tage durchgehen, weil sie wegen der Umzugsvorbereitungen in Frankfurt alles nur noch in dem alten Schuhkarton gesammelt hatte, der jetzt vor ihr auf der Küchenplatte stand. Sie zog den Ringgummi ab und sortierte als Erstes Werbung und Zeitungen aus, so dass nur noch die Briefe übrig blieben. Das waren vor allem Rechnungen, aber es befand sich auch ein Schreiben des Anwaltsbüros Hertzweiler & Partner darunter.
Das bedeutete bestimmt nichts Gutes!
Mit einem Kribbeln im Magen öffnete Mara das Kuvert und entfaltete das darin befindliche Schriftstück. Während sie es von Anfang bis Ende aufmerksam studierte, spürte sie, wie das anfängliche Unbehagen immer mehr in Wut umschlug.
Dieser verdammte Bastard!
Ihr wurde klar, dass sie rechtlichen Beistand brauchen würde.
»Wie sieht es eigentlich mit Mittagessen aus?«
Mara sah auf. Ihre Freundinnen kamen gerade von der Raucherpause zurück.
»Soll ich im Ort etwas besorgen?«, fragte Sabine.
Mara schüttelte den Kopf. »Ich mache das schon«, sagte sie. Nach der unerwarteten und höchst ärgerlichen Neuigkeit brauchte sie jetzt erst mal ein paar Minuten für sich, um wieder herunterzukommen.
Sie schnappte sich ihren Geldbeutel, eilte zum Auto und fuhr viel zu schnell die Serpentinenstraße nach Naunheim hinunter. Erst als in der ersten Kurve die Reifen quietschten, kam sie zur Besinnung und trat auf die Bremse. Ein Totalschaden würde die Situation bestimmt nicht verbessern.
Trotz des schönen Wetters war in Naunheim samstags um kurz nach halb eins nur wenig los. Der Ort lag abseits der üblichen Touristenzentren in einem abgelegenen Tal. Genau das hatte ihn für Mara so attraktiv gemacht.
Sie fand einen Parkplatz direkt vor der Metzgerei, wo sie belegte Brötchen, ein paar Wiener Würstchen und eine große Schale Kartoffelsalat für alle kaufte.
Der Brief von vorhin spukte ihr immer noch im Kopf herum.
»Wissen Sie, ob es in Naunheim einen Anwalt gibt?«, fragte sie beim Bezahlen.
Die Frau hinter der Wursttheke nickte. »Herr Brunner. Sein Büro liegt nur ein paar Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite«, sagte sie. »Aber ich glaube, der hat am Sonnabend nur bis um eins geöffnet. Da müssen Sie sich beeilen.«
Mara nahm ihren Einkauf entgegen, bedankte sich und verließ den Laden. Sie verstaute das Essen im Kofferraum und überlegte. Eigentlich sollte sie gleich wieder zurückfahren, das war ihr klar – die anderen hatten Hunger. Aber das Schreiben von Hertzweiler & Partner wurmte sie so sehr, dass sie dringend etwas unternehmen musste. Sie wollte dem hiesigen Anwalt wenigstens einen kurzen Besuch abstatten, um einen Beratungstermin mit ihm zu vereinbaren. Danach würde sie sich bestimmt besser fühlen.
Die Kanzlei Brunner befand sich im ersten Stock eines alten Fachwerkhauses in der Seiboldstraße. Über eine knarrende Holztreppe erreichte Mara das Büro.
Hier ist es ja beinahe so gespenstisch wie in meinem Keller, dachte sie.
Paul Brunner war ungefähr in ihrem Alter, Mitte dreißig, und trug einen gepflegten Dreitagebart. Hinter der randlosen Brille verströmten seine haselnussfarbenen Augen eine angenehme Wärme, gleichzeitig wirkte sein Blick ein bisschen scheu. Mit dem karierten Pullunder über dem Hemd sah er ziemlich bieder aus, aber auf angenehme Art und Weise. Auf Mara machte er vom ersten Moment an einen sympathischen Eindruck.
Sein Büro war winzig klein. Die Unmengen von Büchern und Akten in den Regalen verstärkten diesen Eindruck noch. Nachdem sie sich die Hände geschüttelt hatten, nahm Mara auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz.
»Was kann ich für Sie tun, Frau Flemming?«, fragte er.
»Ich brauche einen Anwalt.«
»Da sind Sie bei mir schon mal grundsätzlich richtig.« Ein spitzbübisches Grinsen legte sich auf sein Gesicht. Wollte er sie etwa auf den Arm nehmen?
»Worum genau geht es?«
»Um meine Scheidung. Kennen Sie sich mit solchen Sachen aus?«
Brunner hob die Augenbrauen. »Scheidungen und Verkehrsdelikte sind mein Spezialgebiet. Bitte erzählen Sie mir, was ich für Sie tun kann.«
Mara seufzte. »Eigentlich wollte ich nur einen Termin für nächste Woche ausmachen«, sagte sie. »Damit wir uns in Ruhe über die Angelegenheit unterhalten können. Heute ist es schlecht – ich stecke mitten im Umzug, und meine Helfer warten aufs Mittagessen.«
In Brunners Miene veränderte sich etwas. »Dann sind Sie also die neue Bewohnerin des Unglückshauses?«, platzte er heraus.
Mara stutzte. »Unglückshaus?«
»Dorfgerüchte«, schob Brunner schnell nach und winkte ab. »Vergessen Sie’s einfach, okay? Das ist mir nur so herausgerutscht. Ich wollte Sie nicht verunsichern. Herzlich willkommen in unserer kleinen Gemeinde.«
»Mein Einzug hat sich also schon herumgesprochen?«
»Herumgesprochen ist gar kein Ausdruck. Sie sind hier das Topthema – abgesehen vielleicht vom Blumenschmuck für das bevorstehende Marktplatzfest.« Er lächelte und setzte eine verschwörerische Miene auf. »Naunheim ist ein kleiner Ort. Geheimnisse bleiben hier nicht lange geheim. Es gibt immer jemanden, der es der Bäckerin erzählt, und wenn die es weiß, weiß es zwei Tage später das ganze Dorf.«
Seine Art war so entwaffnend, dass Mara ihm das Unglückshaus schon beinahe verziehen hatte. »Wie sieht es in den nächsten Tagen bei Ihnen mit Terminen aus?«, fragte sie.
»Ich bin ab Montag für drei Tage in Berlin«, sagte Brunner. »Wie wäre es also Ende der kommenden Woche?«
Das war Mara zu lange. Sie würde sich bis dahin nur jede einzelne Minute über Thorsten ärgern.
Brunner schien ihre Gedanken zu erraten. »Ich habe noch etwa eine Stunde hier zu tun«, sagte er. »Wie wäre es, wenn ich danach zu Ihnen komme, damit Sie mir erzählen können, wie ich Ihnen helfen kann? Natürlich ist Ihr Umzug dann noch in vollem Gang, aber zumindest würde niemand verhungern.«
»Ich dachte, Sie haben samstagnachmittags geschlossen«, entgegnete Mara.
Brunner sah sie aus seinen unergründlichen, braunen Augen an – einen Tick zu lange vielleicht. Schließlich sagte er: »Ich denke, heute werde ich eine Ausnahme machen.«
Kapitel 3
Nach dem Mittagessen übernahmen Babsi und Sabine den Abwasch, während die Packer sich an das schwerste Möbelstück wagten: Maras Klavier – kein modernes Elektrogerät, sondern ein klassisches Instrument mit Mechaniken und Saiten. Mara war zwar schon lange nicht mehr zum Spielen gekommen, hing aus sentimentalen Gründen jedoch sehr daran. Es war ein Erbstück ihrer Eltern, das viele Erinnerungen auslöste.
Gute wie schlechte.
Doch die guten überwogen, und die schlechten gehörten schließlich auch zum Leben.
Leider hatte das Klavier, wie bei alten Instrumenten üblich, einen massiven Metallkern, damit die Saiten nicht so schnell verstimmten. Mit allem Drum und Dran brachte das gute Stück an die dreihundert Kilogramm auf die Waage. Deshalb kamen die Möbelpacker ordentlich ins Schwitzen, während sie das schwarz glänzende Musikmonster über die Treppe nach oben hievten. Auch Mara half mit.
Sie steckten mitten im Treppenaufgang fest, als sich von unten Schritte näherten. Babsi kam mit Anwalt Paul Brunner im Schlepptau die Stufen herauf.
»Hier hat sich jemand in die Küche verirrt«, flötete sie und machte dabei ein Gesicht, als wolle sie sagen: »Der ist ja eine Sahneschnitte!«
Zum Glück konnte Brunner es nicht sehen, das wäre Mara peinlich gewesen.
»Ich scheine wohl gerade recht zu kommen«, sagte er. »Wenn Sie noch einen Helfer brauchen, springe ich gerne ein.«
Er wartete nicht auf die Antwort, sondern legte seine Jacke auf die Treppe und packte sofort mit an. Mit vereinten Kräften schafften sie es endlich, das schwere Musikinstrument in den ersten Stock zu tragen und es ins Wohnzimmer zu stellen.
Allen standen dicke Schweißtropfen auf der Stirn. Mara fühlte sich wie nach einem Marathon.
»Danke für die Hilfe«, sagte sie zu dem Anwalt. »Lassen Sie uns nach unten gehen. Am besten reden wir in der Küche, da haben wir mehr Ruhe als hier oben. Außerdem ist dort der Kühlschrank schon befüllt. Sie sehen aus, als könnten Sie nach der Anstrengung etwas zu trinken vertragen.«
Bei einem Glas Limo – das angebotene Bier hatte Brunner abgelehnt – schilderte Mara ihren Fall.
»Wahrscheinlich ist das der Klassiker«, begann sie. »Ich habe jung geheiratet, weil ich dachte, den Mann fürs Leben gefunden zu haben, aber der vermeintliche Hauptgewinn entpuppte sich irgendwann als Niete. Letztes Jahr haben wir uns getrennt, die Scheidung ist seit zwei Monaten rechtskräftig. Er heißt übrigens Thorsten. Wir haben eine gemeinsame Tochter, Leni, für die er bisher Unterhalt bezahlt hat. Jetzt schreibt mir sein Anwalt, dass er die Zahlungen künftig nicht mehr leisten kann.«
»Hat seine finanzielle Situation sich verändert?«
»Höchstens insofern, als seine jetzige Freundin anspruchsvoller ist als ich«, sagte Mara, bemüht, ihre Wut zu unterdrücken. Sie hatte Thorsten erst vor ein paar Wochen in der Frankfurter Innenstadt gesehen, beim Schaufensterbummel mit seiner neuen Flamme – einer aufgetakelten Silikontussi à la Kardashian. Am Körper trug sie nur Prada, Versace und Louis Vuitton.
Ihr Outfit hat wahrscheinlich mehr gekostet als mein Gebrauchtwagen, verdammt nochmal!
Außerdem – und das wurmte Mara am allermeisten – war diese High-Heels-Barbie mindestens zehn Jahre jünger als sie.
Im Moment tat das jedoch nichts zur Sache, weshalb sie es gegenüber dem Anwalt lieber unerwähnt ließ. Sie wollte nicht wie eine eifersüchtige Exfrau klingen.
»Thorsten kann machen, was er will«, sagte Mara. »Wir sind geschieden, und wie er lebt, geht mich nichts mehr an. Aber seit unserer Trennung hat er sich keinen einzigen Tag um Leni gekümmert. Deshalb lasse ich nicht zu, dass er sich jetzt auch noch vor seinen finanziellen Verpflichtungen drückt. Schreiben Sie seinem Anwalt, dass die Einstellung der Unterhaltszahlungen absolut inakzeptabel ist. Ich bin nicht einmal bereit, über eine Aussetzung oder eine noch so geringe Kürzung nachzudenken, hören Sie? Thorsten hat mich während unserer Ehe, falls man das überhaupt so nennen kann, zweimal betrogen und mich am Ende verlassen. Ich will, dass Sie ihn dafür bluten lassen!«
Sie musste tief durchatmen, um sich wieder in den Griff zu bekommen. Vielleicht klang sie doch wie eine eifersüchtige Ex.
Und wenn schon! Hauptsache, Thorsten kommt nicht ungeschoren davon.
Kapitel 4
Die darauffolgenden Tage vergingen wie im Flug. Mara pendelte zwischen Frankfurt und Naunheim hin und her, brachte die letzten Einrichtungsgegenstände ins neue Heim und fuhr mit dem Einräumen der Schränke fort.
Ganz allmählich nahm das Haus eine wohnliche Gestalt an. Vor dem Einzug waren Mara die leerstehenden Zimmer riesig vorgekommen, jetzt wirkten sie zunehmend gemütlich, auch wenn längst noch nicht alles seinen Platz gefunden hatte und überall Umzugskartons herumstanden.
Leider war die Zeit viel zu kurz für alle anstehenden Aufgaben, weil Mara nachmittags immer in Frankfurt zurück sein musste, um Leni aus dem Kindergarten abzuholen. Eine befreundete Mutter hatte zwar angeboten, die Kleine ein paar Tage lang mit nach Hause zu nehmen und bis zum Abend auf sie aufzupassen, doch Mara brachte das nicht übers Herz. Für Leni war es auch so schon schwer genug. Immerhin würde sie in wenigen Tagen ihren kompletten Freundeskreis verlieren. Mara spürte, wie ihre Tochter darunter litt. Deshalb bemühte sie sich, trotz Umzugsstress eine gute Mutter zu sein und Leni zu den üblichen Zeiten abzuholen.
Am Donnerstagvormittag stattete Anwalt Brunner ihr einen Überraschungsbesuch ab, mit zwei Bechern Kaffee und einer Tüte voll Plunderstücken unter dem Arm. Eine Portion Rührei mit Speck hatte er auch dabei, weil er nicht wusste, was Mara bevorzugte.
»Ich dachte, Sie sind in Berlin«, sagte Mara und ließ ihn herein.
»Seit gestern Abend wieder zurück«, antwortete Brunner.
Irgendwie fand Mara es süß, dass er sich so rasch um ihren Fall kümmern wollte und ihr dafür sogar einen zweiten Hausbesuch abstattete.
Inklusive Frühstück.
Andererseits drängte die Zeit, weil sie am Samstag ihre alte Wohnung in Frankfurt übergeben musste – ihre letzte Amtshandlung in der Großstadt, bevor sie mit ihrer Tochter hierherkommen würde. Deshalb blieben ihr nur noch der Donnerstag und der Freitag, um das Haus für Leni herzurichten. Sie wollte, dass die Kleine sich so schnell wie möglich hier wohl fühlte.
»Wenn Sie wollen, helfe ich Ihnen beim Einräumen«, bot Brunner an. »Sie müssten mir nur sagen, wohin die Sachen gehören.«
Das Angebot kam unerwartet. Ein solches Maß an Hilfsbereitschaft hatte Mara in Frankfurt vergeblich gesucht. Für den Umzug am vergangenen Samstag hatten nur Babsi und Sabine sich Zeit genommen. Alle anderen waren um Ausreden nicht verlegen gewesen.
»Sollten Sie denn nicht besser in Ihrem Büro sein, Herr Brunner?«, fragte Mara.
Brunner lächelte. »Das ist der Vorteil eines Freiberuflers«, antwortete er. »Man kann sich seine Zeit einteilen, wie man will. Und bitte – nennen Sie mich Paul.«
Beim Frühstück unterhielten sie sich über Maras Scheidung. Paul hatte einen Entwurf für das Schreiben an Thorstens Anwalt mitgebracht, der Mara jedoch noch viel zu diplomatisch war. Gemeinsam besprachen sie die Änderungen, danach erörterten sie, welche Optionen ihnen blieben, falls Thorsten die Unterhaltszahlungen für Leni dennoch einstellen würde.
Paul machte sich ein paar Notizen und versprach, das Antwortschreiben so schnell wie möglich zu überarbeiten. Vor dem Verschicken wollte er es Mara noch einmal zeigen.
»Was hat dich hierhergeführt?«, fragte er, nachdem der offizielle Teil abgeschlossen war. »Mal abgesehen davon, dass die Gegend wunderschön ist, meine ich.«
»Ich bin in Landau geboren und in Edenkoben aufgewachsen«, antwortete Mara.
»Dann hat es dich also in die Heimat zurückverschlagen?«
»Gewissermaßen, ja.«
»Und warum bist du nicht direkt nach Edenkoben gezogen?«
Mara zögerte, ihr Magen begann unruhig zu kribbeln.
»Lass mich raten«, sagte Paul. »Du hattest Angst, dass die Jungs aus deiner Schule dir dort die Tür einrennen würden. Kommt das ungefähr hin?«
Sie musste unweigerlich schmunzeln. In der Schule war ihr niemand hinterhergelaufen, aber sie empfand es als nettes Kompliment, dass er so etwas dachte.
»Okay, du willst offenbar nicht darüber reden«, sagte Paul, weil Mara nicht darauf einging. »Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du deine alten Liebesgeschichten lieber für dich behalten willst.«
Damit traf er genau die Worte, die Mara dazu bewegten, sich ihm gegenüber doch zu öffnen – und das, obwohl sie ihn im Grunde gar nicht kannte. Aber eine innere Stimme sagte ihr, dass er vertrauenswürdig war.
»Ich habe wunderschöne Kindheitserinnerungen«, begann sie, während sie nach den richtigen Worten suchte. »Vor allem sind mir die heißen Sommer in Erinnerung, die ich mit den Nachbarskindern in den Weinbergen und auf den Feldern verbracht habe. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die ich seit damals verdrängt habe. Meine Mutter ist an Krebs gestorben, als ich sieben war.«
Die plötzliche Tiefgründigkeit des Gesprächs machte Paul betroffen, das konnte sie ihm am Gesicht ablesen.
»Das war bestimmt nicht leicht für deinen Vater und dich«, sagte er.
Die Erwähnung ihres Vaters versetzte Mara einen Stich. Das war eine alte, nie verheilte Wunde, die in Momenten wie diesen noch heute schmerzte.
»Ich denke, mein Vater hat sein Bestes gegeben, um die Lücke zu schließen, die meine Mutter hinterlassen hat«, fuhr sie fort. »Aber aus irgendeinem Grund hat das nicht gereicht.«
Sie fühlte sich plötzlich unendlich traurig und spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen.
»Was ist passiert?«
Mara schluckte. »Eine ganze Zeitlang hat er versucht, uns über die Runden zu bringen. Er hat vormittags bei der Post gearbeitet, war mittags für mich da und hat abends in der Bahnhofskneipe gekellnert. Drei Jahre ging das so. Einen Tag nach meinem zehnten Geburtstag ist er dann weggegangen.«
Sie zog ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche und tupfte sich damit die Tränen trocken.
»Weggegangen?«, wiederholte Paul. »Wie meinst du das?«
»Er hat mich verlassen. Einfach so, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Er ist von einem Tag auf den anderen verschwunden und nie mehr zurückgekehrt.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen.
»Tut mir leid, ich wollte dich nicht mit meinen alten Geschichten belasten«, sagte Mara.
Paul nahm ihre Hand und drückte sie sanft, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Obwohl es sich irgendwie gut anfühlte, erschrak Mara auch über die unerwartete Nähe.
»Lass uns an die Arbeit gehen«, sagte sie. »Wir haben noch viel zu tun – das heißt, natürlich nur, wenn du mir tatsächlich noch ein bisschen helfen willst.«
Paul ließ wieder von ihrer Hand ab und wirkte dabei ein bisschen enttäuscht. »Klar, das habe ich dir doch angeboten«, sagte er mit einem schüchternen Lächeln. »Wo sollen wir anfangen?«
Sie widmeten sich den oberen Zimmern, wo Mara und Leni ab dem Wochenende wohnen wollten, ohne sich wie auf einer Müllhalde vorzukommen. Zu zweit ging die Arbeit erstaunlich leicht von der Hand. Mara konzentrierte sich auf das Einräumen der Schränke, Paul installierte die Deckenlampen und reparierte eine Kommode, bei der durch den Umzug eine Seitenwand ausgebrochen war. Obwohl er auf Mara äußerlich nicht den Eindruck machte, entpuppte er sich als begabter Handwerker.
Gegen ein Uhr hingen alle Lampen, und ein Großteil der Kartons war geleert.
»Wo geht’s weiter?«, fragte Paul voller Tatendrang.
Mara warf einen Blick auf die Uhr. »In einer Stunde muss ich nach Frankfurt zurück, um Leni vom Kindergarten abzuholen«, sagte sie. »Wir könnten damit anfangen, den Waschkeller zu entrümpeln. Der ist momentan vollkommen zugestellt, aber den brauche ich spätestens am Wochenende.«
Sie gingen ins Erdgeschoss, wo sie durch die Tür in der Küchenrückwand zur Kellertreppe gelangten.
»Das ist ja beinahe wie in einer anderen Welt«, bemerkte Paul angesichts der unverputzten Wände und des muffigen Geruchs.
»Ja, hier unten ist alles noch ziemlich ursprünglich«, gab Mara zu. »Das ist eben ein historisches Gebäude, mit allen Vor- und Nachteilen.«
Sie zögerte kurz, dann stellte sie eine Frage, die ihr schon seit ihrer ersten Begegnung mit Paul auf der Seele lag.
»Warum hast du dieses Haus neulich als Unglückshaus bezeichnet?«
Die Bemerkung war ihm in seiner Kanzlei so spontan über die Lippen gekommen, dass irgendetwas dahinterstecken musste.
»Ich habe dir doch gesagt, dass das nur dumme Dorfgerüchte sind«, erwiderte Paul. »Die Leute in der Gegend waren früher ziemlich arm, und der Winzer, der dieses Haus errichtet hat, galt als der reichste Mann in der Gegend. Da haben die Leute dem Anwesen ein paar Gruselgeschichten angedichtet – aus Neid. Mach dir darüber keine Gedanken mehr, okay? Diese Mauern sind einen halben Meter dick.« Er klopfte gegen den unverputzten Stein. »Hier bist du so sicher wie in einer Festung.«
Mara lächelte. Bestimmt hatte Paul recht.
Bevor sie den großen Gewölbekeller erreichten, führte die Treppe auf Höhe des ersten Absatzes in einen separaten, gefliesten Raum, der bis dicht an die Tür mit alten Möbeln vollgestopft war.
»Die Maklerin hat mir versichert, dass es hier einen Wasseranschluss für die Wäsche gibt«, sagte Mara. »Wo der sich befindet, werden wir erst erfahren, wenn es hier leerer ist.«
Mit vereinten Kräften fingen sie mit der Entrümpelung an. Zum Vorschein kamen einige Holzstühle, ein alter Esstisch, mehrere Kommoden und Sessel, eine Stehlampe, ein paar Ölbilder und einiges mehr.
»Was hast du mit dem ganzen Zeug vor?«, fragte Paul, während sein Blick durch den Raum wanderte.
»Ich werde einen Termin für den Sperrmüll vereinbaren«, antwortete Mara.
»Du willst die Sachen wegwerfen?«
»Hast du eine bessere Idee?«
Paul zog nachdenklich die Mundwinkel nach unten. »Ich verstehe ein bisschen was davon«, sagte er. »Mein Vater war Antiquitätenhändler. Reich wirst du mit dem Krempel zwar nicht, aber bestimmt kannst du das eine oder andere noch gut verkaufen.«
»Das meiste davon ist so dreckig, das will doch keiner mehr haben«, winkte Mara ab.
»Für die rostige Klappliege hier wirst du wirklich nichts mehr bekommen«, gab Paul zu. »Und die Sessel sind auch schon ziemlich abgewetzt. Aber die Lampe da hinten könnte etwas wert sein, und die ganzen Holzmöbel auch. Ich mache dir einen Vorschlag: Lass uns die Sachen, die nur noch Schrottwert haben, nach draußen vors Haus bringen. Die kannst du dann von der Müllabfuhr abholen lassen. Was noch in halbwegs gutem Zustand ist, stellen wir vorerst in ein ungenutztes Zimmer. In den nächsten Tagen werde ich mit einem Antiquitätenhändler in Landau Kontakt aufnehmen. Dann kann der sich die Sachen mal anschauen und ein Angebot abgeben, wenn er interessiert ist. Was hältst du davon?«
Mara nickte. »Einverstanden.«
Im schlimmsten Fall würden die alten Sachen noch eine Weile in irgendeinem Zimmer herumstehen, bis dann der nächste Sperrmüll anstand. Und wenn Pauls Vorschlag ein paar Euro einbrachte, umso besser.
Der Waschraum wurde schnell leerer, dafür stapelte sich der Müllberg neben dem Haus. Aber auch das Zimmer mit den vermeintlichen Wertgegenständen füllte sich zusehends.
»Wir müssen allmählich Schluss machen«, sagte Mara schließlich mit einem Blick auf die Uhr. »Ich habe Leni versprochen, sie um drei Uhr vom Kindergarten abzuholen, und ich will mich nicht verspäten.«
Paul, der neben ihr im Eingang zum Waschraum stand, nickte. »Ich bin froh, dass du das sagst«, grinste er. »Mir tun nämlich schon sämtliche Knochen weh.«
Sie beschlossen, noch eine letzte Sache mit nach oben zu nehmen und entschieden sich für eine hüfthohe Kommode. Als sie versuchten, sie anzuheben, rumpelte es.
»Da muss etwas drin sein«, stellte Paul fest. »Etwas Schweres. Lass es uns rausnehmen, dann lässt sich die Kommode leichter tragen.«
Mara drehte den Schlüssel im Schloss herum und öffnete die Flügeltüren. Zum Vorschein kamen ein paar mit Lederriemen und Eisenketten verbundene Eichenholzklötze.
Sie breiteten das sonderbare Ding auf dem Boden aus, wurden daraus aber nicht schlau.
»Vielleicht hat man das früher zum Keltern benötigt«, meinte Paul.
»Ja, vielleicht«, sagte Mara, obwohl sie es nicht glaubte. Aus irgendeinem Grund verursachte der Anblick bei ihr ein unangenehmes Gefühl.
Was zum Teufel ist das?, dachte sie.
Kapitel 5
Es war ein wunderschöner Samstagnachmittag mit einem azurblauen Himmel. Die Sonne tauchte das Land in angenehm warmes Licht, das das bunte Herbstlaub der Bäume und Sträucher perfekt zur Geltung brachte.
Doch heute konnte Mara der hübschen Aussicht nicht viel abgewinnen, denn sie fühlte sich wie gerädert. Sie hatte die Nacht mit Schlafsack und Luftmatratze in ihrer leerstehenden, alten Wohnung verbracht, um gleich am Morgen noch einmal durchzuputzen und den letzten Kleinkram ins Auto zu verfrachten. Die Luftmatratze war undicht gewesen, und in dem engen Schlafsack hatte Mara sich gefühlt wie lebendig begraben. Jetzt war sie verspannt, und ihr Genick schmerzte, als würde jemand versuchen, ihr mit einem Messer jeden Halswirbel einzeln herauszuhebeln.
Hinter dem Steuer ihres Wagens sitzend, ließ sie den Kopf kreisen. Hin und wieder massierte sie sich mit einer Hand den Nacken. Viel besser wurden die Schmerzen dadurch aber nicht.
Sie fuhr im dichten Verkehr auf der A67 in Richtung Mannheim. Im Radio lief Lady Gagas neuester Song.
Ihr Blick fiel durch den Rückspiegel auf Leni, die schon seit einer halben Stunde schweigend in ihrem Kindersitz saß. Sie hatte die letzte Nacht noch einmal bei ihrer Freundin Jule verbringen dürfen. Jetzt war sie traurig, weil sie wusste, dass sie sich für eine ganze Weile nicht mehr sehen konnten.
Schon die ganze Fahrt über hatte Mara versucht, ihre Tochter zu beruhigen.
»Ich verspreche dir, dass du Jule so bald wie möglich besuchen darfst«, sagte sie auch jetzt wieder. »Und wenn ihre Mama es erlaubt, darf Jule auch jederzeit zu uns kommen, sobald wir richtig eingerichtet sind. Außerdem wirst du auch im neuen Kindergarten ganz schnell neue Freunde finden, du wirst sehen. Ich bin neulich dort gewesen, um mir alles anzuschauen. Auch die Erzieherinnen sind supernett.«
Leni reagierte gar nicht darauf.
»Wollen wir beim nächsten McDonald's etwas essen?«, fragte Mara. Pommes und Chicken McNuggets brachen normalerweise jeden Widerstand.
Heute wirkte jedoch nicht einmal das. Reglos wie eine Stoffpuppe saß Leni in ihrem Kindersitz und starrte aus dem Seitenfenster ins Leere. Tat sie das unbewusst? Oder wollte sie damit demonstrativ zur Schau stellen, wie sehr ihr der Wegzug aus Frankfurt missfiel? Es tat Mara weh zu sehen, dass ihre Tochter litt. Aber sie glaubte immer noch fest daran, dass die Ortsveränderung nach Naunheim der richtige Schritt für sie beide war.
Mara beschloss, Leni vorerst in Ruhe zu lassen. Sie stellte das Radio etwas lauter und überholte einen Lastwagen.
Während sie ihren Gedanken nun freien Lauf ließ, wurde ihr bewusst, wie aufgeregt sie war – im positiven Sinn. Die letzten Tage hatte sie sich vor lauter Umzugsstress gar nicht freuen können. Jetzt, da Frankfurt abgehakt war, fühlte es sich an, als habe sie sich einer tonnenschweren Bürde entledigt.
Nicht, dass der Job als Reporterin ihr nicht gefallen hätte. Im Gegenteil, sie war sogar so etwas wie der Star ihrer Abteilung gewesen – wegen einiger Skandalgeschichten, die sie aus dem Sumpf der Großstadt zutage gefördert hatte. Aber vor allem seit der Trennung von Thorsten waren Beruf und Mutterrolle immer mehr zur Doppelbelastung ausgeufert. In Naunheim sollte nun alles besser werden. Sie würde nur noch in Teilzeit für die FAZ schreiben, um das Grundeinkommen zu sichern. Dadurch konnte sie sich viel mehr als bisher um Leni kümmern. In der verbleibenden Zeit wollte sie endlich ihren langgehegten Traum verwirklichen und ein Buch schreiben. Einen Krimi vielleicht, das war schon immer ihr Faible gewesen. Ein paar Ideen dazu hatte sie schon skizzenhaft zu Papier gebracht.
Jedenfalls freute sie sich auf die Zeit, die vor ihr lag. Die Autofahrt fühlte sich für sie an wie eine Reise in eine wundervolle Zukunft.
Bei Neustadt an der Weinstraße fuhr sie von der Autobahn ab. Von dort aus ging es über die Landstraße weiter ins Pfälzer Weinland.
»Da vorne ist es«, sagte sie auf der Zubringerstraße von Maikammer nach Naunheim, als diese in die erste Talserpentine überging. Durch den Wald war das Haus nur rudimentär zu erkennen, dennoch konnte man schon einen Eindruck von dessen gewaltiger Größe gewinnen. Leni schwieg immer noch, aber im Rückspiegel sah Mara ihren suchenden Blick – offenbar schien die neue Unterkunft sie mehr zu interessieren, als sie es zugeben wollte.
Nach ein paar Kurven fuhren sie in die Einfahrt ein. Mara hielt den Wagen vor dem Eingang.
»Und? Wie ist dein erster Eindruck?«, fragte sie, als sie Leni aussteigen ließ. Die schwieg sich jedoch beharrlich weiter aus.
So ein Trotzkopf!
Mara öffnete die schwere Eichenholztür.
»Komm rein, dann zeige ich dir alles«, sagte sie.
Pflichtschuldig folgte Leni ihrer Mutter durch die großen Räume. Zwar betrachtete sie alles ganz genau, doch an ihrer Miene konnte man nicht erkennen, was in ihrem Kopf vor sich ging.
»Das hier ist nur der untere Bereich«, erklärte Mara, während sie einen Blick ins Wohnzimmer, in die Bibliothek und in die Küche aus der Gründerzeit warfen. »Ich habe vor, in die Bibliothek einen Schreibtisch reinzustellen und dort zu arbeiten. Aber wohnen werden wir in der ersten Etage. Dort ist es schon richtig gemütlich.«
Auch oben zeigte Mara ihrer Tochter alle Räume. Das Beste hob sie sich bis zum Schluss auf: Lenis neues Kinderzimmer. Damit hatte sie sich besonders viel Mühe gegeben und nicht nur die alten Möbel aus Frankfurt aufgestellt, sondern auch ein paar neue Sachen gekauft – das Puppenhaus für Lenis Barbiesammlung zum Beispiel, das sich hervorragend auf dem knallbunten Teppich in der Spielecke machte. Von einem so schönen Zimmer hatte sie früher nur träumen können.